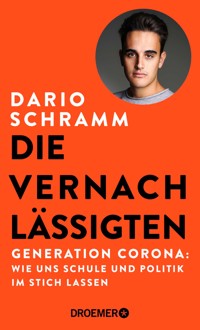
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Streitschrift über die Missstände der Schulpolitik von der Stimme einer empörten Generation Deutschlands ehemaliger oberster SchülersprecherDario Schramm ist einer der schärfsten und profiliertesten Kritiker der Schulpolitik seit dem ersten Lockdown und klagt an: - Wie kann es sein, dass Kinder und Jugendliche nicht nach ihren Bedürfnissen gefragt werden? - Warum werden sie wenn überhaupt nur als allerletzte mitgedacht? - Und wieso wird die Lufthansa mit einem Milliarden-Paket gerettet, während es an Schulen immer noch mit Luftfiltern und schnellem Internet hapert? Schülerinnen und Schüler stehen ganz unten auf der Prioritätenliste der Politik – nie wurde dies deutlicher als während der Corona-Pandemie. Durch Bildungsverluste und große psychische Belastungen ist gar die Rede von einer verlorenen Generation. Dario Schramm möchte dies nicht hinnehmen. Als Pandemie-Abiturient kennt er die Probleme der Generation Corona wie kein Zweiter: seien es Wechselunterricht, Homeschooling, schleppende Digitalisierung, aber auch fehlendes Mitspracherecht, Chancenungleichheit oder Inklusion. Er legt den Finger in die Wunde und zeigt konstruktive Lösungswege auf. Denn nur wer sich engagiert, kann etwas ändern. Dario Schramm (Jg. 2000) ist einer der schärfsten Kritiker der Schulpolitik während der Corona-Pandemie und setzt sich unermüdlich für die Belange von Schülerinnen und Schülern ein. Nach seinem Abitur im Frühjahr 2021 hat er das Amt des Generalsekretärs der Bundesschülerkonferenz im Herbst 2021 abgegeben, um in Frankfurt/Oder Recht und Politik zu studieren. Seit Januar 2022 verantwortet er darüber hinaus die politische Kommunikation der Lernplattform simpleclub. Schramm kommt aus Bergisch Gladbach und ist Mitglied der SPD.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dario Schramm
Die Vernachlässigten
Generation Corona: Wie uns Schule und Politik im Stich lassen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Pandemie hat es auf allen Ebenen gezeigt: Die deutsche Schul- und Bildungspolitik ist eine Katastrophe. Als Pandemie-Abiturient kennt Dario Schramm die Probleme der Generation Corona wie kein Zweiter. Ob Homeschooling, schleppende Digitalisierung, fehlendes Mitspracherecht oder Chancenungleichheit: Der Ex-Schülersprecher legt den Finger in die Wunde und zeigt, woran es den deutschen Schulen mangelt. Gleichzeitig hat er viele praktische und konstruktive Vorschläge, wie mithilfe einer ordentlichen Portion Mut, den notwendigen Geldern und einer gemeinsamen Vision Schule endlich zukunftsfähig gemacht werden kann.
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorwort
Einleitung
1 Mach es zu Deinem Projekt! Modernisierung der Schulen
2 Bin ich schon drin? Schule und Digitalisierung
3 Gut gemeint ist nicht gut gesagt: Kommunikation
4 Die gläserne Decke: Warum eben nicht alle dieselben Chancen haben
5 Verlieren mit System: Inklusion in der Schule
6 Alle Schrauben locker: Schulsozialarbeit und psychologische Unterstützung
7 Wenn keine Schublade passt: Besondere Talente und Begabungen im schulischen System
8 Der Lehrer, die unbekannte Spezies
9 Mitdenken, mitreden, mitgestalten: Wie wir in Schulen endlich etwas fürs Leben lernen könnten
Epilog
Dank
Für Mama, Papa, Francesco, Nana und Patti
Vorwort
An einem späten Abend im Juli 2021 sitze ich auf meinem Bett und überlege, wie es zu all dem überhaupt gekommen ist.
Wie konnte es passieren, dass sich Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Schüler*innen in Deutschland völlig alleingelassen fühlen? Wie konnte es dazu kommen, dass wir sehenden Auges Kinder über Wochen unbeobachtet nach Hause schickten – obwohl wir wussten, was sie dort erwartet? Wie konnten Konzerne Milliardenhilfen erhalten, eine Schule muss aber nach 16 Monaten Pandemie noch immer fehlendes Internet beklagen? Und warum gab es Auto-, jedoch nie einen Bildungsgipfel während dieser Zeit, in der ein Virus unser Leben beherrschte?
Corona hat uns schonungslos offenbart, dass die Gesellschaft der Verantwortung für junge Menschen nicht gewachsen ist. Viel schlimmer noch: Sie beschützt sie nicht einmal.
Dieses Buch will aufzeigen, was die Pandemie mit einer ganzen Generation gemacht hat. Es knöpft sich vor allem das verkrustete Bildungssystem vor. Vieles ist durch Corona sichtbar geworden – existiert hat es bereits vorher. Dieses Buch klagt allerdings nicht nur an und legt den Finger in die Wunde, es bietet auch Lösungsansätze, um dringend benötigte Veränderungen einzuläuten.
Bildung ist wichtig und nur als Ganzes wahrzunehmen. Bildung ist mehr als das Einmaleins und die Analyse von Gedichten. Bildung ist mehr als Schule im Allgemeinen. Bildung schafft Orte des Lebens, der Erkundungen und der Erkenntnisse.
Im Mittelpunkt der Bildung stehen die Menschen, nicht das Bildungssystem. Doch genau diese hat unsere Gesellschaft über Monate schmerzhaft vernachlässigt – und es schmerzt noch heute. Für ebenjene Vernachlässigten, die Kinder und Jugendlichen der verlorenen Generation, habe ich dieses Buch geschrieben.
Einleitung
Es muss ein Tag Ende April 2020 sein. Ich habe Leistungskurs Sozialwissenschaft. Das erste Mal digital, und keiner weiß so richtig, wie das funktionieren soll. Mal abgesehen davon, dass niemand wirklich motiviert ist. Mein Wecker hat um drei Minuten vor acht geklingelt, warum sollte ich auch früher aufstehen? Der Klassenraum ist in diesen Zeiten nur zwei Schritte vom Bett entfernt, und zwar an meinem Schreibtisch.
Völlig verschlafen versuche ich mich bei der neuartigen Plattform für Videokonferenzen anzumelden. Was ich nach dem Login zu sehen bekomme, überrascht mich nicht: Ich entdecke in den kleinen Videofenstern acht genauso verschlafene Mitschüler*innen, denen mehr Fragen als Antworten ins Gesicht geschrieben stehen.
Natürlich kommt die Lehrkraft zu spät. Der Akku ihres Computers war leer, und mein Eindruck ist, dass sie die Technik überfordert. Mittlerweile ist es zehn nach acht, und ich frage mich, wann der Unterricht endlich losgeht. Gerade als es zum ersten Mal inhaltlich wird, also tatsächlich so etwas wie eine Lehrsituation entsteht, friert das Bild ein, und der Ton ist weg. Der Grund ist simpel: Ein Zimmer weiter hat mein Bruder ebenfalls Online-Unterricht.
Ich brülle hinüber: »Mach dein WLAN aus! Ich hab Leistungskurs!«
»Mein Unterricht ist auch wichtig«, ruft er durch die Wand zurück.
Nicht nur an diesem Morgen konkurrieren wir um die Bandbreite. Das Problem wird sich durch die gesamte Zeit des »Homeschooling« ziehen. Ein trügerischer Begriff, der mehr verspricht, als er hält.
Diese Unterrichtsstunde jedenfalls wird ein Desaster. Nachdem ich meine Kamera ausgeschaltet habe, um nicht mehr vom WLAN zu beanspruchen als nötig, höre ich mir die Erklärungen der Lehrkraft zur Europäischen Union an – jedoch aus dem Bett heraus. Ohne Bild, nur mit Ton sind die Interaktion, das Raumgefühl und das soziale Gefüge innerhalb einer Klasse definitiv nicht dasselbe wie zu »alten« Zeiten.
Die Vorfreude, nach Wochen der Isolation mal wieder ein paar Gesichter zu sehen, hat sich nach nur einer digitalen Unterrichtsstunde in Luft aufgelöst. In diesem Moment wird mir bewusst: Die Vorbereitungen für das Abitur werden ein harter Brocken, wenn der Unterricht vor allem im Leistungskurs so weitergeht.
Vielleicht wird es ja aber doch nicht so schlimm, tröste ich mich. Bestimmt ist die Pandemie in einigen Wochen wieder vorbei. Ein wenig Abstand halten und Hände waschen, und wir werden schon bald in die Schulen zurückkehren können. Das glaube nicht nur ich, das glauben auch die meisten meiner Mitschülerinnen und Mitschüler.
Wie falsch unsere Einschätzung ist, wissen wir spätestens ein paar Wochen später.
Am nächsten Tag steht keine Videokonferenz an. Die halbherzigen Aufgaben aus den anderen Fächern habe ich bereits bearbeitet. Oder muss die Antworten noch aus unserer klasseninternen WhatsApp-Gruppe abschreiben.
Mein Lieblingsbeispiel dazu kommt aus dem Fach Biologie. Die Aufgabe: Lesen Sie den Text und stellen Sie eine Hypothese auf, welche Evolutionsfaktoren bei der Entwicklung des Hasen eine Rolle gespielt haben!
Klingt einfach. Leider hat das Thema Evolution vollständig im Hausunterricht stattgefunden, eine wirkliche Erklärung vom Lehrer oder so etwas wie didaktische Methoden gab es nie. Es galt das Prinzip »learning by doing«. Da ich gewillt war, im Hinblick aufs Abitur gute Noten zu erhalten, blieb mir nur eines übrig: abschreiben. Dass mir das spätestens beim schriftlichen Abitur auf die Füße fallen würde, hätte ich ahnen sollen.
Nach einem ausgiebigen Frühstück stellt sich mir die Frage, was ich heute so alles mache. Der geregelte Schultag ist außer Kraft gesetzt, Struktur und Ordnung fehlen auch mir. Bereits nach einigen Tagen im Lockdown wurden die Stimmen in meiner Clique lauter, dass wir wieder den normalen Schulalltag benötigten, ansonsten gerieten wir völlig aus dem Ruder.
Ich verbummle den Vormittag in den sozialen Medien. Gegen Mittag frage ich in meinem Freundeskreis herum, was heute ansteht.
Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus. Einige sind noch im Bett, andere treiben gerade Sport, der Rest sitzt an den Schulaufgaben, um »up to date« zu bleiben und den Anschluss nicht zu verpassen, wenn es wieder zurück in die Schule geht. Wir sind alle in einer Klasse und hätten jetzt eigentlich gemeinsam Unterricht. Stattdessen ist jeder mit seinen Ängsten, Sorgen und Nöten auf sich allein gestellt. Uns fehlen der Rhythmus, die Zusammenarbeit und durchaus auch die Kontrolle durch die Lehrer*innen. Wir sind gezwungen, schneller erwachsen zu werden, als wir geplant hatten.
Irgendwann fragt einer: »Sollen wir ins Schwimmbad?« Geht nicht. Es ist geschlossen. Dann eben zum Baggersee um die Ecke? Auch keine Option, er wurde durchs Ordnungsamt gesperrt. Und was ist mit dem Park? Den hat die Polizei abgeriegelt.
Wir sind nicht ein-, sondern ausgesperrt. Die Wohnung dürfen wir unter bestimmten Auflagen verlassen, doch es gibt keinen Treffpunkt. Digitale Verabredungen sind unsere einzige Option. So bleibt uns nur, zu Hause zu hocken und irgendwie zu versuchen, nicht durchzudrehen. Wir, die junge Generation, sitzen daheim, schränken uns ein und verzichten auf nahezu alles, was uns eigentlich Freude bereitet. Das ist unser persönlicher und schmerzhafter Beitrag in dieser Pandemie. Zum Wohle aller.
Dennoch hält man es kaum aus. Unser Alltag ist monoton. Es gibt kleine Lichtblicke und Schlupflöcher wie den Parkplatz des Schwimmbads. Klingt nach keinem vielversprechenden Ort, aber in Zeiten des Lockdowns gibt es wenige Dinge, auf die man sich so sehr freut wie auf die Treffen auf dem holprigen, zugewucherten Parkplatz. Von Angesicht zu Angesicht analog miteinander sprechen. Ein freundliches Gesicht sehen, das nicht aus Pixeln besteht.
Freundschaften, Beziehungen und deren Bedeutung haben wir selten so geschätzt wie in den letzten Monaten. Wir sind uns einig, dass die Zeit allein zu Hause furchtbar anstrengend ist und uns an die Grenzen der Belastbarkeit führt. Das Schulische verwässert durch den gleichförmigen Alltag mehr und mehr. Die Erreichbarkeit einiger Lehrkräfte lässt ebenfalls oft zu wünschen übrig.
Es werden noch viele Parkplatztreffen folgen. Wobei die Gespräche zunehmend anklagender werden, denn die Frustration über die Politik wird in jeder Woche, die vergeht, spürbarer. Immerhin eines lernen wir in dieser Zeit: debattieren und reflektieren, Position beziehen und eine Meinung vertreten – auch wenn die keiner hören will. Wir sind erschrocken und schockiert darüber, wie kurzsichtig die Regierung mit unserer Generation umgeht. Wir werden von ihr schlichtweg alleingelassen. Vieles wird versprochen, doch am Ende erleben wir klassisches Phrasenbingo der politisch Verantwortlichen. Was wir fast noch mehr vermissen als die Schule selbst: Empathie, Authentizität und Ehrlichkeit darüber, dass sie selbst nicht wissen, wo die Reise hingeht. Selbst eine Handreichung scheint zu viel des Guten.
Vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben begreifen wir, was Schule neben der Vermittlung von Lerninhalten ist: soziales Netz, Ort des Austauschs, Zentrum der Kommunikation. Die Sorge, in Bezug auf den Lernstoff abgehängt zu werden, ist ebenfalls enorm, doch die wesentlichen Probleme sitzen viel tiefer.
Während unsere Eltern noch mehr als sonst in ihrem Job kämpfen, manche sogar um die blanke Existenz bangen, vereinsamen Kinder und Jugendliche in den eigenen vier Wänden. Dem heimischen Gefängnis zu entfliehen, wird praktisch zur moralischen Untat erklärt.
In einem Spot der Bundesregierung heißt es: »Werde auch du zum Helden und bleib zuhause.«1 Nichtstun ist mit einem Mal ein Dienst an der Gemeinschaft. Ein heroisch verklausulierter Aus- beziehungsweise Rückblick, der vielen von uns perfide suggeriert, wir sollten uns doch bitte nicht so anstellen. Immerhin verlangt man von uns: nichts.
Einen Monat später, es ist mittlerweile Mai 2020, dürfen zumindest die Abschlussklassen wieder in die Schule. Für mich persönlich ist das eine große Erleichterung. Kein Streit mehr um Bandbreite, keine missglückten Versuche, die Videoanleitungen übermotivierter Fitness-YouTuber*innen nachzuturnen – und endlich wieder Menschen treffen! Das chaotische Selbststudium hat ein Ende, zumindest für mich und meine Klassenkamerad*innen.
Doch zu früh gefreut. Wir haben das eine Chaos noch nicht hinter uns gelassen, da kündigt sich bereits das nächste an. Abgesehen davon, dass mir gar nicht klar war, wie viel Kreativität man bei der Gestaltung von Masken aufbringen kann, spüren wir nun am eigenen Leib, welche dramatischen Auswirkungen die Pandemie auf den Schulalltag hat – wenn man den überhaupt noch so nennen kann.
Es gibt bereits wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass große Gruppen für die Verbreitung des Virus förderlich sind. Daher wurde unsere Jahrgangsstufe in zwei Gruppen geteilt. Dementsprechend sitzt nur eine Hälfte der Klasse im Schulraum. Die Tische sind weit auseinandergezogen, und wir tragen die ganze Zeit über die Masken.
Ich kann auch rückblickend nicht sagen, welches Gefühl in diesem Moment überwiegt: das Glück, zumindest einige aus meiner Stufe wiederzusehen? Die Sorge, da ab Minute eins klar ist, dass dieser völlig unvorbereitete Unterricht nicht aufgehen wird? Oder die Angst, dass ich mich mit diesem noch unerforschten Virus infiziere? Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem.
In dieser ersten Schulstunde nach Wochen der Einsamkeit ist vieles anders. Alle Schüler*innen erscheinen pünktlich im Klassenzimmer und setzen sich gleich auf ihre Plätze. Das hat es in der Form zuvor nicht gegeben. Die Erleichterung, sich wiederzusehen, ist überall zu spüren. Es wirkt auf mich fast wie ein Abiturjahrgang, der sich nach 20 Jahren trifft. Alle können kaum erwarten zu erfahren, wie es den anderen in der Zeit ergangen ist. Sosehr uns das gegenseitige Interesse jedoch unter den Nägeln brennt, so abrupt geht der Unterricht los.
Doch wer sich nach Wochen der Abstinenz auf ein gemeinsames Ankommen gefreut hat, wird bitter enttäuscht. Denn die Lehrkraft begrüßt uns mit staubtrockenen Wirtschaftstheorien und Steuersystemen. Ich könnte an dieser Stelle leicht in »Lehrerbashing« verfallen, doch das lehne ich ausdrücklich ab. Die in diesem Fall fehlende soziale Kompetenz ist kein persönliches Defizit der Lehrkraft. Das Problem hat seinen Ursprung an einer ganz anderen Stelle: bei den Landesregierungen und ihren Bildungsminister*innen.
Über Wochen wurden Schülerinnen und Schüler gezwungen, unter unterschiedlichsten Gegebenheiten und Voraussetzungen zu Hause zu bleiben. Die Lösungsansätze der Politik darauf sind:
keine verlässliche Anpassung der Prüfungen,
keine Entschlackung der Lehrpläne, um Freiraum für Austausch und Gespräche zu schaffen,
keine Aussetzung der Bewertung und der Notenvergabe sowie
kein sicheres und belastbares Konzept für langfristigen Präsenzunterricht.
Die Sorge der nächsten Schließung nahm in den politischen Diskussionen der letzten Wochen mehr Platz ein als die Motivation, die Schulen so lange wie möglich geöffnet zu lassen. Zumindest geht das bestehende Konzept bis zu den Sommerferien auf, denn der Übergang vom »Unterricht« zum »Urlaub« fällt nicht allzu schwer – und ja, ich setze beides in Anführungszeichen, weil keines davon im Jahr 2020 wirklich stattfindet.
Ich war schon immer ein rebellischer Schüler. Einige Lehrer*innen schätzten meine Diskussionsfreude, andere dachten vermutlich darüber nach, den Beruf zu wechseln. Der Wunsch nach Mitsprache in mir, manche schimpften es auch mein »Veränderungs-Gen«, sorgte in der 8. Klasse dafür, dass ich mich in der Schülervertretung engagierte. Ich war unzufrieden mit dem Essensangebot an unserer Schule und wollte etwas in Bewegung setzen.
In der 9. Klasse wurde ich schließlich in die Schülervertretung meiner Schule gewählt und fühlte das erste Mal Verantwortung.
Das Schlüsselerlebnis, das zu einem entscheidenden Antrieb meines weiteren Engagements werden sollte, hatte ich jedoch in der 10. Klasse. In Nordrhein-Westfalen werden in diesem Jahrgang an allen Gesamt- und Realschulen die zentralen Abschlussprüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch geschrieben. Die dort erzielten Noten fließen in die Endjahresnote ein, und zwar zu fünfzig Prozent, was nicht zu unterschätzen ist. Denn dieses Zeugnis entscheidet darüber, ob ein Schüler oder eine Schülerin die Zulassung zur Oberstufe und zum Abitur erhält.
Im Mai 2017 saß ich also in der zentralen Prüfung im Fach Englisch. Schon bei der ersten Aufgabe zum Hörverständnis wurde klar: Dieser Test war deutlich zu schwer und nicht unserem Niveau entsprechend. Mein Eindruck zog sich durch die gesamte Prüfung. Nicht identifizierbare Vokabeln, unbekannte Textarten und grammatikalische Leckerbissen jenseits unserer Kompetenzen.
»Absolut unfair!«, sagten alle Schüler*innen, die den Raum verließen.
Auch ich ging völlig frustriert und verärgert nach Hause. In meiner Wut startete ich eine Petition. Ich gebe ehrlich zu, dass es mir in diesem Moment mehr darum ging, meiner Entrüstung Ausdruck zu verleihen und herauszufinden, ob andere Schüler*innen meine Meinung teilten, als tatsächlich etwas an der Prüfung zu verändern.
Die Petition verbreitete sich allerdings rasant. Vier Stunden nach dem Start hatten bereits über zehntausend Menschen meinen Aufruf nach einer Neuauflage der Prüfung unterschrieben. Am nächsten Morgen waren es dreißigtausend, und am Ende wurde es die bisher erfolgreichste Bildungspetition aller Zeiten.
Fünf Tage lang beriet das Ministerium darüber und schwieg. Dann folgte, selbst für mich, die große Überraschung: Meiner Petition wurde stattgegeben. Alle Schülerinnen und Schüler konnten freiwillig an einer neuen Prüfung teilnehmen oder erhielten eine Neubewertung auf Basis einer deutlich verbesserten Bewertungsskala für die bereits erbrachten Leistungen.
Dieser Moment war das, was man eine Offenbarung nennt: Er bestätigte mich in dem Glauben, alles verändern zu können, wenn ich mich nur mutig genug dafür einsetze. Es war der Augenblick meiner Politisierung, vor allem für Bildungsthemen.
Ein Jahr später stellte ich mich zum ersten Mal als Schülersprecher zur Wahl. Im selben Jahr folgten der Vorstand der Bezirksschülervertretung und im Anschluss die Wahl zum Delegierten der Landesschülervertretung in Nordrhein-Westfalen.
Nach meiner Rückkehr aus den USA





























