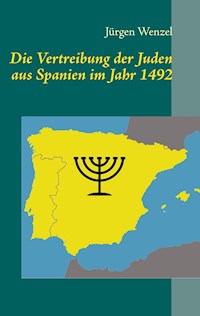
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In weiten Teilen Europas endete bereits im Spätmittelalter das Zusammenleben von Juden und Christen infolge von Ausschreitungen, Pogromen und Ausweisungen. Die christlichen Königreiche der Iberischen Halbinsel stellten einen Sonderfall dar, weil hier noch im 15. Jahrhundert eine große jüdische Bevölkerung in relativer Autonomie lebte. Die spanische Convivencia wurde jedoch immer mehr in Frage gestellt. Im Zuge der Zurückdrängung der muslimischen Reiche nahm die religiöse Intoleranz zu, während schwierige wirtschaftliche und soziale Situationen zusätzlich zu Spannungen führten. Ferdinand von Aragonien und Isabella von Kastilien bemühten sich, das durch ihre Ehe und durch die Eroberung Granadas entstandene Gebiet durch eine Instrumentalisierung religiöser und kirchlicher Angelegenheiten zu einem Reich verschmelzen zu lassen. Diese Zielsetzung ließ sich nicht mit der Existenz großer jüdischer und muslimischer Bevölkerungsgruppen vereinbaren. Dieses Buch beschreibt die Entwicklung bis zum Vertreibungsedikt gegen die Juden im Epochejahr 1492 und der Vertreibung der Muslime aus Kastilien im Jahr 1502. Die Entwicklung basierte nicht auf einem konsequenten Programm, sondern auf einer Folge von Einzelereignissen, deren Ursachen in religiösen, ökonomischen und politischen Faktoren lagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben.
André Gide
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
THEMATISCHE EINFÜHRUNG UND METHODIK
QUELLENLAGE UND FORSCHUNGSSTAND
Juden
Mudejaren
Landesfremde
VORGESCHICHTE
DIE JUDEN
Sonderfall Spanien
Juristische Grundlagen: Lokale Fueros
Alfons X. und die Siete Partidas
Die Convivencia im christlichen Spanien
Jüdische Berufstätigkeit
Kulturelle Scharnierfunktion
Hofbedienstete
Berufliche Einschränkungen
Assimilierte Oberschicht
Geldgeschäfte und Steuerpacht
Autonomiebefugnisse der Gemeinden
Häufige Stereotypen und ihre Ursachen
Die Katholische Kirche und die Juden
Die Entwicklung bis zu Heinrich II.
Die Pogrome des Jahres 1391
Rekonstruktion und Verschärfung der Lage
Conversos in der christlichen Gesellschaft
Die Juden und die Katholischen Könige
Die Erneuerung der Inquisition
Kirchenreform und Nationalkirche
Das Vertreibungsdekret von 1492
Ursachen und Hintergründe
Wirtschaftliche Faktoren
Demographische Überlegungen
Religiöse Gründe
Soziale Motive
Die Folgen
DIE MUDEJAREN
Muslimisches Leben im christlichen Spanien
Kastilien
Aragonien
Wirtschaftliche und soziale Lage
Juristische Grundlagen: Die Siete Partidas
Das Ende der Reconquista
Granada unter christlicher Herrschaft
Das Vertreibungsdekret von 1502
Moriscos
DIE VERTREIBUNGEN VON 1492 BIS 1502 IM VERGLEICH
LANDESFREMDE
Militärwesen
Handel
Untersuchungen anhand von Reiseberichten
Georg von Ehingen (1457)
Nikolaus von Popplau (1484 - 1485)
Hieronymus Münzer (1494 - 1495)
Sonstige Landesfremde
ERGEBNISSE
SCHLUSSBETRACHTUNG
BIBLIOGRAFIE
Gedruckte Quellen
Bibliografische Hilfsmittel
Literaturverzeichnis
Rezensionen
STICHWORTVERZEICHNIS
ZUM AUTOR
„Ferdinand von Aragonien begnügte sich nicht immer damit, bloß Krieg zu führen, sondern er bediente sich der Religion als eines Schleiers, seine Absichten zu verbergen. Er spielte mit der Treue der Eide; er redete von nichts als Gerechtigkeit und beging nichts als Ungerechtigkeit. Machiavelli lobt an ihm alles, was man an ihm tadelt.“1
Vorwort
Das vorliegende Buch befasst sich prinzipiell mit dem Thema Umgang mit Fremden, das anhand einer Einzelfallstudie über Juden, Muslime und Landesfremde im spätmittelalterlichen Kastilien und Aragonien bearbeitet wurde. Die von Alexander Demandt herausgegebene Aufsatzsammlung „Mit Fremden leben“, in der mit den Beiträgen von fünfzehn Historikern ein kulturgeschichtlicher Vergleich zur Behandlung von Fremden gezogen wurde, bildete eine Leitschnur bei der Formulierung der Fragestellung.2
Einige der Schwierigkeiten, die im spätmittelalterlichen Spanien vor allem zwischen Christen, Juden und Muslimen existierten, lassen sich in modifizierter Form auch im späten 20. Jahrhundert antreffen. Die historische Aufarbeitung des Umgangs mit Fremden könnte deshalb bei gutem Willen helfen, den Blick für aktuelle Probleme zu schärfen.
Dieses Buch wurde in neuer Rechtschreibung abgefasst. Verwendete Zitate wurden jedoch grammatisch nicht verändert.
___________________________
1 Friedrich der Große, in: Floerke [vor 1929], S. 189.
2 Demandt, Alexander [Hrsg.]: Mit Fremden leben. Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. München 1995.
Thematische Einführung und Methodik
Im Rahmen des vorliegenden Buches soll versucht werden, die jeweilige Stellung verschiedener gesellschaftlicher Randgruppen in Kastilien und Aragonien im Spätmittelalter zu untersuchen und miteinander zu vergleichen. Dabei beschäftigt sich die Analyse vor allem mit der Lage der Juden, der Muslime und landesfremder Christen. Daneben verdienen die zahlenmäßig bedeutsamen Gruppen der jüdischen und muslimischen Konvertiten und ihrer Nachkommen Beachtung.
Unter den Begriff des Außenseiters bzw. der Randgruppe lassen sich zahlreiche und - je nach Gesichtspunkt und wissenschaftlicher Vorgehensweise - sehr unterschiedliche Gruppen auflisten.3 Um das Thema überschaubar zu halten, müssen daher Einschränkungen vorgenommen werden. In diesem Buch werden daher vor allem Randgruppen behandelt, deren Stellung in erster Linie religiös bedingt ist. Die Untersuchung von Außenseitern nach religiösen Gesichtspunkten erscheint meines Erachtens sinnvoll, weil das Leben im christlichen Mittelalter in hohem Maße durch religiöse Aspekte geprägt war. Dieser Umstand galt - wie noch zu zeigen sein wird - in besonderem Maße für die christlichen Staaten auf der iberischen Halbinsel während der letzten Phase der Reconquista.
Nennenswerte Randgruppen in diesem Sinne bildeten aufgrund ihrer demographischen Größe, ihrer Partizipation an den Wirtschaftsaktivitäten und an der kulturellen Entwicklung die Personen jüdischen und muslimischen Glaubens. Ähnliches gilt für die Sondergruppen der Conversos und Moriscos, der zum Christentum bekehrten Juden und Muslime und ihre Nachkommen. Nur aufgrund dieses Gewichts lassen sich die politischen Ereignisse während der Herrschaft der letzten Repräsentanten der Trastámara-Dynastie, Isabella von Kastilien und Ferdinand II. von Aragonien, verstehen. Weitere Argumente für diese Spezifizierung stellen die Quellenlage und der Forschungsstand dar.
Zusätzlich wurden Belege für landesfremde Christen im Betrachtungsgebiet gesammelt und analysiert, um zu einer Bewertung ihrer Stellung zu gelangen. Diese beiden verschiedenen Näherungen an den Begriff des Außenseiters bilden die Basis für einen Vergleich der Ergebnisse. Untersucht werden vorwiegend die Fragen nach der Existenz einer pauschalen Fremden-Feindlichkeit und einheitlichen Fremden-Politik der Herrscher des zunehmend vorabsolutistisch geprägten Staates.
Eine Ausweitung der Untersuchung auf weitere Randgruppen, z. B. Hexen,4 Zauberer, Kranke an Körper und Geist, Arme, Schausteller, „Zigeuner“, Prostituierte, Homosexuelle, Räuber und Sklaven5 wäre erstrebenswert, ist jedoch im Rahmen des vorliegenden Buches nicht zu leisten. Das Betrachtungsgebiet beschränkt sich weitgehend auf Kastilien und Aragonien, wobei die Herrschaftsgebiete auf der iberischen Halbinsel im Mittelpunkt stehen. Einige Ausführungen zur Entwicklung in Portugal, in Navarra sowie im muslimisch regierten Teil der Halbinsel sind zum Zwecke der Erhellung dennoch unverzichtbar.
Für die demographische Untersuchung von Randgruppen und Minderheiten bieten die Quellen ein zu dünnes Fundament. Die in der Forschung verwendeten Zahlen schwanken teilweise um das Fünffache.6 Daher musste auf einen statistischen Teil verzichtet werden; die im Text genannten Zahlen sind ebenfalls „mit Vorsicht zu genießen“. Hier böte sich ein weites Feld für neue Forschungen.
___________________________
3 Einen aktuellen Forschungsüberblick zum Begriffspaar „Fremde“ und „Marginalität“ liefert Schaser (1995), S. 140 - 142.
4 Eine erwähnenswerte Studie zu den Hexen in Navarra stammt z. B. von: Videgáin Agós, Fernando: Navarra en la noche de las brujas. Pamplona 1992 (Colección Temas de Navarra; Nº 5).
5 Diese Aufzählung orientiert sich im Wesentlichen am Inhaltsverzeichnis von Roeck (1993).
6 Für die 1492 aus Spanien vertriebenen Juden werden Zahlen zwischen 30.000 und 150.000 oder mehr Personen genannt. Vgl. z. B. Bernecker / Pietschmann (1993), S. 61.
Quellenlage und Forschungsstand
Juden
Eine wichtige Grundlage für das Studium der Geschichte der Juden stellen Urkunden und Regesten aus bedeutenden spanischen Archiven dar. Die zweibändige Quellenedition von Fritz (später Yitzhak) Baer beruht auf zwei Studienreisen in den Jahren 1925 / 26, die ihn und seine Mitarbeiter unter anderem zu den Archiven in Barcelona,7 Pamplona,8 Simancas, Valladolid,9 Madrid10 sowie zu einigen kirchlichen11 und lokalen Archiven12 führten. Diese Quellensammlung enthält dermaßen umfangreiches und repräsentatives Material, dass sie noch heute als Fundament der Forschung angesehen werden muss. Baer setzt - was Aragonien betrifft - die Arbeit von Jean Régné fort, dessen im Jahr 1912 zuerst erschienene Quellenedition die königlichen Akten bis zum Ende der Regierungszeit Jakobs II. umfasst. Weitere nennenswerte Quelleneditionen stammen u. a. von Luis Suárez Fernández,13 Pilar León Tello14 und von Robert I. Burns.15 Leider sind die schriftlichen Quellen - von Zufallsüberlieferungen abgesehen - ausschließlich christlichen Ursprungs, weil die Archive jüdischer Privatpersonen und Gemeinden durch die Inquisition zerstört worden sind.16
Die Forschung zur Geschichte der Juden im christlichen Spanien muss als vergleichsweise jung angesehen werden, da nennenswerte Arbeiten erst auf der Basis der Quellensammlungen von Régné und Baer entstehen konnten.17 Im Jahr 1940 erschien daraufhin die erste Ausgabe der Zeitschrift zur Geschichte der Juden in Spanien, Sefarad. 1945 legte Baer eine zweibändige Monographie zum Thema vor, die noch heute in punkto Quellennähe und Niveau Maßstäbe setzt. Einige wenige Abhandlungen aus dieser Zeit sind einem so deutlichen Einfluss der zeitgenössischen politischen Verhältnisse unterworfen, dass sie als verfehlt gelten müssen.18 Insbesondere seit den 1960er Jahren wurde die Forschung zunehmend intensiver betrieben, so dass 1986 bereits knapp fünfhundert Titel ermittelt werden konnten.19 Diese Zahl dürfte angesichts der vielen Neuerscheinungen bzw. Neubearbeitungen, die anlässlich des Jubiläumsjahres 1992 entstanden sind, mittlerweile als deutlich überholt gelten. Folgende Autoren wichtiger moderner Werke seien hier stellvertretend genannt: Alisa Meyuhas Ginio, Werner Keller, Maurice Kriegel, Miguel Angel Ladero Quesada, Horst Pietschmann, Luis Suárez Fernández und Bernard Vincent.
In der jüngsten Zeit gewinnt die Untersuchung archäologischer Quellen zunehmend an Gewicht, wodurch sich der Schwerpunkt der Veröffentlichungen, z. B. in der Zeitschrift Sefarad, deutlich in Richtung der Lokalstudien verschoben hat.
Mudejaren
Für die Mudejaren, d.h. Mauren, die in mittlerweile christlich beherrschten Gebieten lebten, stellt sich die Lage hinsichtlich des Quellenmaterials und der Forschungssituation gänzlich anders dar. Für diesen Aspekt des spanischen Mittelalters ist ein genereller Mangel an Quellen kennzeichnend. Dieser Umstand gilt insbesondere für die Gebiete Kastiliens ohne Granada. In den Aktenbeständen der Krone von Aragonien finden sich vergleichsweise viele Erwähnungen mudejarischer Einzelpersonen, vor allem für den Zeitraum von 1355 bis 1366, während des Krieges mit Kastilien.20
Das Thema der Mudejaren wurde im Gegensatz zur Geschichte des muslimischen Spanien bislang kaum von der Forschung berührt. Entsprechend drückt Juan Carlos de Miguel Rodríguez im Untertitel seiner Abhandlung über die Gemeinschaft der Mudejaren in Madrid aus dem Jahr 1989 aus, das er sein Werk hinsichtlich der Methodik als Modell für die Forschung in ganz Kastilien versteht.21 Die Tatsache, dass Miguel Rodríguez angesichts der Quellenlage häufig auf Hypothesen zurückgreift, wird in Rezensionen als notwendig und richtig erachtet.22
Ähnlich gestaltet sich die Situation für Aragonien. Die Untersuchung von John Boswell über die aragonischen Mudejaren im 14. Jahrhundert, die 1977 erschienen ist, zählt zu den wenigen Übersichtswerken zu diesem Thema.23 Einige Hinweise ergeben sich auch aus den Reiseberichten von Popplau und Münzer.
In den Quelleneditionen von Baer befinden sich allerdings etliche Dokumente kirchlichen und weltlichen Ursprungs, in denen Regelungen sowohl für die jüdische als auch für die mudejarische Bevölkerung getroffen bzw. eingefordert wurden. Es bietet sich also an, die christliche Differenzierung zwischen den beiden Gruppen zu untersuchen. Diese Möglichkeit besteht für beide Königreiche.
Das Gebiet des ehemaligen Königreichs Granada nimmt dank der ungleich besseren Quellenlage eine Sonderrolle ein. Auch die Forschung zu diesem Thema ist recht fortgeschritten, wobei die Entwicklung der Stadt Granada seit 1492 einen Schwerpunkt bildet. Zur Erforschung dieses Themas hat vor allem Miguel Angel Ladero Quesada seit den späten 1960er Jahren maßgeblich beigetragen.
Landesfremde
Für diesen Aspekt wurde überwiegend auf die Quellengattung des Reiseberichts zurückgegriffen. Anhand der Übersicht von Werner Paravicini wurden deutsche Reiseberichte des Spätmittelalters ermittelt, deren Verfasser christlich beherrschte Gebiete der iberischen Halbinsel betreten haben und relevante Aussagen für unser Thema getroffen haben. Ferner erwies sich die Edition von Reiseberichten von García Mercadal als wertvoll. Da die Mehrzahl der Reiseberichte lediglich eine Aufzählung der Entfernungen der jeweiligen Etappen und eine Beschreibung des Aufenthaltes am Wallfahrtsort Santiago de Compostela liefert, müssen wir uns auf folgende Autoren beschränken: Sebastian Ilsung (1446), Hans von der Gruben (1447), Georg von Ehingen (1457), Nikolaus von Popplau (1484 - 1485), Hieronymus Münzer (1494 - 1495).
Da die verwendeten Reiseberichte von Personen abgefasst wurden, die aus dem Heiligen Römischen Reich stammten, wurde in erster Linie auf in Spanien und Portugal ansässige Fremde dieser Provenienz verwiesen. Um ein vollständigeres Bild zu erlangen, müsste eine weitergehende Untersuchung sämtliche Reiseberichte sichten, deren Autoren Spanien im Betrachtungszeitraum besucht haben.
Bei Georg von Ehingen handelte es sich um einen schwäbischen Ritter, der 1428 bei Tübingen geboren wurde und nach einer höfischen Erziehung an verschiedenen Höfen als Kammerherr diente.24 Er gelangte im Jahr 1457 nach Spanien und Portugal mit dem Vorhaben, an der bevorstehenden Expedition Heinrichs IV. von Kastilien gegen die nach christlicher Auffassung heidnischen Mauren teilzunehmen. Er starb 1508 in Kilchberg.25
Nikolaus von Popplau stammte aus einer germanisierten polnischen Familie. Er wurde um 1440 in Breslau geboren und starb zwischen 1490 und 1494, vermutlich in Alexandria.26 Er befand sich vor 1483 im Hofdienst Kaiser Friedrichs III., in dessen Auftrag er in den Jahren 1486 - 1487 und 1489 - 1490 zwei Reisen nach Russland unternahm. Auch seine Reise nach Spanien und Portugal in den Jahren 1484 und 1485 hing mit diplomatischen Diensten für Friedrich III. zusammen und wurde mit einer Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela verknüpft.27
Hieronymus Münzer wurde 1437 in Feldkirch (Voralberg) geboren und starb 1508. Er erwarb 1478 in Pavia den Titel eines Doktors der Medizin und erhielt 1480 das Bürgerrecht in Nürnberg. Der Bericht seiner Reise, die ihn in den Jahren 1494 und 1495 nach Spanien führte, ist in humanistisch geprägtem Lateinisch abgefasst.28 Münzer beherrschte das Kastilische nicht,29 doch die Kommunikationsprobleme hielten sich aufgrund seiner Kenntnisse in verwandten Sprachen wie Italienisch, Französisch und Lateinisch in Grenzen.30 Zudem verfügte mindestens einer seiner Begleiter, drei deutsche Drucker, über Kastilischkenntnisse. Münzer reiste offensichtlich im Auftrag von Kaiser Maximilian nach Spanien, um die neue politische Situation auf der Halbinsel zu erkunden. Den Reisezeitpunkt mögen drohende Seuchen im Heimatland bestimmt haben.31
Sebastian Ilsung stammte aus einer bekannten Augsburger Patrizierfamilie und reiste im Jahr 1446 nach Santiago de Compostela. Möglicherweise war er in diplomatischer Mission für Papst Felix V. unterwegs.32
Hans von der Gruben besuchte im Jahr 1447 das Heerlager von Alfons V., König von Aragonien, Sizilien und Neapel, der sich bei Pescara in Italien aufhielt. Danach begab er sich über Marseille nach Aragonien, Kastilien und Navarra.33
Die Quellenedition von Baer enthält ebenfalls einige Hinweise auf Landesfremde. Auf weitere relevante Quellen zum Thema, z. B. Soldlisten und Hinweise auf landesfremde Händler, wurde in der benutzten Sekundärliteratur eingegangen.
___________________________
7 Archivo general de la Corona de Aragón und Archivo del Real Patrimonio.
8 Archivo General de Navarra (Archivo de la Camara de Comptos).
9 Archivo de la Chancilleria.
10 Archivo Historico Nacional.
11 Z. B. Archivo del Gran Priorato de Cataluña in San Gervasio.
12 Z. B. Stadtarchive in Barcelona, Sevilla und Burgos.
13 Suárez Fernández, Luis: Documentos acerca de la expulsión de los judíos. Valladolid 1964.
14 León Tello, Pilar: Judíos de Toledo. 2 Bde. Madrid 1979.
15 Burns, Robert I.: Foundations of Crusader Valencia. Revolt and recovery, 1257 - 1263. Princeton 1991 (Diplomatarium of the crusader kingdom of Valencia. The registered charters of its conqueror, Jaume I, 1257 - 1276; II: Documents). Weitere Quelleneditionen vgl. Régné (1978), S. 721f.
16 Vgl. Baer (1970, I), S. iii sowie XXIII.
17 Zur Literatur bis 1928 vgl. Baer (1970, I), S. I - V.
18 Siehe u. a. Baer (1970, I), S. iv - v, zu Sanchez Albornoz (dort zitiert). Die Thesen mancher spanischer Autoren, z. B. Ballesteros Gaibros (1964), sollten ebenfalls äußerst kritisch bewertet werden.
19 Carrete Parrondo (1992), S. 103.
20 Hervás Herrera (1990), 355; García-Arenal (1979), S. 228.
21 Untertitel: „Un modelo de análisis de aljamas mudéjares castellanas.“
22 Hervás Herrera (1990), S. 355 - 357.
23 Vgl. Bibliographie von Boswell (1977), S. 514 - 529.
24 Paravicini (1994), S. 127f.
25 Ehrmann (1979, I), S. 42. Vgl. Mercadal (1952), S. 233; Paravicini (1994), S. 128.
26 Paravicini (1994), S. 220; Mercadal (1952), S. 307f.
27 Paravicini (1994), S. 220 - 223; Mercadal (1952), S. 307f.
28 Paravicini (1994), S. 261 - 265; Mercadal (1952), S. 327f.
29 Das Kastilische wird heute überwiegend als Spanisch bezeichnet. Wegen der Sprachenvielfalt im Mittelalter wäre es irreführend, von Spanisch zu sprechen.
30 Hoenerbach (1987), S. 46.
31 Hoenerbach (1987), S. 45f. Sehen in der Seuche den einzigen Reiseanlass: Paravicini (1994), S. 261 - 265; Mercadal (1952), S. 327f. Vgl. Münzer in: ebenda, S. 404.
32 Paravicini (1994), S. 100 - 102.
33 Diesbach (1896), S. 121 und S. 125 - 128.
Vorgeschichte
Die ersten Juden sind offenbar bald nach der Zerstörung des Tempels auf der iberischen Halbinsel eingetroffen. Im vierten Jahrhundert waren sie so zahlreich, dass sich das spanische Konzil von Elvira im Jahr mit den Folgen jüdischen und christlichen Zusammenlebens beschäftigte.34 Die Juden waren römische Bürger und sogar zum Besitz christlicher Sklaven berechtigt.35 Das Leben im Römischen Reich und unter westgotischer Herrschaft entwickelte sich friedlich, bis 586 der Westgotenkönig Rekared vom Arianismus zum Katholizismus übertrat und eine antijüdische Gesetzgebung einleitete. Unter seinem Nachfolger kam es im Jahr 613 zu einem Dekret, das die Juden zur Bekehrung zum Christentum zwang.36 Obwohl die Existenz des Judentums im Westgotenreich dadurch nicht beendet wurde, blieb vielen unfreiwilligen Konvertiten nur die Möglichkeit, ihren alten Glauben heimlich weiter zu praktizieren. In den nächsten hundert Jahren wurden diverse Zwangsmaßnahmen gegen die Juden verhängt. Ein Konzil forderte sogar ihre Enteignung und Versklavung.37
Die islamische Invasion seit dem Jahr 711 bedeutete daher eine Befreiung für die spanischen Juden. In der ersten Phase der maurischen Herrschaft auf der iberischen Halbinsel fanden die Juden durch den Rechtsstatus des Dhimmi gute Lebensbedingungen vor. Sie mussten zwar beträchtliche Abgaben leisten, doch da sie als Nichtmuslime keine Staatsbürger waren, konnten sie einen Großteil ihrer Angelegenheiten intern regeln.38 Einzelne Juden gelangten in hohe politische, diplomatische und militärische Posten, doch die Mehrheit war im Textilgewerbe, im Arzneimittelsektor, im Handwerk, im Handel, als Arzt oder auch in Geldgeschäften tätig.39 Die Entwicklung verschiedener Wissenschaften, der Medizin und der Künste erreichte im 10. und 11. Jahrhundert einen Höhepunkt, bei dem Juden einen wesentlichen Teil beitrugen. Ein wichtiges Merkmal dieser época de oro bestand in der Convivencia, dem symbiotischen Zusammenwirken von Juden und Muslimen in den verschiedensten Bereichen.40 Dieses Goldene Zeitalter des Judentums in Spanien war solchermaßen von relativer Toleranz der Muslime gegenüber den jüdischen Dhimmis gekennzeichnet, dass es noch im 19. und 20. Jahrhundert während der Judenemanzipation bzw. in der Auseinandersetzung um den Zionismus als positives Beispiel eines Zusammenlebens angeführt wurde.41
Ähnlich wie später im christlichen Spanien war die Verwendung und Beherrschung des Hebräischen rückläufig, so dass Arabisch bis zum zwölften Jahrhundert unter den Juden zur wichtigsten gesprochenen und geschriebenen Sprache wurde.42 Der jüdische Philosoph Maimonides und Judah ha-Levi schrieben einige ihrer wichtigsten Werke auf Arabisch, um sie einer größeren Gruppe von Juden zugänglich zu machen.43 Diese Entwicklung kennzeichnet einen zunehmenden Grad an Assimilation in der muslimischen spanischen Gesellschaft.
Als sich jedoch im elften Jahrhundert infolge militärischer Niederlagen der religiöse Eifer verstärkte, verschwand die Toleranz gegenüber den Nichtmuslimen.44 Im Jahr 1066 kam es zum ersten Pogrom im muslimischen Spanien, in dessen Verlauf 4.000 Juden umkamen.45 Beinahe zur gleichen Zeit wandten sich im christlichen Norden französische Ritter, die zum Kampf gegen den Islam nach Spanien gekommen waren, erst einmal gegen die Juden. Offenbar wirkte sich der zunehmende militärische Druck negativ auf die Toleranz gegenüber Minderheiten aus.46 Unter dem Einfluss der radikalen nordafrikanischen Gruppe der Almoraviden, die ursprünglich zum Kampf gegen die vorrückenden Christen ins Land geholt worden waren, verschlechterte sich die Situation weiter.47 Im Jahr 1146 nahmen die Almohaden, wie die Almoraviden eine berberische Reformbewegung,48 die aber die vorigen an Fanatismus übertraf, die muslimischen Gebiete Spaniens ein. Die almohadischen Kalifen stellten ihre jüdischen Untertanen vor die Wahl zwischen der Konversion zum Islam und der Emigration.49 Da die Mehrheit die Auswanderung dem Übertritt zum Islam vorzog, vollzog sich eine große Zuwanderungsbewegung in den christlichen Herrschaftsbereich, insbesondere nach Kastilien und nach Katalonien.50 Diese Veränderungen kennzeichneten nicht nur das vorläufige Ende jüdischer Präsenz in den muslimischen Reichen, sondern zogen auch ein deutliches Wachstum der Judenviertel in den nördlichen Reichen, der sogenannten Juderías oder Aljamas, nach sich.51
Die christlich-katholische Gesellschaft muss, so Lourie, primär als „Society Organized for War“ angesehen werden.52 Die Reconquista, die von den kleinen unter christlicher Herrschaft verbliebenen Gebieten in Asturien und vom karolingischen Reich ausging, erforderte solche Kraftaufwendungen, dass sich die Entwicklung eines vielfältigen ökonomischen Lebens verzögerte. Dieser Rahmen bot daher gute Entfaltungsmöglichkeiten für Gruppen mit überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Aktivitäten wie den Juden, die aufgrund des Menschenmangels in den eroberten Gebieten mit offenen Armen aufgenommen wurden, nachdem Ferdinand I. von Kastilien im Jahr 1066 die diskriminierenden Gesetze aus der Westgotenzeit aufgehoben hatte.53 Insbesondere in Aragonien und in Navarra gab es gezielte Anwerbungen und Ansiedlungen von Juden,54 denen häufig ein Kastell zur Verfügung gestellt wurde.55 Durch eine solche Nutzung erfüllte die Festung eine doppelte Funktion: Einerseits bot sie den Juden Schutz vor Verfolgungen, andererseits trugen die jüdischen Festungsbewohner durch ihre Selbstverteidigung zur Sicherung des Landes für den Herrscher bei. Die Juden erreichten theoretisch den Rechtsstatus der Christen56 und erlebten insbesondere im 13. Jahrhundert ein Aufblühen ihrer Kultur.57 Durch den allmählichen Wandel der Situation verlor die jüdische Gemeinschaft langsam ihre wirtschaftliche Schlüsselfunktion, woraufhin sie von ihrer christlichen Umwelt oft unter dem Gesichtspunkt der Konkurrenz wahrgenommen wurden.58
Im Norden der Iberischen Halbinsel wurden die Muslime aufgrund des starken Bevölkerungsdrucks aus den nördlichen Reichen in kleine Stadtviertel und Landbezirke (Morerías), zurückgedrängt, wodurch viele Mudejaren zu Abwanderung in den Süden animiert wurden.59 Erst als die Reconquista die Gebiete des heutigen Andalusien, Valencia und Murcia erreichte, bildeten sich mit den dort weiter ansässigen Mauren, den Mudejaren, nennenswerte muslimische Minderheiten unter christlicher Herrschaft.
___________________________
34 Pietschmann (1992), S. 33; Greive (1992), S. 15.
35 Greive (1992), S. 15f.
36 Pietschmann (1992), S. 33f; Greive (1992), S. 16f.
37 Greive (1992), S. 18f.
38 Greive (1992), S. 21. Ausführlich zum Dhimmi-Status: z. B. Colpe (1995), S. 85 (dort weiterführende Literatur).
39 Greive (1992), S. 23f.
40 Greive (1992), S. 24f; Arié (1973), S. 328f; Vincent (1991), S. 35.
41 Wasserstein (1992), S. 177.
42 Wasserstein (1992), S. 180f. Dagegen: Gutwirth (1989), S. 239 -243.
43 Wasserstein (1992), S. 180f.
44 Wasserstein (1992), S. 177 und 183.
45 Arié (1973), S. 329; Greive (1992), S. 27.
46 Greive (1992), S. 33f; Wasserstein (1992), S. 184.
47 Greive (1992), S. 27f.
48 Colpe (1995), S. 90.
49 Pietschmann (1992), S. 34; Greive (1992), S. 29; Suárez Fernández (1992), S. 11.
50 Arié (1973), S. 329.
51 Suárez Fernández (1992), S. 11; Kellenbenz (1966), S. 99 - 102.
52 Zit. in: Vones (1993), S. 238.
53 Pietschmann (1992), S. 34; Suárez Fernández (1992), S. 12.
54 Baer (1970, I), Nr. 28, 120, 175. Vgl. Marcu (1991), S. 186.
55 Baer (1970, I), Nr. 73, 235, 405, 578.
56 Baer (1970, I), Nr. 572.
57 Assis, in Régné (1978), S. VII.
58 Battenberg (1990), S. 127.
59 Boswell (1977), S. 3f.
Die Juden
Es erscheint im Rahmen dieses Abschnittes kaum möglich, ein vollständiges Bild der Geschichte der Juden auf der iberischen Halbinsel in ihrem Verlauf bis ihrer Vertreibung im Jahr 1492 aufzuzeigen. Daher wird versucht, die wichtigsten Etappen in ihren wesentlichen Zügen zu beschreiben, um mit Hilfe dieser Erkenntnisse die Entscheidung zu beleuchten, die Ferdinand II. von Aragonien und Isabella von Kastilien mit dem Edikt vom 31. März 1492 trafen. Ein Schwerpunkt dieses Buches liegt daher auf der Untersuchung der Ereignisse des Jahres 1492 und ihrer Hintergründe.
Sonderfall Spanien
Die mittelalterliche Geschichte der Juden im christlichen Teil der iberischen Halbinsel zeigt grundsätzliche Unterschiede zu den übrigen Staaten in Mittel- und Westeuropa. Mancherorts wurde die Existenz jüdischer Gemeinden schon am Beginn des Spätmittelalters beendet: Edward I. beschloss im Jahr 1290, die Verfügungen zu annullieren, nach denen jüdisches Leben in England und in der Gascogne toleriert wurde. Im selben Jahr kam es auch in Süditalien (außer Sizilien) zu Vertreibungen.60 1306 dekretierte der französische König Philipp IV. die Vertreibung der Juden aus seinem Reich. Nach seinem Tod gab es zwar einige Perioden, in denen kleinen Gruppen der Aufenthalt in Frankreich erlaubt wurde, doch 1394 wurden die Gesetze über den Ausschluss der Juden dauerhaft erneuert.61
Aus strukturellen Gründen war das Heilige Römische Reich nicht mit den obigen Ländern vergleichbar, so dass sich die Frage eines allgemeinen Vertreibungsediktes nicht stellte. Judenvertreibungen einzelner Städte kamen aber ebenso vor wie wiederholte Pogrome (z. B. im Rheinland 1095), die in der Mitte des 14. Jahrhunderts erhebliche Ausmaße annahmen.62 Auch in anderen europäischen Ländern bildeten soziale Benachteiligung und Segregation die Regel. Im Allgemeinen war die Tätigkeit der Angehörigen jüdischen Glaubens durch Maßnahmen der christlichen Umwelt so stark eingeschränkt, dass wenige Berufsfelder übrigblieben: in erster Linie die Tätigkeit des Arztes und einige kaufmännische Einkommensquellen wie z. B. Geldverleih und Bankgeschäfte.63
Wesentlich bessere Lebensbedingungen boten dagegen die christlichen Staaten auf der iberischen Halbinsel. Sie bildeten seit dem 13. Jahrhundert die Zufluchtsstätte der aus anderen europäischen Ländern vertriebenen Juden, so dass das von Suárez Fernández benutzte Bild einer „Oase“ eine gewisse Berechtigung hat.64 Gegen Ende des 13. Jahrhunderts erreichte der Anteil der Juden an der Gesamtbevölkerung in Kastilien ca. 4%, in Aragonien ungefähr 7%.65
Juristische Grundlagen: Lokale Fueros
Die hochmittelalterlichen Fueros in Kastilien und León sahen für die Juden einen hohen Rechtsstatus vor, der sie den Christen weitgehend gleichstellte. Sie wurden in den ältesten Fueros, z. B. im Fuero von Castrojeriz aus dem Jahr 974, in Mordfällen gleich behandelt66 und diverse Fueros (Briviesca,67Alcalá de Henares,68Abia de las Torres,69Cuenca,70Alcaraz,71Alarcón,72Ubeda,73Sepúlveda74) garantierten Juden, teilweise auch Mudejaren, dieselben Freiheiten wie den Christen, wenn sie in den entsprechenden Gebieten beheimatet waren bzw. sich dort niederließen.75 Die Ansiedlung von Bevölkerung in den nach der Abwanderung der besiegten Mauren weitgehend leeren Gebieten war ein Hauptanliegen von Krone, Klerus und kastilisch-leonesischem Adel. Dieses Ziel machte großzügige Zugeständnisse an die Juden notwendig, deren Ansiedlung vor allem aufgrund ihrer Fachkenntnisse und wegen ihrer Steuerkraft vom Monarchen gern gesehen wurde.
Eine entsprechende Entwicklung nahm die christliche Rechtsauffassung. Die Juden wurden als königliches Eigentum verstanden und mussten als Gegenleistung für ihre Duldung direkte Zahlungen an die Krone leisten: „ca los judíos siervos son del rey e acomendados por la bolsa del rey propria“.76 Im Libro de los Fueros de Castilla (§ 107) wird im gleichen Sinne festgehalten: „Esto es por fuero: que los judios son del rey; maguer que sean so poder de ricos omnes o con sus cavalleros o con otros omnes o so poder de monesterios, todos deven ser del rey en su goarda e para su servycio.“77 Daraus folgte die häufig geübte Regelung, dass Geldsummen, zu deren Zahlung ein Christ wegen einer an einem Juden verübten Straftat verurteilt wurde, direkt an die Krone flossen.78 Eingriffe in ihre jurisdiktionellen Befugnisse über die Juden, z. B. seitens der Städte oder des Klerus, duldete das Königtum nicht.79
In Angelegenheiten der allgemeinen Rechtsprechung wurde peinlich auf paritätische Besetzung der Gerichte geachtet. Zusätzlich nahm man Rücksicht auf jüdische Feiertage.80 Die Fueros von Cuenca, Alcaraz, Alarcón und Ubeda verboten den Juden, teilweise auch den Mudejaren, die Ausübung administrativ bedeutsamer Ämter wie dem des Burgvogts oder Merinos,81 was in der Praxis keine erhebliche Einschränkung bedeutete. In Bezug auf den Geldverleih wurden einerseits Obergrenzen für den Zinssatz festgelegt, andererseits wurde z. B. im Fuero von Cuenca und anderen daraus hervorgegangenen Fueros die rechtliche Gleichstellung von (jüdischem) Gläubiger und (christlichem) Schuldner strikt bewahrt.82
Der direkte Zusammenhang zwischen der Nachfrage an Siedlern und der rechtlichen Stellung der Juden bis zum frühen Spätmittelalter ist deutlich erkennbar. Die Siete Partidas (1256 - 1265) markieren insofern einen Einschnitt, als sie die Verschlechterung der Rechtssituation nach Abschluss der Ansiedlungstätigkeit und in einer Phase militärischer Niederlagen festhalten. Die Unterschiede zwischen Kastilien und Aragonien waren äußerst gering. Tendenziell lässt sich feststellen, dass die breite jüdische Bevölkerung in Kastilien ein wenig besser gestellt war. Die vermögende und in Geldgeschäften tätige jüdische Oberschicht fand dagegen in Aragonien wesentlich bessere Rahmenbedingungen zum sozialen Aufstieg als in Kastilien.83
Alfons X. und die Siete Partidas
Für unseren Betrachtungszeitraum bildete die unter Alfons X. zusammengestellte Gesetzessammlung der Siete Partidas84 die juristische Grundlage des jüdischen wie des mudejarischen Lebens in Kastilien.
Alfons X. (1252 - 84), genannt el Sabio,85 galt als wissbegieriger Mensch mit großem Respekt vor dem





























