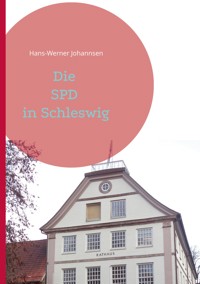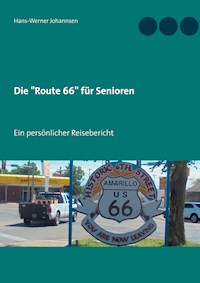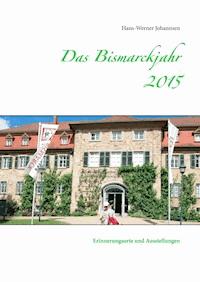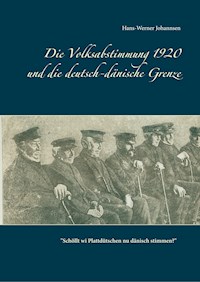
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
2020 jährt sich die Volksabstimmung über die deutsch-dänische Grenze zum 100. Mal. Die beiden Abstimmungen in der 1. Zone am 10. Februar 1920 in Nordschleswig und am 14. März 1920 in der 2. Zone im nördlichen Mittelschleswig haben damals die Menschen in der Region erheblich emotionalisiert und politisiert. Letztlich haben die beiden Abstimmungen aber zu einer Grenze geführt, die seit 100 Jahren Bestand hat und selbst Erschütterungen wie das unsägliche Dritte Reich überstanden hat. Zudem konnten die nationalen Minderheiten erfolgreich integriert werden. Hier werden zum Teil lokale Dokumente erstmals veröffentlicht, über die die Forschung bisher nicht verfügte. Geprägt waren die nationalen Auseinandersetzungen 1920 auch durch die Aktivitäten zweier bedeutender Persönlichkeiten, Hans Peter Hanssen auf dänischer und Adolf Köster auf deutscher Seite. Ihr besonnenes Wirken hat maßgeblich zur Beruhigung der erhitzten Gemüter in der Grenzregion beigetragen. Von daher wird aufbauend auf strukturgeschichtlichen Grundlagen deren persönlicher Beitrag entsprechend gewürdigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Über die Volksabstimmung 1920 im Schleswiger Raum gibt es inzwischen eine Fülle von Berichten und Monographien. Und auch alle Sammelwerke zur Schleswig-Holsteinischen Geschichte nehmen Bezug auf dieses Ereignis. Im Zentrum der meisten deutschen Darstellungen steht der Abstimmungskampf um die Stadt Flensburg. Mir war es wichtig, den Blick auf die ländliche Region, z.B. die Landschaft Angeln oder die Geest, zu richten und die Vielzahl der Chroniken aus den dortigen Orten zu sichten. Und auch die Einschätzung der dänischen Seite ist wichtig und darf nicht übergangen werden. Immerhin konnte das dänische Reichsgebiet bis an die heutige Grenze nach Süden erweitert werden. Von daher waren die dänischen Bemühungen um eine Grenzziehung, die weitgehend der Sprachengrenze entsprach, von Erfolg gekrönt. Da inzwischen auch in der Geschichtswissenschaft die Einbeziehung von wichtigen Personen in die Strukturgeschichte nicht mehr verpönt ist, habe ich einen Schwerpunkt auf die bedeutenden handelnden Personen, Hans Peter Hanssen auf dänischer und Adolf Köster auf deutscher Seite, gelegt.
Natürlich sollte auch der Blick der Bevölkerung auf das Geschehen um 1920 nicht zu kurz kommen. Hier waren mir einige heimatgeschichtlich interessierte Menschen aus der Region, die noch über eigene Erfahrungen oder Fotos verfügten, eine große Hilfe. Das gilt insbesondere für Ingo Obst und Rüdiger Wamser aus Wanderup, für Henning Brunkert aus Husby und für Erich Koch aus Schleswig. Danksagen möchte ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisarchive in Schleswig und Husum sowie der Archive in Flensburg und Glücksburg und dem Museum im Schloss Sonderburg. Das gleiche gilt für das Landesarchiv in Schleswig. Überaus wertvoll waren auch die Hinweise des Historikers Jan Schlürmann, einem sehr guten Kenner der deutschdänischen Geschichte. Nicht zuletzt danke ich meiner Frau Adelheid Johannsen, die mir mit Wort und Tat zu wichtigen Anregungen verhalf und akribisch meinen Text redigierte.
„Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“
(Victor Hugo)
Inhalt
Die Vorgeschichte
Der Erste Weltkrieg
Was wollen die Nordschleswiger?
Hans Peter Hanssen – Ein deutscher Politiker mit dänischer Gesinnung
Der Versailler Vertrag
Die Nordschleswig-Frage
Adolf Köster – Die deutsche Antwort
Der Deutsche Ausschuss (DA)
Der Schleswiger Raum unter Alliierter Verwaltung („Plebiszit Schleswig“)
Die Abstimmung in der 1. Zone
Der Plakatkampf
Die Abstimmung in der 2. Zone
Die Zugereisten
Die Tiedje-Linie
Notgeld
Die zwei „Wiedervereinigungen“
Der neue Grenzverlauf und Minderheiten beiderseits der Grenze
Die weitere Entwicklung
Abbildungen
Literatur
1 Die Vorgeschichte
Im Rahmen der zwei Schleswigschen Kriege zwischen 1848 und 1864 verlor Dänemark mit den Herzogtümern Schleswig, Holstein und Lauenburg rund 40% seines Staats-Gebietes. Bis dahin gehörten die formal nicht zum dänischen Reich gehörenden Herzogtümer zum Dänischen Gesamtstaat, der mit Holstein sogar über einen Sitz im Deutschen Bund verfügte. Dänemark hatte mit seinem Beharren auf der in der eiderdänischen Verfassung vom Herbst 1863 vorgesehenen Einverleibung Schleswigs die Londoner Verträge von 1852 gebrochen und bekam deshalb in der Auseinandersetzung mit Preußen/Österreich keinerlei internationale Unterstützung.
In der Folge wurden die Herzogtümer nach den Kriegen von 1864 (deutsch-dänisch) und 1866 (deutsch-österreichisch) eine preußische Provinz, die die neue Großmacht Preußen 1866 im Norddeutschen Bund und 1871 im Deutschen Kaiserreich mit abrundeten oder „arrondierten“, wie Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-1898) es im Nachhinein ausdrückte.
In den alten Herzogtümern Holstein und Lauenburg lebten nur deutsche Bewohner, die sich im Rahmen der nationalen Auseinandersetzungen zusammen mit dem Herzogtum Schleswig allerdings mehrheitlich als Schleswig-Holsteiner wohl eher einen eigenen Deutschen Bundesstaat wünschten. Dafür hatte sich der Augustenburger Prinz Friedrich mit seinen Erbansprüchen zur Verfügung gestellt, was von der deutschen Nationalbewegung und dem Bundestag in Frankfurt unterstützt wurde, aber letztlich den diplomatischen Aktivitäten eines Bismarcks weichen musste: „Die ‚up ewig Ungedeelten' müssen eines Tages Preußen werden.“ (Bismarck o.J., S. 95). Durch geschicktes Taktieren gelang es Bismarck letztendlich, auch Österreich zu überzeugen, mit Waffengewalt gegen Dänemark vorzugehen. Die Niederlagen Dänemarks auf den Düppelner Schanzen und beim Übergang nach Alsen waren aufgrund der stärkeren Bewaffnung der Landmacht Preußen vorprogrammiert.
Nach dem deutsch-österreichischen Krieg 1866 wurde die Königsau (dänisch: „Kongeå“ - alle Übersetzungen: Johannsen) die neue Grenze zwischen Dänemark und dem Norddeutschen Bund. Schließlich mussten die dänisch gesinnten Nordschleswiger nicht nur preußische Bürger, sondern nach 1871 auch gegen ihren Willen Bürger des neu gegründeten Deutschen Reiches werden. Die nordschleswigschen Abgeordneten nahmen ihr Mandat für den Preußischen Landtag allerdings nicht an, weil sie sich weigerten, den von ihnen verlangten Eid auf die preußische Verfassung abzulegen. Da dieser Eid nicht für den Reichstag galt, nahmen dänisch gesinnte Abgeordnete ihr dortiges Mandat an. Teilweise bekannten sogar zwei Reichstagsabgeordnete, dänisch orientiert zu sein.
Schleswig-Holstein erhielt in den darauffolgenden Jahren zwar eine moderne Verwaltung, hatte aber in Nordschleswig eine starke dänische Minderheit im Lande, die anfangs nicht bereit war, sich zum Deutschen Reich zu bekennen. Da der preußische Verwaltungsapparat eine streng deutsche Nationalitäten-Politik verfolgte, wurden dänische Aktivitäten im Norden Schleswigs unterdrückt. Viele dänisch orientierte Schleswiger wanderten deshalb bis zum Ersten Weltkrieg nach Amerika aus.
Abb.1: Die Grenze bei Foldingbro über die Königsau
Wer daheimblieb, erhoffte sich irgendwann eine Volksabstimmung, die in den Friedensverträgen nach dem preußisch-österreichischen Krieg 1866 auf Veranlassung des französischen Königs Napoleon III. mit aufgenommen wurde. 1878 strichen Preußen und Österreich diese Notiz aus dem Prager Protokoll. Damit war der völkerrechtliche Anspruch auf eine Volksabstimmung vom Tisch, nicht aber der moralische, auf den die dänisch sprechenden Nordschleswiger weiterhin setzten. Durch etliche zunehmend restriktivere Maßnahmen wie die „Köller-Politik“ seines Oberpräsidenten zwischen 1897 und 1901 (vgl. Degn 1994, S. 259) versuchte Preußen, „seine Dänen“ zu germanisieren, was gründlich misslang.
Da für den Deutschen Reichstag seit 1871 das allgemeine, geheime und direkte Mehrheitswahlrecht (nur für Männer) galt, gab es im Norden Schleswigs die Möglichkeit, dänische Abgeordnete zu wählen, was auch geschah. Durchgängig wählten die Nordschleswiger dänische Kandidaten. Allerdings „übten die Dänen bis 1878 weitgehend Stimmenthaltung. Sie wollten damit deutlich machen, dass sie mit dem deutschen Reich nichts zu tun haben wollten.“ (ebd., S. 256). Nach 1878 fügten sich die meisten in ihr Schicksal, wurden Deutsche, blieben aber sprachlich Dänen.
Abb. 2: Bevölkerungsanteile rot mit mehrheitlich dänischer Muttersprache in Mittel- und Nordschleswig 1905
Im Wahlkreis Apenrade/Flensburg/Glücksburg kippte im Laufe der Jahre die einst dänische Mehrheit bei den Wahlen zum Reichstag. Nur im nördlichen Schleswig (Hadersleben/Sonderburg) wurde der Abgeordnete zwischen 1871 und 1912 durchgehend von der dänisch sprechenden Bevölkerung gestellt. Die Grenze zum dänisch gesinnten Nordschleswig war lange eine reine Sprachgrenze, bei der sich das Deutsche während des 18. und 19. Jahrhunderts nach Norden verschoben hatte.
Schon der 1754 in St. Jürgen bei Schleswig geborene klassizistische Maler Asmus Jakob Carstens (1754-1798) sprach von zuhause aus nur deutsch. Seine Dänisch-Kenntnisse waren wenig ausgeprägt, obwohl er einige Jahre an der Kunstakademie in Kopenhagen studierte. Die Sprachgrenze verlief 1920 nördlich der Stadt Tondern über Tingleff nach Pattburg/Flensburg. Nördlich davon wurde überwiegend Dänisch bzw. Sønderjysk (ein Dialekt) gesprochen, südlich davon Deutsch oder Plattdeutsch in vielen Varianten. Daneben gab es an der Küste zur Nordsee und auf den Inseln noch die Friesen mit einer eigenen, der friesischen Sprache.
2 Der Erste Weltkrieg
In den Ersten Weltkrieg (1914-1918) schlitterten die großen Nationen Europas wie „Schlafwandler“ (Clark), alle waren sie hochgerüstet und überzeugt, dass nach 1870/71 irgendwann ein Krieg bevorstand. Vor allem die „Erzfeindschaft“ zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich belastete den brüchigen Frieden. Den Verlust Elsass-Lothringens von 1871 hatte Frankreich nie verschmerzt. Als auch Deutschland nach den Worten seines forschen Außenministers einen „Platz an der Sonne“ (von Bülow) forderte und Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) in seiner berüchtigten „Hunnenrede“ ins gleiche Horn blies, zeigten die Machthaber ihr wahres Gesicht. Die eindeutig gegen England gerichtete Aufrüstung zur Seemacht (Tirpitz) und eine widersinnige Bündnispolitik zugunsten Österreichs trugen dazu bei, dass dem Menetekel tatsächlich die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ (Kennan) folgte.
Auf den Schlachtfeldern Ostfrankreichs und im Osten Europas verbluteten Millionen junger Soldaten in jahrelangen Stellungskriegen. Noch 1918/1919 waren die regionalen Tageszeitungen wie die FLENSBURGER NACHICHTEN täglich voller Todesanzeigen der Gefallenen oder an den Verletzungen Gestorbener, auf die immer an vorderer Stelle hingewiesen wurde. Längst hatte der Kaiser im Deutschen Reich seine nicht mehr vorhandene Macht der Obersten Heeresleitung (OHL) übertragen. Die Generäle machten aus Deutschland eine Militärdiktatur, die bis zuletzt einen „Siegfrieden“ wollte und alle demokratischen Kräfte, die auf einen „Verständigungsfrieden“ setzten, von der Macht fernhielt.
Erst als die sich abzeichnende Niederlage im September 1918 nicht mehr abzuwenden war, verzichtete die OHL auf ihren Machtanspruch und übergab diesen an den Reichstag, der ab Anfang Oktober 1918 erstmals den Reichskanzler selbst wählen konnte. Die OHL betrieb auf diese Weise ein perfides Spiel. Die Demokraten sollten für die Militärs den Frieden aushandeln und so letztlich auch die Verantwortung für die Friedensbedingungen tragen. Das gelang, wie wir heute wissen, nahezu perfekt, obwohl mit der Novemberrevolution 1918, die später als „Dolchstoß-Legende“ propagandistisch missbraucht wurde, aus der Monarchie eine Republik geworden war. Von dieser schweren Hypothek sollte sich die „Weimarer Republik“ (1919-1933) nie ganz erholen.
Das Ende des Ersten Weltkrieges zog sich über Wochen hin. Über schweizerische Kanäle hatte die deutsche Regierung schon seit 1916 und intensiver ab September 1918 versucht, Kontakt zu den US-Amerikanern aufzunehmen, was auch gelang. Allerdings wurden die deutschen Noten mit den Waffenstillstands-Angeboten bewusst nur zögerlich beantwortet. Die amerikanische Regierung stimmte sich jeweils mit der Entente ab und erhöhte mit jeder neuen Note ihre Forderungen. Selbst der Wechsel zur parlamentarischen Monarchie Anfang Oktober 1918 in Deutschland reichte schließlich nicht. Die Alliierten forderten eine Abkehr vom preußisch-deutschen Militarismus und das bedeutete letztlich die Abschaffung der Monarchie. Als die neue deutsche Regierung schließlich auch das durchsetzte, unterschätzte sie anschließend dennoch die Gegenseite bei den Waffenstillstands-Verhandlungen. Obwohl in der November-Revolution zu einer Demokratie mutiert, wurde dieser Machtwechsel bei den anstehenden Friedensverhandlungen in Versailles von der Entente überhaupt nicht honoriert.
Während die Deutschen auf den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson (1871-1925) und seine „14 Punkte“ setzten, vertraten der französische Präsident Georges Clemencau (1841-1929), der französische Verhandlungsführer der Alliierten, und sein Marschall Ferdinand Foch (1851-1929) einen strikt antideutschen Kurs. Für beide hatte die Schwächung Deutschlands oberste Priorität. Es galt sicherzustellen, dass Deutschland nicht mehr in der Lage sein konnte, erneut zu den Waffen zu greifen. Von daher wollten die Alliierten erst einmal sicherstellen, dass Deutschland kein Bedrohungsszenario mehr aufbauen konnte. Die letztlich vier auf-einander folgenden Waffenstillstände wurden auf Verlangen der Entente so terminiert, dass jeweils der Fortschritt der Demilitarisierung Deutschlands kontrolliert werden konnte.
Abb. 3: Dänische Landkarte von Sønderjylland/Schleswig 1918
Noch ein Wort zur Sprachgrenze. Warum verschob sich diese im Laufe der Jahrhunderte in Richtung Norden? Noch im Mittelalter war das Danewerk die von Deutschen und Dänen akzeptierte Grenze, die durch historische Relikte wie die Waldemarsmauer, den Margarethenwall oder Haithabu zumindest teilweise noch erhalten geblieben war. Diese Erinnerungsorte werden noch heute gerne von dänischen Besuchern erkundet. Außerdem war mit dem Vertrag von Ripen (1460) schon vor Jahrhunderten geregelt worden, dass die Herzogtümer Holstein und Schleswig „ungedelt“ sein sollten. Darauf bauten vor allem die Schleswig-Holsteiner, die wie die „Eider-Dänen“ noch 1919 ebenfalls einseitig historisch argumentierten.
Seit 1523 gab es in Kopenhagen eine „Deutsche Kanzlei“, die für die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg zuständig war. Die gebräuchliche Verwaltungssprache war Deutsch und viele Mitarbeiter kamen aus dem Holsteiner Adel, waren demnach deutschsprachig. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts soll jeder dritte Kopenhagener deutschsprachig gewesen sein. Noch in Zeiten des Dänischen Gesamtstaates, der bis 1864 Bestand hatte, blieb es in Kopenhagen bei zwei Kanzleien, einer dänischen und einer deutschen. Und seit dem „Wiener Kongress“ 1815 war der dänische König in seiner Eigenschaft als Herzog von Holstein sogar Mitglied im neugeschaffenen Deutschen Bund.
Abb. 4: Die Verschiebung der dänischen Sprachgrenze nach Norden. Noch um 1840 wurde im mittleren und nördlichen Angeln sowohl Deutsch als auch Dänisch gesprochen
Sicherlich hat auch die letztlich aber gescheiterte Kolonisation der dünnbesiedelten Geest in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch Kolonisten-Familien aus Süddeutschland eine gewisse Rolle gespielt. Diese siedelten hauptsächlich auf dem Geestrücken im südlichen und mittleren Schleswig. Noch heute weisen Familienamen wie Wamser, Huber oder Metzger sowie Ortsnamen wie Friedrichsfeld darauf hin. Im aufgeklärten Absolutismus skandinavischer Prägung spielte die Nationalitäten-Frage noch keine Rolle. Erst in der nachnapoleonischen Ära entwickelte sich auch im Schleswiger Raum ein Nationalbewusstsein, so dass man sich als Deutscher, Schleswig-Holsteiner, Friese oder Däne fühlte.
3 Was wollen die Nordschleswiger?
In ganz Dänemark setzte man während der Preußen-Jahre 1864-1919 darauf, dass es irgendwann einmal zu einer Wiedervereinigung („Genforeningen“) des alten Herzogtums Schleswig mit dem Dänischen Reich kommen würde. Während des Ersten Weltkrieges (1914-1918), in dem Dänemark neutral blieb, nahm die dänische Bewegung für einen Wiederanschluss an das Königreich Fahrt auf. Gegen Ende des Krieges kontaktierte die dänische Regierung in der Schleswig-Frage die britische Regierung in London, zu der sie traditionell gute Beziehungen pflegte.
Die britische Regierung riet dazu, nicht einseitig Gebietsforderungen an die Siegermächte (Entente) zu übermitteln, sondern vorher das Gespräch mit den Deutschen zu suchen (vgl. Opitz, 2002, S. 321). Mit dieser Aufgabe betraut wurde ein dänisch orientierter Nordschleswiger, der als Deutscher von 1906 bis 1919 einen Sitz im Deutschen Reichstag besaß: Hans Peter Hanssen (H.P. Hanssen) aus Apenrade.
Wegen seiner journalistischen Tätigkeit für dänisch orientierte Zeitungen und seiner dänischen Gesinnung wurde der Apenrader Hanssen (1862-1936) auf Veranlassung der preußischen Verwaltung mehrmals von der Polizei verhaftet. Schon als junger Mann war Hanssen überzeugt, dass zumindest Nordschleswig eines Tages ein Teil Dänemarks werden müsse. Dieses Lebensziel verfolgte der talentierte und selbstbewusste Politiker gradlinig über Jahrzehnte. Schon in der Redaktion der „SØNDERJYSKE ǺRBØGER“ („Nordschleswigsche Jahrbücher“) assistierte er dem Abgeordneten des Reichstages Gustav Johannsen (1840-1901) und wurde dessen „kronprins“ (Klaus Tolstrup Petersen, 2017, S. 127). Als Mitglied zuerst des Preußischen Landtages und später des Deutschen Reichstages in Berlin wurde Hanssen zum wichtigsten dänisch gesinnten Politiker Nordschleswigs. Zu seinen deutschen Kollegen und zur Reichsverwaltung in Berlin entwickelte er ein gutes Verhältnis auf einer sachlichen Grundlage.
Der im Reichstag fraktionslose Hanssen war ein Pragmatiker, kein Idealist oder gar Radikaler. Er war nicht nur wirtschaftlich abgesichert, sondern auch politisch gut geerdet. Er wusste, was politisch durchsetzbar und was lieber zu unterlassen war. Gerade in der Schleswig-Frage gab es Dogmatiker auf beiden Seiten und in allen Gesellschaftsschichten. In dieser Sache blieb Hanssen überzeugt, dass das Problem eines Tages im dänischen und damit in seinem Sinne gelöst werden würde.
Das bekräftigte Hanssen bereits 1895 vor dem Apenrader Amtsgericht, wo er die „dauernde Trennung Nordschleswigs von Deutschland“ (zitiert nach Hähnsen, 1930, S. 35) als erwünschtes Ziel formulierte. Auch im deutschen Reichstag äußerte er sich entsprechend und sprach 1915 von einer von ihm und den Dänen gewünschten „Grenzkorrektur“