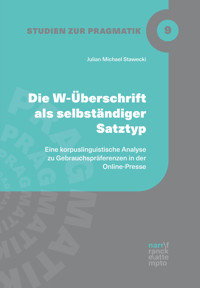
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Studien zur Pragmatik
- Sprache: Deutsch
Die W-Überschrift ist ein besonderer Satztyp mit Verbletztstellung, der nur in Überschriften vorkommt. Diese Arbeit untersucht mit korpuslinguistischen Methoden, welche Bedeutung und Wirkung dieser Satztyp hat und wie sich diese systematisch beschreiben lassen. Grundlage der Analyse ist ein eigens erstelltes Korpus mit Überschriften aus über 19 deutschen Online-Presse texten. Die Studie zeigt, dass W-Überschriften nicht zufällig, sondern gezielt in bestimmten Textsorten verwendet werden, um Erwartungen an die Art und den Inhalt der Wissensvermittlung im Haupttext zu steuern. Die Arbeit nutzt verschiedene sprachwissenschaftliche Ansätze, um zu erklären, wie sich Form und Textposition auf die Bedeutung dieses Satztyps auswirken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julian Michael Stawecki
Die W-Überschrift als selbständiger Satztyp
Eine korpuslinguistische Analyse zu Gebrauchspräferenzen in der Online-Presse
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381140725
© 2025 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 2628-4308
ISBN 978-3-381-14071-8 (Print)
ISBN 978-3-381-14073-2 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Der vorliegende Text ist eine überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die ich im Juli 2023 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eingereicht habe. Sie wurde im Rahmen des DFG-geförderten Projekts „W-Überschriften im Deutschen. Empirische Untersuchung und theoretische Modellierung der Schnittstelle zwischen Satztyp und Textsorte“ (Geschäftszeichen FI 2297/1-1) erstellt. Erst durch die Förderung der DFG wurde diese Untersuchung möglich, und dafür gilt ihr mein tief empfundener Dank.
Diese Arbeit wurde in einer Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen und Herausforderungen verfasst. Die Corona-Pandemie prägte den gesamten Entstehungsprozess, brachte unvorhersehbare Unsicherheiten im Alltag mit sich und veränderte die Arbeitsbedingungen grundlegend. Doch inmitten dieser Herausforderungen gab es auch Lichtblicke: Die Geburt meiner Tochter Yana. Viele Tage und Nächte verbrachte ich sowohl mit dem Schreiben als auch mit ihrer Betreuung – eine intensive Zeit, die mir nicht nur wertvolle Erfahrungen, sondern auch neue Perspektiven schenkte.
Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Rita Finkbeiner, deren geduldige Unterstützung und stete Gesprächsbereitschaft mich durch die gesamte Entstehungsphase der Dissertation begleitet haben. Ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten als Computerlinguist und ihre Ermutigung, meine empirischen Ideen umzusetzen, waren von unschätzbarem Wert. Ebenso danke ich meinem Zweitprüfer, Prof. Dr. Alexander Ziem, dessen Vertrauen in meine Fähigkeiten mich stets bestärkt hat. Beide haben mir gezeigt, dass Wissenschaft nicht nur darin besteht, präzise zu arbeiten, sondern auch Mut zur eigenen Forschung zu haben, bestehende Annahmen zu hinterfragen und neue Wege zu gehen.
Mein tiefster Dank gilt meiner Familie – meiner Frau Lin, meiner Tochter Yana und meinen Eltern. Ohne eure Liebe, Geduld und Unterstützung wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Ihr habt mir die nötige Kraft gegeben, um trotz aller Herausforderungen durchzuhalten und diese Dissertation zu vollenden.
Besonderer Dank gebührt auch den studentischen Hilfskräften Lara Kerkenberg, Tasnim Khayata, Darya Malukha, Nina Jakob, Juliet Gülükoglu und Sophia Atteln. Ihre sorgfältige Arbeit bei der Annotation der Korpusdaten hat wesentlich zur empirischen Basis dieser Untersuchung beigetragen. Ohne ihr Engagement hätte diese Arbeit nicht auf der fundierten Datenbasis stehen können, die sie auszeichnet.
Kaarst, im Mai 2025, Julian Michael Stawecki
1Gegenstand und Motivation
Satztypen spielen eine besondere Rolle in der sprachlichen Kommunikation. Sie sind grundlegende sprachliche Einheiten, die anhand bestimmter struktureller Merkmale wie der Stellung des finiten Verbs, der Satzintonation und dem Einsatz von Modalpartikeln definiert werden und eine spezifische illokutive Funktion kodieren. Diese illokutiven Funktionen – etwa Behaupten, Fragen oder Bitten – beeinflussen maßgeblich, wie Sätze in Kommunikationssituationen interpretiert werden. Satztypen sind daher nicht nur strukturelle Kategorien, sondern auch wesentliche Mittel zur Steuerung von Kommunikationsprozessen in unterschiedlichen Kontexten.
Während Satztypen traditionell vor allem im Rahmen der mündlichen Kommunikation untersucht werden, zeigt sich ihre Bedeutung auch in schriftsprachlichen Kontexten, insbesondere in der Pressekommunikation. Hier fungieren Überschriften als Schnittstelle, an der der Textproduzent (TP) mit dem Textrezipienten (TR) kommuniziert und einen Übergang zu einem Diskursbeitrag – dem eigentlichen Artikel – schafft. Dabei lassen sich verschiedene Satztypen erkennen, die bevorzugt in Überschriften eingesetzt werden. Häufig finden sich Deklarativsätze, insbesondere V2-Deklarativsätze wie in (1), aber auch Interrogativsätze, z.B. w-V2-Interrogativsätze wie in (2). Besonders auffällig ist jedoch der Gebrauch von w-VL-Sätzen, wie in (3).
(1)
Belarussische Airline verhängt Flugverbot (faz.net, 15.11.2021)
(2)
Was bringen Hamburgs neue Campusschulen? (abendblatt.de, 03.09.2019)
(3)
Warum die FDP-Niederlage verdient ist (tagesspiegel.de, 02.09.2019)
Während w-V2-Sätze wie in (2) in der Literatur als selbständige Interrogativsätze mit einem typischen Fragepotenzial gut beschrieben sind, stellen w-VL-Sätze wie in (3) ein besonderes Phänomen dar. Sie treten üblicherweise in Satzgefügen wie in (4–6) auf, wo sie als unselbständige Nebensätze vom pragmatischen Potenzial eines Hauptsatzes abhängen. In der Position der Überschrift werden sie allerdings selbständig verwendet. Diese besondere Form eines w-VL-Satzes wird nach Finkbeiner (2018) als W-Überschrift (WÜ) bezeichnet.
(4)
Ich sage dir, warum die FDP-Niederlage verdient ist.
(5)
Sag mir, warum die FDP-Niederlage verdient ist.
(6)
Ich frage mich, warum die FDP-Niederlage verdient ist.
Aufgrund der selbständigen Verwendung in der Überschriften-Position stellen sich die Fragen, wodurch die WÜ lizensiert ist und welches illokutive Potenzial sie besitzt. Dabei liegt es nahe, dass die Positionierung und der Bezugstext der Überschrift Hinweise hierauf geben könnten. Erste Evidenzen im Rahmen von Pressetexten deuten bereits darauf hin, dass bei WÜ ein präferierter Gebrauch in Rezensionen und Reportagen vorliegt (Finkbeiner 2018). Zudem lässt sich annehmen, dass in der Presse konventionalisierte Auffassungen und Regeln existieren, die bestimmen, welche Überschriften sich für welche Textsorten besonders eignen.1 Daraus ergibt sich die Annahme, dass bestimmte Satztypen, wie die WÜ, eine stärkere Affinität zu spezifischen Textsorten aufweisen könnten. Die zentrale Frage lautet: Welche Rolle kann den Satztypen im Gebrauch der Überschrift zugesprochen werden und welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Textsortenzugehörigkeit? Es erscheint denkbar, dass der Satztyp in der Überschrift auf einer Metaebene eine textverweisende Funktion übernimmt, die mit der Funktion der Textsorte korrespondiert. Diese Verbindung könnte erklären, warum bestimmte Satztypen eine besondere Eignung für bestimmte Textsorten aufweisen.
Ausgehend vom Gegenstand der WÜ ist daher den Fragen nachzugehen, warum gerade dieser Satztyp auf die Überschriften-Position beschränkt ist und welche pragmatischen Effekte sich bei seinem Gebrauch in spezifischen Textsorten nachweisen lassen. Ein Vergleich mit anderen Satztypen könnte dazu beitragen, die Eigenschaften der WÜ besser zu verstehen.
Die Motivation dieser Arbeit ergibt sich aus der Feststellung, dass die bestehenden Ansätze zur Beschreibung von Satztypen nicht ausreichen, um die WÜ als eigenständigen Satztyp adäquat zu beschreiben. Die WÜ wirft das Licht nämlich auf ein Phänomen, das bisher wenig Beachtung gefunden hat: Die funktionale Beziehung zwischen Satztypen und Textebene.
Im Forschungsdiskurs finden sich kaum ausführliche Auseinandersetzungen, die sich mit dem Zusammenhang von Satztypen und Überschriften beschäftigen. Dabei ist das Phänomen der WÜ als ausschließlich in Überschriften lizenzierter w-VL-Satz schon länger bekannt. Bereits Weuster (1983) beobachtete im Kontext von w-Wort-Sätzen diese Form des w-VL-Satzes, den sie als verweisende Ergänzungsfrage ohne Frage-Illokution klassifizierte und der häufig als Textüberschrift oder Buchtitel verwendet wird (vgl. 1983: 54). Weitere Nennungen der WÜ finden sich auch unter dem Begriff der „w-Schlagzeile“ bspw. bei Altmann (1987), Luuko-Vinchenzo (1988) und Oppenrieder (1989). Eine spezifische Auseinandersetzung mit dem Gegenstand blieb aber längere Zeit aus. Erst Finkbeiner (2018) prägte den Terminus W-Überschrift und widmete sich dem Satztyp im Detail. Es gelang ihr, eine höhere Verträglichkeit der WÜ mit Pressetexten, die eine gegebene Proposition p spezifizieren, nachzuweisen als bei Pressetexten, die eine neue Proposition p assertieren. Finkbeiner (2018) nimmt an, dass der TP mit dem schriftsprachlichen Gebrauch einer Textüberschrift eine eigenständige sprachliche Handlung vollzieht. Um die Rolle der WÜ in dieser Handlung angemessen zu beschreiben, fehlt aber ein angemessener Beschreibungsansatz, der die Textsortenbezogenheit und die damit einhergehenden kontextuellen Faktoren berücksichtigt.
Durch eine nähere Auseinandersetzung mit der WÜ bietet sich die Möglichkeit, eine Brücke zwischen der Satztypenforschung und der Textlinguistik zu schlagen, da die WÜ aufgrund ihrer festen Bindung an die Überschriften-Position stets einen Bezugstext benötigt. Die Betrachtung der Überschriften-Position als Schnittstelle zwischen der Textebene und der Satztypenebene eröffnet das Potenzial, das Zusammenspiel von Satztypen in Überschriften und den Eigenschaften und Funktionen des Bezugstextes detaillierter zu analysieren. In diesem Zusammenhang bietet eine Betrachtung des Gebrauchs von Satztypen in Überschriften spezifischer Textsorten eine wertvolle Gelegenheit, detailliertere Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen der textuellen und kommunikativen Funktion der WÜ zu gewinnen. Dies könnte nicht nur dazu beitragen, die Verflechtungen zwischen Satztypologie und Textlinguistik besser zu verstehen, sondern auch neue Perspektiven auf die Rolle von Satztypen im Gesamtgefüge schriftlicher Kommunikation zu eröffnen.
Die vorliegende Arbeit verfolgt daher das Ziel, mithilfe korpusgetriebener und korpusgeleiteter Methoden den Gebrauch der WÜ in Pressetextsorten zu erschließen, um Aussagen über die WÜ als Satztyp und ihre funktionale Beziehung zur Textebene zu treffen. Als Vergleichsgegenstand dienen w-V2-Interrogativsätze, um Aussagen über die Signifikanz der Beobachtungen zum WÜ-Gebrauch zu treffen. Der Grund für diesen Vergleich liegt in der formalen und semantischen Nähe beider Satztypen, die bedingt durch den w-Ausdruck einen interrogativen Modus und eine offene Proposition aufweisen, womit eine Informationslücke als Leseanreizfunktion eröffnet wird – die sogenannte „curiosity inducing information gap“ (Blom/Hansen 2015: 88).
Die Einschränkung der Untersuchung auf den Bereich der Pressetexte ergibt sich aus zwei zentralen Gründen: einem theoretischen und einem methodischen. Erstens handelt es sich bei Pressetexten um stark konventionalisierte Gebrauchstexte, die primär eine assertive Funktion bzw. Informationsfunktion für den Leser erfüllen. Werden also Gebrauchstexte betrachtet, die nach einer systematischen Typologie (Rolf 1993) klassifizierbar sind, können sie funktional näher spezifiziert und somit auch feiner differenziert werden. Eine solche Feindifferenzierung ermöglicht es schließlich, präzisere Aussagen über den Textsortengebrauch der WÜ zu treffen. Zweitens sind Pressetexte durch das traditionelle journalistische Handwerk und den Pressekodex geprägt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Textsorten etablierte, gefestigte Formen und einen begrenzten Funktionsumfang aufweisen. Dies erleichtert die Typologisierung insofern, dass sich an den Konventionen der Presse orientiert werden kann. Aber auch aus methodischer Sicht ist eine bevorzugte Erfassung von Überschriften aus der Presse begründbar: Journalistische Texte sind überschaubare, abgeschlossene Einheiten, die sich vergleichsweise schnell in Bezug auf ihre Funktion und ihren Inhalt analysieren lassen. Darüber hinaus bieten öffentlich zugängliche Artikel in Online-Presseportalen eine umfangreiche und leicht zugängliche Datengrundlage, die sich gut für korpuslinguistische Studien eignet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die Untersuchung der WÜ ein Beitrag zur Erforschung der funktionalen Beziehung zwischen Satztypen und Textebene geleistet werden soll. Die bestehende Forschung soll am Beispiel der WÜ um eine Satztyp-Text-Schnittstelle erweitert und das Potenzial für die Beschreibung von Satztypen auf Textebene aufgezeigt werden.
1.1Leitfragen und Ziele
Anhand der vorherigen Ausführungen lassen sich für die Dissertation folgende Fragestellungen ableiten, die es in der Arbeit zu beantworten gilt:
Frage F1: Worin unterscheidet sich die WÜ von anderen etablierten Satztypen?
Frage F2: Wodurch lässt sich die Beschränkung der WÜ auf den Gebrauch in Überschriften erklären?
Frage F3: Liegt bei den WÜ eine Bindung an spezifische Textsorten vor, durch die sich pragmatische Effekte erklären lassen?
Frage F4: Wie kann eine potenzielle Schnittstelle zwischen Satztyp und Textsorte theoretisch modelliert werden?
Um das Ziel der Erschließung der Schnittstelle Satztyp-Text am Beispiel der WÜ zu erreichen, werden korpuslinguistische Methoden zum Einsatz kommen. Konkret wird der Textsortengebrauch der WÜ datengestützt erschlossen, mit dem ein Erklärungsansatz für die funktionale Beziehung zwischen Textebene und Satztypen geliefert werden soll.
Damit dieses primäre Ziel erreicht werden kann, ergibt sich für das dargelegte Forschungsvorhaben eine Vorgehensweise, die theoretischer und methodischer Natur ist:
Die Beschreibung der WÜ als selbständiger w-VL-Satztyp, der auf den Gebrauch in Überschriften beschränkt ist.
Die Beschreibung der Presse-Überschrift in der Online-Massenkommunikation, ihr textsortenspezifischer Gebrauch und die Erfassung ihrer kontextuellen Merkmale.
Das Aufstellen einer funktional getriebenen Textsorten-Typologie für Pressetexte, die der Differenzierung möglicher Beziehungsaspekte zur Überschrift dient.
Aufbau eines qualitativ geprüften, ausgewogenen Überschriften-Korpus aus Online-Pressetexten mit textsorten- und satztypenspezifischer Annotation.
Die quantitative und qualitative Untersuchung des Textsortengebrauchs von WÜ in Online-Pressetexten und der damit einhergehenden kommunikativen Effekte mithilfe korpuslinguistischer Methoden.
Die Entwicklung eines Beschreibungsansatzes für WÜ, der auf Basis der Evidenzen aus der Korpus-Studie gestützt ist und die textuelle Ebene berücksichtigt.
1.2Aufbau der Arbeit und Vorgehen
Die vorliegende Arbeit teilt sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil beginnt mit einer Betrachtung des aktuellen Forschungsstands und greift zentrale Aspekte der Satztypenforschung und Textlinguistik auf, anhand derer sich Schnittstellen zwischen beiden Disziplinen aufzeigen lassen. Zudem werden bisherige Erkenntnisse zur WÜ zusammengefasst (Kapitel 2). Das Kapitel trägt dazu bei, einen Überblick über die Beziehung zwischen Satztypen und der Textebene zu geben und den Gebrauch von Satztypen in Überschriften und Textsorten zu beleuchten. Zudem wird aufgedeckt, welchen Status WÜ in alter und neuer Forschungsliteratur einnehmen und welche offenen Forschungspunkte sich feststellen lassen, an die in dieser Arbeit angeknüpft werden kann.
Der hierauf folgende Teil der Dissertation dient der Vorbereitung auf die empirische Arbeit, indem Hypothesen entwickelt und sowohl das Beschreibungsinventar als auch die Forschungsdesiderate herausgearbeitet werden. Es wird der Gegenstand der WÜ als Satztyp im Satzmodus-System und seine imperativisch-epistemische Strukturbedeutung genauer betrachtet. Zudem wird das Potenzial der diskurslinguistischen Perspektive auf die WÜ als Question Under Discussion (QUD) aufgezeigt, die Aufschluss über eine Textsortenbindung geben kann (Kapitel 3). Des Weiteren wird die Überschrift und ihr Textsortengebrauch in der Kommunikation der Online-Presse näher betrachtet (Kapitel 4). Anschließend wird eine Textsortentypologie für journalistische Textsorten aufgestellt, die funktional getrieben ist und die Grundlage für die empirische Arbeit darstellt (Kapitel 5). Zusammenfassend zielt der theoretische Teil darauf ab, den Forschungsgegenstand der WÜ sowie ihre Kommunikationssituation zu erfassen, Hypothesen zu entwickeln und die Basis für die Korpusstudie im empirischen Teil der Dissertation zu legen. Der Aufbau noch einmal im Detail:
Kapitel 3 führt theoretische Ansätze, Begriffe und Modelle aus der Satztypenforschung und Diskurspragmatik ein, die für diese Arbeit relevant sind. Hierbei wird sich am Satztypenmodell nach Altmann (1993), der imperativisch-epistemischen Strukturbedeutung von Interrogativsätzen nach Truckenbrodt (2004) und der Modellierung von QUD-Diskursbäumen nach Riester (2019) orientiert. Das Ziel ist es, für die Arbeit fruchtbare Beschreibungsansätze aufzuzeigen und Hypothesen in Bezug auf die pragmatischen Effekte und den Textsortengebrauch der WÜ aufzustellen.
Kapitel 4 dient der Definition der Presse-Überschrift und der Betrachtung ihres textsortenspezifischen Gebrauchs vor dem Hintergrund der Massenkommunikationssituation der Online-Presse. Das Ziel ist es, eine klar abgrenzbare Definition der Überschrift zu formulieren, und am Beispiel der WÜ herauszuarbeiten, welchen potenziellen Einfluss kontextuelle Merkmale der Kommunikationssituation auf die Wahl von Überschriften in bestimmten Textsorten haben.
Kapitel 5 dient der Erstellung einer funktional geprägten Textsortentypologie von Online-Pressetexten, die in Bezug auf das Forschungsvorhaben induktiv erarbeitet wird. Es werden bestehende Typologisierungsmerkmale von Pressetextsorten vor dem Hintergrund des Online-Gebrauchs betrachtet, um funktionale und gestalterische Merkmale zu erschließen, die als Grundlage für die eigene Typologie dienen. Die in diesem Kapitel entwickelte Typologie wird im Weiteren für das empirische Vorgehen verwendet.
Der empirische Teil dieser Arbeit beschreibt die Vorbereitung und Erstellung des Überschriften-Korpus (Kapitel 6) und seine anschließende Auswertung (Kapitel 7). Hierbei werden die theoretischen Vorüberlegungen aus den vorhergehenden Kapiteln herangezogen, um die Korpusgestaltung theoriegerecht umzusetzen und Schlussfolgerungen zur Beziehung zwischen WÜ und Textsorte bzw. Textfunktion zu ziehen.
Kapitel 6 begründet die Erstellung eines eigenen Überschriften-Korpus und dokumentiert den gesamten Erstellungsprozess. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der einzelnen Prozessschritte, einschließlich der Annotation und Qualitätssicherung. Eine abschließende quantitative und qualitative Betrachtung dient dazu, das Korpus als Ganzes zu bewerten und seine Einsatzmöglichkeiten für korpuslinguistische Studien aufzuzeigen.
Kapitel 7 umfasst die Auswertung des Korpus hinsichtlich der Fragen und Hypothesen dieser Arbeit. Spezifisch wird der Gebrauch der WÜ in Textsorten analysiert und mit dem Gegenstand der w-V2-Interrogativsätze kontrastiv verglichen, um signifikante Gebrauchsspezifika hervorzuheben. Zudem wird die Beziehung der WÜ zu ihrem Bezugstext u.a. anhand der Beantwortung der durch die WÜ adressierte Frage im Bezugstext untersucht.
Aufbauend auf den Ergebnissen des empirischen Teils wird ein konstruktionsgrammatischer Beschreibungsansatz für die WÜ mit Bezug zur Textebene entwickelt (Kapitel 8). Für die WÜ scheint dieses Vorgehen insofern fruchtbar zu sein, da es ermöglicht, die spezifischen Merkmale, die die Textposition und die möglichen Funktionen für den Bezugstext betreffen könnten, zu erfassen. Das Kapitel wird motivieren, warum ein konstruktionsgrammatischer Ansatz einem projektionistischen Ansatz vorgezogen wird. Als Basis für den Beschreibungsansatz werden die gewonnenen Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil und die Ergebnisse aus der Korpus-Studie herangezogen. Ziel dieses Kapitels ist die Entwicklung eines Satztypen-Modells, mit dem sich die WÜ beschreiben und neben ihrer pragmatischen Funktion auch ihr Bezug zur Textsorte bzw. Textfunktion integrieren lässt.
Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Forschungsausblick ab (Kapitel 9). Hierbei wird auf die einzelnen Ergebnisse aus der Arbeit in Bezug auf die Ziele, Fragestellungen und Hypothesen zusammenfassend zurückgeblickt. Zudem zeigt ein kurzer Ausblick das Potenzial weiterer Forschungen im Grenzbereich zwischen Satz- und Textebene.
2Forschungsstand: Satztypen, Textebene und W-Überschrift
Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zur Schnittstelle von Satztypen und Textsorten sowie den spezifischen Fall der WÜ im Kontext der Satztypenforschung und Textlinguistik. Das Ziel besteht darin, die Beziehungen zwischen Satztypen und Textsorten aus verschiedenen theoretischen Perspektiven darzustellen und die WÜ in ihrer besonderen Stellung zwischen Satz- und Textebene einzuordnen.
Zunächst werden Bezüge zwischen Satztypen und Textsorten im Rahmen der Satztypenforschung und Textlinguistik aufgezeigt (Kapitel 2.1). Anhand einiger Beispiele wird der Gebrauch von Satztypen im Hinblick auf die Ebene Text(-sorte) veranschaulicht. Anschließend wird die Beziehung zwischen Überschrift und Bezugstext aus Sicht der journalistischen und publizistischen Forschung näher betrachtet (Kapitel 2.2), um hervorzuheben, welche Funktionen Überschriften in Bezug auf ihren Bezugstext erfüllen und welche Eigenschaften hiermit in Verbindung gebracht werden.
Auf dieser Grundlage wird die Behandlung der WÜ in früheren Arbeiten wie Weuster (1983) sowie in aktuellen Forschungsbeiträgen von Finkbeiner (2018; 2020; 2022), Finkbeiner et al. (2021), Finkbeiner/Külpmann (2022) und Finkbeiner/Fetzer (2022) aufgezeigt (Kapitel 2.3). Ziel ist es, den bisherigen Kenntnisstand zu WÜ zusammenzufassen und offene Fragen aufzudecken.
Abschließend werden die aufgedeckten Forschungsfragen systematisch zusammengetragen (Kapitel 2.4). Es wird beschrieben, wie diese in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen werden, um die WÜ als Schnittstelle zwischen Satztyp und Textebene zu untersuchen und zur Erweiterung der Satztypenforschung beizutragen.
2.1Die Beziehung zwischen Satztypen und Textsorten
In der Satztypenforschung stehen die Textebene und der Gebrauch von Satztypen in Textsorten bislang weniger im Fokus. Die Untersuchungen konzentrieren sich überwiegend auf mündliche, dialogische Kommunikationssituationen. Die Sicht auf Satztypen aus einer schriftlichen, monologischen Perspektive bleibt eine Randerscheinung. Spezifische Typen wie bspw. Echofragen, die sich nur im Rahmen eines dialogischen Kontextes adäquat beschreiben lassen, da sie vorher Geäußertes echoartig wiederholen, sind Gegenstand zahlreicher Untersuchungen (u.a. bei Reis, 2013; 2016; Altmann, 1987; 1993). Satztypen, wie z.B. monologische Fragen, die auf eine monologisch geprägte Kommunikation beschränkt sind und eingebettet im Monolog eine spezifische strukturierende Funktion erfüllen, finden hingegen weniger Aufmerksamkeit (Brandt et al. 1992; Truckenbrodt 2004). Es fehlt eine feindifferenzierte und systematische Betrachtung von Satztypen, die deutlicher zwischen der Medialität (mündlich-schriftlich) und der Gesprächsform (dialogisch-monologisch) unterscheidet, um funktionale Unterschiede klar herauszuarbeiten. Trotz dieser fehlenden Systematisierung finden sich in Forschungsarbeiten dennoch immer wieder Hinweise und Fälle, bei denen der Bezug von Satztypen zur Textebene genannt wird.
Ein häufig genanntes Beispiel, etwa bei Donhauser (1987), Oppenrieder (1987; 2013) und Schaller (2014) ist der V1-Deklarativsatz mit unbesetztem Vorfeld (7–8), der einen frequenten Gebrauch in Witzanfängen aufweist. Die Positionierung am Textanfang und die starke Bindung an die Textsorte Witz scheinen entscheidende Merkmale für den Gebrauch des Satztyps in Texten zu sein.
(7)
Kommt ein Mann in eine Kneipe.
(8)
Sitzen zwei Kühe auf einem Baum.
Schaller (2014: 8f.) stellt bei der Betrachtung des Gebrauchs von V1-Deklarativsätzen aus sprachhistorischer Sicht fest, dass sie aus althochdeutschen Erzählungen und Textanfängen von frühneuhochdeutschen Gedichten und Volksliedern1 stammen. So tauchen sie bspw. am Anfang von Goethes Heideröslein (9) oder im Kinderlied Kommt ein Vogel geflogen (10) auf.
(9)
Sah ein Knab’ein Röslein stehen (Goethe in Trunz 1981: 78)
(10)
Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein’ Schoß
hat ein Zettel im Schnabel, von der Mutter ein’ Gruß.
In zeitgenössischer Lyrik ist der V1-Deklarativsatz im Neuhochdeutschen jedoch seltener geworden, weshalb es so scheint, dass er „in der geschriebenen Sprache beinahe ausschließlich […] auf bestimmte Textsorten beschränkt“ (Schaller 2014: 54) ist. Es ist aber zu hinterfragen, ob nicht eher von einer Gebrauchspräferenz als von einer Gebrauchsbeschränkung gesprochen werden sollte. „Gebrauchsbeschränkung“ impliziert, dass Satztypen ausschließlich in bestimmten Textsorten verwendet werden dürfen. Der Begriff „Gebrauchspräferenz“ drückt hingegen aus, dass ein Satztyp auch in anderen Texten verwendbar sein kann, empirisch jedoch nachweislich in bestimmten Textsorten frequenter bzw. am frequentesten vorkommt. V1-Deklarativsätze ohne Vorfeldbesetzung eignen sich bspw. aktuell nämlich immer noch für Kinderlieder und Reime, allerdings scheint ihr Gebrauch in Witzen häufiger bzw. präferierter. Dies zeigt sich bspw. darin, dass der Satztyp weiterhin als prominentes Beispiel für ein textstrukturierendes Element am Anfang von Witzen genannt wird, das den Rahmen für die abschließende Pointe schafft. So scheint die Annahme berechtigt, dass der V1-Deklarativsatz eine präferierte Verwendung hinsichtlich einer Textposition (initial) in einer bestimmten Textsorte (Witz) aufweist. Nur ist zu fragen, wodurch diese Präferenz zustande kommt und ob die Textsorte Witz den Gebrauch des Satztyps bedingt oder umgekehrt.
(11)
Warum ich denn kein Autogramm von Lukas Podolski mitgebracht habe, mischt sich unsere Tochter ein. Die hat es nötig, denke ich. Wo sie doch sonst jeden oberpeinlich-uncool findet, der nur das Wort Fußball in den Mund nimmt. (brz06/jul.01343 Braunschweiger Zeitung, 04.07.2006)2
Bezüglich des Gebrauchs von Satztypen in Texten fallen auch wo-VL-Sätze mit doch-Modalpartikel (11) auf. Nach Müller (vgl. 2018: 413) tauchen solche wo-doch-Sätze insbesondere frequent in Texten des Feuilleton-Bereichs auf, in denen der Ich-Erzähler eine Beschwerde äußert, so bspw. in Kolumnen. Für sie lässt dies die Annahme zu, dass wo-doch-VL-Sätze (11) eine höhere Verträglichkeit mit Texten mit „lockerem Kontext“ (Müller 2018: 413) aufweisen. Offen bleibt nur, was mit einem solchen Kontext genau gemeint ist. Ist hiermit die Textsorte gemeint, das Genre, das Thema, die Sprachstilistik oder ein Mix aus allen? Es ist zwar anzunehmen, dass bestimmte textinterne Eigenschaften zum präferierten Gebrauch des Satztyps beitragen, aber welche könnten hierzu gezählt werden und sind sie für bestimmte Textsorten charakteristisch?
Sowohl V1-Deklarativsätze als auch wo-doch-VL-Sätze scheinen Beispiele dafür zu sein, dass Gebrauchspräferenzen für Satztypen in bestimmten Texten vorliegen können. Dies legt die Annahme nahe, dass spezifische Formausprägungen von Sätzen für bestimmte Textsorten und Textpositionen geeigneter scheinen als andere.
Nun kann auch aus textlinguistischer Sicht die Frage gestellt werden, ob ähnliche Beobachtungen in Texten hinsichtlich der Verwendung bestimmter Satztypen zu finden sind und welchen Stellenwert sie bei der Konstituierung von Textsorten einnehmen. Simmler (vgl. 1996: 612) merkt bspw. an, dass Makrostrukturen – textinterne, satzübergreifende Einheiten von Texten – zusammen mit hierarchisch kleineren Einheiten wie Satztypen Textsorten konstituieren können. Welches Satztypen-Verständnis er hierbei jedoch vertritt, bleibt offen. Zudem fehlt bei ihm eine Auseinandersetzung damit, welche Prozesse zwischen Satztypen und Makrostrukturen bei der Bildung von Textsorten eine Rolle spielen. Satztypen können ihm zufolge jedoch als eine textinterne Eigenschaft interpretiert werden, die dazu beiträgt, eine Textsorte zu bestimmen.
Die Annahme, dass der präferierte Gebrauch bestimmter Satztypen als Eigenschaft von Textsorten angesehen werden kann, wird aber nicht nur durch Beobachtungen wie den V1-Deklarativsatz in Witzanfängen gestützt, sondern auch durch Beobachtungen zur historischen Wandelbarkeit des Satztypengebrauchs. So zeigt Donalies (2012) im Zuge der Betrachtung von Verbformen in Kochrezepten, dass sich die Verwendung der Verbformen historisch zusammen mit der Textsorte gewandelt hat. Mitte des 14. Jahrhunderts ist der Gebrauch von Imperativsätzen (12) typisch für Kochrezepte. In zeitgenössischen Rezepten finden sich allerdings nun u.a. auch Anweisungssätze mit dem Verbmodus Indikativ (13) oder Konjunktiv (14). Hieran ist zu sehen, dass der charakteristische V1-Imperativsatz früher eine Eigenschaft mit hoher Gewichtung zur Bestimmung der Textsorte Rezept oder Anweisungstext war, wohingegen er aus aktueller Sicht diese Gewichtung verloren hat. Zudem weist diese Beobachtung darauf hin, dass sich gewisse Konventionen in der Produktion und Rezeption von Kochrezepten geändert haben, die Einfluss auf die Verwendung von Satztypen haben.
(12)
Nimm den Kuchen aus dem Ofen und bestäube ihn mit Puderzucker
(13)
Du nimmst den Kuchen aus dem Ofen und bestäubst ihn mit Puderzucker
(14)
Man nehme den Kuchen aus dem Ofen und bestäube ihn mit Puderzucker
Zusammenfassend zeigen sich beim Blick auf die aktuelle Forschungsliteratur Hinweise darauf, dass bestimmte Satztypen gezielt in Textsorten verwendet werden und als textinterne Eigenschaft hinweisend für die Sorte eines Textes sein können. Der V1-Deklarativsatz kann in der initialen Position eines Textes auf die Textsorte Witz hindeuten oder wird in Gedichten oder Liedern verwendet, und wo-doch-VL-Sätze werden präferiert in kommentierenden journalistischen Texten verwendet. Der Gebrauch bestimmter Satztypen in Textsorten scheint von Konventionen geprägt zu sein und ist historisch wandelbar, wie die rückläufige Verwendung von V1-Imperativsätzen in Kochrezepten beispielhaft verdeutlicht. Die aktuelle Literatur bietet aber keine ausreichende Beleuchtung des textsortenspezifischen Satztypengebrauchs, so dass eine tiefergehende Auseinandersetzung mit diesem Phänomen fehlt. Bei der Thematisierung des Bezugs zwischen Textsorte und Satztyp fallen allerdings zwei Aspekte auf: Die gezielte Verwendung von Satztypen in bestimmten Textsorten und ihre Positionierung bzw. Einbettung im Text. Gerade der letzte Aspekt spielt für die WÜ eine besondere Rolle, da ihre Positionierung in der Überschrift ein konstitutives Merkmal ist. Die obligatorische Beziehung der WÜ zu ihrem Bezugstext und dessen Textsorte kann also ein Schlüssel zur Erschließung dieses Satztyps sein. Bevor der Forschungsstand zur WÜ allerdings genauer beleuchtet wird, wird noch ein Blick auf die derzeitige Forschungslage zu Presse-Überschriften und ihrer Textsortenzugehörigkeit geworfen.
2.2Überschriften und ihre Textsortenzugehörigkeit im Journalismus
Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, wie der aktuelle Forschungsstand zur Funktion von Überschriften in der Institution Presse hinsichtlich möglicher Textsortenrestriktionen aussieht. Aus dem Blickwinkel der Journalistik betrachtet, liegt eine enge Beziehung zwischen der Form der Überschrift und spezifischen Textsorten vor. Wolff (2017) merkt hierzu Folgendes an:
Überschriften sind ein spezifischer Teil der Darstellungsform, und sie erfüllen für ihre Darstellungsform eine bestimmte Aufgabe. Diese Aufgabe ist das attraktive Verpacken oder Verkaufen des Artikels, wobei die angestrebte Attraktivität ganz erheblich von der Darstellungsform und ihrer Funktion für die Leser abhängt (Wolff 2017: 260).
Die Textsorte (Darstellungsform) und ihre Funktion haben dieser Aussage zufolge einen Einfluss darauf, welche Überschrift (Verpackung) für einen jeweiligen Artikel gewählt wird. In der Presse gibt es also für bestimmte Texte spezifische Überschriften-Formen. Nun stellt sich die Frage, ob auch Satztypen zu den hier genannten Überschriften-Formen zählen. Falls ja, könnten Satztypen in Überschriften dazu verwendet werden, um anzuzeigen, welche Textfunktion der Bezugstext besitzt und zu welcher Textsorte er gehört.
Auf eine textsortenanzeigende Funktion wird in der Literatur allerdings nicht explizit eingegangen. Vielmehr wird darauf verwiesen, welche Funktionen der Überschrift mit welchen Textsorten kompatibel sind. Ein häufig genanntes Beispiel ist die primär wirkende Informationsfunktion von Überschriften des Typs Meldung in Tageszeitungen, die u.a. den Telegrammstil verwenden (vgl. Wolff 2017: 264) und mit der Informationsvermittlungsfunktion von der Textsorte einhergeht. Weiterhin wird den Überschriften von Berichten in Magazinen verstärkt eine Leseanreizfunktion zugeschrieben (vgl. Wolff 2017: 260f.). Fragen hingegen werden in Zeitungsredaktionen oftmals als unzulässig betrachtet (vgl. Wolff 2017: 267), da sie in der Regel keine Informationsfunktion besitzen würden. Dennoch finden sie in der Praxis immer wieder Anwendung in Überschriften. Solche groben Zuordnungen sind allerdings für eine systematische Betrachtung wenig gehaltvoll. Eine Ausnahme stellt allerdings Finkbeiner (2021a) dar. Sie betrachtet Presseüberschriften aus einer sprechakttheoretischen Sicht und geht von einer Überschriften-Illokution aus, die metasprachlicher Natur ist und mit der etwas über den Bezugstext ausgesagt wird. Von der Annahme ausgehend, dass die Überschrift etwas über ihren Bezugstext aussagt, ist es plausibel, dass auch indirekt etwas über die Funktion des Bezugstextes ausgesagt wird, was Rückschlüsse auf die verwendete Textsorte ermöglicht.
Bei einer näheren Betrachtung von Interrogativsätzen in Überschriften und ihren zugehörigen Textsorten fallen in jüngster Zeit insbesondere im Bereich der Computerlinguistik Untersuchungen zum Thema Clickbait auf. Clickbait bezeichnet hier einen spezifischen Schreibstil in Überschriften aus dem Online-Bereich, der die TR dazu verleitet, den Artikel zu öffnen und zu lesen, unabhängig davon, ob der Textinhalt die Erwartungen der TR erfüllt oder nicht1 (s. Kuiken et al. 2017: 1311; Burgess/Hurcombe 2019: 363; Scott 2021). Anhand einer korpusgestützten Betrachtung zu redaktionellen Überarbeitungen von Clickbait-Titeln zum Zweck einer Generierung höherer Leserzahlen konnten Kuiken et al. (2017) bestätigen, dass u.a. der Gebrauch von Interrogativsätzen in Überschriften zu einem wesentlichen Merkmal von Clickbait-Titeln zählt. Sie kommen zu der Annahme, dass sowohl Thema als auch Genre des Textes einen Einfluss darauf haben könnten, was für eine Überschrift von TP eingesetzt wird (vgl. Kuiken et al. 2017: 1312). Dieses Beispiel zeigt, dass empirische Beobachtungen die Annahme stützen, dass eine Korrelation zwischen Interrogativsätzen in Überschriften und der Art ihrer Bezugstexte besteht. Ob diese Korrelation auch kausal zu begründen ist, so dass Interrogativsätze aufgrund spezifischer Merkmale in Überschriften bestimmter Textsorten verwendet werden, bleibt allerdings offen.
Weiterhin zeigen Blom/Hansen (2015) auf, dass es eine Beziehung zwischen der Überschrift und ihrem Bezugstext gibt, die durch kataphorische Referenzen zustande kommt. Diese Referenzen werden in der Regel mithilfe von Pronomen wie bspw. Interrogativpronomen in Überschriften realisiert. Mit ihnen wird die Aufmerksamkeit der TR gesteigert, da ein Verweis vorliegt, der erst im Bezugstext aufgelöst wird. Durch sie entsteht eine Wissenslücke – die „curiosity inducing information gap“ (Blom/Hansen 2015: 88). Sie trägt dazu bei, dass TR den zugehörigen Artikel lesen wollen, um die eröffnete Lücke mithilfe des vermittelten Wissens aus dem Bezugstext zu schließen. Das bedeutet, dass w-Interrogativsätze in Überschriften, einschließlich der WÜ, die Aufmerksamkeit des TR steigern und aufgrund des w-Ausdrucks eine kataphorische Referenz auf den Bezugstext besitzen, bei der das Referierte offen bleibt. Es ist also möglich, dass WÜ aufgrund der oben beschriebenen Funktion des w-Ausdrucks ähnliche textsortenspezifische Gebrauchspräferenzen besitzen wie bspw. w-Fragen in der Überschrift.
Zusammenfassend zeigt sich hinsichtlich eines Bezugs zwischen Überschriften und Pressetexten ein heterogenes Bild, das aus unterschiedlichen Forschungsdisziplinen betrachtet werden kann. Es finden sich aber disziplinübergreifend theoretische und empirische Hinweise darauf, dass Überschriften etwas über ihren Text aussagen und es eine Korrelation zwischen Interrogativsätzen in Überschriften und der Art ihrer Bezugstexte gibt, die mit formalen Merkmalen wie Interrogativpronomen als kataphorische Referenzen auf Textinhalte begründbar sein können. Welche konkreten Beziehungen spezifisch bei Satztypen in Überschriften und der Textebene bestehen, wird in der bisherigen Forschung aber nicht eingehend thematisiert.
2.3Der Forschungsstand zur W-Überschrift
Bisher wurden Berührungspunkte zwischen Satztypen und der Textebene aufgezeigt, die in der Forschungsliteratur thematisiert werden. Die WÜ wie in (15) als spezieller Satztyp, der nur in der Position der Überschrift verwendet wird, wurde dabei ausgeklammert. Ihrem Forschungsstand wird sich spezifisch in diesem Kapitel gewidmet.
(15)
Was über den Terrorangriff von Christchurch bekannt ist (zeit.de, 15.03.2019)
Finkbeiner (2018) nahm in jüngster Zeit eine detaillierte Betrachtung dieses Satztyps vor, der schon früh von Weuster (1983) als W-Wort Satz in Buchtiteln und Schlagzeilen von Zeitungen erkannt worden war. Auch in weiteren Forschungsarbeiten zu Satztypen (u.a. Altmann, 1987; Oppenrieder, 1987; 1989; d’Avis, 2001) findet sich die WÜ unter verschiedenen terminologischen Bezeichnungen wieder: Schlagzeile mit einleitendem w-Element (Altmann 1987), w-Satz als Überschrift (Pafel 2016) oder w-Schlagzeile (Oppenrieder 1987; 1989; d’Avis 2001). Die Bezeichnung w-Schlagzeile impliziert, dass sich der Satztyp ausschließlich auf Artikel-Überschriften in Pressetexten beschränkt. Wie aber bereits Weuster (1983) feststellt, ist dieser Typ eines selbständigen w-VL-Satzes bspw. auch in Buchtiteln zu finden, und wie Finkbeiner (2018) ergänzt, auch in Filmtiteln oder Kapitelüberschriften.1 Daher prägte Finkbeiner (2018) den Begriff der W-Überschrift, um den Gebrauch dieses Satztyps in titelgebenden Positionen zusammenfassend zu beschreiben. Die vorliegende Arbeit schließt sich diesem Terminus an, so wie bereits zuvor geschehen.
Das Ziel der folgenden Unterkapitel ist eine zusammenfassende Reflexion des Forschungsstands zur WÜ. Der erste Abschnitt beleuchtet die Anfänge und schaut darauf, wie die WÜ bis in die Mitte der 2010er Jahre in der Satztypen-Forschung behandelt wurde (Kapitel 2.3.1). Anschließend werden aktuelle Forschungsarbeiten thematisiert, die rund um Finkbeiner (2018) zum Gegenstand der WÜ entstanden sind und das aktuelle Verständnis der WÜ prägen (Kapitel 2.3.2).
2.3.1Die W-Überschrift als Randerscheinung (1983–2017)
Die zentrale Herausforderung bei der WÜ besteht in der Bestimmung ihrer kommunikativen Funktion im Kontext der Überschriften-Position bzw. Textebene. Weuster (1983) greift das Phänomen der WÜ näher im Zuge ihrer Untersuchung von nicht eingebetteten Satztypen mit Verb-Endstellung auf. Sie argumentiert dafür, dass es sich bei VL-Sätzen mit finitem Verb um selbständige Sätze handelt, für deren Selbständigkeit es syntaktische, semantische und pragmatische Indizien gibt. Sie benennt die Eigenschaften, dass die Proposition der WÜ nicht spezifiziert ist und das w-Wort auf den fehlenden Teil der Proposition hinweist, ähnlich wie bei Ergänzungsfragesätzen, bei denen das w-Wort in verweisender Funktion mit unterschiedlichen Illokutionen der Äußerung korrespondiert (vgl. Weuster 1983: 28). Nach Weuster (vgl. 1983: 53f.) verweist die WÜ darauf, dass ein Teil der Proposition in einem bestimmten Zusammenhang erläutert wird. Da WÜ in Überschriften vorkommen, nimmt sie an, dass der Sprecher bzw. der TP etwas „glaubt oder glauben machen will“ (Weuster 1983: 54). Das, was der TP glauben machen will, spiegelt sich in den verwendeten w-Ausdrücken wider. So will der TP bspw. mit warum glauben machen, dass es Gründe für die Wahrheit des Präsupponierten gibt, oder mit was, dass es etwas gibt, das in dem genannten Zusammenhang der Äußerung von Bedeutung ist. Zusammenfassend ausgedrückt: Mit der WÜ drückt der TP aus, dass der indizierte Inhalt aus dem w-Wort „für den Hörer von Interesse ist und ihm mitgeteilt werden soll“ (Weuster 1983: 54). An diesen Ausführungen wird deutlich, dass die Beziehung der w-Ausdrücke zum Bezugstext für das pragmatische Verständnis der Äußerung entscheidend ist. Die Überschrift weckt beim TR ein situatives Interesse an der Wissensvermittlung und erzeugt spezifische Erwartungen an den Bezugstext. Diese Annahmen werden bei Weuster (1983) zwar nicht weiter beleuchtet, deuten aber darauf hin, dass die w-Ausdrücke auf Inhalte und die Funktion des Bezugstexts verweisen.
Weuster (vgl. 1983: 53f.) äußert sich hinsichtlich des Funktionstyps einer WÜ wie in (15), dass dieser nur mit einem Matrixsatz (16) paraphrasierbar ist, der sich aus dem Kontext ergeben müsste. Allerdings bietet die WÜ aufgrund ihrer Überschriften-Position keinen sprachlich realisierten Kontext, aus dem ein Matrixsatz erschlossen werden kann.
(16)
Hier erfahren Sie, was über den Terrorangriff von Christchurch bekannt ist.
Auch Altmann (vgl. 1987: 28) benennt für die WÜ genau diese Problematik eines fehlenden Kontextes, der zur Erschließung des Funktionstyps beitragen könnte. Als mögliche Funktionstypen gibt er sinngemäße Rekonstruktionen der WÜ (15) als Aussagesatz (17), Imperativsatz (18) oder Fragesatz (19) an, auch wenn er anmerkt, dass „man keine klaren Intuitionen über den Funktionstyp des isolierten Verb-Letzt-Satzes hat“ (Altmann 1987: 28).
(17)
Wir sagen Ihnen, was über den Terrorangriff von Christchurch bekannt ist.
(18)
Lesen Sie hier, was über den Terrorangriff von Christchurch bekannt ist.
(19)
Möchten Sie wissen, was über den Terrorangriff von Christchurch bekannt ist?
Die Ambiguität hinsichtlich des Funktionstyps ergibt sich also aus den fehlenden Informationen des Kontextes. Da die WÜ in einer Überschriften-Position steht, fehlen entsprechende kontextuelle Ankerpunkte, mithilfe derer eine Paraphrasierung des Funktionstyps konstruierbar wäre. Lediglich kommunikationsbezogene und situative Kontextmerkmale können verwendet werden, um sich der pragmatischen Funktion der WÜ anzunähern.
Eine eindeutige Erklärung hinsichtlich des Funktionstyps findet auch Luuko-Vinchenzo (vgl. 1988: 117f.) nicht. Sie vertritt die Ansicht, dass in der WÜ ein Direktiv vorliegt, unter dem eine Aufforderung an den TR zum Handeln zu verstehen ist, z.B. das Lesen des Artikels oder das Kaufen des Produkts (Tageszeitung, Magazin, etc.). Jedoch schreibt sie den WÜ neben einem direktiven Illokutionspotenzial auch ein assertives Illokutionspotenzial zu, da sich die WÜ (15) sowohl in einem Matrixsatz sowohl als Assertiv (17) als auch Direktiv (18) paraphrasieren lässt.
Oppenrieder (vgl. 1989: 215f.) beschreibt diese Ambiguität zwischen Direktiv und Assertiv als „spezialisierte assertive Funktion“ (Oppenrieder 1989: 215) der WÜ, bei der eine Information angekündigt wird. Die angekündigte Information wird durch die w-Ausdrücke angezeigt, ähnlich wie es bei Weuster (1983) ausgeführt ist. Als passende Funktionstypexplizierung einer WÜ (15) nennt er Formulierungen wie hier erfahren Sie (20) oder sehen/lesen Sie (21) als imperativische Variante. Er erläutert jedoch nicht, wie diese funktionsanzeigende Paraphrasen entstehen und bezeichnet sie lediglich als vom „Sinn her passende Paraphrasen“ (Oppenrieder 1989: 215). Auch hier lassen sich die Funktionstypexplizierungen nicht aus dem Kontext rekonstruieren.
(20)
Hier erfahren Sie, was über den Terrorangriff von Christchurch bekannt ist
(21)
Sehen/Lesen Sie, was über den Terrorangriff von Christchurch bekannt ist
Pafel (vgl. 2016: 412) betrachtet die WÜ aus der Sicht von intentionalen Modi. Nach ihm ist die WÜ genau wie bei Oppenrieder (1989) als eine Ankündigung zu verstehen, bei der ein intentionaler Deklarativ vorliegt, bei dem die kommunikative Intention des Sprechers (S) es ist, dem Adressaten (A) etwas mitzuteilen. Der intentionale Deklarativmodus ist nach Pafel (2016: 409) auf folgende Weise zu beschreiben: „S intendiert (indem S X tut), A mitzuteilen, ___“. Im Fall der WÜ (15) ergibt sich entsprechend die folgende Beschreibung des intentionalen Modus:
(22)
S intendiert, A mitzuteilen, was über den Terrorangriff von Christchurch bekannt ist
Einen solchen deklarativen Modus sieht er auch bei V1-Entscheidungsinterrogativen (23) vorliegen, die ebenfalls in Überschriften oder auch eingebettet in monologischen Reden auftreten können.
(23)
Ist die Finanzkrise jetzt beendet? (aus Pafel 2016: 412)
Die Beispiele verdeutlichen, dass die kontextuelle Verwendung einer Äußerung – z.B. in der Überschrift oder im Monolog – Einfluss auf die Intention des Sprechers bzw. TP hat. Was Pafel (2016) jedoch unbeantwortet lässt, ist die Frage danach, ob eine Äußerung in der Überschriften-Position nicht stets einen intentionalen Deklarativmodus erfordert. Schließlich sollte es bei Äußerungen in der Überschrift immer die Intention des TP sein, dem TR etwas über den Inhalt oder das Thema des Bezugstextes (direkt oder indirekt) mitzuteilen.
An der bisher gezeigten Literatur ist zu sehen, dass der Fokus bei der Erschließung der WÜ stets darin liegt, ihren Funktionstyp auf adäquate Weise zu explizieren. Dies scheitert allerdings daran, dass ein passender sprachlicher Kontext für die Rekonstruktion eines Matrixsatzes fehlt. Der situative Kontext der WÜ legt nahe, dass aufgrund der Position in der Überschrift bestimmte Intentionen beim TP vorliegen. Allerdings bleibt hierdurch die pragmatische Funktion der WÜ ambig. Es kann entsprechend keine adäquate Erfassung der Illokution bzw. des illokutiven Potenzials erfolgen. Was z.B. in bisherigen Ausführungen fehlt, ist eine weitaus systematischere und intensivere Auseinandersetzung mit den Besonderheiten der WÜ, die sich aus ihrer Positionierung und Beziehung zur Textebene ergeben. Spezifische Merkmale wie die Bezüge der w-Ausdrücke auf Inhalte im Bezugstext oder die Intention des TP, den TR zum Lesen des Bezugstextes zu bewegen, werden zwar genannt, aber nicht weiter vertieft. Diese Aspekte im WÜ-Diskurs erkennt auch Finkbeiner (vgl. 2018: 24f.) und stellt fest, dass die Auseinandersetzung mit der WÜ zu stark von der Seite der syntaktischen Ebene stattfindet. Deshalb erweitert sie den Blick auf den Satztyp um die Textebene und eröffnet neue Beschreibungsmöglichkeiten.
2.3.2Die W-Überschrift nach Finkbeiner (ab 2018)
In den bisher angesprochenen Arbeiten wird die WÜ lediglich als Randerscheinung behandelt und meist im Zusammenhang mit Satztypklassen wie selbständigen VL-Sätzen (Weuster 1983) erwähnt. Über einen langen Zeitraum fehlten detaillierte Untersuchungen, die sich speziell mit dem Phänomen der WÜ beschäftigten. Erst Finkbeiner (2018) widmet sich gezielt diesem Thema und legt dabei zahlreiche Grundlagen, die in weiteren Arbeiten von ihr (Finkbeiner 2020) sowie gemeinsam mit Külpmann (Finkbeiner/Külpmann 2022), Külpmann/Stawecki (Finkbeiner et al. 2021) und Fetzer (Finkbeiner/Fetzer 2022) vertieft werden. Im Folgenden werden die zentralen Erkenntnisse, die aus diesen Arbeiten stammen, zusammengefasst und in einzelnen Unterkapiteln erläutert.
2.3.2.1Syntaktische Selbständigkeit
Finkbeiner (2018) und Finkbeiner et al. (vgl. 2021: 132) schließen aus, dass es sich bei der WÜ um eine Ellipse handelt und argumentieren für eine syntaktische Selbständigkeit dieses Satztyps. Wie bisher erwähnt, lässt eine WÜ (24a) es zwar grundsätzlich zu, dass sie in einen Hauptsatz (24b) eingebettet werden kann, doch kann eine solche Rekonstruktion nur dem Sinn nach vorgenommen werden. Der Grund dafür ist das Fehlen eines Vorkontextes der Überschriften-Position, der dies rechtfertigen würde. Ein solch lose konstruierter Matrixsatz (24b) dient eher der Beschreibung einer funktionalen Prägung, weist aber nicht automatisch auf das Vorliegen einer Tilgung hin, denn eine derartige Rekonstruktion ist auch für weitere syntaktisch selbständige VL-Satztypen (25–26) möglich.
(24)
a.
Warum erwachsene Männer ihren Arbeitsplatz wie eine Kirmesbude dekorieren (sueddeutsche.de, 14.06.2019)
b.
Dieser Text sagt, warum erwachsene Männer ihren Arbeitsplatz wie eine Kirmesbude dekorieren.
(25)
a.
Ob ich das wohl sagen darf?
b.
Ich frage mich, ob ich das wohl sagen darf.
(26)
a.
Was DER nicht alles weiß!
b.
Es ist unfassbar, was DER nicht alles weiß.
Für den Ellipsenstatus der WÜ ist also nur haltbar zu argumentieren, falls sich ein Matrixsatz aus einem schriftlich realisierten Vorkontext rekonstruieren lässt. Wie Finkbeiner et al. (vgl. 2021: 133) zeigen, ist zwar in seltenen Fällen eine solche Rekonstruktion anhand von Spitzmarken1 – direkt vorgeschaltete Begleitelemente in der Überschriftenzeile – möglich, allerdings entstehen hierdurch bei den WÜ (27a, 28a) Bedeutungsunterschiede in den Matrixsätzen (27b, 28b).
(27)
a.
Gesetze und Urteile: Was im Kleingarten erlaubt ist (focus.de, 17.04.2019)
b.
Gesetze und Urteile (darüber), was im Kleingarten erlaubt ist
(28)
a.
Sportpsychologe erklärt: Was der HSV von Jürgen Klopp lernen kann (focus.de, 10.05.2019)
b.
Sportpsychologe erklärt, was der HSV von Jürgen Klopp lernen kann
Die Spitzmarken Gesetze und Urteile (27a) sowie Sportpsychologe erklärt (28a) stellen eine semantische Beziehung zum w-VL-Satz her, indem sie ihn inhaltlich einordnen und einen diskursiven Rahmen schaffen. Das kommunikative Gewicht liegt hier jeweils auf dem w-VL-Satz. Anders ist dies in den Rekonstruktionen (27b, 28b). Bei diesen liegt das kommunikative Gewicht jeweils auf dem Matrixsatz. Für das Vorliegen einer unterschiedlichen Gewichtung bei den WÜ und den rekonstruierten Matrixsätzen kann mithilfe eines Fortsetzungstests (vgl. Finkbeiner et al. 2021: 133) argumentiert werden, bei dem Sätze ohne ein kommunikatives Hauptgewicht (29a, 30a) schlechter fortführbar sind als solche Sätze mit einem kommunikativen Hauptgewicht (29b, 30b).
(29)
a.
Gesetze und Urteile: Was im Kleingarten erlaubt ist. ??Über die will ich mehr erfahren
b.
Gesetze und Urteile darüber, was im Kleingarten erlaubt ist. Über die will ich mehr erfahren
(30)
a.
Sportpsychologe erklärt: Was der HSV von Jürgen Klopp lernen kann. ??Das macht er gut.
b.
Sportpsychologe erklärt, was der HSV von Jürgen Klopp lernen kann. Das macht er gut.
Die Beispiele verdeutlichen, dass eine Rekonstruktion der WÜ zusammen mit der Spitzmarke als Matrixsatz nicht ohne Bedeutungsunterschied möglich ist. Es liegt bei der WÜ also kein sprachlich realisierter Antezedent vor. Finkbeiner (2018) und Finkbeiner et al. (2021) schließen daher für die WÜ den Fall einer A-Ellipse (antecedent-based ellipsis) (Reich 2011) aus. Sowohl Finkbeiner (vgl. 2018: 26) als auch Finkbeiner et al. (vgl. 2021: 137) weisen allerdings darauf hin, dass bei der WÜ eine S-Ellipse (Situationsellipse) (Reich 2011) vorliegen kann, die erst durch ihren außersprachlichen Kontext zu interpretieren und zu verstehen ist. Im Falle der WÜ würde der Bezugstext die notwendigen kontextuellen Informationen für das Glücken der WÜ-Verwendung liefern. Die Möglichkeit einer S-Ellipse spricht jedoch nicht automatisch gegen eine syntaktische Selbständigkeit. Vielmehr verdeutlicht dies, dass der Bezugstext für das Verständnis der WÜ entscheidend ist.
2.3.2.2Gebrauchsbeschränkung auf Überschriften
Finkbeiner (vgl. 2018: 27) argumentiert dafür, dass WÜ als selbständige Äußerungen lizenziert sind, da sie Bestandteil einer Überschrift-Text-Konfiguration sind, in der sie die Position der Überschrift besetzen. Finkbeiner et al. (2021) belegen dies durch eine Korpusuntersuchung, die die These prüft, dass sich keine Evidenzen für WÜ außerhalb der Überschriften-Position nachweisen lassen. Die Datengrundlage der Untersuchung besteht aus Sprachdaten des DWDS-Kernkorpus 21, das Texte aus Belletristik, Gebrauchsliteratur, Wissenschaft und Presse der Jahre 2000 bis 2010 umfasst. Durch die Auswertung von rund 874.113 Sätzen aus 12.184 Dokumenten sind 457 selbständig auftretende w-VL-Sätze ermittelbar (vgl. Finkbeiner et al. 2021: 139f.). Die Treffer2 umfassen neben etablierten selbständigen w-VL-Sätzen, wie bspw. w-Exklamativsätze (31) und deliberative Fragen (32), auch solche w-VL-Sätze, bei denen es sich um textstilistische Phänomene, wie feste Wendungen (33), Zitateinleiter (34) oder verdeckte Einbettungen (35–40) handelt. Verdeckte Einbettungen bezeichnen w-VL-Sätze, die hinsichtlich Graphematik und Interpunktion als desintegriert erscheinen, da sie entgegen der orthographischen Norm keine Kommas, sondern Punkte und Doppelpunkte verwenden, aber dennoch als unselbständig einzustufen sind. Zu diesen gehören u.a. weiterführende Relativsätze (35), freie Relativsätze (36), attributive Relativsätze (37), Pseudocleft-Sätze (38), Konzessivsätze (39) und wo-doch-Sätze (40) (vgl. Finkbeiner et al. 2021: 140ff.).
(31)
Was das wieder dauerte! (Dölling, Hör auf zu trommeln, S. 57)
(32)
Was sie wohl angekreuzt hat? (Bach, Marsmädchen, S. 88)
(33)
Wie Sie wollen. (Kopetzky, Grand Tour, S. 171)
(34)
Wie mein Skilehrer immer sagte: (Nach dem Kopf ist der Stiefel das Wichtigste) (Die Zeit, 03.02.2000)
(35)
(Lieber stiftete sie mich an Karamellen oder Kirschen zu stehlen.) Was wir zu bereuen hatten. (Koneffke, Paul Schatz im Uhrenkasten, S. 56)
(36)
(Er hat ja gesagt, klar, du lernst Englisch, dann studierst du.) Was du willst. (Krausser, Eros, S. 91)
(37)
(Sie sagten all das, was du niemals sagen kannst.) Was keiner hören will. (Hahn, Unscharfe Bilder, S. 142)
(38)
Was ihn von vielen anderen Schlaubergern unterscheidet: (Krause tut was.) (Die Zeit, 06.04.2000)
(39)
Was aber auch immer die Motive für diese Bezeichnungen sind: (Der Name für den Felsen kam zuerst […]) (Krämer/Sauer, Lexikon der populären Sprachirrtümer, S. 172)
(40)
(Aber du!) Wo du doch selbst nordskogisches Blut in deinen Adern hast! (Boie, Skogland, S. 213)
Die Korpusstudie liefert keine Belege für eine selbständige Verwendung von WÜ außerhalb der Überschriften-Position. Sie bekräftigt somit die These, dass dieser Satztyp auch nur in dieser Position gebraucht wird. Um aber den Fragen nachzugehen, ob WÜ dennoch ein Potenzial bergen, außerhalb der Überschrift eingesetzt zu werden, und ob Sprecher des Deutschen eine solche Verwendung als akzeptabel erachten, schließen Finkbeiner et al. (2021) der Korpusuntersuchung eine Fragebogenstudie an. Mit dieser soll die Hypothese geprüft werden, dass WÜ in textmedialer Stellung eine geringere Akzeptabilität gegenüber WÜ in textinitialer Stellung besitzen, wo eher eine Überschriften-Lesart möglich ist. Für die Studie bewerteten 39 Studenten an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Testitems mit w-VL-Sätzen (WÜ) und w-V2-Sätzen (w-Fragen) in textinitialer und textmedialer Stellung. Die Testitems bestehen aus verkürzten Online-Artikeln des Online-Magazins Bento ohne typografische Auszeichnungen und ohne Satzendzeichen, da typografisch nicht erkennbar sein soll, ob die Äußerung zu einer Überschrift oder zum Fließtext zählt. Beispiel (41) zeigt ein solches Testitem, bei dem der zu bewertende Satz unterstrichen ist (vgl. Finkbeiner et al. 2021: 143ff.):
(41)
w-VL-Satz in textmedialer Position
Wir Millennials gelten oft als eine Generation, die etwas ganz anderes vom Leben will als ihre Eltern – die sich mehr um die richtige Work-Life-Balance kümmert, statt auf ein Eigenheim zu sparen | Für mehr Sinn im Job stecken wir bei der Bezahlung gerne zurück | Warum es Millennials schlechter geht als ihren Eltern | Blöd nur: Während unsere Eltern sich noch ein Haus im Grünen leisten konnten, können wir jetzt froh sein, wenn wir unsere winzige Stadtwohnung bezahlen können | Obwohl wir oft besser ausgebildet sind, verdienen wir nicht mehr und gleichzeitig steigen unsere Ausgaben | So wird der Traum vom sozialen Aufstieg für unsere Generation zunehmend ungreifbarer.
Die Fragebogenstudie kommt zu dem Ergebnis, dass eine textinitiale Stellung der WÜ eher bevorzugt und akzeptiert wird als eine textmediale Stellung, da eine textinitiale Positionierung des Satztyps im Text eher eine Überschriften-Lesart zulässt.
Zusammenfassend liefert die Korpusstudie Evidenzen dafür, dass Sprecher bzw. TP die WÜ nicht außerhalb der Überschrift verwenden, und die Fragebogenstudie verdeutlicht, dass Hörer bzw. TR eine höhere Akzeptanz für die WÜ in textinitialer als in textmedialer Stellung haben, da die initiale Stellung eher eine Überschriften-Lesart erlaubt. Die Ergebnisse beider Studien legen nahe, dass bei WÜ tatsächlich eine Gebrauchsbeschränkung auf das Überschriften-Format vorliegt und dass die Überschriften-Position das entscheidende Merkmal für die Lizenzierung ihrer Selbständigkeit ist.





























