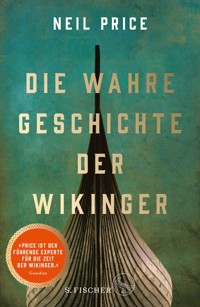
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit zahlreichen Karten, Illustrationen und farbigen Abbildungen gibt der weltweit renommierte Experte Neil Price einen verblüffenden Einblick in die Welt der Wikinger: Waren sie wirklich die brandschatzenden Seefahrer und gewaltsamen Eroberer aus den Legenden? »Die wahre Geschichte der Wikinger« stellt die gängigen Vorurteile auf den Prüfstand und zeigt uns die echten Menschen hinter dem Mythos. Basierend auf neuesten archäologischen Funden, zahllosen Textquellen und nicht zuletzt der nordischen Mythologie selbst zeigt Neil Price uns die Wikinger erstmals so, wie sie selbst sich sahen. Fundiert und überraschend lebendig schildert er ihr Alltagsleben und ihre reiche Kultur: Wie übten sie ihre Religion aus, wie gestalteten sie Politik? Welche Rolle hatte die Frau, und wie zentral war Gewalt? Von Eirík I., genannt Blutaxt, der sich den norwegischen Thron erkämpfte, bis zur isländischen Entdeckerin Gudríd, die bis nach Amerika reiste, ist dies die definitive Geschichte der Wikinger und ihrer Zeit, opulent ausgestattet und prächtig bebildert. »Tausende von Büchern wurden über die Wikinger geschrieben – dies ist eines der allerbesten.« Sunday Times »Auf brillante Weise gelingt es Neil Price, die Welt der Wikinger aus deren eigener Perspektive zu zeigen.« David Abulafia »Price ist der führendeExperte für die Zeit der Wikinger und ein wunderbarer Schriftsteller – das Buch ist philosophisch, unterhaltsam, lyrisch und ergreifend.« Guardian »Ein must-read für Wikinger-Fans!« Publishers Weekly »Jeder meint, die Wikinger zu kennen, aber Neil Price' magisches Buch lässt sie in völlig neuem Licht erscheinen … Fundiert, lebendig und bemerkenswert unterhaltsam: Dies ist Geschichtsschreibung vom Feinsten, die ein üppig geschmücktes Fenster in eine fremde Welt eröffnet.« The Times UK »Das beste historische Buch des Jahres« The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 948
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Neil Price
Die wahre Geschichte der Wikinger
Über dieses Buch
»Tausende von Büchern wurden über die Wikinger geschrieben – dies ist eines der allerbesten.« Sunday Times
Waren die Wikinger wirklich die brandschatzenden Seefahrer und gewaltsamen Eroberer aus den Legenden? Der weltweit renommierte Experte Neil Price schreibt gegen die gängigen Vorurteile an und zeigt uns die echten Menschen hinter dem Mythos. Basierend auf neuesten archäologischen Funden, zahllosen Textquellen und nicht zuletzt der nordischen Mythologie selbst zeigt er uns die Wikinger erstmals so, wie sie selbst sich sahen. Fundiert und überraschend lebendig schildert er ihr Alltagsleben und ihre reiche Kultur: Wie übten sie ihre Religion aus, wie gestalteten sie Politik? Welche Rolle hatte die Frau, und wie zentral war Gewalt? Von Eirík I., genannt Blutaxt, der sich den norwegischen Thron erkämpfte, bis zur isländischen Entdeckerin Gudríd, die bis nach Amerika reiste, ist dies die definitive Geschichte der Wikinger und ihrer Zeit, opulent ausgestattet und prächtig bebildert.
»Auf brillante Weise gelingt es Neil Price, die Welt der Wikinger aus deren eigener Perspektive zu zeigen.«David Abulafia
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Neil Price, 1965 geboren, studierte Archäologie in London und York. Bereits während des Studiums spezialisierte er sich auf die Wikinger und zog 1992 nach Schweden, um ihre Gebräuche und Lebenswirklichkeit als Feldarchäologe zu erforschen. Seit 2014 ist er Professor für Archäologie und Frühgeschichte an der Universität Uppsala in Schweden. Price hat zahlreiche Bücher und Aufsätze über die Wikinger und ihre Zeit veröffentlicht und gilt als einer der führenden Experten weltweit. Er lebt in Uppsala.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© Neil Price
Für die deutsche Ausgabe:
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D - 60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490303-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Karten]
Zur Sprache
Prolog: Treibholz
Einführung: Vorfahren und Erben
Die Erschaffung von Midgard
1. Das Heim ihrer Schatten
2. Zeit der Winde, Zeit der Wölfe
3. Das soziale Netzwerk
4. Das Streben nach Freiheit
5. Grenzüberschreitungen
6. Die Ausübung der Macht
7. Die Begegnung mit den Anderen
8. Der Umgang mit den Toten
Das Wikingerphänomen
9. Überfälle
10. Maritorien
11. Kriegertum
12. Hydrarchie
13. Diaspora
Neue Welten, neue Nationen
14. Das Goldene Zeitalter der Schafzüchter
15. Silber, Sklaven und Seide
16. Die Experimente mit der Monarchie
17. Länder des Feuers und der Reben
18. Die zahlreichen Enden der Wikingerzeit
Epilog: Spiele
Literaturhinweise
1. Allgemeiner Hintergrund
2. Anmerkungen zu den einzelnen Kapiteln
Dank
Register
Tafelteil
Für die fylgjur, für alle von ihnen
Karte 1. Die vereinfachte politische und ethnische Geographie Europas um das Jahr 565 nach den in den vorausgegangenen Jahrzehnten der Krise eingetretenen Veränderungen. Gezeigt sind die Grenzen des Oströmischen Reiches beim Tod von Kaiser Justinian. Karte Neil Price.
Karte 2. Skandinavische Stammesgruppen, Rechtsbezirke und Königreiche nach Quellen der Jahre 500–1350, einschließlich der Getica des Jordanes (um 551) und der englischen Dichtung Widsith (10. Jahrhundert). Karte und © Ingvild T. Bøckman und Frode Iversen, Kulturhistorisches Museum, Universität Oslo, mit freundlicher Genehmigung.
Karte 3. Angriffsziele in der ersten Phase der Wikingerraubzüge 793–833. Europäische Küstenemporierg.
Karte 4. Die Wikingerangriffe auf die Britischen Inseln und das Fränkische Reich 834–999 mit den in Irland, England und auf dem Kontinent errichteten Stützpunkten. Karte Ben Raffield und Daniel Löwenborg.
Karte 5. Der große Mittelmeerraubzug um 859–862, vermutlich unter dem Kommando von Björn Eisenseite und Hásteinn. Die Wikingerflotte fuhr von ihrem Stützpunkt in Noirmoutier an der Loire-Mündung in Richtung Süden, vorbei an den Küsten des Frankenreichs und Iberiens bis ins Mittelmeer. Nachdem sie irgendwo im östlichen Mittelmeer einige Zeit verbracht hatte, kämpfte sie sich durch die Straße von Gibraltar (Nörvasund) zurück. Ein Drittel der Flotte schaffte es wieder nach Hause. Karte Neil Price.
Karte 6. Die Wikingerdiaspora im Osten erstreckte sich über Byzanz bis in die asiatische Steppe und darüber hinaus. Die von den Rus beherrschten Flussrouten von der Ostsee zum Schwarzen Meer schlossen sich nahtlos an die Karawanenwege des Kalifats der Abbasiden und die weit ins Innere Asiens reichenden Seidenstraßen an. Karte Ben Raffield, Daniel Löwenborg und Neil Price.
Karte 7. Die spätere Wikingerzeit in Skandinavien und im Nordseeraum, von der Herrschaft Harald Blauzahns (ca. 960–987) bis zum »Reich« Knuts des Großen (ca. 1016–1035). Eingezeichnet sind die sechs bekannten kreisförmigen Festungen vom Typ »Trelleborg«: (1) Aggersborg, (2) Fyrkat, (3) Nonnebakken, (4) Trelleborg, (5) Borgring, (6) Borgeby. Karte Ben Raffield und Daniel Löwenborg.
Karte 8. Die Nordmänner im Nordatlantik. Island wurde um 870 besiedelt und zog schnell zahlreiche Menschen an. Etwas mehr als ein Jahrhundert später gründeten die Isländer die östlichen und westlichen Siedlungen in Grönland und segelten bis in die Gebiete des heutigen Ostkanadas. Die exakte Lage der Regionen, die sie Helluland, Markland und Vinland nannten, lässt sich nur vermuten, und L’Anse aux Meadows auf Neufundland ist nach wie vor die einzige sicher nachgewiesene nordische Siedlung in Nordamerika. Karte Neil Price.
Zur Sprache
Ein großer Teil dieses Buches befasst sich mit Lebewesen, Orten und Begriffen, deren heute gebräuchliche Namen sich letztendlich entweder aus dem Altnordischen (ein verkürzter Sammelbegriff für eine komplexe Reihe von Dialekten und Sprachzweigen aus Island und Skandinavien, aus dem Mittelalter und früher) oder aus den modernen Sprachen der nordischen Länder ableiten. Es kann kompliziert sein, sich in dieser Klanglandschaft zurechtzufinden, und es gibt keinen einfachen Weg, sie in einem deutschen Text zu normieren und gleichzeitig ihrer ursprünglichen Vielfalt Rechnung zu tragen. Aus Gründen der Konvention und der besseren Lesbarkeit habe ich hier auf Konsistenz verzichtet und die Sprache auf verschiedene Weise vereinfacht.
Zwei altnordische (und moderne isländische) Buchstaben wurden anglisiert, außer in bestimmten Namen oder wenn Texte im Original zitiert werden: Dem Zeichen Þ/þ, »Thorn«, transkribiert als »th«, entspricht als Lautwert das (stimmlose) englische th [θ], während die Glyphe Ð/ð, »Eth«, ebenfalls als »th« transkribiert, phonetisch dem stimmhaften englischen th [ð] entspricht. Der altnordische Diphthong æ wird ungefähr wie »ai« bzw. das englische »eye« ausgesprochen.
Der nordische Akut, der die Vokale längt, ist bei den Namen fast immer beibehalten. Abweichend vom Deutschen wird á wie »au« ausgesprochen, é wie »äi« bzw. wie ein englisches a, í wie ein langes i, ó wie das englische »owe«, ú wie ein langes, tiefes u. Und y, im Altnordischen ebenfalls ein Vokal, spricht sich wie das englische »ew«, nur etwas in die Länge gezogen.
Bei Orts- und Personennamen werden, wenn es geläufiger ist, die modernen skandinavischen Buchstaben å (wie das englische »oar« gesprochen), ä/æ und ö/ø verwendet, wobei zwischen dem Schwedischen und dem Dänischen/Norwegischen leichte Unterschiede bestehen. Der schwedische Buchstabe ö wurde für ǫ verwendet, den altnordischen Buchstaben »o mit Ogonek«.
Einige wissenschaftliche Werke – darunter viele meiner eigenen – verwenden den altnordischen Nominativ für Eigennamen, auch wenn dies im modernen Text bisweilen ungrammatisch ist. Das häufigste Beispiel, das auch einige der oben genannten Buchstaben und Akzente aufweist, ist wahrscheinlich der Name des Gottes Óðinn (ausgesprochen ˈoʊðin bzw. wie das englische »Owe-thinn«). Von einigen Ausnahmen abgesehen sind diese und andere ähnliche Namen (wie der seines Sohnes Þórr) eingedeutscht und erscheinen als »Odin« und »Thor«.
Zitate aus altnordischen Texten werden meist ohne das Original wiedergegeben. Wenn sie in einer geeigneten Umgebung richtig rezitiert wird, kann die wikingerzeitliche Dichtung wie kaltes Eisen auf der Zunge schmecken, wobei ihre komplexen Reimschemata wie Frostschichten aufeinander aufbauen, tückisch, aber schön. Wir können in dieser Sprache etwas Altes und Wahres entdecken, auch wenn wir nur die Übersetzung verstehen, und aus diesem Grund habe ich für dieses Buch einige dieser Texte ausgewählt.
Prolog: Treibholz
Die Götter hinterlassen am Ufer des Weltmeeres mäandernde Fußspuren, deutliche Abdrücke im Sand. Sie sehen die schäumend brechenden Wellen des Ozeans, sie hören sein Tosen. Ansonsten ist der Strand völlig unberührt, denn in dieser Welt gibt es noch keine Menschen.
Es sind drei Brüder, die wir hier spazieren gehen sehen: Odin – der mächtigste und furchtbarste von allen – und seine Brüder Vili und Vé. Sie haben viele Namen, was in ihrer göttlichen Familie der Asen ganz üblich sein wird.
Die Szene wirkt friedlich und ruhig, und doch ist alles, was die Brüder umgibt, aus Blut entstanden; die Erde und der Himmel wurden – im wahrsten Sinne des Wortes – aus dem zerstückelten Körper eines Mordopfers erschaffen. Das Universum als Schauplatz eines Verbrechens: Es ist eine verstörende Geschichte voller Widersprüche, Fremdheit und Gewalt, eine, deren Wahrheiten mehr noch nachempfunden als nur erklärt und verstanden werden müssen. Wir werden sie zu gegebener Zeit ergründen – jetzt, da sie gerade geschehen ist, herrscht überall Ruhe. Sie sind neugierig, diese Götter, unermüdlich erforschen sie das Wesen der Dinge, die sie in ihrer strahlenden neuen Schöpfung vorfinden. Was ist jenes? Und was ist dieses? Sie sind allein an diesem Ort, dem es noch an Geist, Gefühl und Farbe mangelt.
Aber jetzt sind die Götter am Strand, und sie haben etwas am Rand des Wassers gesehen.
Zwei große Treibholzstümpfe sind mit der Flut an den Strand gespült worden, der ansonsten unter der riesigen Weite des Himmels gänzlich leer daliegt. Odin und seine Brüder nähern sich den Stämmen und drehen sie im Sand mühsam um. Und jetzt erkennen sie, was sich in ihrem Inneren befindet, so wie ein Bildhauer in einem rohen Steinblock die Figur wahrnimmt, die auf ihre Befreiung wartet. Die drei Götter bearbeiten mit ihren Händen das Holz, formen, glätten und gestalten es, seiner Maserung folgend. Eine Wolke aus Spänen und Staub. Sie grinsen sich an, mitgerissen von der Freude an ihrer schöpferischen Arbeit. Langsam werden die Dinge im Inneren sichtbar und nehmen unter dem Druck der göttlichen Finger Gestalt an. Hier ist ein Arm, dort ein Bein; und schließlich treten die Gesichter zum Vorschein.
Zuerst ein Mann – der erste Mensch – und dann eine Frau. Die Götter starren auf sie hinab. Jetzt rührt sich Odin, haucht ihren Mündern seinen Atem ein und erweckt sie zum Leben. Sie husten, beginnen zu atmen, noch immer im Holz gefangen. Vé öffnet ihre Augen und Ohren, lockert ihre Zungen, glättet ihre Züge. Wilde Blicke, Stimmengewirr. Vili schenkt ihnen Verstand und Bewegungsfähigkeit; sie schütteln sich und befreien sich von den Stämmen. Zu Boden fallende Rindenflocken.
Zuletzt geben die Götter ihnen Namen, ihre Substanz verwandelt sich in Klang. Der Mann ist Askr, die Esche. Die Frau ist Embla, die Ulme.
Die ersten Menschen der Welt schauen sich erstaunt um, lauschen auf die Stille und füllen sie mit Reden, Rufen und Lachen. Sie zeigen auf den Ozean, den Himmel, den Wald und auf immer mehr Dinge, geben ihnen allen Namen, und wieder lachen sie. Sie beginnen vor den sie beobachtenden Göttern davonzulaufen, immer weiter den Strand entlang in ihr neues Zuhause, bis sie den Blicken entschwunden sind. Vielleicht winken sie Odin und den anderen zu, vielleicht auch nicht, doch sie werden sie wiedersehen.
Von diesem Paar stammt die gesamte Menschheit ab, durch die Jahrtausende bis in unsere Zeit.
Die Wikinger sind sehr populär und stoßen auf ein Interesse, das nur wenigen anderen alten Kulturen zuteilwird. Fast jeder hat zumindest von ihnen gehört. Im Laufe von nur drei Jahrhunderten, von etwa 750 bis 1050, haben die Völker Skandinaviens die nördliche Welt auf eine noch heute spürbare Weise verwandelt. Sie veränderten die politische und kulturelle Landkarte Europas und prägten neue Formen des Handels, der Wirtschaft, der Besiedelung und des Konflikts, von der amerikanischen Ostküste bis hin zur asiatischen Steppe. Die Wikinger sind heute mit dem Stereotyp maritimer Aggression belegt – man denkt an jene berühmten Langschiffe, an Plünderungen und Beutezüge, an das feurige Schauspiel eines »Wikingerbegräbnisses«. Hinter diesen Klischees steckt ein Fünkchen Wahrheit, aber die Skandinavier brachten auch neue Ideen, Technologien, Glaubensüberzeugungen und Praktiken in die Länder, die sie entdeckten, und zu den Völkern, denen sie begegneten. Dabei veränderten sie sich selbst und entwickelten in einer riesigen Diaspora neue Lebensweisen. Die zahllosen kleinen Königreiche ihrer Heimatländer sollten schließlich zu den Staaten Norwegen, Schweden und Dänemark werden, die es noch heute gibt, während die traditionellen Glaubensüberzeugungen des Nordens allmählich vom Christentum verdrängt wurden. Jene ursprünglich fremde Religion sollte ihr Weltbild fundamental verändern und die Zukunft Skandinaviens prägen.
Abb. 1. Die Wikinger und die Viktorianer, wie sie leibten und lebten. Die außergewöhnliche Zeichnung von Lorenz Frølich (1895) zeigt das Festmahl der Götter, wie es in der altnordischen Dichtung Lokasenna, »Lokis Zankreden«, beschrieben ist. Die göttlichen Asen erscheinen als eine Kreuzung zwischen Barbaren nach klassischem Vorbild und eher steifen zeitgenössischen Dinner-Gästen, während Loki den Betrunkenen spielt. Ort des Geschehens ist ein Rokoko-Saal, das Gebilde an der Decke vielleicht ein Kronleuchter. Lizenzfreie Abbildung.
Genau genommen sind die Wikinger natürlich Menschen der Vergangenheit, gestorben und begraben – aber gleichzeitig bewohnen sie eine seltsam haptische Form der Prähistorie, die jedes Mal zu diffundieren scheint, wenn auf die Membran, die uns von der Vergangenheit trennt, Druck ausgeübt wird. Viele haben versucht, ihre Finger auf diese Scheidewand zur Geschichte zu legen. Sie haben stets geglaubt, der Impuls dazu sei nicht von ihnen ausgegangen, sondern sie seien durch die Entdeckung von im Laufe der Zeit verschütteten, lange verborgenen Wahrheiten dazu inspiriert worden. Mittelalterliche Mönche und Gelehrte erfanden ihre heidnischen Ahnen neu, entweder als auf noble Weise irregeleitete Vorfahren oder als Handlanger des Teufels. In den illuminierten Manuskripten der romanischen Literatur wurden sie, einem orientalistischen Klischee entsprechend, mit Turban und Krummschwert als Sarazenen dargestellt, Feinde Christi. Im England Shakespeares galten die Wikinger als Katalysatoren, die mit brutaler Gewalt die frühe Geschichte des Königreichs und seiner späteren Größe vorantrieben. Während der Aufklärung als eine Art »edler Wilder« wiederentdeckt, wurde die Gestalt des Wikingers von der Nationalromantik des 18. und 19. Jahrhunderts begeistert übernommen. Auf der Suche nach einer eigenen neuen Identität durchforsteten viktorianische Imperialisten die skandinavische Literatur. Sie hielten Ausschau nach geeigneten, überzeugenden Vorbildern aus dem Norden, um die sich vollendende historische Bestimmung der Angelsachsen anhand ihrer nordischen Vettern zu erklären. Das logische Ende jener Reise kam ein Jahrhundert später, als die Nazis sich die Wikinger im Rahmen ihrer rassistischen Fiktionen einverleibten. Sie erhoben sie zu einem dubiosen arischen Archetyp, dessen moderne Nachfolger uns heute noch heimsuchen. Einige Strömungen innerhalb der breiten neopaganistischen Community suchen nach einer spirituellen Alternative, die ihre Inspiration aus der Wikingerreligion schöpft, wobei ein wolkiges altnordisches Gebräu mit Tolkien’schen Aromen angereichert wird. All diese Leute und noch viele andere mehr, darunter heutige Wissenschaftler und ein das historische Drama schätzendes Publikum, haben die fragmentarischen materiellen und schriftlichen Hinterlassenschaften der Wikinger in neue Formen ihrer Wahl gegossen. Manchmal scheint es, als seien die tatsächlichen Menschen hinter den Zuschreibungen, mit denen sie von allen Seiten belegt wurden, fast verschwunden. Das erinnert an Wiedersehen mit Brideshead von Evelyn Waugh und Anthony Blanches Seufzer: »Oh, la fatigue du Nord.«
Abb. 2. Als alles schiefging. Ein Rekrutierungsplakat der SS, das für eine Kundgebung im von Nazis besetzten Norwegen wirbt (1943). Die politische Vereinnahmung der Wikinger könnte nicht offensichtlicher sein. Lizenzfreie Abbildung.
Den meisten dieser Perspektiven ist gemeinsam, dass sie vom Beobachter ausgehen; sie betrachten die Wikinger von außen, ohne zu berücksichtigen, wie diese selbst die Welt sahen. Diese Haltung hat eine lange Tradition und geht de facto auf die Schriften der Opfer der Wikinger zurück, von denen man kaum erwarten kann, dass sie unparteiisch sind. Ironischerweise waren selbst die Menschen, mit denen die Skandinavier in Kontakt kamen (oft über die Spitzen ihrer Schwerter), nicht immer ganz sicher, mit wem sie es wirklich zu tun hatten. Um nur ein Beispiel aus dem späten 9. Jahrhundert anzuführen: Nach einem schrecklichen Krieg mit einer ganzen Wikingerarmee bewirtete König Alfred von Wessex in Südengland trotz allem einen norwegischen, nicht an den Kämpfen beteiligten Kaufmann an seinem Hof und stellte ihm Fragen über Fragen: Woher kamen sie? Was taten sie? Wie lebten sie? Der König stand mit seiner Unwissenheit ebenso wie mit seiner Neugier nicht allein.
Dieselben Rätsel wurden in den nächsten tausend Jahren weiterhin debattiert und nehmen mit vermehrter akademischer Forschung und Gelehrsamkeit seit circa zwei Jahrhunderten sogar noch Fahrt auf. Doch auch hier lag der Fokus wieder weitgehend auf dem, was die Wikinger taten, und weniger auf der Frage, warum sie es taten. In gewisser Weise schaut man, wenn man diese Perspektive einnimmt, durch das falsche Ende des historischen Teleskops und definiert (womit häufig ein Urteil einhergeht) ein Volk nur anhand der Folgen seiner Handlungen und nicht anhand der dahinterliegenden Motive.
Dieses Buch verfolgt den entgegengesetzten Ansatz und schaut von innen nach außen. Der Schwerpunkt liegt sehr nachdrücklich auf der Frage, wer die Wikinger wirklich waren, was sie antrieb, was sie dachten und fühlten. Ihre dramatische Expansion wird natürlich nicht beiseitegelassen, aber im Zentrum stehen ihr Kontext und ihre Ursprünge.
Wo also könnte man besser beginnen als bei der Schöpfung? Die Geschichte, in der die Götter am Ufer des Weltmeeres die ersten Menschen aus Baumstämmen erschufen, hat ihre Wurzeln tief in der nordischen Mythologie. Obwohl jene, denen sie begegneten, hinsichtlich ihrer Identität so angstvoll verwirrt waren, gab es in der Vorstellung der Wikinger niemals den geringsten Zweifel: Sie waren die Kinder von Askr, die Kinder von Embla.
Einführung: Vorfahren und Erben
Was ist mit »Wikinger« eigentlich gemeint? Sollte der Begriff überhaupt benutzt werden, und wenn ja, wie?
Vom 8. bis zum 11. Jahrhundert kannten die Skandinavier das altnordische Wort víkingr als Bezeichnung für eine Person, aber sie hätten sich oder ihre Zeit in diesem Begriff nicht wiedererkannt. Für sie könnte das Wort vielleicht so etwas wie »Pirat« bedeutet haben, eine Beschäftigung oder Aktivität (und vermutlich eine ziemlich marginale) bezeichnend, aber mit Sicherheit stand es nicht für die Identität einer gesamten Kultur. Auch war es damals weder zwangsläufig negativ besetzt noch immer mit Gewalt assoziiert – diese Untertöne sollten sich erst in den Jahrhunderten nach der Wikingerzeit allmählich herausbilden. Außerdem bezog es sich nicht ausschließlich auf Skandinavier, sondern wurde auch für baltische Seeräuber im Allgemeinen verwendet und war sogar in England gebräuchlich. Die Ziele der Wikinger lagen überdies keineswegs nur außerhalb von Skandinavien; die mit Gewalt verbundene maritime Piraterie respektiert nur selten solche Anstandsregeln. Noch im 11. Jahrhundert erwähnte ein schwedischer Runenstein einen Mann – einen Assur, Sohn des Jarl Hákan – der »Wart gegen die Wikinger« war; er hielt also Wache, um Überfälle der Nachbarn zu verhindern.
Die genaue Herkunft des Begriffs ist unbekannt, aber die Interpretation, die heute die breiteste Zustimmung findet, gründet sich auf das altnordische vík, eine Meeresbucht. Somit könnten die Wikinger ursprünglich »Meeresbucht-Leute« gewesen sein, die mit ihren Schiffen auf der Lauer lagen, um aus ihrem Versteck heraus vorüberfahrende Reisende anzugreifen. Eine andere Deutung verbindet den Begriff mit dem Gebiet Víken im südwestlichen Norwegen, aus dem die frühesten Seeräuber einst gekommen sein sollen. Auch diese Ableitung hat einiges für sich.
In den modernen nordischen Sprachen wird vikingar oder vikinger noch immer strikt im Sinn von Seeräuber verwendet, während das Wort im Englischen und in anderen Sprachen jeden bezeichnet, der, wie ein Wissenschaftler aus Cambridge resigniert feststellte, »eine flüchtige Beziehung zum Skandinavien ›jener Tage‹« hatte. Es gab viele Versuche, das Problem zu lösen, aber mit geringem Erfolg. (So lamentierte der inzwischen verstorbene Historiker auf mehreren Seiten über das, was er als die terminologische Nachlässigkeit seiner Kollegen ansah, um sich dann mit »Nordmänner« zufriedenzugeben – womit er die Schweden, die Dänen und natürlich Frauen ausschloss.) Manche Gelehrte bezeichnen heute mit der kleingeschriebenen Form (»vikings«) die allgemeine Bevölkerung und reservieren die großgeschriebene Form (»Vikings«) für die Piraten. In diesem Buch wird überall »Wikinger« verwendet, aber durch den Kontext definiert.
Das ist keineswegs nur semantische Haarspalterei. Indem sie von einer Wikingerära sprechen und damit einen Begriff benutzen, der das so bezeichnete Volk überrascht hätte, hat die Geschichtswissenschaft in gewisser Hinsicht eine wenig hilfreiche Abstraktion vorgenommen. Natürlich wurde die Vergangenheit immer in bequem handhabbare Zeitabschnitte unterteilt, doch ein Streit der Gelehrten über den Beginn der Wikingerzeit ist nicht dasselbe wie eine Debatte beispielsweise über die Anfänge des Römischen Reiches, denn dieses war alles andere als ein nachträgliches Konstrukt.
Man sollte immer daran denken, dass keine anderen Völker jener Zeit sich in ähnlichem Ausmaß in der damals bekannten eurasischen und nordatlantischen Welt ausgebreitet hatten wie die Skandinavier. In dokumentierten Begegnungen mit mehr als fünfzig Kulturen bereisten sie die Gebiete von über vierzig heutigen Ländern. Manche Wissenschaftler haben behauptet, dass die Wikinger darin keineswegs bemerkenswert oder bedeutsam wären. Sie seien nur regionale Manifestationen der allgemeinen Mobilität auf dem Kontinent gewesen und repräsentierten generelle Trends, die mit der Neustrukturierung der nachrömischen Wirtschaft einhergingen. Im Grunde genommen eine Art florierende frühmittelalterliche Europäische Union mit einigen besonders aggressiven Unterhändlern im Norden. Es trifft natürlich zu, dass es an der Ost- und Nordsee Jahrhunderte (und wahrscheinlich Jahrtausende) vor der Zeit der Wikinger Raubzüge und Seekriege gegeben hat. Doch es steht außer Zweifel, dass seit den 750er Jahren der Strom, die Ausbreitung und der Umfang der Piraterie zwar allmählich, aber dramatisch zunahmen. In den umfassenden militärischen Feldzügen des 9. und 10. Jahrhunderts, die die politischen Strukturen Westeuropas erschüttern sollten, erlebte sie schließlich ihren Höhepunkt. Gleichzeitig gab es parallele und damit verknüpfte Bewegungen: Kolonialismus, Handel, die Erforschung der Welt, besonders des Ostens. Kurzum, der Begriff »Wikingerära«, obwohl ein zweifellos erst nachträgliches Konstrukt der Wissenschaftler, hat durchaus seine Berechtigung.
Es gab auch andere Versuche, die Wikinger aus der Geschichte herauszuschreiben, wobei man sich ironischerweise darauf fokussierte, wie sie in die Geschichte hineingeschrieben worden waren. Dahinter steht die Vorstellung, dass dieses Stück Vergangenheit von der Zukunft »kolonisiert« und verbogen wurde, um ihren Bedürfnissen zu entsprechen – was im Kern darauf hinausläuft, dass die Wikinger der Phantasie späterer Völker entsprungen wären. Das ergibt für mich wenig Sinn. Ja, die nationalistische Romantik, der viktorianische Imperialismus und ihre noch dunkleren europäischen Nachfolger haben gewiss allesamt das spätere Bild der Wikinger beeinflusst. Aber sie sagen uns überhaupt nichts darüber, was zwischen der Mitte des 8. und 11. Jahrhunderts wirklich geschah – sondern nur etwas darüber, wie dies später angeeignet und als Waffe benutzt wurde (was natürlich nicht ignoriert werden sollte).
Angesichts all dieser Vieldeutigkeiten und einer so langen Vorgeschichte soziopolitischen Missbrauchs ist es sehr wichtig klarzustellen, dass hinter dem Konzept der Wikingerzeit eine überprüfbare und empirische Realität stand, die durch genaue Studien erhellt werden kann. Die 300 Jahre nach etwa 750 n. Chr. waren vor allem die Periode eines gesellschaftlichen Wandels, der so tief ging, dass er Nordeuropa schließlich für die nächsten tausend Jahre prägte – ein Prozess, der nicht zuletzt das Konzept einer eigenständigen Wikingerzeit rechtfertigt.
All dies zu einer Synthese zu verbinden ist eine gewaltige Aufgabe. Wir müssen einen narrativen, der Chronologie folgenden Weg beschreiten, um die Ereignisse dieser drei Jahrhunderte aus ihrem Kontext heraus zu verstehen. Doch es gibt nicht nur einen einzelnen Faden, der durch die riesigen und unterschiedlichen Gebiete der Wikingerdiaspora hindurchführt. Es gibt Bücher, die länger sind als dieses, obwohl sie beispielsweise nur die skandinavischen Interaktionen mit dem heutigen europäischen Russland thematisieren, und das gilt ebenso für die übrigen Regionen ihrer Welt. Zwangsläufig wird einiges verlorengehen, wenn man ein solches Weitwinkelobjektiv benutzt. Leser, die detaillierte Abhandlungen über die Kunst der Wikinger, die Typologie von Artefakten, Schiffsbaumethoden und vieles mehr suchen, können zwischen zahlreichen gut illustrierten, technischen Studien wählen und die Literaturhinweise am Ende dieses Buches als Einstieg nutzen. Die Skandinavier begegneten mehr als fünfzig Kulturen – würde man jeder davon nur tausend Wörter widmen, würden diese trockenen Beschreibungen leicht ein halbes Buch füllen. Der produktivste Fokus ist folgender: Während das größere Bild auf unserem Weg mit den Wikingern stets im Hintergrund steht, konzentrieren wir uns auf Gleichzeitigkeiten, auf Schnappschüsse und kurze Besuche in unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten.
Dieser Ansatz eröffnet neue Chancen, hat aber zugleich seine Grenzen. Insbesondere die Vorstellung des Exzeptionalismus der Wikinger (was nicht dasselbe ist wie Unterschiedlichkeit) wirft Probleme auf und sollte meines Erachtens, wo immer möglich, vermieden werden. Um zu einem Bild zu greifen, das ihnen gefallen hätte: In den nordeuropäischen Volksmärchen geht es häufig um die Suche nach dem geheimen Namen einer Person (das Märchen von Rumpelstilzchen ist ein gutes Beispiel). Die Wikinger haben Hinweise auf ihre Namen hinterlassen, auf ihr unter der Oberfläche verborgenes wahres Selbst. Ein ausgeprägter Sinn für geheimnisvolle Orte, an denen göttliche Kräfte wirken, durchströmt nicht nur die nordische Dichtung, sondern auch Runen-Inschriften, geschaffen von Menschen, die im Einklang mit ihrer Umgebung lebten. Dieselbe Einstellung zeigt sich auch in ihrer materiellen Kultur: Jede zugängliche Oberfläche – einschließlich des menschlichen Körpers – ist mit verschlungenen Zeichnungen geschmückt, mit sich windenden Mustern, mit Tieren und anderen mit Bedeutung aufgeladenen Bildern. Ihre Welt war von vibrierender Lebendigkeit, doch deren innere und äußere Grenzen waren in vielerlei Hinsicht durchlässiger als die unserer heutigen Welt, und ihre verschlungenen Pfade standen in steter und ständiger Verbindung mit den Reichen der Götter und anderer Mächte.
Bei den Geschichten, die in diesem Buch erzählt werden, ist es jedoch wichtig, die Abwesenheiten, die Dinge, die nicht bekannt sind, nicht aus dem Blick zu verlieren. Bei einigen handelt es sich um Details, bei anderen um Wesentliches, und die daraus resultierenden Lücken erscheinen bisweilen merkwürdig willkürlich. Diese Leerstellen lassen sich füllen, aber nur durch informierte Spekulation (wobei die Geschichtswissenschaft nichts anderes ist als eine auf Annahmen beruhende Disziplin, manchmal verwandt mit einer spekulativen Fiktion der Vergangenheit).
So weiß man beispielsweise kaum, wie die Wikinger die Zeit maßen. Ihre Musik und ihre Lieder sind ein Mysterium. Hier bilden die wenigen erhaltenen Instrumente einen möglichen Ausgangspunkt; ihre Klänge mögen sich rekonstruieren lassen, aber wie die Wikinger ihre Instrumente benutzten, ist eine ganz andere Sache. Es ist unklar, wohin in der Vorstellung der Wikinger Frauen nach ihrem Tod kamen. Warum wurde so viel Silber in der Erde vergraben, aber niemals wieder hervorgeholt? Diese und andere Fragen werden immer und immer wieder gestellt und haben den Wissenschaftlern jahrhundertelang Kopfzerbrechen bereitet. Einige Fragen sind eher vorsichtig tastend und vielleicht auch unlösbar. Trotzdem ist es lohnend, sie zu stellen. Wenn man wirklich glaubte – ja sicher wusste –, dass der am Ende des Tals lebende Mann sich unter bestimmten Umständen in einen Wolf verwandeln konnte, wie war es dann, wenn man sein Nachbar war? Wie, wenn man mit ihm verheiratet war?
Wir werden vermutlich niemals den geheimen Namen der Wikinger aussprechen können, aber wenn wir offen sind für ihre Stimmen, ihre Sorgen und Ideen – kurzum, für ihr Denken und Fühlen – dann ist es, glaube ich, möglich, nicht nur dieses alte Leben wirklich zu erforschen, sondern auch eine neue Geschichte darüber zu schreiben, wie wir zu dem wurden, was wir sind. Dies also ist die Wikingerzeit der Kinder von Askr und Embla: eine Reihe von Aussichtspunkten, von denen aus man über Menschen, Orte und Zeiten schaut, eine Welt, die notwendigerweise begrenzt, aber auch in ständiger Bewegung ist. Natürlich ist es in einem gewissen Sinn auch meine Wikingerzeit, das Ergebnis von mehr als dreißig Jahren Forschung, die aber – wie die Arbeit jedes Wissenschaftlers, der sich beruflich mit der Vergangenheit befasst – ebenso Ausdruck meiner eigenen Vorlieben und Vorurteile ist.
Doch wie kommen wir dorthin? Auf welche beweiskräftigen Quellen können wir uns stützen, um den Wikingern näherzukommen?
So wie viele andere wissenschaftliche Fächer werden auch die Wikingerstudien bisweilen durch interdisziplinäre Querelen erschüttert, insbesondere zwischen den Experten, die mit Texten arbeiten, und ihren archäologischen Kollegen, die sich der Vergangenheit über Dinge und Orte nähern. Dieser Streit endet niemals wirklich, sondern grollt weiterhin wie die unregelmäßigen Beben auf einer geographischen Verwerfungslinie. Dabei ist die Produktion von Texten natürlich auch ein sehr materieller Akt – man ritzt Zeichen in Stein oder Holz oder malt sie mit einem Federkiel auf Pergament. Es ist ein Prozess, der zielgerichtetes Vorgehen, Anstrengung, Ressourcen und Vorbereitung erfordert, alles natürlich mit einem Ziel und in einem sozialen Kontext jenseits bloßer Kommunikation. Einige der seltensten Quellen, wie etwa das große Epos Beowulf, sind nur in einem einzigen Manuskript überliefert. Sie sind buchstäblich Artefakte.
Wikingerforscher neigen dazu, sich auf einen bestimmten Ausschnitt von Signalen aus dem späten ersten Jahrtausend zu spezialisieren, aber sie müssen auch mit vielen weiteren Befunden umgehen können, die zeitlich oft viel später liegen: Archäologie, Sagenkunde, Philologie, Runologie, Religionsgeschichte und so weiter, wobei aktuell immer mehr Beiträge aus den Natur- und Umweltwissenschaften hinzukommen, die Genomik eingeschlossen. Die Kenntnis der modernen skandinavischen Sprachen ist unabdingbar, ebenso wie eine zumindest ausreichende Vertrautheit mit dem Altnordischen und Lateinischen.
Weil ich selbst Archäologe bin, ist es kaum überraschend, dass ein großer Teil dieses Buches auf den Ergebnissen von Ausgrabungen und Feldforschung beruht. Ob es sich um Objekte handelt, Gebäude, Bestattungen oder Beispiele für wissenschaftliche Analysen unterschiedlicher Art, es geht im Wesentlichen immer um Dinge. Der akademische Begriff hierfür lautet »materielle Kultur«, was das Phänomen gut erfasst.
Manche dieser Objekte, insbesondere der Inhalt von Gräbern, haben überdauert, weil die Menschen sich ihrer damals bewusst entledigt haben: Einfach gesagt, die Dinge wurden gefunden, weil man sie absichtlich dort abgelegt hatte, wo sie zurückgelassen wurden. In den Grabstätten kann man den Wikingern, in Form ihrer Skelette oder verbrannten Überreste, direkt begegnen. Was die archäologischen Untersuchungen jedoch hauptsächlich zutage fördern, sind zerbrochene und schlecht erhaltene Fragmente, die zufällig auf die Nachwelt gekommen sind, weil Dinge verloren gingen, aufgegeben oder weggeworfen wurden oder verfallen waren. Zu nennen sind hier die Siedlungsschichten mit all dem Krimskrams, der im Laufe der Jahre, in denen die Menschen dort lebten, in der Erde gelandet war: zerbrochene Töpferwaren, Lebensmittelabfälle, Dinge, die entsorgt oder zurückgelassen wurden, wenn es wieder an der Zeit war weiterzuziehen. Archäologen stoßen auch auf Spuren von den Gebäuden selbst, etwa dunkle Umrisse im Boden, wo die Balken verrotteten, oder Löcher, in denen einst die Stützpfähle für Dächer und Wände standen. Selten gibt es Steine von Fundamenten oder aus Gruben, in denen sie gelegen hatten, bevor jemand sie an sich nahm, um sie wiederzuverwenden.
Die Archäologie ist ein höchst interpretatives Unternehmen, ein ständiges Abwägen von Wahrscheinlichkeiten und Alternativen. Man kann mehr oder weniger zuverlässige Spekulationen anstellen, aber es ist nicht immer möglich, sicher zu sein. Eine wesentliche Voraussetzung für einen guten Forscher ist die Bereitschaft, sich zu irren, die Einladung zu konstruktiver Kritik. Trotzdem ist es, auch wenn die meisten Schlussfolgerungen vorsichtig in Klammern gesetzt werden müssen, sinnlos, alles in Frage zu stellen und zu glauben, dass es unmöglich ist, wirklich etwas über die Vergangenheit zu wissen. Die Archäologen werden durch einen eindrucksvollen theoretischen Apparat unterstützt, der sich stets weiterentwickelt. Er ist umstritten und von außen oft undurchschaubar, aber nichtsdestotrotz unverzichtbar. Es kann positiv überraschen und überaus motivierend sein, wenn wir die Kenntnisse über die Wikingerära und die (globale) Vergangenheit, die wir noch vor fünfzig Jahren hatten, mit unserem heutigen Wissen vergleichen. Die Wikinger, mit denen ich mich in den 1980er Jahren an der Universität befasst habe, waren ganz andere Menschen als die, über die ich heute die Studenten unterrichte, und dasselbe wird sicherlich wiederum für deren Studenten gelten. So sollte es auch sein.
Es gibt weitere Fragen. Bei den meisten archäologischen Stätten stellt sich das Problem der Erhaltung, die weitgehend von den lokalen Bodenarten und ihrem relativen Säuregehalt abhängt. Stein ist am wenigsten anfällig, obwohl er, wenn er über lange Zeit den Elementen ausgesetzt ist, brüchig werden oder erodieren kann. Sowohl Metall als auch Keramik haben gute Chancen zu überdauern (wenn auch korrodiert oder auf andere Weise beschädigt), während Knochen unterschiedlich gut erhalten bleiben. Am seltensten finden sich organische Materialien – Dinge aus Stoff, Leder, Holz und dergleichen, die fast immer verlorengehen, außer wenn der Boden sehr feucht ist oder auf andere Weise die Sauerstoffzufuhr verhindert.
All dies betrifft die Dinge in der Erde, aber die Archäologen dokumentieren auch die sichtbare Landschaft – für die Wikingerära insbesondere in Form von Wallanlagen, Befestigungen oder Grabhügeln, aber auch von Steinmonumenten, Feldbegrenzungen wie Gräben oder Trockensteinmauern und so weiter. Die Topographie mag sich gewandelt haben, Flüsse anders verlaufen, Küstenlinien aufgestiegen oder abgesunken und Sumpfgebiete trockengelegt sein; in seltenen Fällen haben Naturereignisse wie Vulkanausbrüche drastischere Auswirkungen gezeitigt – aber die Zeugnisse sind vorhanden. So wie Landschaften »gelesen« werden können, so auch das, was unter ihnen verborgen liegt, wobei zerstörungsfreie Ortungstechniken wie das Georadar und eine Vielfalt elektromagnetischer Methoden eingesetzt werden, mit denen man in den Boden eindringen und dort verborgene Strukturen, Gräben, Pfostenlöcher und Feuerstellen ausfindig machen kann.
Wenn man Ausgrabungen, Feldvermessungen und geophysikalische Prospektion kombiniert, lassen sich die Wikingersiedlungen wieder rekonstruieren, bis hin zu den Details des Lebens der Menschen. So kann man Aufschluss darüber erhalten, wie sie lebten, wie sie gekleidet waren und was sie aßen, welche Dinge sie herstellten und verwendeten. Die Archäologen können nachvollziehen, wie ihre Häuser und Bauernhöfe aussahen, wie die Menschen ihren Lebensunterhalt bestritten und wovon sie lebten, und sie können sich eine Vorstellung von ihrem Wirtschaftssystem machen. Außerdem lässt sich ein Bild der Familienstruktur und gesellschaftlichen Hierarchien skizzieren – eine Annäherung an politische Systeme und die Art, wie sich Macht manifestiert haben könnte. Die Archäologie kann darüber hinaus Rituale für die Lebenden wie für die Toten nachweisen und damit einen Einblick in den Geist und die Landschaften der Religion gewähren. Nicht zuletzt kann all dies auch illustrieren, wie diese Völker der Wikingerzeit miteinander umgingen, sowohl in dem riesigen Gebiet des heutigen Skandinaviens wie auch weit jenseits seiner Grenzen.
Im Laufe der vergangenen fünfzig Jahre hat die Archäologie unser Verständnis der Vergangenheit dramatisch verändert, das der Wikingerära nicht weniger als das anderer Epochen. Die Strontium- und Sauerstoffisotopenanalyse der menschlichen Zähne und Knochen kann die Orte lokalisieren, an denen Menschen ihre prägenden Jahre verbrachten, kann uns erzählen, ob sie umherzogen, und auch über ihre Ernährungsweise Auskunft geben. Die Materialwissenschaft kann Objekte und Substanzen identifizieren, die so schlecht erhalten sind, dass man früher nur Vermutungen über sie anstellen konnte. Die wissenschaftliche Analyse kann die Herkunft der Metalle, unterschiedliche Arten von Ton und Mineralien nachverfolgen, die bei der Herstellung von Waren verwendet wurden. Sie kann die Spezies und Habitate der Tiere, deren Fell, Knochen und Elfenbein als Rohmaterialien benutzt wurden, bestimmen und mit Hilfe der Jahresringe von Bäumen exakte Daten – manchmal das Jahr und sogar die Jahreszeit eines Ereignisses – angeben. Die Archäologen können in Dänemark ein untergegangenes Schiff heben und feststellen, dass es in Irland gebaut wurde. Die Analyse alter DNA kann das Geschlecht der Toten verlässlich bestimmen, ihre familiären Beziehungen aufdecken und sogar die Farbe ihrer Augen und Haare herausfinden. Dank ihrer lassen sich auch breitere Migrationsbewegungen und größere demographische Veränderungen belegen. Umweltstudien können die Flora von Siedlungen und Landschaften rekonstruieren, feststellen, ob ein Gebiet kultiviert oder bewaldet war, welche Feldfrüchte angebaut wurden, und erfassen, wie sehr sich die Nutzung des Landes im Laufe der Zeit verändert hat.
Kein einzelner Spezialist kann all diese Fachgebiete beherrschen, aber die Teamarbeit von Archäologen vor Ort, im Labor und in der Bibliothek bietet jetzt größere Möglichkeiten als jemals zuvor, das Leben vergangener Völker zu erforschen.
Die Zeugnisse der Wikingerzeit basieren jedoch nicht nur auf dieser materiellen Kultur und den anderen natürlichen und physischen Spuren der Zeit, trotz der Vielfalt und der stets wachsenden Menge an Daten. Was ist mit den schriftlichen Quellen? Die Kulturen Skandinaviens waren zur damaligen Zeit vorherrschend oral, insofern als man keine literarischen oder dokumentarischen Texte verfasste – die Wikinger haben ihre eigenen Geschichten niemals aufgeschrieben. Das bedeutet nicht, dass sie Analphabeten waren. Die Verwendung der Runenschrift war im Norden weit verbreitet, von ihren Anfängen in römischer Zeit bis in die Blütezeit der Inschriften in der Wikingerära selbst. Dennoch ist dieses Material begrenzt. Neben Tausenden von in Stein gehauenen kurzen Grabinschriften und Epitaphen, manchmal von einigen poetischen Zeilen begleitet, gibt es noch spärliche Beispiele von in Holzstücke gekratzten Alltagsnotizen und Etiketten, doch aus den Wikingergesellschaften des Nordens gibt es keine längeren Texte.
Ihre Kultur ist hingegen eine, die als »protohistorisch« bezeichnet wird, da ihre »Geschichte« auf dem beruht, was einige ihrer ausländischen Zeitgenossen über sie niederschrieben. Das wirft jedoch Probleme auf, die in vielerlei Hinsicht den Kern aller modernen Wikingerstereotype ausmachen, was natürlich daran liegt, dass die meisten dieser Quellen von Menschen verfasst wurden, die unter den Aggressionen der Wikinger besonders zu leiden hatten. Ein Großteil dieser Berichte hat die Form von Hofannalen, die, häufig auf Latein, für die herrschenden Dynastien Westeuropas erstellt wurden. Etliche unterschiedliche Texte, oftmals benannt nach den Klöstern, in denen sie verfasst oder verwahrt wurden, befassen sich mit den (germanischen) Reichen der Franken und Ottonen auf dem Kontinent, verschiedene altenglische Manuskripte der Angelsächsischen Chronik handeln von England. Es gibt Gegenstücke aus der arabischen Welt, insbesondere aus dem Kalifat von Córdoba in Andalusien und dem Byzantinischen Reich, das von Konstantinopel aus regiert wurde – um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Hinzu kommen noch die trockeneren rechtlichen Dokumente über Landschenkungen und Gründungen, von denen manche beiläufige Informationen über die Aktivitäten der Wikinger liefern, wie zum Beispiel Hinweise auf die Stätten ihrer früheren Befestigungsanlagen oder Lager. Es gibt auch das Recht selbst, die frühmittelalterliche regionale Gesetzgebung, die ein Jahrhundert nach der Zeit der Wikinger oder noch später niedergeschrieben wurde, aber häufig eine Vielfalt nützlicher Informationen enthält, die eindeutig sehr alt sind. Dasselbe kulturelle Milieu brachte auch eine kleinere Zahl eher persönlich gehaltener Texte hervor, verfasst von Mönchen und Priestern, Reisenden, Diplomaten und Kaufleuten, Spionen, Dichtern und anderen, die den Wikingern zu Hause oder im Ausland begegneten.
Auf alle Dokumente dieser Art werde ich in den folgenden Kapiteln zurückkommen, aber es ist wichtig, sich vor allem über zwei ihrer Eigenschaften im Klaren zu sein. Erstens: Obwohl sie auf zeitgenössischen, manchmal von Augenzeugen stammenden Berichten beruhen, liegen sie nicht in ihrer ursprünglichen Form vor; sie wurden fast alle zu einem späteren Zeitpunkt kompiliert, bearbeitet oder transkribiert, und dies führt zwangsläufig zu einigen kritischen Fragen. Zweitens: Obwohl sie häufig wie eine schlichte Reportage wirken, verfolgen sie doch immer einen bestimmten Zweck – oftmals geht es um unverhohlene Propaganda, die nicht nur ihre Autoren in einem günstigen und die Wikinger somit in einem ungünstigen Licht erscheinen lässt, sondern auch zulasten anderer benachbarter Königreiche oder Völker geht. Kurzum, sie müssen mit Vorsicht behandelt werden.
Neben den weitgehend zeitgenössischen schriftlichen Quellen gibt es noch die vielleicht berühmtesten Erzählungen überhaupt: das außergewöhnliche Korpus isländischer Texte, denen der Norden seine eigene literarische Tradition verdankt. Für viele Leute sind die Wikinger so gleichbedeutend mit den »Sagas«, dass sie überrascht sind, wenn sie feststellen, dass diese anschaulichen Erzählungen tatsächlich erst Jahrhunderte nach den Ereignissen, die sie zu beschreiben vorgeben, entstanden sind. Für jeden, der die Wikingerzeit besser verstehen will, ist es eine komplexe Aufgabe, diese Texte in den Griff zu bekommen.
Saga bedeutet einfach »Geschichte«, buchstäblich »Gesagtes«, sowohl im Altnordischen als auch in den modernen skandinavischen Sprachen. So wie in jeder Erzähltradition gibt es auch hier zahlreiche narrative Stile und Genres, wobei die Werke zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten geschaffen wurden und eine breite Vielfalt von Absichten verfolgten. Die ersten altnordischen Sagas wurden in den späten 1100er Jahren in Island niedergeschrieben, mehr als 100 Jahre nach dem nominellen Ende der Wikingerzeit. Die Tradition bestand – mit einer kreativen Blütezeit in den 1200er Jahren – noch jahrhundertelang fort, und neue Sagas wurden sogar noch nach der Reformation bis in die frühe Moderne hinein verfasst. Der trügerisch einfache Begriff bezeichnet somit eine Bandbreite von Texten, die sich von offiziellen historischen Darstellungen über viele andere Stationen bis zu Gute-Nacht-Geschichten für Hörer am Kamin erstreckt.
Die beiden Saga-Gattungen, die am häufigsten im Zusammenhang mit den Wikingern zitiert werden, sind die Sagas der Isländer, auch bekannt als die Familiensagas, und die sogenannten fornaldarsögur, wörtlich »Geschichten alter Zeiten«, die aber häufiger als Vorzeitsagas bezeichnet werden. Beide Gattungen handeln von der Wikingerzeit, aber auf verschiedene Weise und mit unterschiedlicher Verlässlichkeit. Allerdings hängt die Frage ihrer »Genauigkeit« davon ab, mit welchem Ansatz man an diese mittelalterlichen Texte herangeht.
Die Sagas der Isländer konzentrieren sich in der Regel auf einzelne in jenem jungen nordatlantischen Land lebende Siedlerfamilien und häufig auf kleinere Regionen wie Täler oder Distrikte. Das genealogische Erbe der Siedler wird ausführlich zurückverfolgt, nicht nur bis zur Besiedelung Islands, sondern bis zu ihren früheren Wurzeln in Skandinavien. Die Sagas schildern anschaulich ihr Leben und ihre Abenteuer, manchmal über Jahrzehnte hinweg, und skizzieren dabei ein verführerisch mitreißend überzeugendes Bild des damaligen Islands: ein einzigartiges politisches Experiment, eine Republik von Bauern in einem Zeitalter von Königen. Fehden und Rachefeldzüge sind verbreitete Themen, wobei Nachbarstreitigkeiten in Diebstahl und Mord eskalieren, während konkurrierende Gerichtsverfahren versuchen, die Flut der generationenübergreifenden Gewalttätigkeiten, die üblicherweise folgen, einzudämmen. Diese Themen sind mit Liebesgeschichten und Kriegen verknüpft und zeigen am konkreten abgegrenzten Beispiel der ländlichen Gemeinden mit internationalen Kontakten die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen. Unter der Oberfläche der meisten Geschichten gibt es ständig magische Berührungspunkte mit der anderen Welt, mit Hexerei und Sehern, Geistern und übernatürlichen Wesen, wenn auch selten mit den Göttern im eigentlichen Sinn. Ab dem 10. Jahrhundert stehen solche Aktivitäten (nach den internen Chronologien der Sagas) zunehmend in Kontrast und manchmal in Konflikt mit dem Einfluss des »weißen Christus«, ihrem Namen für Jesus. Alle diese Ereignisse spielen oft vor der Folie unguter Spannungen mit den königlichen Familien Norwegens, die Island mit territorialem Neid betrachten, und vor dem stets gegenwärtigen Hintergrund der politischen Ereignisse in einer größeren Welt.
Wie ihr Name impliziert, enthalten die Vorzeitsagas Elemente, die in den Erzählungen des Phantastischen üblich sind – Helden, die gegen Ungeheuer kämpfen, Flüche böser Hexen und dergleichen. Aber sie sind häufig in Geschichten eingebettet, die eine gewisse Verbindung mit der bekannten Historie aufweisen. So enthalten vor allem die Vorzeitsagas manchmal Narrative, die scheinbar Ereignisse lange vor der Wikingerzeit betreffen und in die Zeit der Völkerwanderung zurückreichen, als die nachrömische Landkarte Europas gewaltsam verändert wurde. Figuren wie der hunnische Kriegsherr Attila (ziemlich wertschätzend beschrieben) erscheinen zusammen mit Königen und Militärführern des 5. und 6. Jahrhunderts, die um die Vorherrschaft kämpfen. Island steht, anders als in den Familiensagas, nicht immer im Mittelpunkt, und die Geschichten umspannen die europäische Welt und breiten sich bis weit in den Osten aus.
Andere zeitgenössischere Formen handeln wiederum von der Zeit der Saga-Autoren. Zu nennen sind hier die Sturlunga-Sagas, die das politische Schicksal der gleichnamigen Familie schildern, die Bischofsagas, mehrere Arten von christlichen moralischen Erzählungen und vieles andere mehr. Das mittelalterliche Island war keineswegs isoliert, und manche Sagas verraten auch deutliche Einflüsse des in Europa modernen höfischen Romans mit Geschichten von schneidigen Rittern, die Prinzessinnen vor Drachen retten, und so weiter. Selbst das populäre Epos über den trojanischen Krieg wurde in eine altnordische Fassung, die Ektors saga, gebracht, die sich bezeichnenderweise mehr auf den dem Untergang geweihten homerischen Helden als auf seinen Mörder Achilles konzentriert – vielleicht ein Einblick in skandinavische Vorstellungen von kriegerischer Ehre.
Es gibt eine weitere wichtige Kategorie altnordischer Texte, nämlich die Poesie. Auch sie kommt in mehreren verschiedenen Formen daher; manchmal sind es freie Verse, öfter jedoch Erinnerungen an Ereignisse und am häufigsten Lobgedichte. Die Poesie diente auch als Medium für die Bewahrung und Vermittlung des mythologischen Erbes sowie als Archiv für Heldengeschichten.
Anders als bei den Prosatexten der mittelalterlichen Sagas ist man sich allgemein einig, dass das altnordische poetische Korpus wohl beträchtlich älter ist und tatsächlich die Stimmen der Wikingerzeit bewahrt haben könnte. Das liegt an der extrem komplexen Struktur und den äußerst komplizierten Reimschemata der nordischen Dichtung: Wenn die Verse überhaupt ihren Zweck erfüllen sollen, muss man sich an sie erinnern und sie weitgehend vollständig wiederholen können. Das poetische Talent wurde in der Wikingerzeit äußerst hoch geschätzt, eine bewundernswerte Fähigkeit, die ein Gebildeter beherrschen sollte, insbesondere derjenige, der eine führende Position anstrebte. Auch dies hat zum Überleben der Poesie beigetragen. Die Erinnerung an einen Menschen – der gute Name, den man nach seinem Tod hinterlässt – war wesentlich und wurde von den oberen Gesellschaftsschichten bewusst gefördert, indem sie entweder Verse zu ihrer eigenen Ehre verfassten oder aber als Schirmherren derjenigen auftraten, die dies für sie tun konnten. Diese professionellen Dichter waren die berühmten Skalden, und man muss zugeben, dass sie ihren Job erledigt haben: Die Sujets ihrer elegant prahlenden Auftragspoesie sind noch tausend Jahre später im Gespräch.
Die altnordischen Gedichte speisen sich aus drei Hauptquellen, von denen eine das Sagakorpus ist, das diese Gedichte gelegentlich als indirekte Rede der Protagonisten bewahrt hat. Ein Großteil der anderen hat in zwei mittelalterlichen isländischen Werken, den Eddas, überlebt. Die Ableitung und Bedeutung des Wortes sind unsicher – man hat viele Erklärungen vorgeschlagen –, aber qua Definition oder metaphorischer Anspielung scheint es sich auf das Erstellen von Poesie zu beziehen.
Die eine Edda, die sogenannte Prosa-Edda oder Snorra-Edda, ist ein eigenständiges Werk des Gelehrten, Historikers und Politikers Snorri Sturluson. Sie wurde um das zweite oder dritte Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts verfasst und ist in mehreren späteren Handschriften überliefert. Snorris Edda ist genau genommen ein Handbuch für Poeten, ein stilistisches Lehrbuch, unterteilt in drei Partien mit einem vorangestellten Prolog, wobei der gesamte Text sich mit Gattungen und Metren befasst, begleitet von Diskursen über die Themen, die sich für verschiedene Anlässe und Zwecke eignen. Das Werk enthält eine reiche Fülle an Informationen in Form von in Prosa verfassten Kommentaren, wobei vor allem herauszuheben ist, dass Snorri seine Ausführungen in der Regel anhand zitierter Beispiele belegt. So straft die Prosa-Edda ihren Namen in gewisser Weise Lügen, da die Seiten mit Gedichten gefüllt sind, die vollständig oder fragmentarisch zitiert werden, häufig mit Angabe des Verfassers. Manche Texte kennt man aus anderen Quellen, viele sind aber auch nur von Snorri überliefert. Das Werk ist besonders reich an skaldischen Versen, Anspielungen auf die Mythologie und die traditionelle Religion. Es gibt viele Fragmente von Erzählungen und Listen alternativer poetischer Begriffe für eine große Bandbreite von Dingen einschließlich übernatürlicher Wesenheiten (zum Beispiel die zahlreichen Namen für Odin). Snorris Edda ist eines der bemerkenswertesten literarischen Dokumente des Mittelalters.
Neben diesem Handbuch ist ein weiteres mittelalterliches Werk zu nennen, die Poetische oder Lieder-Edda, ein (wie bei Snorris Buch) moderner Titel. Sie ist in zwei voneinander abweichenden Handschriften sowie in späteren Kopien weitgehend erhalten und stellt eine umfassende Sammlung anonymer Verse über mythologische und heroische Themen dar. Man weiß kaum etwas darüber, wie, von wem oder warum sie so zusammengestellt wurden. Man hat sogar vermutet, dass die Haupthandschrift (der sogenannte Codex Regius, aufbewahrt in Reykjavík) das Werk eines Kuriositätensammlers sei, was erklären könnte, warum es ein so schmales und zusammengestoppeltes Büchlein ist, hergestellt aus wiederverwendetem Pergament – nicht gerade die klassische Wahl für ein Werk von solch großem Renommee. Niemand weiß, was einen isländischen Christen des 13. Jahrhunderts veranlasste, die wichtigsten Erzählungen der heidnischen Vergangenheit seines Volkes so sorgfältig aufzuzeichnen, aber glücklicherweise hat er es getan. Die Gedichte sind mehrdeutig, schwer fassbar und schwierig zu interpretieren, und sie sprechen auf indirekte Weise von einem für die bereits Eingeweihten mächtigen heiligen Wissen. Sie lassen sich auch nur sehr schwer datieren, wobei die frühesten gegen Ende der Wikingerära nach älteren Vorbildern verfasst worden sein könnten. Trotz all ihrer Komplexität und quellenkritischen Problematik ist die Lieder-Edda die wichtigste Quelle für unsere Kenntnisse der nordischen Mythologie, Kosmologie, Götter- und Göttinnengeschichten und großen Heldenlieder des Nordens. Fragmente der »eddischen« Gedichte finden sich auch in Snorris Schriften und gelegentlich in den Sagas, ein Korpus von insgesamt etwa vierzig Werken.
Mit Ausnahme der Runeninschriften stammen sämtliche altnordischen Texte aus den Jahrhunderten nach der Wikingerzeit und wurden von Christen niedergeschrieben. Sie sind daher von der heidnischen Wikingerära, die sie zu beschreiben vorgeben, durch Zeit, Kultur und ideologische Perspektive signifikant getrennt. Viele der Sagas sind auch auf Island konzentriert, entweder aufgrund des narrativen Ortes und/oder weil sie dort entstanden sind, und führen so eine geographische Einseitigkeit in das ein, was ursprünglich eine viel größere panskandinavische Welt der Geschichten gewesen sein muss. Darüber hinaus war jeder Text einzigartig, geschrieben zu spezifischen Zwecken, die sich einem modernen Leser nicht alle sofort erschließen. Dazu kommen noch die Launen der Erhaltung: Die Texte wurden im Laufe der Zeit durch fehlerhaftes Kopieren entstellt (wir besitzen fast nie die »originalen« Handschriften). Manche Passagen sind verlorengegangen, wurden bearbeitet, verändert oder schlichtweg zensiert. Und natürlich lässt sich die Frage, ob ein Werk als Ganzes überlebt hat, niemals klären. Manchmal ist der fragmentarische Zustand eines Textes offensichtlich, und man weiß, wie und warum es dazu gekommen ist. Gelegentlich sind die Namen von Sagas, die nicht auf die Nachwelt gekommen sind, überliefert, zusammen mit kurzen Inhaltsangaben. In zahlreichen Fällen kann man jedoch überhaupt nicht wissen, was verlorengegangen ist.
Bevor man sich den Sagas oder irgendwelchen anderen Werken der altnordischen Prosa oder Poesie zuwendet, muss man eine trügerisch schlichte Frage beantworten: Was will man mit den Texten anfangen? Für viele, die sich mit einer Saga befassen, ob aus einem literarischen oder materiellen Forschungsinteresse, gibt es oft (wie es Tolkien im Hinblick auf Beowulf formulierte) eine »Enttäuschung über die Entdeckung, dass es sich um sich selbst handelte und nicht um etwas, das sich der Gelehrte lieber gewünscht hätte«. Wie der Name schon andeutet, waren die Sagas in allererster Linie Geschichten, die laut erzählt werden sollten, aber für ihre intendierten Hörer auch in einem bestimmten Kontext standen. Das Leben der Wikinger war auf Beziehungen aufgebaut, nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch zwischen verschiedenen Familien, und diese Beziehungen durchzogen die gesamte Gesellschaft in Netzen gegenseitiger Abhängigkeit. Die Sagas verankerten die Menschen in der Zeit, verbanden sie mit der Vergangenheit und gaben ihnen etwas, das wiederum Tolkien als »diesen Sinn für Perspektive, für die Antike mit einer noch größeren und noch dunkleren Antike dahinter« bezeichnete.
Diese Wahrnehmung ist nicht verschwunden. Ein Teil der verstörenden Wirkung der Familiensagas auf die moderne Leserschaft beruht darauf, dass sie sich so real anfühlen, so als ließen sie den Leser auf irgendeine Weise erfahren, was es bedeutete, in jener fremden Welt mit all ihren lakonischen Dramen und ihrem geschärften Sinn für Dinge zu leben. In Island, ihrer Heimat, sind die Sagas auch jetzt noch ganz lebendige Werke, die allen vertraut sind. Jeder kann (und sollte!) diese Geschichten als die echten Meisterwerke der Weltliteratur, die sie zweifellos sind, genießen – doch wenn man darüber hinausgehen und sie auf irgendeine Weise »verwenden« möchte, dann stellen sich jene grundsätzlicheren Fragen. Die allererste Frage betrifft den Fokus: Sind wir an der tatsächlichen, realen, gelebten Wikingerzeit, von der die Sagas handeln, interessiert, oder wollen wir wissen, wie diese alte Erfahrung in der mittelalterlichen Komposition und im gesellschaftlichen Kontext der Sagas vermittelt und angeeignet wurde? Dies sind grundlegend verschiedene Fragen.
In einem ersten vernünftigen Schritt muss man sich überlegen, ob es überhaupt möglich ist, das wirkliche Leben der Wikingerzeit unter der mittelalterlichen Patina der Texte zu erkennen, ja, ob es dort streng genommen je enthalten war. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was eine gänzlich negative Antwort bedeuten würde. Selbst die skeptischsten Literaturwissenschaftler, diejenigen, die generell bestreiten, dass die altnordischen Texte nützliche (wenn auch entfernte) Quellen für die Wikingerzeit seien, setzten sich nicht immer mit der Frage auseinander, die dieser Standpunkt erfordert: Warum sollten denn mittelalterliche Isländer im Laufe mehrerer Jahrhunderte dann ein weltweit herausragend detailliertes, umfassendes und konsistentes Korpus historischer Fiktion erschaffen haben? Manche haben behauptet, es gebe christliche Allegorien in den Sagas – etwa den odinischen Krieger und Dichter Egil Skalla-Grímsson als Inkarnation des heiligen Paulus –, aber wieso ein solcher Kunstgriff, wenn die nordischen Autoren bestens in der Lage waren, die biblischen Geschichten direkt zu assimilieren? Wenn es die Absicht war, christliche Tugenden nachträglich mit den Vorfahren zu verbinden, die noch immer bewundert werden konnten, weil man nicht erwarten konnte, dass sie es besser hätten wissen können, wie erklärt dies eine Erzählgattung, die in ihrem moralischen Kern eine heidnische Lebensanschauung unterstützt, die den herrschenden Normen des mittelalterlichen Denkens völlig widerspricht? Weit jenseits des verschwommenen Goldenen Zeitalters einer Ilias oder der in Auftrag gegebenen Gründungsmythen einer Aeneis handelt es sich hier um ganze Erzählzyklen, die sich ausführlich mit dem – dem Untergang geweihten – Adel eines Volkes befassen, vor dem die Kirche in der Zeit der Saga-Verfasser zurückgeschreckt wäre.
Dieses Buch verwirft jenen Standpunkt, zumindest soweit er die altnordischen Texte betrifft, und wagt eine unvoreingenommene, aber nicht unkritische Reise auf einem anderen Weg – einem, der uns hoffentlich in die Welt der Wikinger hineinführt; wir werden uns nicht sehr lange in ihrem späteren mittelalterlichen Schatten aufhalten. Die Hindernisse, die sich einer solchen Deutung der Quellen in den Weg stellen, sind allerdings beträchtlich. Früh- und spätmittelalterliche Schriften aller Art können im Großen und Ganzen fast niemals als wahre, vertrauenswürdige und verlässliche Berichte über das, was sie zu beschreiben vorgeben, gelesen werden. Es gibt immer eine Art Agenda, doch inwieweit dies zutrifft, ist abhängig von dem jeweiligen Text und immer strittig. Die Sagas und anderen Texte des altnordischen Geistes sind wirklich wunderbar, doch bei ihrer Interpretation muss man äußerste Vorsicht walten lassen und sich stets der Wissenslücken, die sich dabei auftun können (und die manchmal eher Abgründe sind), bewusst sein.
Die Quellen liefern einen Bezugsrahmen für das Kommende, aber vorher muss man noch einige Begriffe und Bedingungen festlegen – sie betreffen den gesellschaftlichen Kontext, die intellektuelle Verantwortung und die Ethik. Die Erfahrungen eines heute lebenden Menschen sind immer subjektiv, und dies gilt auch für die Geschichte und ihr Studium. Die Wikinger könnten hier leicht als Paradebeispiel dienen.
Im Laufe der Jahrhunderte haben sehr viele Leute die Wikinger eifrig für (un)moralische Zwecke eingespannt, und andere tun dies noch immer. Dieses intensive Interesse zeigt jedoch auch, dass ihr altes Leben uns auch heute noch etwas zu sagen hat. Nach meiner festen Überzeugung muss man, wenn man sich im 21. Jahrhundert ernsthaft mit den Wikingern befasst, anerkennen, dass die Art und Weise, wie man sich gegenwärtig an sie erinnert, häufig sehr problematisch ist. Manche Wikingerforscher werden das Gefühl kennen, wenn im öffentlichen oder privaten Diskurs mal wieder faktenbefreiter Unsinn zur Sprache kommt, weshalb es wichtig ist, hier von Beginn an keine Missverständnisse aufkommen zu lassen.
Die Wikingerwelt, die dieses Buch erkundet, war ein sehr multikultureller und multiethnischer Ort, mit allem, was dies in Bezug auf Bevölkerungsbewegungen, Interaktion (in jeder Bedeutung des Wortes, die intimste eingeschlossen) und die notwendige relative Toleranz impliziert. All das reichte weit in die nordische Prähistorie zurück. Es gab niemals so etwas wie eine »rein nordische« Blutlinie, und die damaligen Menschen wären wahrscheinlich schon über den Ausdruck verblüfft gewesen. Wir verwenden das Wort »Wikinger« als ein bewusst problematisches Etikett für den größten Teil der skandinavischen Bevölkerung, die aber ihre unmittelbare Welt auch mit anderen teilte – insbesondere mit dem halbnomadischen Volk der Sámi. Ihre jeweiligen Siedlungsgeschichten reichen so tief in die Steinzeit zurück, dass jede moderne Diskussion darüber, »wer zuerst da war«, völlig absurd ist. Skandinavien hat auch schon Jahrtausende vor der Wikingerzeit Immigranten willkommen geheißen, und zweifellos war ein Bummel durch die Marktzentren und Handelsplätze ein vibrierend kosmopolitisches Erlebnis.
Die Wikinger lassen sich nicht auf eine Schablone reduzieren, doch wenn abstrakte Begriffe ihren Einfluss auf und ihren Umgang mit der sie umgebenden Welt beschreiben können, dann sollte man auf Neugier und Kreativität, auf die Komplexität und Differenziertheit ihrer mentalen Landschaften achten und ja, auch auf ihre Offenheit für neue Erfahrungen und Ideen. Wenn man sich ernsthaft mit den Wikingern und ihrer Zeit beschäftigt, muss man sich auf alle diese Dinge einlassen und darf sie absolut nicht mit Stereotypen belegen und nivellieren. Die Wikinger waren so unterschiedliche Individuen wie alle Leser dieses Buches. Gleichzeitig sollte niemand die Augen vor den Seiten verschließen, die wir als weniger angenehm empfinden, insbesondere die Aggression, die ihren Expansionsdrang teilweise mit befeuerte – jenseits des Klischees, dass die Wikinger Räuber und Plünderer waren, war dieser Aspekt der frühmittelalterlichen skandinavischen Kulturen durchaus real. Sie waren ein kriegerisches Volk in konfliktreichen Zeiten, und ihre Ideologien wurden durch eine übernatürliche Ermächtigung zur Gewalt erheblich gestützt. Dies konnte extreme Formen annehmen, die sich in solchen Gräueln wie ritueller Vergewaltigung, Massenmord, Versklavung und Menschenopfern manifestierte. Wir dürfen die Wikinger nicht von unserer Zeit aus beurteilen, doch jeder, der sie in einem »heroischen« Licht sieht, sollte noch einmal nachdenken.
Im Zentrum jeder modernen Beschäftigung mit den Wikingern muss vor allem ein Streben nach Klarheit stehen. Wenn man feststellt, dass diese nördlichen Völker tatsächlich die Geschichte beeinflusst haben, bedeutet dies nicht, dass man dies billigt oder verurteilt, sondern schlichtweg eine alte Realität anerkennt, deren Vermächtnisse noch heute spürbar sind.
Konventionelle Studien der Wikinger neigen dazu, sich an Regionen zu orientieren, wobei sie an den künstlichen Vorstellungen von »westlichen« und »östlichen« Schauplätzen festhalten, die in Wirklichkeit nur akademische Erben des Kalten Krieges sind, der in Europa eine mehr oder weniger undurchlässige Barriere errichtete. So wird man gewöhnlich nacheinander über die britischen Inseln, den europäischen Kontinent und den Nordatlantik geführt, von den ersten Überfällen bis zur Schlacht von Stamford Bridge im Jahr 1066. Dann folgt eine gesonderte chronologische Reise durch den Osten innerhalb desselben Zeitraums. In Werken dieser Art kann man auch eigenständige und klar umrissene Themen finden (wie etwa Kapitel 4, »Religion«).
Dieses Buch versucht jedoch etwas anderes, indem es nicht nur das Weltbild der Wikinger beschreibt, sondern auch betont, dass es dasselbe Volk war, das die große Landkarte der Kulturen und Begegnungen bereiste – für sie gab es keinen Eisernen Vorhang. Außerdem muss ihr Leben als ein nahtloses Ganzes gesehen werden, wobei »Religion«, Politik, Geschlecht, Lebensunterhalt und alle anderen Existenzbereiche zu einer allgemeinen Wahrnehmung der Realität – schlichtweg ihrer Sicht der Dinge – verschmelzen. Was für manche der »Hintergrund« ist, das, was die Leistungen der Wikinger draußen in der Welt ermöglicht hat, ist hier das Wesentliche.
Der Text ist in drei Hauptteile untergliedert, die sich mehr oder weniger an der Chronologie orientieren, aber auch gleichzeitig oder später stattfindende Ereignisse berücksichtigen.
Das neue Zuhause, in dem Askr und Embla aufwachten, hieß Miðgarðr oder Midgard, wörtlich »Mittelhof« (übrigens die Inspiration für Tolkiens »Mittelerde«). Das ist natürlich auch unsere Welt, selbst wenn sie für die Wikinger ziemlich anders aussah. Ihre geographischen Grenzen wurden anscheinend nur durch Erfahrungen und Reisen definiert. Der erste Teil erkundet diesen Bereich anhand der Selbstwahrnehmung der Wikinger und ihrer Umgebung und beschreibt zunächst die Konturen dieser Landschaft sowohl vor Ort als auch in ihren Köpfen. Er untersucht ihre ganz eigenen Vorstellungen von Persönlichkeit, Gender und dem Platz des Individuums in den zahlreichen Dimensionen des Kosmos. Dazu gehören auch die Begegnungen mit den anderen Lebewesen, mit denen die Wikinger diese Räume teilten.
Dann wird das skandinavische Schicksal nachgezeichnet, angefangen mit dem Niedergang des weströmischen Reiches und seinen Auseinandersetzungen mit den Germanenstämmen jenseits seiner Grenzen; die Reise führt durch die turbulenten Jahre des 5. und 6. Jahrhunderts bis hin zu der neuen Ordnung, die auf den Überresten der alten errichtet wurde. Hier wird die Gesellschaft des frühen Nordens beschrieben: die materielle Kultur des Alltagslebens, die besiedelte Landschaft und die alles überspannenden Strukturen von Politik, Macht, Ritual, Glauben, Gesetz und Krieg. Erforscht werden die Grenzen zwischen den Lebenden und den Toten sowie die Beziehungen der Menschen zu den sie umgebenden unsichtbaren Wesen. Die Zeitreise führt uns hier bis ins 9. Jahrhundert, in etwa die – von Historikern und Archäologen allgemein anerkannte – Mitte der Wikingerzeit.
Der zweite Teil des Buches beginnt mit den frühen 700er Jahren, verfolgt jedoch einen anderen Weg, um die großen soziopolitischen Entwicklungen und demographischen Faktoren zu erkunden, die schließlich gemeinsam das Wikingerphänomen auslösten. Dies war die Zeit der Überfälle und ihrer allmählichen Eskalation: In dem stets gegenwärtigen Kontext expandierender Handelsnetze wurden aus einzelnen Angriffen Eroberungszüge. Die maritime Kultur Skandinaviens, der Aufstieg der Seekönige und die Entwicklung einzigartig mobiler Piratenverbände sind hier zentral. Die Anfänge der Diaspora lassen sich in alle Richtungen nachverfolgen: Die Wikinger verbreiteten sich entlang der östlichen Silberflüsse bis nach Byzanz und ins Kalifat der Araber und schufen sich in den Krieger-Händlern der sogenannten Rus eine neue Identität; im Westen verbreiteten sie sich auf den britischen Inseln; im Süden in den kontinentalen Reichen und im Mittelmeerraum; und sie erschlossen sich den Nordatlantik. In einer Reihe paralleler, simultaner Narrative befasst sich dieser Abschnitt des Buches mit diesen Ereignissen bis zum Beginn des 10. Jahrhunderts.





























