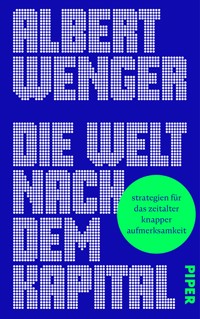
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die größte Disruption unserer Geschichte Wir stehen an einem Scheideweg. Die digitale Revolution hat das Tor zu einer neuen Ära aufgestoßen, dem Zeitalter des Wissens. Die nunmehr knappe Ressource ist nicht mehr Kapital, sondern Aufmerksamkeit. Aus der spannenden Perspektive eines deutsch-amerikanischen Investors analysiert dieses Buch diese neue Welt und zeigt, welche Kompetenzen wir brauchen, um den Übergang erfolgreich zu meistern. Zugleich ist es ein leidenschaftlicher Appell für einen Paradigmenwechsel - weg von den überholten Denkmustern des Industriezeitalters, hin zu einer bewussten Gestaltung unser aller Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-61034-6
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel The World After Capital, New York
© Albert Wenger, 2021
Für die deutsche Ausgabe:
© der deutschsprachigen Ausgabe 2025
Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, www.piper.de
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an: [email protected]
Covergestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, München
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorwort zur zweiten Auflage
Ursprüngliches Vorwort
Einleitung
Digitale Technologien
Null-Grenzkosten
Universelle Programmierbarkeit
Universalität bei Null-Grenzkosten
Teil 1
Grundlagen
1. Wissen
2. Optimismus
3. Entscheidungen
Regulierung
Selbstregulierung
4. Humanismus
5. Knappheit
6. Geschichte
7. Angriffsplan
Teil 2
Ausreichendes Kapital
8. Bedürfnisse
Individuelle Bedürfnisse
Kollektive Bedürfnisse
Ermöglicher
9. Bevölkerung
10. Kapital
Individuelle Bedürfnisse
Kollektive Bedürfnisse
Ermöglicher
Teil 3
Aufmerksamkeit ist knapp
11. Aufmerksamkeit
Knappheit an individueller Aufmerksamkeit
Mangel an kollektiver Aufmerksamkeit
12. Fehlallokation
13. In der Falle
Die Jobschleife
Die große Entkopplung
Fixe Arbeitsmenge oder Beschäftigungsmythos?
Hohe Lohnkosten und Innovation
14. Grenzen des Kapitalismus
Nicht vorhandene Preise
Potenzierung
Selbsterhaltung
15. Die Macht des Wissens
Die Wissensschleife
Versprechen und Gefahren der digitalen Wissensschleife
Es braucht mehr als Technologie
Teil 4
Die Freiheiten erweitern
16. Ökonomische Freiheit
Bedingungsloses Grundeinkommen
Technologische Deflation
Aber ist Deflation nicht etwas Schlechtes?
Ein BGE ist finanzierbar
Auswirkungen des BGE auf den Arbeitsmarkt
Weitere Einwände gegen ein BGE
Das BGE als moralischer Imperativ
17. Informationsfreiheit
Zugang zum Internet
Ein globales Internet
Keine künstlichen Überhol- und Schleichspuren
Bots für alle
Teilen und Erschaffen weniger einschränken
Das Privatleben hinter uns lassen
18. Psychologische Freiheit
Freiheit vom Wollen
Freiheit zum Lernen
Freiheit für Kreativität
Freiheit, sich mitzuteilen
Psychologische Freiheit und Humanismus
Teil 5
Aktiv werden
19. Sich in Achtsamkeit üben
20. Die Klimakrise bekämpfen
21. Die Demokratie verteidigen
22. Dezentralisierung fördern
23. Lernmöglichkeiten verbessern
24. Den Humanismus vorantreiben
Schluss
Eine gefährliche Spirale
Transhumans, Neohumans und Superintelligenz
Das Fermi-Paradoxon und außerirdische Besucher
Chancen im Wissenszeitalter
Die Herausforderung des Zeitenwechsels
Dank des Autors
Anhang
Das Wachstum des Kapitals
Kapitaleinsatz im Zweiten Weltkrieg
Die Bedürfnisse der Menschheit
Quellen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Vorwort zur zweiten Auflage
Seit der Veröffentlichung von Die Welt nach dem Kapital habe ich mit Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum über die in meinem Buch vorgestellten Ideen diskutiert. Im persönlichen Austausch betone ich, dass meine Ansätze weder nach links noch rechts, sondern vielmehr nach vorn gerichtet sind (Dank an Scott Santens, der sich mit diesem Ausspruch zum bedingungslosen Grundeinkommen geäußert hat). Meine Ausführungen haben aber offenbar manche Leser vor den Kopf gestoßen, die sich politisch eher rechts einordnen. In der vorliegenden Neuauflage möchte ich daher noch einmal betonen, dass sich sowohl meine Diagnose der aktuellen Situation als auch meine Vorschläge zum weiteren Vorgehen nicht an den bestehenden politischen Lagern orientieren. Vielmehr geht es um ein neues Verständnis der vor uns liegenden Herausforderungen und Chancen und um Erkenntnisse für Initiativen und Parteien, die nicht länger in der Ideologie des Industriezeitalters gefangen sind.Zwei große Faktoren tragen dazu bei, die Welt nachhaltig zu verändern: künstliche Intelligenz (KI) und die Klimakrise. Beide Phänomene werden in Die Welt nach dem Kapital ausführlich behandelt, haben sich seit der Erstveröffentlichung aber noch einmal bedeutend beschleunigt. Im Bereich der KI hat eine Vergrößerung der Modelle weitreichende neue Fähigkeiten freigesetzt, wodurch die Systeme den Menschen inzwischen bei einer Vielzahl von Aufgaben übertreffen. Insbesondere die sogenannten generativen Großsprachenmodelle wie GPT von OpenAI und Claude von Anthropic haben mit ihrer Leistung alle überrascht. In puncto Klimakrise war 2024 nach kurz vor Weihnachten erfolgten Angaben des Deutschen Wetterdienstes das in Deutschland wärmste Jahr seit dem flächendeckenden Messbeginn im Jahr 1881 – und der EU-Klimawandeldienst Copernicus veröffentlichte für die globale Situation eine entsprechende Erwartung.
Die grundlegenden Erkenntnisse von Die Welt nach dem Kapital haben standgehalten. Im Sommer 2023 hatte ich eine Hörfassung der ersten Auflage dieses Buches eingelesen und konnte feststellen, dass die aktuellen Ereignisse mehr denn je einen tiefgreifenden Wandel erfordern. Ich freue mich, dass diese zweite Auflage beim Piper Verlag in Deutschland (zunächst auf Deutsch und dann auch auf Englisch) erscheint, denn auf diese Weise öffnen sich neue Distributionskanäle, und Die Welt nach dem Kapital wird einem breiteren Publikum zugänglich.
Ursprüngliches Vorwort
Als Risikokapitalgeber werde ich oft gefragt: »Was ist das nächste große Ding?« Die Leute lauern auf einen neuen Technologietrend und erwarten, dass ich ihnen Auskunft über Entwicklungen auf dem Gebiet der Robotertechnik oder Virtual Reality geben kann. Dabei birgt die Frage viel spannendere Aspekte als das Auf und Ab von Hype-Zyklen, die ein wachsendes beziehungsweise schwindendes Medieninteresse an einer bestimmten Technologie widerspiegeln. Ich antworte also: »Och, nichts Besonderes. Nur das Ende des Industriezeitalters.« Eben von diesem enormen Wandel handelt das vorliegende Buch.
Die Welt nach dem Kapital nimmt sich unerschrocken wirklich große Themen vor. Wenn ich auf den folgenden Seiten erkläre, warum das Industriezeitalter zu Ende geht und was ihm folgt, beziehe ich Fragen nach dem Wesen der Technologie und der Bedeutung des Menschseins in meine Analyse ein. Das mag übertrieben ehrgeizig klingen, doch ich behaupte, dass wir vor einem ebenso tiefgreifenden Übergang stehen wie dem, der die Menschheit vom Agrarzeitalter ins Industriezeitalter geführt hat. Eine ehrgeizige Herangehensweise ist also durchaus geboten.
Der gegenwärtige Wandel wurde durch das Aufkommen digitaler Technologien angestoßen, und deshalb ist es entscheidend, dass wir das Wesen dieser Technologie verstehen und erkennen, inwiefern sie sich von allem Vorausgegangenen unterscheidet. Ebenso wichtig ist ein genauer Blick auf die philosophischen Grundlagen dessen, was wir erreichen wollen – immerhin liegt es in unserer Hand, was auf das Industriezeitalter folgen wird. Ich vertrete hier die Ansicht, dass wir derzeit ins Wissenszeitalter eintreten und uns auf dem Weg dorthin auf die Verteilung von Aufmerksamkeit statt von Kapital einstellen müssen.
Märkte versagen bei der Zuweisung von Aufmerksamkeit, denn es gibt keine Preise, die unsere Aufmerksamkeit auf die für das Überleben und Wohlergehen der Menschheit wesentlichen Probleme und Möglichkeiten lenken. Die Klimakrise etwa ist schwerwiegender und bedrohlicher, als den meisten Menschen bewusst ist, und sie ist eine direkte Folge unseres Versagens, ihr die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Welche Formen der derzeitige Wandel annimmt, wird stark davon beeinflusst, wie schnell wir diese Krise angehen. Wenn wir nicht rasch drastische Veränderungen vornehmen, wird der Übergang ins nächste Zeitalter noch schmerzhafter ausfallen als der Wechsel ins Industriezeitalter, der im 18. Jahrhundert begann, zahlreiche gewaltsame Revolutionen mit sich brachte und erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs abgeschlossen war.
Der Austritt aus dem Industriezeitalter ist bereits im Gange und sorgt für massive Störungen und Unsicherheiten. Viele Menschen haben Angst vor Veränderungen und halten sich an populistische Politiker, welche die simple Botschaft vertreten, man solle zur Vergangenheit zurückkehren. Dieser Trend zeigt sich überall auf der Welt: Wir haben es 2016 beim britischen Referendum zum Austritt aus der Europäischen Union und noch im selben Jahr bei der ersten Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten erlebt. Mit der Niederschrift von Die Welt nach dem Kapital habe ich vor diesen beiden Ereignissen begonnen, doch unterstreichen sie die Wichtigkeit einer in die Zukunft weisenden Erzählung, die der Menschheit einen Weg nach vorn aufzeigt. Rückschritt ist keine Option und ist es niemals gewesen. Weder haben wir nach der Erfindung des Ackerbaus weiter nach Nahrung gesucht, noch sind wir nach dem Aufkommen der Industrie Bauern geblieben (Landwirtschaft ist natürlich immer noch wichtig, wird aber von einem minimalen Prozentsatz der Bevölkerung betrieben.) Jeder dieser Übergänge verlangte von uns, eine neue Sinnquelle zu finden. Mit dem Verlassen des Industriezeitalters können wir aus unserer Arbeit oder einem ständig wachsenden Konsum von materiellen Gütern keinen Sinn mehr schöpfen, sondern müssen stattdessen eine mit dem Wissenszeitalter vereinbare Aufgabe finden. Ich schätze mich glücklich, meine Aufgabe in der Förderung von Innovationen durch Investitionen in Start-ups gefunden zu haben sowie darin, mich mit der Analyse des aktuellen Wandels zu beschäftigen, indem ich etwa darüber nachdenke, warum dieser Übergang gerade jetzt stattfindet und wie wir ihn bewältigen können.
An diesen Punkt haben mich meine bisherigen Betätigungen geführt, und das auf eine seltsame und wunderbare Weise. Als Teenager im Deutschland der frühen 1980er-Jahre war ich absolut vernarrt in Computer. Ich begann, Software für Unternehmen zu schreiben, und studierte schließlich Wirtschaftswissenschaften und Informatik in Harvard. Meine Abschlussarbeit widmete sich den Auswirkungen des computergestützten Handels auf Aktienkurse. Nach dem Studium arbeitete ich als Berater und erlebte die Auswirkungen von Informationssystemen in der Automobilbranche, im Flugverkehr und in der Stromversorgung. Als Doktorand am Massachusetts Institute of Technology (MIT) schrieb ich meine Dissertation über die Auswirkungen von Informationstechnik auf die Organisation von Unternehmen. Als Unternehmer war ich Mitbegründer einer der ersten Internetfirmen im Gesundheitsbereich. Und als Risikokapitalgeber hatte ich das Glück, Unternehmen wie Etsy, MongoDB und Twilio zu unterstützen, die transformative digitale Technologien und Dienstleistungen anbieten. Nun mag man sich fragen, wie ein Risikokapitalgeber, der doch mit der Auswahl und Verwaltung von Investitionen sicherlich genug zu tun haben müsste, darauf kommt, ein Buch zu schreiben. Tatsächlich ist es so, dass mir die Beschäftigung mit Start-ups ermöglicht, in die Zukunft zu spähen. Ich komme mit Trends und Entwicklungen in Kontakt, bevor sie allgemein bekannt werden, und befinde mich damit in der Lage, das Kommende zu überblicken. Wenn ich über die Zukunft schreibe, die ich mir wünsche, kann ich mir gleichzeitig Unternehmen suchen, die mir helfen, diese Zukunft zu verwirklichen. Die Welt nach dem Kapital habe ich geschrieben, weil meine Beobachtungen mich dazu gedrängt haben, doch bin ich zugleich überzeugt, dass die Niederschrift meiner Gedanken mich zu einem besseren Investor gemacht hat.
Einleitung
Wir Menschen sind die einzige Spezies der Erde, die Wissen entwickelt hat. Ich werde den Begriff »Wissen« im Laufe dieses Buches genauer fassen, für den Moment aber genügt die Aussage, dass wir die einzigen Lebewesen sind, die lesen und schreiben können: Fähigkeiten, die uns ermöglichen, immer leistungsfähigere Technologien zu entwickeln. Und dieser technische Fortschritt erweitert wiederum den »Raum des Möglichen«: So hat die Erfindung des Flugzeugs den Menschenflug Realität werden lassen. Dabei kann die Erweiterung des Möglichen Gutes wie Schlechtes mit sich bringen. Diese Zweischneidigkeit des Fortschritts begleitet uns seit der Erfindung des kontrollierten, nutzbaren Feuers, der allerersten menschlichen Technologie. Denn an einem Feuer kann man sich wärmen und Mahlzeiten zubereiten, man kann damit aber auch ganze Wälder und feindliche Dörfer niederbrennen.
Heute ist es so, dass uns das Internet den Zugang zu Wissen und Lernen erweitert, ebenso aber die globale Verbreitung von Hass und Lügen erleichtert. Doch hat unsere Zeit eine Besonderheit, denn in der Technologie erleben wir eine Nichtlinearität, in der sich der Raum des Möglichen so dramatisch ausweitet, dass auf Extrapolation beruhende Voraussagen unbrauchbar werden. Diese Nichtlinearität liegt in der extremen Leistungsfähigkeit von digitalen Technologien begründet, deren Eigenschaften alles übertrifft, was mit industriellen Maschinen möglich war. Digitale Technik bietet universelle Programmierbarkeit (denn sie löst potenziell jedes lösbare Problem), und das zu Grenzkosten von null (da zusätzliche Kopien kostenlos hergestellt werden können).
Wollen wir die gegenwärtigen Ereignisse verstehen, müssen wir uns viel größere Zeitspannen vor Augen führen. Tatsächlich ist die Menschheit schon zweimal mit ähnlichen Nichtlinearitäten konfrontiert worden. Die erste ereignete sich vor etwa 10 000 Jahren mit der Erfindung des Ackerbaus, die das Zeitalter der Jäger und Sammler beendete und uns in das der Landwirtschaft führte. Die zweite begann vor etwa 400 Jahren mit der Aufklärung, die den Übergang ins Industriezeitalter einleitete.
Man stelle sich vor, die vor 100 000 Jahren lebenden Jäger und Sammler hätten vorhersagen wollen, wie die Gesellschaft nach der Erfindung der Landwirtschaft aussehen würde. Selbst etwas für uns so Selbstverständliches wie das Wohnen in Häusern wäre aus Sicht der nomadischen Stämme schwer vorstellbar gewesen. Ebenso wären viele unserer heutigen Errungenschaften, von der modernen Medizin bis zur Computertechnik, den Menschen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts wie Science-Fiction erschienen. Nicht nur den Gebrauch von Smartphones, sondern auch die weitverbreitete Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit derart leistungsfähiger Technologie hätten sie wohl kaum vorhergesehen.
Das vorliegende Buch verfolgt zwei Ziele. Zum einen arbeitet es auf die Erkenntnis hin, dass wir derzeit eine dritte Periode globaler, nicht linearer Veränderungen erleben. Hauptargument hierfür ist, dass sich mit jeder dramatischen Erweiterung vom Raum des Möglichen die prägende Knappheit für die Menschheit verschiebt, dadurch verlagert sich das für die Erfüllung unserer Bedürfnisse wesentliche Zuteilungsproblem. Mit der Erfindung der Landwirtschaft wurde aus der Nahrungsmittel- eine Landknappheit, und mit der Industrialisierung wendete sich die Land- zur Kapitalknappheit. (Sofern nicht anders angegeben, bezeichne ich mit »Kapital« Sachkapital wie Maschinen und Gebäude.) Digitale Technologien verlagern nun die Knappheit vom Kapital auf die Aufmerksamkeit.
In einigen Teilen der Welt mangelt es bereits nicht mehr an Kapital, allgemein wird eine Abnahme der Kapitalknappheit beobachtet. Wir sollten dies als den großen Erfolg des Kapitalismus betrachten. Doch Märkte, die als Verteilungsmechanismus für Kapital gedient haben, werden die Aufmerksamkeitsknappheit nicht in den Griff bekommen. Die Allokation von Aufmerksamkeit gelingt uns schlecht, im persönlichen wie im kollektiven Rahmen. Wie viel Aufmerksamkeit widmen Sie zum Beispiel Ihren Freunden und Ihrer Familie oder der existenziellen Frage nach dem Sinn Ihres Lebens? Und wie viel Aufmerksamkeit widmen wir als Menschheit den großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit wie der Klimakrise und der Weltraumerkundung?
Märkte können uns nicht dabei helfen, unsere Aufmerksamkeit besser zu verteilen, denn vielen Themen, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken sollten, ist kein Preis zuzuordnen. Widmen wir uns etwa der Suche nach einem Lebensinhalt, so sind weder Angebot noch Nachfrage vorhanden, die einen Preis für diese persönliche Sinnfindung festlegen könnten. Es ist letztlich an uns, dieser existenziellen Frage genügend Aufmerksamkeit zu schenken.
Mit Die Welt nach dem Kapital möchte ich als zweites Ziel einen Ansatz entwickeln, der uns bei der Bewältigung der Grenzen und Mängel der kapitalistischen Marktwirtschaft hilft, um so einen möglichst reibungslosen Übergang vom Industriezeitalter (mit seiner Kapitalknappheit) zum Wissenszeitalter (mit seiner Aufmerksamkeitsknappheit) zu ermöglichen. Für die Menschheit ist ein Gelingen dieser Wende von entscheidender Bedeutung, waren doch die beiden vorangegangenen Übergänge von Wirren und Aufruhr geprägt. Überall auf der Welt sehen wir bereits Anzeichen für wachsende Spannungen innerhalb von Gesellschaften und Auseinandersetzungen zwischen Wertesystemen. Diese Konflikte fördern den Aufstieg populistischer und nationalistischer Politiker und Bewegungen – schauen wir etwa auf Donald Trump in den USA und den linkspopulistischen Nouveau Front populaire in Frankreich.
Wie nun können wir diesen dritten Übergang meistern? Welche Maßnahmen sollte die Gesellschaft akut ergreifen, wenn die beobachtete Nichtlinearität uns daran hindert, genaue Vorhersagen für die Zukunft zu treffen? Es sind politische Maßnahmen vonnöten, die einen schrittweisen sozialen und wirtschaftlichen Wandel ermöglichen. Die Alternative wäre, diese Veränderungen jetzt künstlich zu unterdrücken, um sie später explodieren zu lassen. Ich spreche mich dafür aus, dass wir den Übergang zum Wissenszeitalter durch die Ausweitung von drei wichtigen individuellen Freiheiten erleichtern sollten:
Wirtschaftliche Freiheit durch die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens;
Informationsfreiheit durch einen erweiterten Zugang zu Informationen und Computern;
Psychologische Freiheit durch die Einübung und Förderung von Achtsamkeit.
Mit der Zunahme dieser drei Freiheiten wird die Aufmerksamkeitsknappheit sinken. Wirtschaftliche Freiheit stellt Zeit zur Verfügung, die wir derzeit mit Arbeiten verbringen, welche automatisiert werden können und sollten. Informationsfreiheit beschleunigt die Schaffung und Verbreitung von Wissen. Und psychologische Freiheit bringt Rationalität in eine Welt, in der wir mit Informationen überflutet werden. Jede dieser Freiheiten ist für sich genommen wichtig, doch verstärken sie sich auch gegenseitig.
Ein entscheidendes Ziel bei der Verringerung der Aufmerksamkeitsknappheit ist die Verbesserung der Funktionsweise der »Wissensschleife«, die aus dem Erwerb, dem Entwickeln und dem Teilen von Wissen besteht. Für den menschlichen Fortschritt ist die Erlangung größeren Wissens unerlässlich. Die Geschichte der Menschheit ist übersät mit gescheiterten Zivilisationen, die nicht genügend Wissen hervorbringen konnten, um die ihnen gestellten Herausforderungen zu meistern.
Um einen kollektiven Fortschritt durch größere individuelle Freiheiten zu erreichen, benötigen wir bestimmte Werte, welche die Schaffung von Wissen fördern. Dazu gehören kritische Nachforschung, Demokratie und Verantwortungsbewusstsein. Diese Werte stellen sicher, dass die Vorteile der Wissensschleife möglichst vielen Menschen zugutekommen und dabei auch andere Arten einschließen. Sie sind von zentraler Bedeutung für einen erneuerten Humanismus, der sich seinerseits aus der Kraft menschlichen Wissens speist. Diese Wiederbelebung des Humanismus ist besonders drängend, da wir kurz davorstehen, mithilfe von Gentechnik und der Technisierung des Körpers beziehungsweise künstlicher Intelligenz »Transhumans« beziehungsweise »Neohumans« zu erschaffen. Die Welt nach dem Kapital argumentiert, dass nur diese Kombination aus größeren Freiheiten und starken humanistischen Werten es uns ermöglichen wird, den Übergang vom Industrie- zum Wissenszeitalter gefahrlos zu bewältigen. Ich bin zutiefst optimistisch, was das wahre Potenzial für den menschlichen Fortschritt angeht. Pessimistisch stimmt mich jedoch, welchen Weg wir aktuell verfolgen. Offenbar sind wir fest entschlossen, um jeden Preis am Industriezeitalter festzuhalten, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit eines heftigen Umbruchs erhöht. Ich hoffe, dass ich mit diesem Buch einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, die Menschheit auf friedliche Weise voranzubringen.
Digitale Technologien
Milliarden Menschen auf der ganzen Welt tragen Smartphones mit sich herum – leistungsstarke Computer also, die mit einem globalen Netzwerk, dem Internet, verbunden sind. Wir verbringen oft sehr viele Stunden am Tag mit diesen Geräten und den Applikationen darauf, spielen, nutzen soziale Medien oder arbeiten natürlich auch mit ihnen. Doch trotz der zunehmenden Allgegenwart von digitalen Technologien können wir oft kaum genau benennen, worin ihre besondere Macht besteht. So haben sich manche Menschen gar über die neuesten Entwicklungen lustig gemacht, indem sie auf Dienste wie X/Twitter verwiesen und behaupteten, diese seien im Vergleich zu anderen Technologien, etwa der Impfstoffentwicklung, vollkommen unbedeutend.
Dabei wird es immer schwieriger, die disruptive Wirkung digitaler Technologien zu ignorieren. So haben viele alteingesessene Unternehmen wie Zeitungen und Einzelhändler mit Schwierigkeiten zu kämpfen, während Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google heute zu den weltweit am höchsten bewerteten Unternehmen gehören (»List of public corporations« 2020).
Zwei besondere Eigenschaften der digitalen Technologie erklären, warum diese den Raum des Möglichen für die Menschheit dramatisch erweitert und deutlich über alles bisher Mögliche hinausgeht: Null-Grenzkosten und universelle Programmierbarkeit.
Null-Grenzkosten
Sobald eine Information im Internet vorhanden ist, kann sie überall im Netz ohne zusätzliche Kosten abgerufen werden. Und da immer mehr Menschen auf der ganzen Welt Internetzugriff haben, bedeutet »überall im Netz« zunehmend »überall auf der Welt«. Die Server, Netzwerkverbindungen und Endgeräte sind ohnehin in Betrieb. Es kostet also nichts, eine zusätzliche digitale Kopie der Informationen anzufertigen und sie über das Netz zu übertragen. In den Wirtschaftswissenschaften spricht man in diesem Fall von Null-Grenzkosten. Das bedeutet nicht, dass man nicht versuchen wird, für diese Informationen Geld zu verlangen und es in vielen Fällen auch tut. Aber hier spielt nur der Preis, nicht die Kosten, eine Rolle.
Null-Grenzkosten unterscheiden sich grundlegend von allem, was in der analogen Welt gültig war, und sie ermöglichen ganz erstaunliche Dinge. Stellen Sie sich vor, Sie besäßen eine Pizzeria. Sie zahlen Miete für Ihren Laden und Ihre Ausstattung, und Sie zahlen Gehälter für Ihre Mitarbeiter und sich selbst. Dies sind von der Anzahl der gebackenen Pizzen unabhängige Fixkosten. Die variablen Kosten dagegen stehen in Relation zur Anzahl der hergestellten Pizzen. Sie bestehen aus den Kosten für Wasser, Mehl und weitere Zutaten, aus den Lohnkosten für eventuelle zusätzliche Mitarbeiter und den Energiekosten zum Beheizen Ihres Ofens. Wenn Sie mehr Pizzen herstellen, steigen Ihre variablen Kosten, bei weniger Pizzen sinken sie.
Was sind also Grenzkosten? Nehmen wir an, Sie backen jeden Tag 100 Pizzen. Dann bestehen die Grenzkosten in den zusätzlichen Kosten für die Herstellung einer weiteren Pizza. Angenommen, der Ofen ist bereits heiß und hat noch Platz und Ihre Mitarbeiter sind nicht voll ausgelastet, dann bleiben nur die Kosten für die Zutaten, die wahrscheinlich relativ niedrig sind. Ist der Ofen aber bereits abgekühlt, dann beinhalten die Grenzkosten für die zusätzliche Pizza die Energiekosten für das Wiederaufheizen des Ofens und fallen unter Umständen recht hoch aus.
Aus unternehmerischer Sicht haben Sie so lange Interesse, diese zusätzliche Pizza herzustellen, wie Sie sie für einen die Grenzkosten übersteigenden Betrag verkaufen. Jeder Cent, den Sie für die zusätzliche Pizza über die Grenzkosten hinaus verlangen können, ist ein Beitrag zur Deckung Ihrer Fixkosten, und falls diese bereits gedeckt sind, kann das Geld als Gewinn verbucht werden.
Die Grenzkosten sind auch aus sozialer Sicht von Bedeutung. Solange ein Kunde bereit ist, mehr als die Grenzkosten für diese eine Pizza zu zahlen, haben beide Seiten einen möglichen Vorteil – Sie erhalten einen zusätzlichen Beitrag zu Ihren Fixkosten oder Ihren Gewinnen, und Ihr Kunde kann die Pizza essen, die er haben wollte und für die er bereit war zu zahlen. (Ich spreche von einem »möglichen« Vorteil, weil Menschen manchmal Dinge haben wollen, die eigentlich nicht gut für sie sind.)
Betrachten wir nun, was passiert, wenn die Grenzkosten von einem hohen Niveau aus sinken. Nehmen wir an, Ihre besondere Zutat ist eine sehr teure Trüffel, wodurch die Grenzkosten für jede Ihrer Pizzen 1000 Dollar betragen. Sie würden dann natürlich nicht viele Pizzen verkaufen und daher beschließen, auf billigere Zutaten umzusteigen, um Ihre Grenzkosten so weit zu senken, dass eine größere Anzahl Kunden bereit ist, mehr als Ihre Grenzkosten zu zahlen, und damit Ihr Umsatz steigt. Wenn Sie die Grenzkosten dann noch durch zusätzliche Prozess- und Produktverbesserungen weiter senken, könnten Sie noch mehr Pizzen verkaufen.
Stellen Sie sich nun vor, Sie könnten durch irgendeine wundersame Erfindung zusätzliche leckere Pizzen zu Grenzkosten von nahezu null (sagen wir, einem Cent pro zusätzliche Pizza) herstellen und sie augenblicklich an jeden Ort der Welt schicken. Sie wären somit in der wunderbaren Lage, eine sehr große Anzahl an Pizzen zu verkaufen. Mit einem Preis von nur zwei Cent pro Pizza würden Sie einen Cent Gewinn für jede zusätzlich verkaufte Pizza machen. Angesichts derart niedriger Grenzkosten könnten Sie schnell ein Monopol auf dem weltweiten Pizzamarkt erlangen (dazu später mehr). Jeder mit ein wenig Appetit und mindestens zwei Cent in der Tasche würde eine Pizza bei Ihnen kaufen.
Aus gesellschaftlicher Sicht wäre der beste Preis für Ihre Pizza ein Cent, also die Höhe Ihrer Grenzkosten. Der Pizzahunger würde gestillt, und Sie deckten Ihre Grenzkosten. Können aber nur Sie allein Pizzen so billig herstellen und ausliefern, besitzen Sie damit ein weltweites Pizzamonopol, dem niemand Konkurrenz machen kann. Als Monopolist würden Sie wohl kaum einen Verkaufspreis in Entsprechung Ihrer Grenzkosten festsetzen. Stattdessen würden Sie Ihre Gewinne maximieren, indem Sie einen deutlich höheren Preis verlangten. Darüber hinaus würden Sie womöglich problematische Maßnahmen ergreifen, die darauf abzielten, Ihre Gewinne zu sichern und weiter zu steigern. Sie könnten Konkurrenten am Markteintritt hindern und möglicherweise sogar versuchen, die Menschen süchtig nach Pizza zu machen, damit sie immer mehr davon konsumierten.
Eben an diesem Punkt stehen wir derzeit im Kontext der Digitaltechnologie. Wir können die Welt mit Informationen »füttern«. Ein zusätzlicher Videoaufruf bei YouTube, ein zusätzlicher Zugriff auf Wikipedia oder ein zusätzlicher Verkehrsbericht von Waze haben allesamt null Grenzkosten. Uns mögen diese Vorgänge nicht mehr erstaunen, doch aus der Sicht einer Zeit, in der es nur gedruckte Enzyklopädien gab, kann die Fähigkeit, das gesamte menschliche Wissen überall auf der Welt zum Null-Grenzkostenpreis verfügbar zu machen, nur wie Zauberei erscheinen.
Null-Grenzkosten sind uns ungewohnt. Die derzeitige Wirtschaftslehre beruht auf der Annahme, dass die Grenzkosten immer größer als null sind. Null-Grenzkosten sind somit etwas wie eine wirtschaftliche Singularität, ähnlich der Division durch null in der Mathematik. Nähert man sich dem Phänomen an, geschehen seltsame Dinge. Wir erleben die Entstehung digitaler Beinahemonopole, mit all den Problemen, die dies mit sich bringt. (Eine Lösung dafür schlage ich im vierten Teil, Abschnitt zwei vor.)
Zudem beobachten wir eine den Potenzgesetzen folgende Verteilung von Einkommen und Vermögen (siehe dritter Teil), bei der kleine, oft zufällige Abweichungen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen. Darüber hinaus nähern wir uns dem Sonderfall der Null-Grenzkosten derzeit auch in vielen anderen Branchen, die in erster Linie auf Informationen beruhen, wie zum Beispiel im Finanz- und Bildungswesen. Null-Grenzkosten, so lässt sich zusammenfassend feststellen, sind das erste Merkmal der digitalen Technologie, mit dem sich der Raum des Möglichen dramatisch erweitert. Dies kann zur Monopolbildung führen, birgt aber auch die Chance, allen Menschen Zugang zum Wissen der Welt zu gewähren.
Universelle Programmierbarkeit
Neben den Null-Grenzkosten gibt es eine zweite, den Raum des Möglichen erweiternde Eigenschaft der digitalen Technologie, die in mancher Hinsicht noch erstaunlicher ist.
Computer sind universelle Maschinen, die im Prinzip jedes erdenkliche Rechenproblem lösen können, wenn genügend Speicherplatz und Zeit vorhanden sind. Das wissen wir seit Alan Turing, dem britischen Pionier der Informatik, und seinen bahnbrechenden Arbeiten aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Er erdachte eine abstrakte Version eines Computers, die wir heute Turingmaschine nennen, und erbrachte sodann den Beweis dafür, dass diese einfache Maschine alles berechnen kann (Mullins 2012; »Church-Turing thesis« 2020).Mit »Berechnung« meine ich jeden Prozess, der eine Dateneingabe annimmt, eine Reihe von Verarbeitungsschritten ausführt und daraufhin Daten ausgibt. Im Wesentlichen führt auch das menschliche Gehirn solche Rechenprozesse aus: Es empfängt über die Nerven Input, führt interne Verarbeitungsschritte aus und erzeugt Output. Im Prinzip kann eine digitale Maschine alle Berechnungen durchführen, die auch ein menschliches Gehirn durchführen kann. Diese umfassen so einfache und alltägliche Dinge wie das Erkennen eines Gesichts (Input: Bild, Output: Name der Person) bis hin zu so komplizierten Dingen wie der Diagnose von Krankheiten (Input: Symptome und Testergebnisse, Output: Differenzialdiagnose).
Dabei ist die Einschränkung »im Prinzip« nur von Bedeutung, falls für die Funktionsweise des Gehirns Quanteneffekte eine Rolle spielen könnten – damit sind Effekte gemeint, die Quantenphänomene wie die Verschränkung und Überlagerung von Zuständen erfordern. Die Hypothese wird in der Wissenschaft jedenfalls heftig diskutiert (Jedlicka 2017). Doch auch Quanteneffekte ändern nichts an der prinzipiellen Berechenbarkeit, da eine Turingmaschine theoretisch auch einen Quanteneffekt simulieren kann – allerdings würde dies eine unvorstellbar lange Zeit, möglicherweise Millionen Jahre, in Anspruch nehmen (Timpson 2004). Falls Quanteneffekte an der Gehirnleistung beteiligt sind, brauchen wir möglicherweise weitere Fortschritte in der Quanteninformatik, um bestimmte Rechenprozesse des Gehirns nachzubilden. Ich nehme jedoch an, dass Quanteneffekte für den Großteil der vom menschlichen Gehirn durchgeführten Berechnungen nicht entscheidend sind, und falls sie überhaupt eine Rolle spielen, tun sie das wohl eher beim Bewusstsein. Es kann natürlich sein, dass wir eines Tages neue Aspekte der physikalischen Realität entdecken und sich unsere Einschätzung zur Berechenbarkeit von Phänomenen ändern wird. Bis jetzt ist jedoch nichts konkret.
Da Computer im Vergleich zum Menschen lange Zeit ziemlich dumm waren, spielte diese Eigenschaft der Universalität keine große Rolle. Für die Computerwissenschaftler, die seit Turing glaubten, dass es möglich sein müsste, eine intelligente Maschine zu bauen, es aber jahrzehntelang nicht hinbekamen, war das natürlich eine frustrierende Erfahrung. Selbst bei für den Menschen einfachen Dingen wie Gesichtserkennung waren die Computer ratlos. Heutige Computer allerdings können Gesichter viel besser erkennen als Menschen.
Eine Analogie dazu ist die Entdeckung des Fliegens. Wir wussten zwar schon lange, dass Körper, die schwerer sind als Luft, fliegen können, doch erst 1903, als die Gebrüder Wright die erste flugfähige Maschine bauten, fanden wir heraus, wie dies tatsächlich gelingen kann (»Wright brothers« 2020). Die Erfolge der Flugpioniere traten einen raschen Fortschritt los. Von der Entdeckung des Menschenflugs bis zur Atlantiküberquerung in Passagierflugzeugen vergingen nur 55 Jahre: Der erste transatlantische Passagierflug der British Overseas Airways Corporation fand 1958 statt (»British Overseas Airways Corporation« 2020). Auf ein Diagramm übertragen, ist diese Entwicklung ein perfektes Beispiel für Nichtlinearität. Denn die Flugtechnik wurde nicht etwa über einen langen Zeitraum hinweg kontinuierlich besser, sondern war zunächst nicht vorhanden und hat sich dann mit einem Mal rasant fortentwickelt.
Mit der digitalen Technologie verhält es sich ähnlich. Eine Reihe von Durchbrüchen hat uns von quasi null Maschinenintelligenz dahin katapultiert, dass Computer den Menschen bei verschiedenen Aufgaben, etwa dem Lesen von Handschriften und dem Erkennen von Gesichtern, übertreffen können (Neuroscience News 2018; Phillips et al. 2018). Die Geschwindigkeit, mit der Maschinen das Autofahren lernen, ist ein weiteres Beispiel für die Nichtlinearität des Fortschritts. 2004 veranstaltete die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ihre erste »Grand Challenge» für selbstfahrende Autos. Es wurde eine 240 Kilometer lange, geschlossene Strecke in der Mojave-Wüste ausgewählt, doch kein Auto kam weiter als rund elf Kilometer (das sind weniger als 5 Prozent der Strecke). 2012 dann, also weniger als ein Jahrzehnt später, hatten Googles selbstfahrende Autos bereits über 480 000 Kilometer im Verkehr auf öffentlichen Straßen zurückgelegt (Urmson 2012), inzwischen sind selbstfahrende Taxis von Waymo in mehreren Städten im Einsatz.
Nun mag man einwenden, dass das Lesen von Handschriften, das Erkennen von Gesichtern oder das Fahren eines Autos nicht das ist, was wir unter Intelligenz verstehen. Doch möglicherweise stimmt hier unsere Definition von Intelligenz nicht ganz. Hätten Sie einen Hund, der eine dieser Aufgaben erfüllen könnte, oder gar alle drei, würden Sie ihn dann nicht als intelligentes Tier bezeichnen?
Auch wird darauf hingewiesen, dass wir Menschen Kreativität besitzen, Maschinen jedoch niemals kreativ sein werden, selbst wenn wir ihnen eine gewisse Form der Intelligenz zugestehen. Dies läuft jedoch auf die Behauptung hinaus, dass Kreativität etwas anderes ist als ein Verarbeitungsprozess. Das Wort impliziert, dass etwas aus dem Nichts entsteht, dass eine Ausgabe ohne Eingabe stattfindet. Dies entspricht jedoch nicht dem Wesen der menschlichen Kreativität. Schließlich erschaffen Musiker neue Musikwerke, nachdem sie viel Musik gehört haben, und Ingenieure erfinden neue Maschinen, nachdem sie bestehende gesehen haben – die Reihe ließe sich für alle möglichen Bereiche fortsetzen.
Inzwischen gibt es Belege dafür, dass zumindest bestimmte Arten von Kreativität durch Computerberechnung nachgebildet werden können. Im Jahr 2016 gelang Google ein Durchbruch in der maschinellen Intelligenz, als das Programm AlphaGo den südkoreanischen Go-Großmeister Lee Sedol mit vier zu eins schlug (Borowiec 2016). Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es im Bereich der Go-Spielesoftware nur recht langsame Fortschritte gegeben. Auch die besten Programme waren nicht in der Lage, starke Vereinsspieler, geschweige denn Großmeister zu schlagen. Die Anzahl der möglichen Züge beim Go ist ungleich größer als beim Schach. Das bedeutet, dass die Abfrage möglicher Züge und Gegenzüge, die Schachcomputer für jede Situation durchführen, beim Go nicht möglich ist – stattdessen müssen in Betracht kommende Züge vermutet werden. Anders ausgedrückt: Das Go-Spiel erfordert Kreativität.
Für das AlphaGo-Programm wurde ein neuronales Netzwerk mithilfe vergangener, von Menschen gespielter Partien trainiert. Sobald das Netzwerk ein gewisses Niveau erreicht hatte, wurde es noch verbessert, indem es gegen sich selbst spielte. Inzwischen werden diese und ähnliche Techniken, die unter dem Begriff »Generative Adversial Networks« (GAN) zusammengefasst werden, auch für die Komposition von Musik und die Erstellung von Designs angewendet. Noch überraschender ist, dass Maschinen nicht nur durch die Analyse vorhandener Spiele oder Designs Kreativität erlernen können, sondern diese auf der Grundlage von Regeln auch selbst entwickeln. Die beiden Nachfolger von AlphaGo, AlphaGo Zero und AlphaZero, kannten anfangs nur die Regeln des Spiels, lernten aber hinzu, indem sie gegen sich selbst spielten (»AlphaZero« 2020). Dieser Ansatz wird es Maschinen ermöglichen, in Bereichen kreativ zu sein, in denen der Mensch bisher nur begrenzte oder keine Fortschritte gemacht hat.
In den letzten zwei Jahren hat es bei Systemen, die Bilder, Musik und sogar Videos erzeugen können, rasche Erfolge gegeben. Modelle wie Midjourney und DALL-E verwenden Texteingaben zum Zeichnen von Bildern. Suno schreibt Lieder mit Musik und Text auf der Grundlage von Informationen (Prompts) des Nutzers. Diese Modelle wurden mit vorhandenen Inhalten im Umfang von Millionen Stunden trainiert.
Es gibt den Einwand, der Output der Modelle sei nur eine neue Zusammenstellung dessen, was Menschen geschaffen haben, aber auch hier ist man offenbar bestrebt, den Begriff »Kreativität« besonders eng zu fassen. Wäre Ihr Hund in der Lage, nach Ihren Wünschen Bilder zu malen, würden Sie ihn sicher als kreativ bezeichnen. Für viele Menschen sind die Ergebnisse dieser Modelle bereits nicht von menschlichen Werken zu unterscheiden. Mögen auch nicht alle Fragen zur Kreativität beantwortet sein, etwa wie neue Genres entstehen oder wie Menschen mathematische Beweise ersinnen, besteht doch kein Zweifel daran, dass Maschinen inzwischen ein erhebliches Maß an Kreativität erreicht haben.
Tatsächlich besteht ein Großteil der Gehirntätigkeit und viele Aufgaben, die wir als kreativ bezeichnen, aus Berechnungen. Und doch gibt es eine Eigenschaft des menschlichen Gehirns, die digitalen Maschinen vielleicht nie zugänglich sein wird: Qualia.
Der Begriff stammt aus der Philosophie und bezieht sich auf unser subjektives Erleben, indem er berücksichtigt, wie es sich etwa anfühlt, wenn einem kalt oder warm ist, wenn man ein bestimmtes Material berührt oder wenn man gestresst oder erstaunt ist. Einem digitalen Thermostat, der die Raumtemperatur anzeigt, sprechen wir ganz sicher kein inneres Erleben zu, das unserem subjektiven Empfinden nahekommt. Auch in viel komplexeren Situationen, etwa wenn sich ein selbstfahrendes Auto auf der Autobahn in die Kurve legt, würden wir keine Qualia ins Spiel bringen. Ein menschlicher Fahrer, so vermuten wir, wird hier Nervenkitzel oder Freude empfinden, nicht aber das Auto, zumindest nicht in derselben Form wie ein Mensch. Das Fehlen oder zumindest die Andersartigkeit von Qualia bei digitalen Maschinen mag nebensächlich erscheinen, ist aber ein wichtiger Teil dessen, worauf die Menschen im Wissenszeitalter ihre Aufmerksamkeit richten könnten.
Universalität bei Null-Grenzkosten
So beeindruckend Null-Grenzkosten und universelle Programmierbarkeit für sich genommen sind, erst in Kombination offenbart sich ihre wahre Stärke. Nehmen wir ein Beispiel: Wir erzielen derzeit gute Fortschritte bei der Entwicklung eines Computerprogramms, das in der Lage sein wird, anhand der Symptome eines Patienten schrittweise eine Diagnose zu erstellen, einschließlich der Anordnung von Untersuchungen und der Interpretation ihrer Ergebnisse (Parkin 2020). Aufgrund des Universalitätsprinzips war zu erwarten, dass wir irgendwann an diesen Punkt gelangen würden, doch die greifbaren Fortschritte deuten darauf hin, dass wir das Ziel schon in einigen Jahrzehnten, wenn nicht früher, erreichen werden. Dank der Grenzkosten von null könnten wir dann jedem Menschen auf der Welt eine kostengünstige Diagnose anbieten. Lassen Sie das auf sich wirken: Durch die digitalen Technologien liegt eine kostenlose medizinische Diagnose für alle im Bereich des Möglichen.
Universelle Berechenbarkeit zum Null-Grenzkostenpreis ist eine Qualität, die wir mit früheren Technologien nicht erlebt haben. Nie zuvor war es möglich, sämtliche Informationen und das gesamte Wissen der Welt für die gesamte Menschheit zugänglich zu machen. Genauso wenig vorstellbar waren intelligente Maschinen. Jetzt haben wir beides. Dies bedeutet für die Menschheit eine mindestens ebenso dramatische und nicht lineare Erweiterung vom »Raum des Möglichen«, wie ihn zuvor die Landwirtschaft und die Industrie hervorgerufen haben. Beide Entwicklungen haben ein völlig neues Zeitalter eingeläutet. Für ein tiefer gehendes Nachdenken darüber, was dies für den gegenwärtigen Übergang und das nächste Zeitalter bedeutet, sollten wir zunächst eine theoretische Grundlage schaffen.
Teil 1
Grundlagen
Angesichts der fundamentalen Erweiterung unserer Möglichkeiten durch digitale Technologien sollten wir einige Grundprinzipien festlegen, mit denen sich Fehlinterpretationen aktueller Trends und Phänomene vermeiden lassen. Anhand dieser Prinzipien sind wir in der Lage, den neuen Raum des Möglichen und die damit verbundenen Vorteile wirklich zu erforschen, anstatt die Technologie so zurechtzustutzen, dass sie in unsere bestehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systeme passt.
Im Folgenden möchte ich also versuchen, eine solide Grundlage für eine mögliche Zukunft zu schaffen, indem diese auf einem klaren Wertesystem beruht. Ich beginne mit einer kurzen Definition von »Wissen«, einem Begriff, den ich ausgiebig und etwas anders als im allgemeinen Sprachgebrauch verwende. Daran anschließend erläutere ich die Beziehung zwischen Optimismus und Wissen und betone dabei die Wichtigkeit von Entscheidungen bei der Gestaltung unserer Zukunft. Daraufhin wird erörtert, warum das Vorhandensein von Wissen eine objektive Grundlage für den Humanismus bietet und ihn so von religiösen und philosophischen Erzählungen unterscheidet. Ein Großteil meiner Überlegungen in diesem Bereich wurde durch die Schriften von David Deutsch beeinflusst, insbesondere durch sein Buch The Beginning of Infinity (dt. Am Anfang der Unendlichkeit), in dem er sich mit der Geschichte, Philosophie und Bedeutung von Erklärungen befasst (Deutsch 2011/2021).
Sodann liefere ich eine direkt an den menschlichen Bedürfnissen statt an Geld und Preisen ausgerichtete Definition von Knappheit, anhand der ich zeige, wie technischer Fortschritt die Knappheit im Laufe der Geschichte verlagert und damit unsere Lebensweise dramatisch verändert hat. Mithilfe dieser Überlegungen entwickle ich einen Angriffsplan für den Rest des Buches.





























