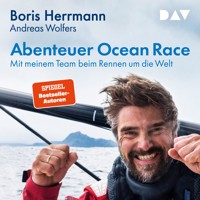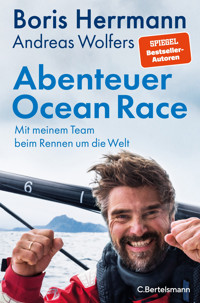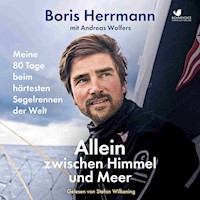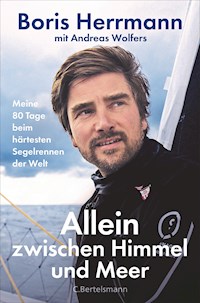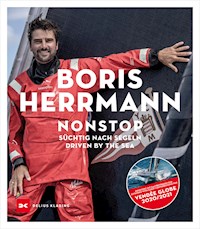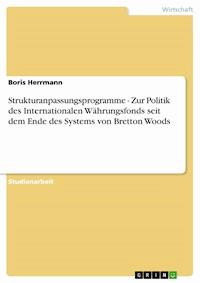17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Spitzensegler Boris Herrmann über das, was ihn zum Ausnahmesportler gemacht hat und was ihm das Segeln und sein Engagement für Wissenschaft und Naturschutz bedeuten
Wie ist Boris Herrmann zu dem Ausnahmesegler geworden, der er ist? Welche Erlebnisse, welche Menschen haben ihn geprägt? Was ist ihm wichtig? Seit seiner Teilnahme an der Soloweltumseglung Vendée Globe im Winter 2020/21 ist der Wahl-Hamburger auch Nichtseglern ein Begriff. Im Winter 2024/25 musste er bei der härtesten Regatta der Welt erneut über seine körperlichen und mentalen Grenzen gehen. Boris Herrmann ist jedoch nicht nur erfolgreicher Segler, er ist auch engagierter Umweltaktivist, der sich für den Schutz und die Erforschung der Meere einsetzt. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Journalisten und Autor Walter Wüllenweber ist ein Buch entstanden, das beide Lebensthemen von Boris Herrmann verbindet – das Segeln am Limit und die gefährdete Welt unter seinem Boot. Erstmals gibt Herrmann hier auch Einblicke in ein faszinierendes Projekt, das in enger Zusammenarbeit mit Meeresforschungsinstituten entsteht.
Mit zahlreichen farbigen Abbildungen im Text.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Prolog
Kapitel 1 Die Zukunft unseres Lebens auf der Erde entscheidet sich im Meer
Kapitel 2 Das Rennen vor dem Rennen
Kapitel 3 Auf Beutezug im Ozean
Kapitel 4 Die ersten Tage auf See
Kapitel 5 Verbrechen auf den Weltmeeren
Kapitel 6 Schnellzug nach Kapstadt
Kapitel 7 Ein Team, zwei Leidenschaften
Kapitel 8 MacGyver holt auf
Kapitel 9 Seinen Traum nicht zu verwirklichen, ist das größte Unglück
Kapitel 10 Solosegeln ist ein Mannschaftssport
Kapitel 11 Pirouette im Morgengrauen
Kapitel 12 Das Fossil-Imperium schlägt zurück
Kapitel 13 Die Pannenserie
Kapitel 14 Hoffnung ist was für Realisten
Kapitel 15 Kollision mit Folgen und endlich ein Wiedersehen mit Familie und Team
Anhang
Anmerkungen
Zitierte und weiterführende Literatur
Liebe Leserin, lieber Leser,
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
Spitzensegler Boris Herrmann über das, was ihn zum Ausnahmesportler gemacht hat und was ihm das Segeln und sein Engagement für Wissenschaft und Naturschutz bedeuten
Wie ist Boris Herrmann zu dem Ausnahmesegler geworden, der er ist? Welche Erlebnisse, welche Menschen haben ihn geprägt? Was ist ihm wichtig? Seit seiner Teilnahme an der Soloweltumseglung Vendée Globe im Winter 2020/21 ist Boris Herrmann auch Nichtseglern ein Begriff. Im Winter 2024/25 war er erneut bei dieser härtesten Regatta der Welt dabei und musste in 80 Tagen allein auf hoher See einige Herausforderungen meistern. Aus seinen Erinnerungen und Gesprächen mit Weggefährten, die Co-Autor Walter Wüllenweber geführt hat, entsteht das Bild eines Spitzensportlers, der sich nicht nur immer wieder Extremen aussetzt und an körperliche und mentale Grenzen geht, sondern der sich auch intensiv mit der gefährdeten Welt unter seinem Boot beschäftigt und sich für den Schutz der Meere engagiert. Erstmals gibt er hier auch Einblicke in ein faszinierendes Projekt, das in enger Zusammenarbeit mit Meeresforschungsinstituten entsteht.
Boris Herrmann, geboren 1981 in Oldenburg, ist der bekannteste deutsche Segler. Der Profisportler nahm 2020/21 erstmals an der Vendée Globe teil, einer Regatta für Solo-Segler, die nonstop um die Erde führt. Sein Buch über das Rennen, Allein zwischen Himmel und Meer, wurde ein großer Bestsellererfolg. 2023 startete Herrmann mit einer neuen Rennyacht und einem vierköpfigen Team beim Ocean Race. Die seit fünfzig Jahren durchgeführte Regatta um die Erde gilt als anspruchsvollster Teamwettbewerb der Sportwelt. Abenteuer Ocean Race erzählt die spannende Geschichte dieses Rennens. Gemeinsam mit seiner Frau Birte Lorenzen-Herrmann und seinem Team Malizia betreibt er das internationale Bildungsprojekt »Malizia Ocean Challenge«. Von November 2024 bis Januar 2025 segelte Boris Herrmann erneut die Vendée Globe.
Walter Wüllenweber, Jahrgang 1962, ist Journalist, Buchautor und Segler. Er besuchte die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg, war Reporter der Berliner Zeitung und 30 Jahre Autor des Magazins stern. Zudem hat er Bücher verfasst: Wir Fernsehkinder (1994), Die Asozialen (2012) und Frohe Botschaft (2018). Als Journalist wurde Wüllenweber mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem »Deutschen Sozialpreis« und als »Reporter des Jahres«, auch erhielt er mehrere Nominierungen zum Henri-Nannen-Preis. Mit seinen beruflichen Erfolgen können die seglerischen nicht ganz mithalten – doch zu ein paar Pokalen auf der Regattabahn hat es gereicht.
www.cbertelsmann.de
Boris Herrmann Walter Wüllenweber
Die Welt unter meinem Boot
Ein Leben für das Segeln und den Schutz der Meere
C.Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 C.Bertelsmann
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Lektorat: Heike Gronemeier, München
Bildbearbeitung: Lorenz+Zeller GmbH, Inning a. A.
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung: © Clément Gerbaud/Qaptur
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33941-8V002
www.cbertelsmann.de
Nachdem ich fast hundert Jahre auf diesem Planeten gelebt habe, verstehe ich jetzt: Der wichtigste Ort auf der Erde liegt nicht an Land, sondern auf dem Meer.
David Attenborough
Inhalt
Vorwort
Prolog
Kapitel 1 Die Zukunft unseres Lebens auf der Erde entscheidet sich im Meer
Kapitel 2 Das Rennen vor dem Rennen
Kapitel 3 Auf Beutezug im Ozean
Kapitel 4 Die ersten Tage auf See
Kapitel 5 Verbrechen auf den Weltmeeren
Kapitel 6 Schnellzug nach Kapstadt
Kapitel 7 Ein Team, zwei Leidenschaften
Kapitel 8 MacGyver holt auf
Kapitel 9 Seinen Traum nicht zu verwirklichen, ist das größte Unglück
Kapitel 10 Solosegeln ist ein Mannschaftssport
Kapitel 11 Pirouette im Morgengrauen
Kapitel 12 Das Fossil-Imperium schlägt zurück
Kapitel 13 Die Pannenserie
Kapitel 14 Hoffnung ist was für Realisten
Kapitel 15 Kollision mit Folgen und endlich ein Wiedersehen mit Familie und Team
Anhang
Anmerkungen
Zitierte und weiterführende Literatur
Vorwort
Ohne Sylvia Earle wäre dieses Buch vermutlich nie entstanden. Lange bevor ich ihr begegnet bin, war ich ein Bewunderer der legendären, inzwischen neunzigjährigen Ozeanografin und Umweltaktivistin. Ich kannte ihre Bücher und hatte viele ihrer Unterwasser-Dokumentationen gesehen. Die Amerikanerin ist eine Pionierin des Tiefseetauchens und hat der Menschheit einmalige Blicke in eine Welt ermöglicht, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Niemand hat sich wirkungsvoller für den Schutz der Ozeane engagiert als »Her Deepness«.
Endlich, im Mai 2024, lernte ich sie persönlich kennen. Beim Transat CIC, einem Solorennen über den Atlantik, war ich von Lorient nach New York gesegelt. Am Zielort der Regatta hatte Team Malizia eine eintägige Ozeankonferenz organisiert, in der Ständigen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen. Vom Rennboot direkt in eine Ozeankonferenz – die perfekte Verbindung meiner beiden großen Lebensthemen: Segelsport und Meeresschutz. Für die Keynote Lecture hatten wir Sylvia Earle gewinnen können. Gleich zu Beginn ihres Vortrags wandte sie sich direkt an mich: »Denkt ihr Segler eigentlich jemals darüber nach, was unter eurem Boot ist?«
Nein, das tun wir in der Regel nicht. Ich bin auf dem Meer aufgewachsen. Ich kenne die Farben, die Schattierungen, die Formen der Oberfläche. Ich kann die Wellen lesen. Aber ganz ehrlich: Für die Welt darunter habe ich mich lange Zeit nicht allzu sehr interessiert. Doch seit gut einem Jahrzehnt habe ich Kontakt zu Wissenschaftlerinnen und Forschern, der mit der Zeit immer enger wurde. Mit einigen bin ich heute befreundet. Erst durch den Austausch mit diesen Experten wurde mir bewusst, wie entscheidend das Meer für das Leben auf unserem Planeten ist. Die Ozeane bedecken nicht nur rund siebzig Prozent der Erdoberfläche, sie umfassen auch 95 Prozent des gesamten Lebensraums auf der Erde. Verglichen damit ist die Welt darüber eine Nebensache der Natur. Für diese restlichen fünf Prozent, für unsere Welt, fungieren die Ozeane als überlebenswichtige Klimaanlage, die den Planeten abkühlt. Denn die gewaltigen Wassermassen absorbieren neunzig Prozent der Wärmeenergie des menschengemachten Klimawandels und rund ein Viertel des Kohlendioxids, das wir in die Umwelt pusten. Das Plankton produziert die Hälfte des gesamten Sauerstoffs, den wir alle atmen. Die Feststellung ist keine Übertreibung: Wenn das größte Ökosystem nicht mehr funktioniert, gibt es kein Leben auf der Erde, zumindest kein menschliches.
Sylvia Earle ist am Meer aufgewachsen. Anders als die Natur an Land waren die Ozeane während ihrer Kindheit noch in einem sehr guten Zustand. Seitdem sind neunzig Prozent der Haie verschwunden. Im Pazifik ist die Anzahl der Bluefin-Thunfische auf drei Prozent geschrumpft. Die Hälfte aller Korallenriffe wurde im Laufe von Sylvias Leben zerstört. Wir haben die Meere in unsere größte Müllkippe verwandelt, an deren Oberfläche riesige Teppiche aus Plastikabfall treiben. Der größte, das »Great Pacific Garbage Patch«, ist so groß wie Frankreich, Deutschland, Polen, Großbritannien und Griechenland zusammen.
Um unseren größten Lebensraum wirksam schützen zu können, müssen wir mehr über ihn wissen. Doch trotz der Fortschritte in der Forschung ist das Unwissen über das Universum unter der Wasseroberfläche noch immer riesig. Das liegt auch am Geldmangel. Von den weltweiten Forschungsetats entfallen nur 1,5 Prozent auf die Ozeanforschung. Darum fehlen den Wissenschaftlern schlicht Daten über die Wasserqualität, besonders aus den entlegensten Regionen des Planeten, in die sich kein Frachtschiff und kein Kreuzfahrtschiff verirrt. Weil ich bei meinen Rennen regelmäßig genau dort segele, nehme ich stets ein kleines Minilabor mit, das unter anderem den CO2-Gehalt des Wassers misst. Auf diese Weise haben wir von Malizia den größten Datensatz aus den südlichen Ozeanen gesammelt, den die internationale Ozeanografie überhaupt zur Verfügung hat.
Neben Geld- und Datenmangel leiden die Meeresforscher auch darunter, nicht oft genug an ihren Arbeitsplatz zu kommen, hinaus aufs Meer. Es gibt nicht genug Forschungsschiffe. Aus diesem Grund haben wir von Malizia eine gebrauchte Segelyacht gekauft und umgebaut, die wir für Forschungsexpeditionen zur Verfügung stellen. Nach unserem Bildungsprogramm »My Ocean Challenge« und dem »Malizia Mangrovenpark« ist das die nächste große Aktion unseres kleinen Teams. Durch das Forschungsschiff heben wir unseren Einsatz für den Naturschutz auf ein neues Level und besitzen nun für jede der beiden Leidenschaften von Team Malizia eine eigene Segelyacht: einen Hochleistungsrenner für die großen Hochseeregatten und eine schwimmende Forschungsstation. Unser neues Baby wurde im Rahmen der UN-Ozeankonferenz von Nizza im Juni 2025 im Yacht Club de Monaco auf den Namen Malizia Explorer getauft. Und natürlich konnte es keine bessere Taufpatin geben als Sylvia Earle, die große Inspiratorin unserer Arbeit.
Schon nach dem Treffen mit ihr in New York war für mich klar, dass das nächste Buch nicht allein von meinen Erlebnissen bei der Vendée Globe erzählen kann. Diesmal liegt der Fokus auf dem Zustand der Ozeane und dem ökologischen Engagement von Team Malizia. Den Titel dafür hat Sylvia Earle eigentlich schon in New York formuliert: »Die Welt unter meinem Boot«.
Mit Sylvia Earle kurz nach der Taufe unseres Forschungsschiffs Malizia Explorer
© Flore Hartout/Team Malizia
Um diese große Materie zu bewältigen, habe ich mich mit Walter Wüllenweber zusammengetan, einem erfahrenen, vielfach ausgezeichneten Journalisten und Buchautor. Normalerweise schreibt er über die großen politischen Themen wie Migration, soziale Ungleichheit oder den Klimawandel. Dass Walter auch ein ambitionierter Regattasegler ist, hat die Zusammenarbeit erleichtert. Die Aufteilung der Aufgaben war simpel: Ich kann besser segeln, Walter kann besser schreiben.
Das Ergebnis ist ein Buch, das meine Geschichte der letzten Vendée Globe 2024/25 mit Einblicken in die unendlichen Weiten der Ozeane und seiner Bewohner verknüpft. Schließlich ist das Spielfeld unseres Sports genau jene Hochsee, die nur wenige jemals zu Gesicht bekommen. Den wenigsten Menschen, nicht mal allen Seglern, ist bewusst: Die Entscheidung über die Zukunft des Planeten und damit unsere eigene fällt im Ozean. Die hohe See liegt hinter dem Horizont, ihre Bedeutung ist ein weißer Fleck in der öffentlichen Wahrnehmung. Daran möchte ich mit diesem Buch etwas ändern. Indem ich meine Faszination für die Ozeane mit Ihnen teile, indem ich davon erzähle, wie wichtig der Meeresschutz ist, von welchen Seiten er bedroht ist, aber auch welche Fortschritte es in den letzten Jahrzehnten gab. Denn die Menschheit ist in der Lage, gemeinsam gewaltige Kraftanstrengungen zu vollbringen. Sie muss es nur wollen. Für mich ist klar: Wer das Segeln liebt, muss die Meere schützen.
Boris Herrmann, im Juli 2025
Prolog
Es ist mit nichts zu vergleichen. Wenn sich eine acht Tonnen schwere Segelyacht aus dem Wasser wuchtet und auf den Foils mehrere Meter über dem Wasser fliegt, spüre ich die ungeheure Power, die in dieser Rennmaschine steckt. Mit einer schweren Limousine gewöhnt man sich rasch an ein Tempo von 200 Stundenkilometern auf der Autobahn. Ans Foilen mit einer Yacht der Imoca-Klasse gewöhnt man sich nicht, auch nicht nach Wochen auf See. Das Adrenalinlevel bleibt hoch.
Ich erinnere mich noch lebhaft an meine erste echte Flugstunde mit einer Imoca. Es war mit meinem ehemaligen Boot, der Malizia II. Wir hatten ihr neue, deutlich größere Foils verpasst. Ob die Yacht damit tatsächlich, wie erhofft, richtig abheben würde, ob sie sich stabil auf den dünnen Flügeln halten und welche Geschwindigkeit sie damit erreichen würde, das war alles andere als sicher. Wir bewegten uns komplett auf technologischem Neuland. Seit vielen Tausend Jahren segeln Menschen und bemühen sich fortwährend, ihre Schiffe zu tunen. Doch tonnenschwere Segelschiffe, die nicht durch, sondern über das Wasser rasen, das gab es noch nie. Schriftsteller haben sich Flugzeuge, Raumschiffe und U-Boote ausgedacht, lange bevor es sie gab. Eine 18 Meter lange Yacht, die foilt, war auch für Fantasten unvorstellbar.
Nachdem wir das umgebaute Boot zu Wasser gelassen hatten, mussten wir zunächst ein paar Tage warten, bis die Windbedingungen ideal für einen Test waren. Dann endlich fuhren mein Co-Skipper Will Harris, Boat-Captain Stuart »Stu« McLachlan und ich hinaus auf den Atlantik. Es dauerte nicht lange, und die Rakete hob tatsächlich ab. Wir brüllten und jubelten in der Kajüte, wie Fußballer, die gerade ein Golden Goal erzielt haben. In diesem Moment gehörten wir zu einer Handvoll Pionieren, die dieses fantastische Spektakel erleben durften.
Abgehoben: Auf der Malizia II erlebte Boris zum ersten Mal das Foilen.
© Same Cade/@samclickclack
Manchmal, wenn Wind und Wellen passen, wenn ich, ohne auf die Instrumente zu achten, instinktiv spüre, dass ich die Segel und die Foils perfekt getrimmt habe und die Imoca nicht nur mit Kraft, sondern mit Leichtigkeit befreit über den Wellen schwebt, dann packt mich dieses Glücksgefühl noch heute. Es nutzt sich nicht ab. Die Geschwindigkeit ist wahrlich ein Rausch. Doch sie ist nicht der entscheidende Antrieb für mich.
Oft fragen mich Fans, Journalisten oder Freunde: Warum machst du das? Warum quälst du dich allein in achtzig Tagen um die Welt? Und warum machst du es wieder, obwohl du schon bewiesen hast, dass du es kannst? Der Reiz an dieser Art des Hochleistungssegelns ist für mich die Möglichkeit, Grenzen auszutesten – und zu verschieben. Wir bewegen uns permanent am Rand des technologischen und menschlichen Leistungsvermögens. Das ist für mich die ultimative Herausforderung. Und wir erleben unmittelbar, oft hautnah, die Grenzen, die die Natur uns setzt. Segeln am Limit bedeutet ein Leben in vielen Grenzbereichen. Das macht die unvergleichliche Faszination meines Berufes aus.
Mit den Abenteuern einer Weltumsegelung, von denen ich als Kind in meinem Zimmer tagträumte, hat das heutige Hochseesegeln mit Rennmaschinen nur noch wenig gemein. Als Bernard Moitessier und Robin Knox-Johnston 1968 am Golden Globe Race teilnahmen, dem Vorgänger der heutigen Vendée Globe, segelten sie in stabilen Fahrtenyachten ohne jeden Firlefanz um die Welt, die ihre Tauglichkeit zuvor vielfach unter Beweis gestellt hatten. Getestet wurde der Mensch, nicht das Material. Das Segeln mit einer Imoca von heute ist dagegen ein einziges technisches Experiment. Ständig probieren wir neue Materialien und Techniken aus, die vorher noch nie zum Einsatz gekommen sind. Vor über zwanzig Jahren ging es darum, zuverlässige Schwenkkiele zu bauen. Nach vielen Runden mit Versuch und Irrtum gehört der »Canting-Keel« inzwischen zum Standard auf Rennyachten. Seit etwa zehn Jahren arbeiten wir daran, das Foilen zu beherrschen. Bei den Entwicklungen helfen uns immer leistungsfähigere Computermodelle, doch auch die beste Software kann die perfekten Foils nicht vollständig berechnen. So lässt sich beispielsweise nicht exakt vorhersagen, wann und an welcher Stelle des Foils die »Kavitation« auftritt, jene kleinen Dampfbläschen, die durch Druck an der Vorderseite der Foils entstehen und deren Effektivität deutlich reduzieren. Weil sie von vielen sich ständig verändernden Variablen abhängig ist – Geschwindigkeit, Wassertemperatur, Wellengang und vieles mehr –, überfordert die Komplexität der Kavitation jedes Rechenmodell.
Als Imoca-Segler ist man immer ein Testpilot. Wir segeln mit Maschinen um die Welt, die vollgestopft sind mit kaum erprobter Technik – denn wir sind es, die sie erproben. Das ist auch der Hauptgrund, warum die Neubauten, die an der Vendée Globe teilnehmen, sich so massiv unterscheiden. So sind einige Schiffe um fast einen Meter schmaler als andere.
Die Arbeit im technischen Grenzgebiet ist eine wichtige Motivation für mich, weil sie meine Neugier befriedigt. Laufend lerne ich etwas Neues. Ich bin überzeugt: Kein Industriekonzern könnte ein Rennboot bauen, so wie wir das machen. Zum einen, weil die besten Experten ihres Faches in unseren Teams arbeiten. Zum anderen, weil wir uns außerhalb der ökonomischen Rationalität bewegen. Wir fragen uns nicht, ob sich eine Lösung am Markt durchsetzt oder wirtschaftlich rentiert. Entscheidend ist, ob wir glauben, dass etwas das Boot schneller oder sicherer macht. Diese Kompromisslosigkeit gibt es nur in einem Start-up wie Malizia.
Weil wir nicht mit bis in jedes Detail ausgereiften Serienmodellen, sondern mit Prototypen unterwegs sind, wird die Vendée Globe niemals von einem Skipper gesteuert werden können, der zu Hause im Hobbykeller sitzt, mit dem Joystick in der Hand. Unsere Rennyachten sind keine Drohnen eines Rüstungskonzerns, die über Jahre getestet werden. Auf einem Rennen um die Welt geht ständig etwas kaputt, das repariert werden muss. Auf See sind die meisten Ereignisse zudem unvorhersehbar. Es gibt nur ein System, das all diese Schwierigkeiten bewältigt und immer funktioniert, ohne Strom, ohne Verbindung zu einem Satelliten und auch in unvorhersehbaren Situationen, für die es kein Vorbild und keinen Plan gibt: der Mensch. Wer sonst klettert auf den Mast, wer sichert ein gebrochenes Foil? Ohne das Improvisationstalent des Menschen droht beim kleinsten Fuck-up der Totalverlust des Bootes. In den Disziplinen Problemlösung und Resilienz bleiben wir unerreicht. Je intensiver ich mich mit der Technik auseinandersetze, umso mehr bestärkt mich das in meiner Überzeugung. All die Unterstützungssysteme steigern die Leistung der Skipper. Aber über den Sieg bei der Vendée Globe entscheidet am Ende der Instinkt, das Bauchgefühl der Segler. Ausschlaggebend für den Sieg im Rennen bleiben weiterhin die menschlichen Fähigkeiten. Der Kapitän auf dem Schiff bleibt der Mensch.
Ein Segelboot kann man perfektionieren. Wir Segler können uns körperlich und mental fit machen für eine Weltumsegelung. Das Sportgerät und den Sportler können wir beeinflussen. Beim Hochseesegeln gibt es jedoch einen noch wichtigeren Faktor, den wir nicht beeinflussen und nie vollständig vorausberechnen können: den Ozean. Jede Welle ist einzigartig und wird sich nie wiederholen. Wann eine konkrete Welle bricht, wie hoch sie sich auftürmt, in welchen Perioden Wellen heranrollen, all das wird man vermutlich niemals exakt vorhersagen können. Draußen auf dem Ozean entscheidet sich, wo ein Tiefdruckgebiet entsteht und wo ein Flautenloch, über welchem Boot ein Gewittersturm tobt, wer von einer Böe angetrieben wird. Weil es auf der hohen See viel weniger Messstationen gibt als an Land, sind hier auch die Wetterprognosen noch sehr unzuverlässig. Das musste ich bei dieser Vendée Globe erneut erfahren.
Wie für alle Generationen zuvor bleiben die Ozeane auch für uns ein Mysterium, unberechenbar, unbesiegbar. Je mehr wir die Meere erforschen, umso deutlicher wird, wie wenig wir über sie wissen. Ich glaube, es war der Philosoph Karl Popper, der von der »Unendlichkeit des Nichtwissens« sprach. Für die Ozeane ist das eine besonders zutreffende Formulierung. Und jede neue Erkenntnis öffnet die Tür zu einem neuen Universum des Nichtwissens. Im Schnitt entdecken Wissenschaftler jeden Tag etwa sechs neue Arten von Meereslebewesen, doch sie können nicht abschätzen, wie viele Millionen noch unentdeckt sind.
Sicher ist jedoch, dass die Meere sich durch den menschengemachten Klimawandel massiv verändern. Viel zu lange haben wir den größten Lebensraum der Erde ausgeplündert, zugemüllt und aufgeheizt. Und noch immer ist den meisten Menschen die überragende Bedeutung der Meere für unsere Zukunft nicht bewusst. Was für die Vendée Globe gilt, ist auch für die Zukunft der Menschheit richtig: Das letzte Wort hat der Ozean.
Kapitel 1 Die Zukunft unseres Lebens auf der Erde entscheidet sich im Meer
An Heiligabend des Jahres 1968 machte der Amerikaner William Anders der Menschheit ein Weihnachtsgeschenk von unschätzbarem Wert. Es sollte unseren Blick auf die Welt für immer verändern.
Wenige Tage zuvor, am 21. Dezember 1968 um 7 Uhr 51 Ortszeit, war Anders mit seinen Kollegen Frank Borman und James Lovell vom Kennedy Space Center in Florida ins Weltall gestartet. Die Apollo-8-Mission war die erste Reise von Menschen zum Mond. Der Auftrag der drei Astronauten lautete, den Himmelskörper zehnmal zu umkreisen und dabei seine Oberfläche detailliert zu fotografieren. Die Aufnahmen sollten helfen, einen geeigneten Platz für die erste Mondlandung eineinhalb Jahre später zu finden.
Noch bevor Apollo 8 die Mondumlaufbahn erreichte, musste sich Kommandant Borman zweimal übergeben. Mit Papiertüchern versuchten Anders und Lovell, das Erbrochene in der Schwerelosigkeit notdürftig einzufangen. Im Kontrollzentrum auf der Erde wurde bereits der Abbruch der Mission erwogen. Doch Borman erholte sich rasch wieder. Kurze Zeit später steuerte die Mannschaft ihr Raumschiff in die gewünschte Position, um mit ihren Kameras die graue Mondoberfläche zu fotografieren.
Bei der vierten Umkreisung des Mondes drehte Borman Apollo 8 einmal um die eigene Achse. Plötzlich bot sich den Astronauten durch ein Seitenfenster ein überwältigender Anblick: die Erde von außen. »Oh mein Gott! Seht euch dieses Bild an! Hier geht die Erde auf. Mann, ist das schön!«, rief Anders. Er griff nach seiner Hasselblad-500-Kamera, tauschte den Schwarz-Weiß-Film für die Mondaufnahmen gegen einen Farbfilm und drückte auf den Auslöser. Es entstand eines der berühmtesten Bilder in der Geschichte der Fotografie. Die NASA hat es unter dem Aktenzeichen ASB-14 – 2383HR archiviert, doch die Welt kennt es als »Earthrise«, Erdaufgang. Es zeigt eine blau leuchtende Erde hinter dem grauen Mondhorizont.
Eigentlich hatten die Astronauten die fremde Welt erkunden sollen, den Mond. Aber in Erinnerung blieb eine neue Sichtweise auf die bekannte alte Welt, die Erde. Oft gewinnen Reisende durch den Perspektivwechsel neue Erkenntnisse über ihr Zuhause. So war es auch damals. Der Blick aus dem All eröffnete den Menschen zum ersten Mal die Möglichkeit, ihren Heimatplaneten als Ganzes zu sehen. Das Bild machte plötzlich sichtbar, für jeden Menschen sinnlich begreifbar, was zuvor lediglich von Wissenschaftlern berechnet worden war: dass die Erde nur zu einem kleinen Teil aus Erde besteht. Dass rund siebzig Prozent der Oberfläche von den Ozeanen bedeckt sind. Erst seit dem Foto von William Anders sprechen wir vom »blauen Planeten«. In unserem Sonnensystem ist die Erde die einzige Wasserkugel weit und breit. Und bislang findet sich im Universum nichts Vergleichbares, kein Planet, auf dem Wasser in allen drei Aggregatzuständen und – in seiner flüssigen Form – vor allem an der Oberfläche vorhanden ist. Wasser ist der Stoff, der die Einzigartigkeit unserer Welt ausmacht.
Ungefähr zur selben Zeit, als zum ersten Mal Astronauten ins Weltall flogen, drangen Forscher auch auf ihrem Heimatplaneten in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hatte: die Tiefsee, jene Region der Meere, die jenseits von 200 Metern unter der Wasseroberfläche liegt. Da beginnt das Mesopelagial oder die Dämmerzone. Die Welt ab 1000 Metern Tiefe nennt man Bathypelagial oder die Mitternachtszone. Hier herrscht ewige Finsternis. Am 23. Januar 1960 tauchten der Schweizer Ozeanograf Jacques Piccard und sein US-amerikanischer Kollege Don Walsh mit ihrem U-Boot Trieste zum tiefsten Punkt der Erde hinab, in den knapp 11 000 Meter tiefen Marianengraben im westlichen Pazifik.
Während der Homo sapiens in den folgenden Jahrzehnten zum Dauergast im Weltraum wurde, sollte es 52 Jahre dauern, bis 2012 mit dem kanadischen Filmregisseur, Oscarpreisträger und Umweltaktivisten James Cameron ein weiterer Mensch den Marianengraben besuchte. Zur Erkundung der außerirdischen Welt bauten die Industriestaaten eine nie da gewesene Forschungsinfrastruktur auf, an ihrer Spitze die National Aeronautics and Space Administration, kurz NASA. Die weltweiten Anstrengungen zur Erforschung des Alls wurden zu einem der bedeutendsten Motoren des technischen Fortschritts, mit einem Budget, das über dem Bruttosozialprodukt mancher Staaten liegt. Ende 2024 umkreisten mehr als 13 000 Satelliten die Erde. Meeresforscher verfügen hingegen weltweit dagegen nur über eine Handvoll tiefseetaugliche Forschungs-U-Boote. Militär-U-Boote tauchen in der Regel bis 600 Meter tief. Die endlose Weite darunter bekommt daher nur sehr sporadisch Besuch von Menschen oder deren unbemannten Tiefseesatelliten.
Verglichen mit der Beachtung in Öffentlichkeit und Politik, mit dem Output an bahnbrechenden Ergebnissen und vor allem verglichen mit den finanziellen Ressourcen, ist die Erforschung der irdischen Wasserwelt zwischen den Küsten allenfalls ein Orchideenfach. Dabei ist die hohe See der mit Abstand größte Lebensraum des Planeten. Aber der am wenigsten erforschte. Wissenschaftler kennen die Oberfläche des Mondes oder des Mars bedeutend besser als die Meeresböden, die immerhin knapp siebzig Prozent der gesamten Erdoberfläche ausmachen. Zu nicht einmal einem Fünftel dieses Tiefseebodens existieren geografische Karten. Das bedeutet: Bis heute ist rund die Hälfte der gesamten Erdoberfläche nicht kartografiert.
Die Tiefsee – ein unerforschtes Universum
Unzählige Bücher, Filme und Serien spielen in fernen Galaxien. Die Fantasie, die großen Erzählungen, die Ziele von Entdeckern und Abenteurern sowie das Interesse von Forschung und Wissenschaft – alles war fokussiert auf die unbekannte Welt jenseits unseres Planeten. Seit mehr als einem halben Jahrhundert richtet sich der Blick der Menschheit aufs All. Es war die falsche Priorität. Für das Überleben der Gattung Homo sapiens hat die Unendlichkeit auf unserem Planeten, haben die Ozeane eine ungleich größere Bedeutung. Und was die Faszination angeht, kann die Welt unter der Wasseroberfläche durchaus mit der des Kosmos mithalten.
Genau wie das Weltall sind auch die Dimensionen der Ozeane für menschliche Gehirne nicht zu erfassen. Im Schnitt sind die Meere etwa 4000 Meter tief. Das Land, auf dem wir leben, besteht lediglich aus den Gipfeln und den Hochebenen der Gebirge, die aus ihnen herausragen. Von den Meeren, die sie umgeben, sehen wir allenfalls die Oberfläche und mit etwas Glück einen springenden Delfin oder pustenden Wal. Die Welt darunter, das mit Abstand größte Ökosystem der Erde, ist bis heute ein weitgehend unerforschtes Universum. Wissenschaftler schätzen, dass in den Ozeanen viele Millionen Arten existieren, die weitaus meisten davon in der Tiefsee. Bislang ist nur ein Bruchteil dieses Schatzes bekannt. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Buches hat das weltweite Register der Meereslebewesen (World Register of Marine Species, kurz: WoRMS) 248 001 verschiedene Arten registriert.[1] Jedes Jahr kommen im Schnitt 2332 neue hinzu.
Hier leben die Rekordhalter unter den Lebewesen. Staatsquallen sind mit bis zu fünfzig Metern die längsten Tiere der Welt. 500 Jahre alte Grönlandhaie, Zeitgenossen William Shakespeares, sind die ältesten Fische. Der Alterspräsident unter allen Lebewesen ist jedoch der 10 000 Jahre alte Scolymastra joubini, ein Riesenschwamm, den Forscher des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven am Meeresboden unter dem Eis der Antarktis entdeckt haben. Das lauteste Tier ist der Pistolenkrebs, der mit seinen Scheren einen Knall erzeugen kann, der mit 240 Dezibel mehr Krach macht als die Trägerrakete der Apollo 8 beim Start (rund 204 Dezibel). Dabei entsteht Wasserdampf, der mit über 4000 Grad Celsius heißer ist als das Triebwerk der Rakete. Auf Platz zwei der lautesten Tiere landet der Pottwal, dessen Klicklaute mit über 200 Dezibel einen Menschen lebensgefährlich verletzen, womöglich sogar töten können. Pottwale holen an der Oberfläche Luft, doch ihr Jagdrevier ist die Tiefsee. Ihr Leibgericht sind Riesenkalmare, Tintenfische, die bis zu 18 Meter lang werden können. Die sind übrigens selbst auch Rekordhalter. Riesenkalmare habe die größten Augen im Tierreich mit einem Durchmesser von 25 Zentimetern. Und der Pseudoliparis aus der Familie der Scheibenbäuche ist seit seiner Entdeckung 2023 der Fisch, der am tiefsten taucht. In 8336 Metern hat ein unbemanntes japanisches Forschungs-U-Boot ein Exemplar entdeckt.
Wunderwesen: ein Kalmar, der in der Tiefsee leuchtet
© Senckenberg/Sven Tränkner
Im größten Teil der Erde, in der Tiefsee, herrscht ewige Finsternis. Viele Bewohner sind jedoch »biolumineszent«, sie machen sich ihr eigenes Licht, um Beute anzulocken oder um miteinander zu kommunizieren. Pflanzen können ohne Licht hier unten nicht existieren. Die Tiefseetiere ernähren sich von anderen Tiefseetieren. Oder von Meeresschnee. Er steht am Beginn der Nahrungskette in diesem fremden, faszinierenden Kosmos. Meeresschnee besteht aus abgestorbenem Plankton, toten Lebewesen oder aus Ausscheidungen von Fischen und Säugetieren, die unablässig aus höheren Schichten nach unten rieseln. 99 Prozent des Meeresschnees wird auf seinem Weg nach unten von Tiefseelebewesen gefressen. Ein kleiner Rest sammelt sich auf dem Meeresboden und hat dort in Jahrmillionen eine Schlammschicht gebildet, die etwa einen Kilometer dick ist.
Die Bedeutung des Meeresbodens für das globale Ökosystem ist bislang noch kaum erforscht. Wie wenig wir darüber wissen, veranschaulicht ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, unser Lebensraum, das Land, läge vollständig im Dunkeln. Nur alle paar Wochen würde ein Forschungsroboter irgendwo landen, um die Umgebung in zwanzig Metern Umkreis für eine Stunde mit einem Scheinwerfer anzustrahlen und zu fotografieren. Mal würde er die Wüste ansteuern, ein anderes Mal die Spitze des Eiffelturms oder die Elektroschrott-Müllhalde Agbogbloshie in Ghana. Aus ähnlich bizarren Puzzleteilchen versucht die Tiefseeforschung, ein Bild des Meeresbodens zusammenzusetzen.
Bei jedem Ausflug in die Tiefsee machen Forscher faszinierende Entdeckungen – manchmal auch ernüchternde. So konnte die Ozeanografin Dawn Wright im Jahr 2022 nachweisen, dass der Mensch bereits im entlegensten Winkel der Tiefsee seine Spuren hinterlassen hat. Wright ist die erste Afroamerikanerin, die mit einem U-Boot zum Fuß des Marianengrabens hinabtauchte. Dort fand sie: eine Bierflasche.
Katastrophe im Verborgenen
»Das Bewusstsein für die Ozeane wächst. Das spüre ich deutlich, wenn ich mit Menschen über das Thema spreche. Aber es wächst nicht schnell genug, verglichen mit der Wichtigkeit, die Ozeane für unsere Zukunft haben«, sagt Boris Herrmann. Für jene drei Milliarden Menschen – etwa vierzig Prozent der Weltbevölkerung –, deren Lebensunterhalt direkt vom Meer abhängt, ist die Bedeutung sauberer Meere offensichtlich. Die große Mehrheit von ihnen lebt im globalen Süden. Weniger offensichtlich ist der entscheidende Einfluss der Ozeane auf die größte Krise unserer Zeit: den Klimawandel. Wenn wir an die Produzenten von Sauerstoff denken, haben wir das Bild von Bäumen und Wäldern an Land vor Augen. Doch Phytoplankton, Algen, Seegras und Seetang produzieren genauso viel Sauerstoff wie alle Wälder an Land.[2] Bei jedem Atemzug füllen wir also einen Lungenflügel mit Sauerstoff aus dem Wald, den anderen mit Sauerstoff aus dem Meer.
Die Ozeane sind zudem überlebenswichtige CO2-Senken, denn sie speichern ein Viertel des Kohlendioxids, das wir Menschen in die Atmosphäre pumpen. Bislang. Zusätzlich haben die Ozeane bis zu 93 Prozent der Wärmeenergie aufgenommen, die wir dem Planeten durch den menschengemachten Klimawandel zumuten.[3] Bislang. Doch es gibt erste Anzeichen, dass sich die Ozeane erschöpfen und diesen überlebenswichtigen Speicherservice künftig nicht mehr in gleicher Weise leisten können. Wir stoßen immer mehr CO2 aus, aber die Ozeane können immer weniger davon aufnehmen. Mojib Latif, Ozeanograf und einer der bekanntesten Klimaforscher Deutschlands, fasst den Einfluss der Ozeane für die bedrohliche Erderwärmung so zusammen: »Das Meer bestimmt Tempo und Ausmaß des Klimawandels.« Wenn man die Erkenntnisse ernst nimmt, die unter Meeresforschern längst unstrittig sind, wird klar: Die Zukunft des Lebens auf der Erde entscheidet sich im Meer.
»Das Tückische ist: Man kann die Veränderungen in den Ozeanen nur sehr schwer erkennen. Selbst für mich ist das schwierig«, sagt Boris. »Seitdem ich Profisegler bin, habe ich zusammengenommen fast vier Jahre an Bord von Rennyachten auf dem Meer verbracht. Mit bloßem Auge sind die Anzeichen des Klimawandels auf dem Wasser nur äußerst schwer wahrnehmbar. Das Meer ist noch immer atemberaubend schön. An Land sehen wir die schmelzenden Gletscher. In den Nachrichten wird laufend über die Folgen von Extremwetterereignissen berichtet: Überflutungen, Dürren, Wirbelstürme, die ganze Städte zerstören, oder verheerende Feuer. Die Wahrheit ist, dass sich in den Ozeanen ebenso dramatische Katastrophen abspielen. Aber die meisten bleiben für uns unsichtbar, denn sie passieren unter der Wasseroberfläche, in der unendlichen Welt unter meinem Boot.«
Die Segeltour, bei der Boris die Klimakrise am unmittelbarsten wahrnahm, führte ihn 2015 durch die Nordostpassage, von Murmansk entlang des arktischen Eises in die Beringstraße. »Als ich zum ersten Mal von Guo Chuans Plänen hörte, hielt ich sie – wie alle anderen – für verrückt«, erinnert sich Boris. Seit Menschengedenken war die Nordostpassage ganzjährig zugefroren, sodass es selbst im Sommer undenkbar war, sie ohne Eisbrecher, ohne Motor, nur unter Segeln zu durchqueren. Doch der Klimawandel machte das Unmögliche möglich.
Der Chinese Guo Chuan wollte die Passage mit einem dreißig Meter langen Renn-Trimaran bewältigen und stellte dafür eine sechsköpfige internationale Crew zusammen. Es dauerte nicht lange, bis Boris seine Meinung geändert hatte und als Navigator an Bord ging. Nach zwölf Tagen, drei Stunden und sieben Minuten waren die Segler der Quingdao die Ersten, die die Nordostpassage ohne Hilfe eines Motors bewältigt hatten. »Natürlich war ich stolz auf diesen Weltrekord. Aber auch nachdenklich und erschrocken. Der Klimawandel war fast mit Händen greifbar. Die Ausmaße waren beeindruckend – und bedrückend. In der Laptewsee gab es vorher kein Durchkommen ohne Eisbrecher. Als wir dort segelten, war nur eine endlose, friedliche See zu sehen, kein Eis, keine Eisberge, nur ab und zu mal ein paar Eisschollen. Trotz der berührenden Schönheit der Natur konnte ich die Arktis in diesem Moment nur als tickende Zeitbombe empfinden.«
Eine Zeitbombe, deren Explosion wir gerade erleben. Wie der jährliche »State of the Climate«-Report der Weltorganisation für Meteorologie vermeldete, wurden 2024 die höchsten jemals aufgezeichneten durchschnittlichen Oberflächentemperaturen der Erde und der Ozeane gemessen.[4] Der mittlere Meeresspiegel war noch nie so hoch, die Eisfläche am Nordpol noch nie so klein wie im Winter 2024/25: ein Schwund um etwa zehn Prozent im Vergleich zu den ohnehin schon viel zu warmen Wintern der Jahre zuvor.[5] Die Arktis ist vom Klimawandel besonders hart betroffen. Dort steigt die Temperatur viermal so schnell wie im globalen Durchschnitt. Im Januar herrschen in der Arktis normalerweise Temperaturen von unter minus dreißig Grad Celsius. Im Januar 2025 gab es in der nördlichsten Region der Erde jedoch eine ungewöhnliche Wetterlage mit südlichen Winden. Das ließ die Temperaturen um etwa zwanzig Grad im Schnitt steigen. Teilweise wurden sogar Plusgrade gemessen – mitten im arktischen Winter.[6]
Das schmelzende Eis lässt nicht nur den Meeresspiegel steigen, es beschleunigt die Erderwärmung. »Arktische Verstärkung« nennen Wissenschaftler dieses Phänomen. Helle Schnee- und Eisflächen reflektieren das Sonnenlicht. Schmelzen sie, werden sie zu dunklen Wasseroberflächen oder legen dunkle Felsböden frei, die das Sonnenlicht absorbieren und sich erwärmen. Dadurch taut noch mehr Eis und die dunkle Oberfläche vergrößert sich. Das International Panel of Climate Change (IPCC) hat errechnet, dass sich die Eisfläche der Arktis im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bereits halbiert hat. Bis Mitte des Jahrhunderts könnte die Region im Sommer vollständig eisfrei sein.
Auf den Spitzensegler Boris Herrmann hatte die Fahrt durch die Nordostpassage wenig Einfluss – es war ein Rekord von vielen. Aber auf den Umweltaktivisten. »Ich muss zugeben, dass ich mir als junger Segler nie viele Gedanken über den Zustand der Ozeane gemacht habe. Ich habe alles über die Farben des Meeres und die Formen der Wellen gelernt. Zu studieren, wie das Wetter funktioniert, war vor allem wichtig, um den Wind vorherzusagen und im Rennen so den schnelleren Kurs zu finden. Die eisfreie Nordostpassage war nicht der alleinige Wendepunkt in meinem Leben, der alles verändert hat, aber ein sehr wichtiger. Das, was ich vorher schon über den Klimawandel wusste, plötzlich direkt vor mir zu sehen, Zeuge der dramatischen Folgen zu sein, das war schon ein Schock. Das hat mich sehr motiviert, mich mit aller Kraft für mehr Klimaschutz einzusetzen.«
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane mögen nur in begrenztem Maße sichtbar sein. Aber sie sind messbar. Exakte wissenschaftliche Messwerte sind heute das wichtigste Sinnesorgan der Menschheit für den Klimawandel. »Mein Freund Toste Tanhua ist derjenige, der mir klargemacht hat, wie wichtig es ist, Daten über den Zustand der Ozeane zu sammeln«, sagt Boris. Tanhua ist einer der international renommiertesten Forscher am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Sieben Jahre lang war er Co-Vorsitzender des Global Ocean Observing System (GOOS), dem wichtigsten Gremium der UN für Ozeanbeobachtung. Seine Messinstrumente sind die Augen der Wissenschaft, seine Daten das Bild, das die Folgen der Erderwärmung darstellt. Kaum jemand weiß mehr über den Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und dem Zustand der Ozeane als der sechzigjährige gebürtige Schwede. »Wir brauchen wahnsinnig viele Daten, um vernünftige Aussagen über den aktuellen Zustand und Vorhersagen für die Zukunft machen zu können«, sagt Tanhua. »Und ohne Leute wie Boris bekommen wir die nicht.«
Eine der wichtigsten Kursentscheidungen im Leben des erfolgreichsten deutschen Hochseeseglers wurde in einer Dönerbude gefällt. »Im Januar 2018 haben uns die Eltern meiner Frau Birte, die in Kiel leben, auf eine Veranstaltung im GEOMAR aufmerksam gemacht. Ein Wissenschaftler, der mit Seglern zusammenarbeitet, erzählte von seiner Arbeit. So haben wir Toste kennengelernt«, erinnert sich Boris. Tanhuas Vortrag drehte sich um zwei Segelboote des Volvo Ocean Race, die er mit mobilen Laboren ausgestattet hatte. Auf ihrem Rennen um die Welt entnahmen die Segler hin und wieder Wasserproben und analysierten sie in ihrem Minilabor. »Das war ein erstes Versuchsmodell der Hochleistungslabore, die uns heute zur Datenerhebung zur Verfügung stehen«, sagt Tanhua. »Als ich nach dem Vortrag meine Unterlagen zusammenpackte, stand ein junges Paar vor mir und sagte: ›Wir haben auch ein Segelboot und wollen Daten sammeln.‹ Dann sind wir gemeinsam in die nächste Dönerbude gegangen, um zu quatschen. Seitdem segelt Boris für die Wissenschaft.«
Der Forscher ist selbst ein begeisterter Segler. »Ich bin an der Ostsee aufgewachsen und habe meine gesamte Kindheit hindurch gesegelt.« Als er sich an der Uni Göteborg zum Studium der Meereschemie einschrieb, kaufte er sich eine stabile 36-Fuß-Segelyacht und zog in seine schwimmende Studentenbude ein. »Das Boot habe ich heute noch«, grinst Tanhua, steht auf und geht zum Fenster seines Büros in dem weitläufigen Neubau des Forschungsinstituts. »Da unten liegt es«, sagt er und zeigt auf eine Marina in der Schwentine, einem Fluss, der 200 Meter weiter in die Kieler Förde mündet. »Mein Boot muss immer segelfertig in der Nähe sein, auch im Winter. Sonst bin ich nicht glücklich.«
Toste Tanhua ist ein ausgeglichener, fröhlicher Mann. Der Inhalt seiner Arbeit kann der Grund dafür nicht sein. »Der Zustand der Ozeane ist absolut kritisch«, erklärt er. »Im Sommer 2024 haben wir in den Ozeanen Hitzewellen erlebt, die alles, was vorher war, und alles, was wir vorhergesagt hatten, bei Weitem übertroffen hat.« Im Mittelmeer wurden über Monate Wassertemperaturen von über dreißig Grad gemessen. Auch die Nord- und Ostsee erlebten 2024 ein Rekordjahr. Von den Hitzewellen waren nicht nur die kleineren Meere, sondern auch sämtliche Ozeane betroffen. Das Tempo des Temperaturanstiegs in den Weltmeeren verschärft sich permanent. Zwischen 1971 und 2011 wurde deren Oberflächenwasser mit jedem Jahrzehnt um etwa 0,11 Grad wärmer. Was sich wie ein kleiner, unbedeutender Temperaturanstieg anhört, ist tatsächlich ein rasantes Katastrophentempo. Doch es geht noch schneller, unvorstellbar viel schneller: Von 2023 zu 2024 betrug der Anstieg gleich mindestens 0,5 Grad, innerhalb eines Jahres.[7] »Das ist ein gewaltiger Sprung, für den die Ozeane vorher ein halbes Jahrhundert gebraucht haben. Und das Schlimme ist: Wir Wissenschaftler wissen noch nicht genau, warum das passiert ist.«
Warmes Wasser verdunstet schneller und warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. 2024 war das wärmste Jahr an Land und das wärmste Jahr in den Ozeanen. Die unvermeidliche Folge: Nach Berechnungen des europäischen Copernicus-Klimawandeldienstes erreichte die Gesamtmenge an Wasserdampf in der Atmosphäre ein Rekordhoch und lag rund fünf Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen vierzig Jahre.[8] Da Wasserdampf ein natürliches Treibhausgas ist, führt dies zu einer weiteren Beschleunigung der Erwärmung.
Der viele Wasserdampf kehrt als Starkregen auf die Erde zurück. In Europa waren diese Folgen der Hitzewellen 2024 unmittelbar und brutal zu spüren. Im Juni des Jahres versanken weite Teile Bayerns, weil extreme Niederschlagsmengen Bäche, Flüsse und insbesondere die Donau über die Ufer treten ließen. Im September standen Österreich und Norditalien unter Wasser. Auch aus Frankreich, Polen, Rumänien, Tschechien und der Slowakei bestimmten im Spätsommer Bilder die Nachrichten, die Menschen zeigten, die in Schlauchbooten durch die Städte fuhren. Besonders hart traf es die Inseln Mallorca, Rhodos und Kreta. Auf dem Festland Griechenlands hatten die Bewohner die Zerstörungen der Unwetterkatastrophe von 2023 noch nicht behoben, da wurden sie 2024 erneut von mehreren Starkregenkatastrophen heimgesucht. Am schlimmsten aber erwischte es am 29. Oktober die Region um die spanische Stadt Valencia. In nur acht Stunden ergossen sich 422 Liter Regen auf einen Quadratmeter des ausgedörrten Bodens. Die Fluten rissen nicht nur Häuser, Brücken und Autos mit. Mehr als 200 Menschen starben.
Mit der Energie von über einer Milliarde Atombomben
Boris und Toste Tanhua (rechts) mit Argo-Floats, in der Mitte Martin Kramp von der World Meteorological Organization WMO
© privat
Die Hitzewellen im Atlantik und im Golf von Mexiko bewirkten 2024 eine verheerende Hurrikan-Saison. Zwischen dem 5. und dem 7. Oktober lieferten die Satelliten den Meteorologen ein bis dahin nie beobachtetes Schauspiel – drei Hurrikane auf einem Satellitenbild: »Leslie« mit Windgeschwindigkeiten von 165 km/h, »Kirk« mit 239 km/h und »Milton«, der mit 285 km/h heftigste Hurrikan der Saison. Insgesamt rasten 2024 gleich elf Wirbelstürme über die Küsten der Vereinigten Staaten. Die Schäden entsprachen gut zwei Prozent des Bruttosozialprodukts der USA.[9]
2024 war ein Jahr, in dem die Ozeane ihre Macht demonstrierten. »Die Dimension des Problems, das der Klimawandel in den Ozeanen verursacht, ist einfach gewaltig. Das ist wirklich sehr schwer zu begreifen, besonders für Nichtwissenschaftler«, sagt Toste Tanhua. Auf Vorträgen erklärt er, dass die Ozeane 93 Prozent der Wärmeenergie, die durch Treibhausgase entstehen, speichern. Nur: Wie viel Energie ist das? Lange hat Tanhua nach einem Vergleich gesucht, der die Dimension begreifbar macht. »Schließlich bin ich auf die Atombombe von Hiroshima gekommen.« Er nimmt als Maßeinheit die Energie, die bei ihrer Explosion freigesetzt wurde. Es ist ein Bild, das der Zerstörungskraft, der Brutalität, der Wucht des Klimawandels gerecht wird. Das Ergebnis von Tanhuas Berechnungen lautet: In den vergangenen vierzig Jahren haben die Ozeane die Energiemenge von zehn Atombomben aufgenommen. Nicht insgesamt. Es waren zehn Atombomben in jeder einzelnen Sekunde. Zusammengerechnet haben wir Menschen die Ozeane also mit der Energie von über einer Milliarde Atombomben aufgeheizt.
Der Wissenschaftler kennt die Wirkung dieser Botschaft. Sie schlägt bei seinen Zuhörern ein wie eine Bombe. Noch bevor man sich von dem Schock erholt hat, beantwortet er bereits die Frage, die sich beinahe automatisch anschließt: Was würde passieren, wenn die Menschheit die Kraft zum sofortigen Stopp aller CO2-Emissionen fände? »Die Ozeane sind ein wahnsinnig träges System. Die Erwärmung geht noch lange, lange weiter. Man muss sich das vorstellen wie eine Herdplatte.« Wenn man den Strom der Herdplatte abstellt, bleibt diese noch eine ganze Zeit lang heiß und heizt den Wasserkessel weiter. »Das bedeutet: Die Meere werden sich noch Jahrzehnte weiter erwärmen, selbst wenn wir jetzt sofort aufhören würden, CO2 in die Luft zu blasen.«
Wenn es um den Klimawandel geht, sind die wichtigsten Messdaten, die Wissenschaftlern Auskunft über die Verfassung der Ozeane geben, Temperatur, Sauerstoff-, CO2- und Salzgehalt. »Ohne diese Daten sind wir bei den Vorhersagen auf Modelle angewiesen, die auf Schätzungen basieren«, sagt Tanhua. »Unsere Erfahrung zeigt, dass solche Vorhersagen und spätere Messungen immer weiter auseinandergehen. Meistens kommt es schlimmer, als wir es vorhergesagt haben. Deswegen sind Echtzeitdaten so unsagbar wichtig.«
Zum Datensammeln nutzen die Wissenschaftler vorwiegend spezielle Messbojen, sogenannte Argo-Floats. Die meisten werden von Forschungsschiffen und Frachtern ausgesetzt. Boris wirft bei jeder Regatta mindestens ein solches Gerät an der exakt bestimmten Stelle über die Reling ins Wasser. Die Messbojen tauchen bis zu 2000 Meter tief, entnehmen Wasserproben, tauchen nach etwa einer Woche wieder auf und senden die Messergebnisse via Satellit in das Forschungsinstitut. Aktuell schwimmen etwa 1500 solcher Argo-Floats in den Weltmeeren. Die zweite relevante Datenquelle sind Kreuzfahrtschiffe, Frachtschiffe oder Kriegsschiffe, die bei ihren Reisen Wasserproben entnehmen. »OceanPack« heißt das Minilabor, das die Schiffe mitführen. »Die Daten, die wir per Satellit erhalten, sind entscheidend für uns. Aber wir haben einfach viel zu wenige davon«, klagt Tanhua. Der Globus ist in 360 Längen- und Breitengrade eingeteilt. So entstehen 129 600 Vierecke. »Wir bekommen nur von einem Prozent aller Vierecke jeden Monat einen Messwert. In den Südmeeren gibt es sogar Gebiete so groß wie Europa, wo wir noch nie etwas gemessen haben. Noch nie. Da sind wir komplett auf Schätzungen angewiesen.«
Die Südmeere umfassen die Region zwischen der Antarktis im Süden und Südafrika, Australien und Südamerika im Norden. Die üblichen Weltkarten untertreiben ihre Größe auf groteske Weise. In der Realität ist ihre Ausdehnung größer als die aller Kontinente zusammen. Das kalte Wasser der südlichen Ozeane nimmt CO2 besser auf als warmes. Die gewaltigen Wassermassen sowie die eisigen Temperaturen sorgen dafür, dass vierzig Prozent des gesamten Kohlendioxids, das in den Ozeanen gespeichert wird, von diesem Teil der Welt aufgenommen wird.[10] Das ist ein Vielfaches der Aufnahmefähigkeit der Urwälder Afrikas oder des Amazonas-Gebiets. Die südlichen Ozeane sind die bedeutendste CO2-Senke, die wichtigste Klimaanlage der Welt. Und ausgerechnet von dieser entscheidenden Region fehlen den Wissenschaftlern die Daten.
Der Datenschatz von Malizia
Einer der Bildschirme auf der Malizia-Seaexplorer. Er zeigt Point Nemo unten links etwas außerhalb der orangen Antarktis-Sperrzone der Vendée Globe.
© Boris Herrmann/Team Malizia
Die südlichen Ozeane sind komplett menschenleer. Point Nemo im Südpazifik ist der Ort auf dem Globus, der am weitesten von einer Landmasse entfernt ist. 2688 Kilometer sind es bis zu Ducie Island, einem winzigen, unbewohnten Atoll. Das nächste Festland ist Chile, eine Seereise von 4200 Kilometern. Durch diese entlegenen Gebiete führen keine Frachtrouten. Für Touristen gibt es nichts zu sehen, für Militärs nichts zu erobern. Niemand kann hier die dringend notwendigen Messungen vornehmen.
Dieses entlegene Gebiet ist der Arbeitsplatz von Boris Herrmann. Er hat Point Nemo bereits sieben Mal passiert. Sämtliche Regatten rund um die Welt führen südlich von Afrika zunächst Richtung Australien und dann in westlicher Richtung um den Globus. »Die Werte aus dem Labor von Boris helfen uns enorm, die Datenlücke ein wenig kleiner zu machen«, sagt Toste Tanhua. Seit dem Treffen in der Dönerbude hat der Extremsegler stets ein OceanPack an Bord. Durch ein kleines Loch in der Kielfinne saugt das Labor 24/7 Wasser an, analysiert es und schickt die Werte für CO2