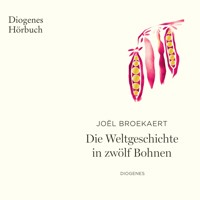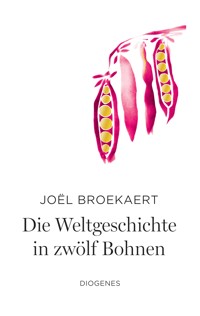
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das hätte der Hülsenfrucht niemand zugetraut! Bohnen haben Revolutionen ausgelöst, den Aufstieg von Imperien ermöglicht, Freiheitskämpfe symbolisch begleitet, die Globalisierung befeuert und die Genetik begründet. Joël Broekaert schaut mit der Bohne in die Geschichte und entdeckt: Erbse und Linse haben so manches Mal die Menschheit gerettet. Und auch für eine nachhaltigere Zukunft lohnt es sich, auf diese Wunderpflanzen und Kraftpakete zu setzen. In dreizehn frisch zubereiteten Kapiteln steht dieses uralte und unterschätzte Gewächs endlich im Zentrum der Geschehnisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Joël Broekaert
Die Weltgeschichte in zwölf Bohnen
Aus dem Niederländischen von Bärbel Jänicke
Mit Cyanotypien von Céline Kesselring
Diogenes
Einleitung
Dies ist ein Buch über Bohnen und Geschichte. Keine Geschichte der Bohne, sondern eine Weltgeschichte anhand von Bohnen. Und das ist gar nicht so weit hergeholt, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag.
Essen ist eines der elementaren Bedürfnisse des Lebens. Sich mit Nahrung zu versorgen kann ein Grund dafür sein, umherzuziehen oder gerade die Entscheidung zu treffen, sich an einem Ort niederzulassen. Oder die Heimat ganz zu verlassen und auf neu entdeckten, unerforschten Kontinenten sein Heil zu suchen. Steht Ihre Lebensmittelversorgung oder die Ihrer Kinder infrage, ist dies ein Grund, sich zu streiten oder schlimmstenfalls Kriege zu führen.
Menschen haben im Laufe der Geschichte in immer komplexeren Verbänden zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten begonnen. Sie haben sich zunehmend spezialisiert, um mehr Geld verdienen und besser leben und essen zu können. So gesehen, diente Nahrung oft als Katalysator für neue soziale Organisationen, industrielle Entwicklung, Krieg, geopolitischen Wettbewerb und militärische und wirtschaftliche Expansion.
Die Geschichte beginnt in dem Moment, in dem die ersten Menschen anfingen, Dinge aufzuschreiben: Das ist offiziell der Punkt, der die Vorgeschichte von der Geschichte scheidet.
Dieser Punkt liegt irgendwo zwischen 3500 und 3100 vor Christus, als in Mesopotamien die Keilschrift entwickelt wurde. Hinter der Entwicklung dieser ersten Schrift verbergen sich wenig romantische Gründe. In den ersten Jahrhunderten nach ihrer Einführung diente sie hauptsächlich dazu, ökonomische Archive anzulegen und kommerzielle Transaktionen festzuhalten. Dabei wird es nicht selten um den Handel mit Lebensmitteln gegangen sein.
Ein anderer Grund dafür, Dinge aufzuschreiben, besteht darin, die Gesellschaft in gute Bahnen zu lenken. Mit anderen Worten: Gesetze und Regeln aufzustellen. Damit jeder weiß, woran er oder sie sich zu halten hat. Einer der ältesten und bekanntesten Gesetzestexte ist der Kodex des babylonischen Königs Hammurabi (1792–1750 vor Christus). Dabei handelt es sich eher um eine Auflistung von Verbrechen und entsprechenden Strafen als um ein Gesetzbuch. Oft geht es darin um Klassenunterschiede, Schulden, Diebstahl und Betrug. Wenn Beispiele für Güter genannt werden, handelt es sich meist um Vieh oder Lebensmittel. So etwa im Rechtssatz 108: »Wenn eine Schankwirtin zur Bezahlung von Bier keine Gerste angenommen hat, (dagegen) Silber nach dem großen Gewichtsstein (berechnet) angenommen hat und (dadurch) den Wert des Bieres im Verhältnis zum Wert der Gerste verringert hat: Man weist es dieser Schankwirtin nach und wirft sie ins Wasser.« Oder in Rechtssatz 237: »Wenn jemand einen Schiffer samt einem Schiff gemietet hat und er es mit Gerste, Wolle, Öl, Datteln oder allerlei sonstigen Waren beladen hat, dieser Schiffer (aber) nachlässig gewesen ist und das Schiff versenkt und seinen Inhalt vernichtet hat: Der Schiffer ersetzt das Schiff, das er versenkt hat, und alles, was er darin vernichtet hat.«
Die prominente Rolle, die das Essen in unserer Geschichte spielt, spiegelt sich auch in der Sprache wider. Das englische salary, das italienische salami, das französische solder (verkaufen) und unser niederländisches soldaat (Soldat) sind allesamt von sal, dem lateinischen Wort für Salz, abgeleitet. Salz bildete das Fundament des Römischen Reiches. Einlegen in Salz war damals die einzige Möglichkeit, Lebensmittel zu konservieren. Ohne Salz konnten große Städte und große Armeen schlichtweg nicht existieren. Die erste große römische Straße quer durch die italienische Halbinsel war die Via Salaria, die Straße, über die Salz antransportiert wurde. Das Wort Salär leitet sich von Salz ab, da Soldaten manchmal mit Salz bezahlt wurden.
Während der gesamten Geschichte wurden zahllose Kriege um die Kontrolle von Salzabbaugebieten geführt, weil Salz als Konservierungsmittel jahrhundertelang eine Voraussetzung für Wohlstand blieb. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts die Konserve erfunden wurde, nachdem kein Geringerer als Napoleon Bonaparte eine Belohnung von 12000Franc für denjenigen ausgelobt hatte, dem es gelingen würde, eine Methode zu erfinden, Lebensmittel über weite Strecken haltbar zu transportieren (wie wir in Kapitel 10 lesen werden).
Von Lebensmitteln im Allgemeinen ist es nur noch ein kleiner Schritt zu Bohnen im Besonderen. Bohnen standen nie im Ruf, besonders sexy zu sein. Zu keiner Zeit. Ein bisschen natürlich, weil sie Blähungen verursachen (warum, können Sie in Kapitel 3 lesen). Vor allem aber, weil Bohnen seit Jahr und Tag als Armeleuteessen gelten. Auch das spiegelt sich in der Sprache wider. In niederländischen Redewendungen wie: »Bohnen aus dem Wasser essen« – eine einfache Mahlzeit genießen. »Eine Bohne im Brühkessel« – das macht nicht viel her. »Hunger macht rohe Bohnen süß« – wenn man wirklich hungrig ist, ist man auch bereit, Bohnen zu essen ...
Wer gut gestellt ist, isst Fleisch, um seinen Eiweißbedarf zu decken. Doch wenn es hart auf hart kommt, greifen wir auf die zuverlässigen, bescheidenen Bohnen zurück. Nach der dunklen Zeit der Unterernährung und des Bevölkerungsschwunds im frühmittelalterlichen Europa war es etwa die Verbreitung der robusten und nahrhaften Ackerbohne durch Karl den Großen, die die Blüte während der karolingischen Renaissance ermöglichte (siehe Kapitel 4). Ja mehr noch, Bohnen waren eine Voraussetzung für die Entwicklung der Landwirtschaft um 8000 vor Christus, weil sie mit ihren Eiweißen eine wesentliche Ergänzung zu den Kohlenhydraten des Getreides boten – und weil sie den Boden fruchtbar hielten (wie wir in Kapitel 1 lesen werden).
Daher ein Buch über Geschichte und Bohnen. Die Geschichten in diesem Buch sind ursprünglich in Vrij Nederland erschienen. Sie wurden hier und da bearbeitet oder mit neuesten Zahlen aktualisiert. Und eine Bohne ist hinzugekommen: die Kaffeebohne (weil die Ackerbohne zweimal ihre Aufwartung macht, bleiben es insgesamt akkurat zwölf). Das bringt mich direkt zu einem wichtigen Punkt (bevor Sie zu protestieren beginnen): Die Kaffeebohne ist natürlich keine Bohne, ebenso wenig wie die Kakaobohne. Sie sind keine Hülsenfrüchte. Gleichwohl nennen wir sie Bohnen. Überdies haben sie in unserer Geschichte eine sehr bedeutende Rolle gespielt. Die Kakaobohne ist untrennbar mit der Geschichte der Sklaverei verbunden (siehe Kapitel 7), und ohne Kaffeebohne keine Französische Revolution (siehe Kapitel 9). Also verdienen sie einen Platz in diesem Buch.
Aber was ist nun genau eine Bohne? Bohnen sind die Samen einer großen Anzahl von Pflanzen aus der Familie der Schmetterlingsblütler, der Fabaceae. Dazu gehören unter anderem alle Hülsenfrüchte. Also Erbsen und Ackerbohnen, aber auch Linsen und Kichererbsen. Außerdem Limabohnen, schwarze Bohnen, Pintobohnen, weiße Bohnen, Flageolettbohnen und braune Bohnen. Die Letztgenannten gehören eigentlich alle zu ein und derselben Bohnenart; sie sind Varianten der »gemeinen Bohne« (siehe Kapitel 6). Dazu gehören auch die grüne Bohne und die Schnittbohne, nur dass wir von ihnen auch die ganze unreife Hülse essen. Öffnet man sie, kann man darin die unreifen Bohnen sehen. Das Gleiche gilt für die Kaiserschote und die Sugar Snap.
Schließlich noch eine kleine Warnung. In diesem Buch geht es mehr um Geschichte als um Bohnen. Es ist eine Weltgeschichte anhand von Bohnen. Das Wort »Weltgeschichte« sollten Sie nicht zu wörtlich nehmen; das ist natürlich eine scherzhafte Übertreibung. Zunächst einmal ist es fast unmöglich, eine komplette Weltgeschichte zu schreiben. Schon gar nicht anhand von Bohnen. Ich lasse bloß Steine über die Geschichte hüpfen und an Stellen landen, die mir zupasskommen. Dennoch streifen wir die wichtigsten Zeitabschnitte, grob gesprochen innerhalb des Zeitraums der letzten 10000 Jahre. Die westliche Geschichte ist dabei eindeutig überpräsentiert, weil ich damit durch mein Geschichtsstudium an der Universität Amsterdam nun einmal am besten vertraut bin. Im Verlauf des Buches kommen wir jedenfalls mindestens einmal auf jeden Kontinent (außer auf Antarktika) zu sprechen.
Ich weiß noch, wie mir meine Frau während eines sonnigen Wochenendes in Friesland vorschlug: Kannst du nicht Phasen in der Geschichte mit verschiedenen Bohnen in Verbindung bringen? (Das Gespräch wird zweifellos mit einer anekdotischen Geschichte über Bohnen und die alten Griechen oder Römer begonnen haben – da wir bei einem kunstsinnigen Onkel mit einem Faible für die Antike zu Gast waren.) Sofort boten sich vier oder fünf offensichtliche Episoden an. So wurde schnell aus einer lustigen Idee ein anspruchsvolles Gedankenexperiment.
Schon während meines Geschichtsstudiums hatte ich festgestellt, dass die fesselndsten historischen Erzählungen (und die besten Dozenten) diejenigen sind, denen es gelingt, eine nette kleine Anekdote mit einer großen historischen Linie oder Bewegung zu verknüpfen. Das Kleine mit dem Großen zu verbinden – davon war diese Übung eine extreme Umsetzung: die Größe der menschlichen Geschichte an etwas scheinbar Unbedeutendes wie eine Bohne zu koppeln.
Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, mit Bohnen und Zeiträumen herumzuspielen, die Kapitel zu konzipieren, zu recherchieren, meine alten Lehrbücher zu entstauben, zu lernen und zu lesen und zu schreiben. Geschichte habe ich schon immer geliebt; meine Liebe zur Bohne in all ihrer Vielfalt ist dadurch immens gewachsen. Ich hoffe, dass Sie diese Geschichte mit ebenso viel Vergnügen verschlingen.
Joël Broekaert
Amsterdam, 2023
1
Die kleine Erbse und die neolithische Revolution
Vor einiger Zeit wohnte ich, weit über meinem gesellschaftlichen Stand, in einem Souterrain in einem schicken Amsterdamer Viertel in der Nähe des Zoos. Ich hatte sogar einen Garten. Dass die Wohnungen vermietet wurden, war wohl eine Maßnahme, um Hausbesetzer fernzuhalten. Das Haus befand sich in einem etwas baufälligen Zustand, der Garten war verwildert. Der ungepflasterte Teil war von Efeu und Brennnesseln überwuchert. Dazwischen ragten dicke grüne Stängel mit kleinen lila Blüten empor: Drüsiges Springkraut. Vielleicht kennen Sie es ja, es ist ein invasiver Exot, der in ganz Westeuropa an Kanälen und Wassergräben üppig gedeiht.
Das Besondere an diesem fremdländischen Hofkolonisatoren ist – wie ich zu meinem Schreck bei einer meiner ersten Gartensafaris entdeckte –, dass er seine Samen mechanisch verbreitet. Anders als der Löwenzahn, der dazu den Wind nutzt, oder die Erdbeerpflanze, die sich hungrige Tiere oder Menschen zunutze macht, die die saftigen süßen Früchte essen und ihre Samen wieder ausscheiden, vermehrt sich das Balsaminengewächs aus eigener Kraft. Die Samen sitzen in einer kleinen grünen torpedoförmigen Fruchtkapsel, die, sobald sie ausgewachsen ist, bei der geringsten Berührung aufspringt und die Samen buchstäblich abschießt – daher der Name Springkraut (der lateinische Name lautet Impatiens glandulifera oder »ungeduldiger Kleindrüsenträger«). Diese unerwartete Samenexplosion bot sich natürlich ganz wunderbar dafür an, Schabernack mit nichts ahnenden Besuchern zu treiben, die ich unter dem Vorwand, unbedingt einmal an diesen kleinen grünen Früchten zu riechen, in den Garten schickte. In der Hoffnung, dass sie versehentlich mit der Nasenspitze gegen eine dieser reifen Kapseln tippen würden, die kurz vor dem Aufplatzen standen.
Als ich irgendwo las, die Samen seien essbar, versuchte ich sie zu »ernten«. Röstet man sie, schmecken sie leicht nussig. Sie seien köstlich in einem Salat oder auf einem Pfannkuchen, schreiben die Wildpflanzensammel-Blogger. Gut zu wissen, doch wenn es darum geht, in der Natur zu überleben, hat man davon rein gar nichts. Diese Samenkapseln sind nämlich nie alle gleichzeitig reif: Entweder sie sind noch hart, oder sie sind schon aufgesprungen. Und wenn man eine gute zu fassen bekommt, muss man zudem noch dafür sorgen, dass ihr Inhalt nicht in alle Richtungen schießt (am besten lässt man die Kapseln in einem Eimerchen oder einer Plastiktüte aufspringen). Einmal eine Handvoll zu sammeln ist recht amüsant, aber angewiesen sollte man nicht darauf sein. Um sie um ihrer Samen willen anzubauen müsste man schon vollkommen verrückt sein.
Warum erzähle ich das? Auch die kleinen, ursprünglich wilden Erbsen und Linsen verbreiteten ihren Samen auf mechanische Weise. Ebenso wie alle anderen Bohnen. Was nicht besonders praktisch ist, wenn man allabendlich eine Familie oder ein Dorf satt zu kriegen hat. Dennoch gehören Linsen und Erbsen zu den ersten Pflanzen, die von Menschen domestiziert wurden. Irgendwann um 8000 vor Christus (vielleicht schon etwas früher) im Fruchtbaren Halbmond, dem Gebiet um das Nildelta und das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Dort tauschte der erste Mensch seine Jäger-und-Sammler-Existenz gegen ein sesshaftes Bauernleben ein: Es war der Beginn der neolithischen Revolution.
Warum in Herrgottsnamen begannen Menschen dann trotzdem, neben Weizen und Gerste zuallererst diese unpraktischen kleinen Erbsen anzubauen? Nun, in der Natur ereignen sich hin und wieder spontane genetische Mutationen. Sie sind, im Zusammenspiel mit der natürlichen Selektion, die treibende Kraft hinter der Evolution. Gelegentlich wird es eine Erbsenpflanze gegeben haben, der das Schussgen fehlte. Die reifen Samen dieser Pflanze blieben fein säuberlich in ihren Hülsen hängen. Eine solche Pflanze würde normalerweise niemals Nachkommen hervorbringen (weil die Samen nicht den Boden erreichen). Wohl aber ließen sich diese zurückgebliebenen Erbsen von Sammlern viel besser ernten als die gesunden Bohnen. Also nahmen sie diese mit nach Hause, um sie zu essen und anzupflanzen, und hielten diese Genmutation damit am Leben. Es entstand eine domestizierte Erbsensorte, die sich nicht mehr mechanisch verbreitete.
Der größte Vorteil der Erbse (und anderer Bohnen) liegt darin, dass sie eine selbstbestäubende, zweigeschlechtliche Pflanze ist. Das heißt: Die Blüten haben sowohl männliche als auch weibliche Organe und können sich selbst befruchten. Die Pflanze kann sich daher endlos fortpflanzen, ohne dazu ein zweites Exemplar zu benötigen. Das erleichtert es, den Genpool konstant zu halten und diese günstige »Anomalie« zu konservieren.
Die neolithische Revolution hat sich in verschiedenen Weltgegenden unabhängig voneinander vollzogen. Immer wieder lässt sich beobachten, dass Ackerbau mit einer Kombination von Getreide und Bohnen beginnt. Sie ergänzen einander besonders gut. Getreide wächst schnell und steckt voller Kohlenhydrate. Hülsenfrüchte wiederum sind reich an Proteinen. Gemeinsam bilden sie die Grundlage einer gesunden und ausgeglichenen Kost. Im Fruchtbaren Halbmond waren es Weizen und Gerste mit Erbsen und Linsen, in Mittelamerika Mais und verschiedene Bohnensorten, in Afrika Sorghum (Kaffernhirse) und Perlhirse mit cowpeas (Augenbohnen) und Erdnüssen, in China Hirse, Reis und Sojabohnen.
Hülsenfrüchte und Getreide ergänzen sich noch auf eine andere bedeutsame Weise. Auf den Wurzeln von Hülsenfrüchten wachsen Bakterien, die Stickstoff aus der Luft aufnehmen und im Boden binden. Sie wirken so als eine Art natürlicher Dünger. Außerdem konnten die Schalen und Stängel der Pflanzen genutzt werden, um das Vieh zu