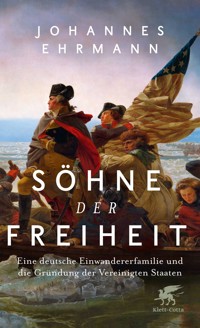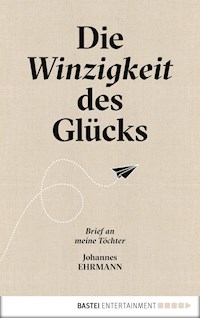
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Wir alle haben Angst, sagt meine Schwester, die schon zwei ältere Kinder hat, die Angst ist normal, aber wir zeigen sie den Kleinen nicht. - Es ist nicht leicht. Ihr liegt in eurer kleinen Kinderwagenwelt, gut geschützt, bald schon geht ihr treu an unserer Hand. Aber woran halten wir uns fest, wir Großen?"
In diesem Buch wird ein Mann Vater - und er ist stolz und glücklich, fühlt sich aber genauso oft ohnmächtig, wütend, verletzlich, hilflos. Auch angesichts der Zeiten, die ihn umgeben. Deutschland 2016 - das ist das Jahr des Terrors und der Bedrohung, in dem uns schon bei einer U-Bahn-Fahrt mulmig wird. Was geben wir unseren Kindern weiter, wie vermitteln wir ihnen die Umbrüche unserer Zeit? Ein Buch zum Thema Vater-Werden in komplizierten Zeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungAnfangUnsere ReiseOpa und der Wert der DingeGrößeDie AngstLernenThe CutWir sind die anderenNachwortÜber dieses Buch
»Wir alle haben Angst, sagt meine Schwester, die schon zwei ältere Kinder hat, die Angst ist normal, aber wir zeigen sie den Kleinen nicht. – Es ist nicht leicht. Ihr liegt in eurer kleinen Kinderwagenwelt, gut geschützt, bald schon geht ihr treu an unserer Hand. Aber woran halten wir uns fest, wir Großen?« In diesem Buch wird ein Mann Vater – und er ist stolz und glücklich, fühlt sich aber genauso oft ohnmächtig, wütend, verletzlich, hilflos. Auch angesichts der Zeiten, die ihn umgeben. Deutschland 2016 – das ist das Jahr des Terrors und der Bedrohung, in dem uns schon bei einer U-Bahn-Fahrt mulmig wird. Was geben wir unseren Kindern weiter, wie vermitteln wir ihnen die Umbrüche unserer Zeit? Ein Buch zum Thema Vater-Werden in komplizierten Zeiten.
Über den Autor
Johannes Ehrmann, Jahrgang 1983, schreibt als freier Journalist und Autor in Berlin unter anderem für den TAGESSPIEGEL. Mit seinem dort erschienenen Text »Wilder, weiter, Wedding« gewann er 2014 den Theodor-Wolff-Preis, 2013 erhielt er mit dem Liveticker-Team der 11FREUNDE den Grimme Online Award. Er lebt am Rande des Wedding.
Johannes EHRMANN
Die Winzigkeitdes Glücks
Brief an meine Töchter
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Lukas Niehaus
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-4880-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Frida und Ella
Anfang
Es ist spät, tiefe Nacht, die zweite nach eurer Geburt, und wir sind zusammen in dem kleinen Raum rechts vom Gang. Tagsüber vermessen sie hier die Babys, wiegen die neuen Leben in der kleinen Schale drüben auf der Arbeitszeile, nehmen ihre Temperatur und betupfen den Nabel. Nachts aber kommt niemand hierher.
Ich sitze am Fenster, schräg auf meinem Sessel, die Beine über der Lehne, die Wärme der Heizung im Rücken. Ab und zu höre ich eine Stimme hinter mir im Hof oder zwei, wenn wieder jemand raucht, um sich die Zeit zu vertreiben oder die Angst. Sie tragen Schals da draußen, Schals oder Mützen, aber hier drinnen ist es warm, warm und dunkel, fast ganz dunkel, nur zwei gedimmte Lämpchen leuchten schwach hinten über der Wickelauflage. Ich sitze mit dem Rücken zum Fenster, euer hölzernes Gitterbettchen vor Augen mit den Rollen unter den vier Füßen und der gepolsterten Umrandung, die euch von allen Seiten schützt vor Zugluft und vor Blicken.
Ich sollte schlafen wollen und kann euch atmen hören.
Ja, wenn ich ganz still bin und mich nicht bewege, dann kann ich es hören. Zwei leise, schnelle Atem, die sich alle paar Sekunden durchkreuzen, und ab und zu ein leises Seufzen von einer von euch beiden.
Ich kann euch beim Leben zuhören, denke ich. Frida und Ella, meine Töchter. Ein seltsamer Satz, ich kann immer noch kaum ahnen, was er bedeutet.
Ich nehme die Beine von der Lehne und setze mich auf. Ich trinke den letzten Rest Tee und warte auf die Müdigkeit, aber sie will noch nicht kommen. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist, zwei, halb drei vielleicht? Ich warte auf ein Geräusch, eine Bewegung, irgendetwas, das diesen Moment durchbrechen wird, diese tiefe Ruhe der Nacht. Aber alles bleibt still.
Sehen kann ich euch nicht von hier aus, ich sitze zu tief, aber ihr seid da, das weiß ich. Ich könnte jederzeit aufstehen und nachsehen, und ihr würdet noch da liegen wie beim letzten Mal, still auf dem Rücken, die Köpfchen zur Seite, ganz erschöpft vom Trinken und vom Hiersein.
Ich nehme das Handy aus der Hosentasche und sehe nach der Uhrzeit. Zwanzig nach zwei. Ich versuche auszurechnen, wie lange eure Mutter schon schläft, aber ich habe vergessen, wann ich mit euch aus dem Zimmer bin, war es elf oder zwölf? Ich glaube, eher zwölf. Sie braucht Erholung, eure Mutter, etwas Schlaf, endlich ein paar Minuten Ruhe, in denen sie nicht ständig nach euch schauen muss, nicht von jedem eurer kleinen Geräusche hochfährt, aus Sorge und vor Schreck, so wie wir es beide tun, wenn wir im Halbschlaf neben euch liegen drüben in unserem Familienzimmer, ein paar Schritte den Gang hinunter.
Alles ist so neu, alles unsicher, alle paar Minuten scheint sich irgendetwas ganz grundlegend zu verändern, ein Schnaufen, ein Fiepen in eurer Lunge, das wir nie gehört haben, und nie wissen wir, ist es normal, schlimm oder vielleicht kritisch? Alles normal, sagt dann die Schwester und lächelt ihr abgeklärtes Schwesternlächeln, bevor sie die Tür wieder hinter sich zumacht und weiter eilt zu den nächsten Eltern, die nicht schlafen können.
Alles gut, keine Sorge, sie sagt es wieder und wieder, die Schwester, im Ton der tausendfachen Routine, aber was sie jeden Tag sieht, das wirkt alles so zerbrechlich für uns, für eure Mutter vielleicht noch ein bisschen mehr als für mich. In der ersten Nacht hat sie kein Auge zugetan, ich bin mir sicher, auch wenn sie es abstreitet.
Drei Stunden, denke ich. Drei Stunden Ruhe wären gut für sie, vielleicht schaffen wir vier. Ich kann euch Fläschchen geben, wenn ihr aufwacht, dann haben wir wieder eine Stunde gewonnen oder zwei. Seit wann sitzen wir hier? Seit wann schlaft ihr wieder? Ich weiß es nicht. Bald schon werdet ihr wieder wach sein, blinzelnd, durstig. Ihr nehmt die Welt noch in solch kleinen Portionen auf, 20 Milliliter, manchmal auch nur zehn, anderthalb Stunden Schlaf am Stück, wenn es gut läuft. Ihr seid kaum angekommen, zwei Fliegengewichte, die erst mal darum kämpfen müssen, wieder auf zweieinhalb Kilo zu kommen. Der Blutzucker ist zu niedrig, sagt uns die Schwester, eure Temperatur eigentlich auch, ihr trinkt noch nicht genug. Alle paar Stunden wird wieder nachgemessen, irgendetwas irgendwo eingetragen, immer noch nicht hoch genug.
Das wird schon, sagt man uns, es geht alles so schnell, warten Sie nur ab. Aber wir können noch nicht an morgen denken oder an in vier Wochen, eure Mutter und ich, wir leben nur im Hier und Jetzt. Es geht um die reine Existenz, ein paar Minuten Schlaf, ein paar Bissen Essen vom Plastiktablett, dann schon die nächste Untersuchung und noch mal eine. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Nur der Zucker, die Temperatur. Also decken wir euch wieder gut zu, wickeln zwei Handtücher um jeden Schlafsack, stellen das Wärmebettchen auf 37 Grad, die Tür bleibt zu, die Fenster kurz gekippt für etwas Frischluft, bloß keinen Durchzug jetzt bei null Grad draußen oder weniger. Wir Großen sind eh schon beide krank, die Nase läuft, der Hals ist geschwollen, das viel zu warme Zimmer, die Anstrengung, die Emotion, wer weiß.
Und doch spüre ich jetzt nichts, gar nichts von all dem, ich weiß nicht, warum. Als wären wir beschützt hier drinnen in unserem winzigen Versteck.
Draußen auf dem Gang ist irgendwo das Rufsignal losgegangen, und ich höre die Schritte der Nachtschwester auf dem Linoleum quietschen. Nicht mehr lange, dann wird sie hereinkommen zu uns, sie, die Einzige, die von unserer Anwesenheit weiß. Dann wird sie euch auspacken und schon wieder in die Füßchen stechen, den dunkelroten Tropfen auf die Messfläche fallen lassen. Und wir werden wieder alle zusammen aufs Display starren, der Wert, wie hoch ist er, der verdammte Grenzwert, 45 braucht ihr, 39 waren es beim letzten Mal, trinken, viel mehr trinken müsst ihr! Ihr könnt noch nicht. Wisst noch nicht, wie.
Ich stelle die Teetasse neben den Sessel auf den Boden, stehe auf, strecke mich, drehe mich um und mache vorsichtig das Fenster auf. Die eiskalte Luft auf meinem Gesicht erinnert mich daran, dass es da draußen auch noch eine Welt gibt, die echte. Der Hof ist still und menschenleer. Drüben in der Notaufnahme sind die Vorhänge zugezogen. Es sind die kleinen Stunden, in denen man zu hören glaubt, wie die Erde sich dreht.
Leise mache ich das Fenster wieder zu und setze ein, zwei Schritte in den Raum, hinüber zu euch. Ich kann eure Köpfchen sehen mit den winzigen bunten Wollmützen, wie zwei Andenkinder seht ihr aus. Ich sehe die Träger eurer gestreiften Schlafsäcke, die euch noch viel zu groß sind, weiche Hüllen mit dem Schriftzug des Krankenhauses auf der Brust. Ihr gehört noch nicht ganz uns.
Noch ein paar Tage müssen wir hierbleiben, drei oder vier, erst am Sonntag werden sie uns gehen lassen, wenn alles okay ist, oder am Montagmorgen. Es scheint noch so weit weg. Dabei steht das Auto nur ein paar Meter die Straße hinunter, von unserem Zimmer aus kann ich es sehen durch die kahlen Äste der Bäume, die auf dem leeren Spielplatz stehen. Der alte, eckige Kombi mit dem kaputten Kat, der noch auf meinen Vater zugelassen ist, er wartet auf uns, auf der Rückbank die beiden Sitzschalen, ganz leer und kalt und unbenutzt. Nur noch ein paar Tage, dann werde ich ihn anlassen, ihr auf der Rückbank hinter uns, dick verpackt und festgeschnallt. Ich male mir den Weg nach Hause aus, links auf die Hauptstraße, drei große Kreuzungen weiter rechts runter auf die Stadtautobahn. Und dann?
Ja, wohin dann?
In die Wohnung erst mal, klar, in unsere zwei Zimmer, die uns sofort zu klein sein werden, wir haben uns über Nacht verdoppelt, und alle vier müssen wir uns nun einen neuen Platz suchen. Wo wird er sein? In welchem Winkel der Stadt, an welcher Ecke, welchem S-Bahnhof?
Ich höre ein Geräusch von einer von euch beiden, wie ein sanftes Knurren, das langsam lauter wird und dann plötzlich verstummt. Ich beuge mich über euer Bettchen und sehe nach, ob etwas ist, ob ihr aufgewacht seid. Aber ihr liegt immer noch unverändert da, mit geschlossenen Augen, die Köpfe zueinandergedreht, die Fäuste nach oben gereckt, wie zwei erschöpfte Revolutionäre.
Hier sind wir also, hier, wo alles anfängt und aufhört, am Hauptbahnhof unserer Art, wo wir ankommen und abfahren oder vielleicht noch mal umsteigen. Hier seid ihr nun, bei uns, und es wird jetzt alles auf euch zukommen. Nicht mehr gefiltert und leise wie in den letzten Monaten, als noch jede von euch für sich war und ihr beide dicht beisammen im Bauch eurer Mutter und alles seinen Lauf ging. Jetzt nicht mehr. Jetzt verlasst ihr euch auf uns, in eurer zweiten Nacht hier draußen, zwei Zwerge, die noch kaum mehr als alleine atmen können, es ist schwer zu glauben, wie das alles gehen soll. So vieles, was wir noch nicht wissen, viel zu viel. Es kommt mir vor wie mit dem Fahrrad oben auf dem Berg, der Moment, wenn die Kuppe aufhört und die Abfahrt beginnt. Alles beschleunigt sich, ein letzter Tritt in die Pedale, dann fängt schon der Lenker an zu zittern, und der Fahrtwind treibt uns die Tränen aus den Augenwinkeln.
Noch ist es kalt, nicht mal März, bald schon wird es wärmer werden. Ihr werdet in einen Frühling hineingeboren, schöner kann es doch nicht sein, oder? Wann wird er kommen, wann wird es die letzte Nacht frieren, wann werden die Kirschbäume am Park weiß, wann ist schon alles grün? Wann hört ihr euer erstes Gewitter, wann kommt die erste weite Reise, wann das erste Lächeln, das erste Wort? Wo wird unsere Wohnung sein, wo euer erstes Kinderzimmer? Werden wir uns etwas Schönes leisten können in dieser großen weiten Stadt, die doch jeden Tag enger zu werden scheint, voller, teurer.
Es wird schon werden, denke ich, aber wer sagt das eigentlich? Wer garantiert uns das? Was wissen wir schon? Was ist das für eine Welt, in die ihr da kommt? Wie werdet ihr sie sehen, ihr beiden, und wie wird sie sein zu euch, diese Welt und ihre Bewohner, die Menschen, die ihr trefft, wen werdet ihr lieben, wem die kalte Schulter zeigen, wen heimlich bewundern?
Wo seid ihr hier nur gelandet? Die Nachrichten voller Krieg und Vertreibung. Bomben und Gewehre jetzt auch bei uns vor der Tür, in Europas Innenstädten. Ist es hier und jetzt nicht schlimmer, gefährlicher, dunkler als all die Jahre vorher, als in meiner Kindheit, oder kommt mir das nur so vor? Wegen euch, wegen der Sorge der ersten Tage, wegen all dem, was da jetzt auf uns zukommt?
Werden wir einen guten Platz für euch finden, in dieser Stadt, in diesem Leben? Wer sind wir überhaupt, eure Mutter und ich? Wissen wir das? Werden wir es euch sagen können? Was werden wir euch geben können, was mit euch teilen, welche Worte finden, wann den Mund halten, damit ihr das alles besser ertragt?
Es gibt so viel, was ich euch erzählen will, aber es ist nicht leicht. Nicht für alles gibt es die richtigen Worte. Erst vor ein paar Tagen, dieser Blick von meinem Schreibtisch, das Licht über dem Park, in der Stunde zwischen Dämmerung und Tag, dieses wundersame Licht und die frische Spur im Schnee. Das muss wieder der Fuchs gewesen sein, mitten in der Stadt, er lebt da irgendwo im Park und streift herum, und man kann seine weiße Schwanzspitze leuchten sehen in der Dämmerung, wenn man lange genug am Fenster sitzt und Glück hat.
Ich höre ein Geräusch und schaue auf. Die Nachtschwester steht in der halb geöffneten Tür, eine kleine resolute Person, ganz in Weiß in Hemd und Hose, sie hat uns nicht vergessen. Ich hebe den Daumen, alles in Ordnung. Sie hat gemerkt, dass ihr noch schlaft, flüstert, dass ich sie rufen soll, wenn ihr wieder aufwacht. Ein kurzes Lächeln, dann geht schon wieder hinter ihr das Rufsignal los, sie drückt die Tür ins Schloss. Kurz bekomme ich Angst, dass ihr aufwacht, aber ihr tut keinen Mucks.
Ich schleiche zurück zum Sessel und setze mich hin. Ich denke an unseren Fuchs, den Fuchs vom Mauerpark. Werde ich ihn euch noch zeigen können? Schon sind die Bagger da, die LKWs rollen in langer Kolonne am Haus vorbei. Baum um Baum wurde gefällt, tonnenweise Erde ausgehoben für die Fundamente, der ganze Nordteil des Parks wird zugebaut, Hunderte neue Wohnungen für die Menschen der Stadt, für die einen mehr, für die anderen weniger. Die Armen dämpfen hinten an der S-Bahn den Schall, die Reichen bekommen vorne teures Eigentum mit Grünblick.
Die Stadt wird eine andere. Und ihr werdet nicht wissen, wie es mal war, werdet es vielleicht erahnen, davon lesen oder euch erzählen lassen, oder es ist euch ganz egal. Ihr werdet schön finden, was ihr schön findet, und schlimm, was euch stört, und über vieles, was ich beklage, werdet ihr nicht mal die Schultern zucken. Ihr werdet nicht die Menschen kennenlernen, die ich gekannt habe, nicht alle und nicht so, wie sie waren, aber ich kann euch von ihnen erzählen. Das ist der Trost, den wir haben.
Ich will euch schreiben, denke ich dann, beseelt vom Halbdunkel der Nacht und der Bedeutung des ersten Moments. Ich will euch von allem erzählen, was mir wichtig scheint, will euch sagen, wer wir sind, wo wir leben. Will versuchen für euch zu beschreiben, was das für Zeiten sind, in die ihr kommt, was ich von ihnen weiß und von dem Ort, an dem ihr leben werdet. Vielleicht kann das helfen. Was bleibt uns, außer es zu versuchen?
Noch einmal stehe ich auf, beuge mich vor, sehe eure Gesichter im warmen Licht. Ihr habt die Köpfe gedreht und schaut euch an mit geschlossenen Augen. Ich schaue euch beim Schlafen zu. Bald gehen wir da wieder raus, denke ich, aber noch nicht, jetzt noch nicht.
Dann setze mich wieder in meinen Sessel am Fenster und hole mein altes Schreibhandy heraus. Das Display wird hell. Ich öffne das Textprogramm und mache eine neue Seite auf. Ich sehe die beleuchteten Buchstaben der Tastatur. Ich lehne mich vor und fange an.
Unsere Reise
Wir sitzen im Auto, Papa wie immer vorne links, neben ihm Mama und dahinter ich in meinem schwarzen Römer-Sitz mit dem orangefarbenen Pult. Wir fahren durch den Sommer, eine enge Straße, wir kommen zwischen steilen Felswänden hindurch, der Wagen legt sich in die Kurve, dann sind die Felsen weg, und alles reißt auf. Wir sind im Freien, ich höre das Klavier aus dem Kassettenradio, und unter uns liegt golden glitzernd das Meer.
Das ist sie, meine erste Erinnerung, der älteste Moment, der in mir geblieben ist. Bis heute hat nichts und niemand ihn verdrängen können aus dem alten Winkel meines Wesens. Ich kann ihn spüren, wenn ich will, diesen Augenblick, diesen Gefühlsakkord, ich muss drei gewesen sein oder vier. Irgendwann, Jahre später, ist mir die Kassette wieder in die Hände gefallen, und ich habe das Klavier gehört, das Schlagzeug, die Stimme des Sängers, that’s just the way it is, und alles war wieder da. Da saß ich wieder, hinten rechts in unserem gelben Passat Kombi, die Nase an der Scheibe, ein heißer Sommer gegen Ende eines Jahrtausends, das ihr nie kennen werdet.