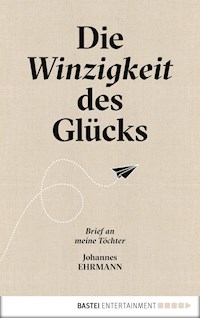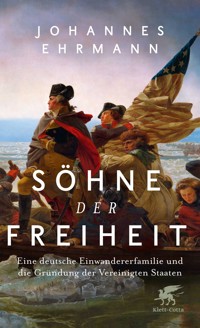
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
1776 – deutsche Migranten machen Revolution in Amerika Die deutschen Founding Fathers: Johannes Ehrmann erzählt zum ersten Mal Amerikas Revolution und den Unabhängigkeitskrieg als deutsche Familiengeschichte. Mit großer Erzählkunst verwebt er das Leben der Mühlenbergs mit den bahnbrechenden Ereignissen ihrer Zeit. Packend schildert er Schicksal und Wirken dieser deutscher Migranten, die Amerika in ein neues Jahrhundert steuerten, und bietet dabei eine neue Sicht auf den alten Mythos USA. Als Amerika am 4. Juli 1776 in Philadelphia seine Unabhängigkeit von England erklärt, machen sich zwei deutsche Einwanderer nur wenige Straßen weiter an deren erste und wichtigste Übersetzung. Die amerikanische Revolution spricht Deutsch – weil die deutschen Migranten so zahlreich sind, dass der Kampf gegen England ohne sie schlicht nicht zu gewinnen ist. Die Deutschen, eigentlich Bürger zweiter Klasse, kämpfen für Amerikas Freiheit, stellen Regimenter auf, sie gehen in die Armee und die Politik und entscheiden bald Präsidentschaftswahlen. Zwei Brüder an vorderster Front, die Pastorensöhne Peter und Friedrich Mühlenberg, die mit den Prinzipien ihres Vaters brechen, um amerikanische Geschichte zu schreiben. Das ist die packende Story der »First German Family« Amerikas, die große Zeitenwende erzählt aus der Perspektive deutscher Underdogs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Johannes Ehrmann
Söhne der Freiheit
Eine deutsche Einwandererfamilie und die Gründung der Vereinigten Staaten
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © Wikimedia: Washington Crossing the Delaware von Emanuel Leutze, 1851
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98718-8
E-Book ISBN 978-3-608-12145-2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
PROLOG
I.
GOTT WIRD AMERIKANER
»Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht«
Pastor Mühlenberg flieht
Unsichtbare Väter
American Crisis
Fourth of July
Die Falle
Thanksgiving
Alle Menschen müssen sterben
II.
WEM GEHÖRT DAS LAND?
Auf Adlers Flügeln
Advent
Penns Wälder
Ein deutsches Heim in Amerika
Die lautere Wahrheit
Wohin mit den Deutschen?
Krieg kündigt sich an
Bücher voll Jammer und Elend
III.
DIE LEHREN DER ALTEN WELT
Auf nach Europa!
Die Republick hat Fieber
Peter in der »freyen Stadt«
»Am Rande der Verzweifelung«
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt
Unter dem Freiheitsbaum
IV.
KRIEG DER BRÜDER
Ein kleiner Märtyrer
Tod eines Vaters
Eine Hochzeit und ihre Folgen
Tea Party
»Ein freies und loyales Volk zu versklaven«
Die deutschen Riflemen
»Ich will für meine Feinde beten«
V.
EINE NATION ENTSTEHT
Yorktown
Zwei Brüder auf dem Land
»Demütiger Diener«
Am Ohio
Neue Ämter
Wie viel Demokratie verträgt das Land?
Mach End, o Herr, mach Ende
VI.
DIE REVOLUTION VON 1800
Des Landes Vater
»Diese beiden Deutschen …«
THE NAMESAKE
VERWENDETE LITERATUR
1 Primärquellen
2 Monographien
3 Fachartikel
4 Online-Quellen
BILDNACHWEIS
REGISTER
Do I contradict myself?
Very well then I contradict myself,
(I am large, I contain multitudes.)
Walt Whitman
Immigrants – we get the job done.
Lin-Manuel Miranda
PROLOG
DUNKELHÄUTIGE DEUTSCHE
Wer den Leuten erzählt, dass er ein Buch über die deutschen Gründer der Vereinigten Staaten schreibt, bekommt fast immer die gleiche Reaktion: Ah, interessant. Wäre das Deutsche nicht mal um ein Haar offizielle Landessprache geworden? Stimmt das eigentlich? Über 42 Millionen US-Bürgerinnen und -Bürger beriefen sich beim Community Survey des Zensusbüros im Jahr 2021 auf eine deutsche Herkunft, das sind 12,7 Prozent der Bevölkerung. Zur Zeit der Amerikanischen Revolution 1776 war der Anteil der deutschen Migranten in den dreizehn Kolonien nur unwesentlich geringer, er wird auf zehn Prozent geschätzt. Was heute also die spanischsprachigen Lateinamerikaner sind, die Latinos oder Hispanics, waren damals die Deutschen: die größte nicht-englischsprachige Gruppe einer englisch dominierten Gesellschaft.
Eine rasant wachsende Minderheit, insbesondere in Pennsylvania, wo sie im 18. Jahrhundert wohl mehr als ein Drittel der Bevölkerung ausmachte. Außerhalb Philadelphias(1), »in diesem waldreichen Pennsylvanien«, hatten sich bereits 1683, kurz nach Gründung der Kolonie, 13 Familien von Religionsflüchtlingen aus Krefeld angesiedelt und ein erstes deutsches Städtlein in Amerika gegründet: Germantown(1).
Sie waren Quäker und Mennoniten, eingeladen vom ebenfalls religiös unterdrückten Engländer William Penn(1). Ihnen folgten alle möglichen Glaubensgruppen: Lutheraner, Herrnhuter, Tunker, auch die heutige Touristenattraktion, die Amische, eine radikale Gruppe von Anabaptisten. Bald aber, spätestens mit der großen deutschen Migrationswelle der 1740er und 1750er Jahre, kamen bereits vorwiegend, wie man heute sagen würde, Wirtschaftsflüchtlinge. Menschen auf der Suche nach einer neuen Chance, einem besseren Leben. Im feudal organisierten Deutschland, damals ein Flickenteppich Hunderter unterschiedlicher Fürstentümer und Grafschaften, gab es gerade für die einfachen Leute viele Gründe, unzufrieden zu sein. Dazu gehörten Frondienste ebenso wie Perspektivlosigkeit durch das Erbteilrecht, verpflichtender Militärdienst, Willkür und Drangsalierung durch die Herrschenden sowie teils sehr hohe Steuern und Abgaben. Auch in Nordamerika mochte das Leben »beschwerdt« sein, wie ein 1711 ausgewanderter Deutscher nach Hause schrieb, doch war die Steuerlast in Pennsylvania im Vergleich so gering, »daß mancher mehr im zapfhauß verdrinkt auf einmahl, denn des Jahres Tax ist«.
Nicht nur Pennsylvania, auch andere Kolonien wie Maine(1), Massachusetts(1) oder North Carolina(1) warben deutsche Siedler an. Die allermeisten Deutschen aber kamen in Philadelphia(2) an – zunächst fast ausschließlich aus dem südwestdeutschen Raum, aus dem Rheinland(1), der Pfalz, Rheinhessen(1) und Württemberg(1) stammend, später auch aus anderen Regionen wie Hamburg(1) oder dem Hannoverschen(1). Meist waren sie zwischen 20 und 40 Jahre alt, etwas häufiger Männer als Frauen, oft Kleinbauern und Handwerker aller Art, die in Amerika in allen möglichen Gewerken Arbeit fanden – als Weber, Schumacher, Schmiede, Fleischer, Bäcker, Fassbinder, Drucker oder Schiffbauer. Sehr oft auch als Farmer, freie Bauern, sobald ein eigenes Stück Land außerhalb Philadelphias(3) für sie erschwinglich wurde.
Bis zum Ausbruch der Revolution waren etwa 110 000 Deutsche und deutschsprachige Schweizer in den englischen Kolonien angekommen, zusammen mit ihren Nachkommen machten sie im Jahr 1776 etwa eine Viertelmillion Menschen aus. Das blieb nicht ohne Folgen in der Kolonialgesellschaft. Der stetige Zustrom an Fremden hatte schon bald nach dem Tod William Penns(2) im Jahr 1718 für Argwohn gesorgt – und für konkrete, steuernde Maßnahmen. Man ließ die deutschen Neuankömmlinge noch auf den Schiffen in Listen eintragen und sie als Erstes einen Treueeid auf den englischen König(1) schwören. Durch strategische Ziehung der Wahlbezirke marginalisierte man sie politisch.
Die Deutschen, das waren die Anderen, Bürger zweiter Klasse, von den Englischstämmigen misstrauisch beäugt. Man hielt sie für ignorante Trampel, belächelte ihren legendären Geiz und ihre seltsamen Manieren. Mussten sie denn auch so viel Bier trinken und Kraut und Schweinefleisch in sich hineinstopfen? Mussten sie so laut und so sichtbar sein, dass sie gleich ganze Stadtviertel übernahmen? Wenn das so weiter ging, würden sie Pennsylvania, von Engländern gegründet, noch »germanisieren statt dass wir sie anglisieren«, wie Benjamin Franklin(1) bereits 1751 unkte. »Sie haben eine deutsche Zeitung und eine halbdeutsche«, bemerkte Franklin zwei Jahre später, »Werbeanzeigen … werden nun auf Deutsch und Englisch gedruckt; die Schilder in unseren Straßen tragen Inschriften in beiden Sprachen und mancherorts nur Deutsch.« Das Deutsche als Landessprache? Für den einflussreichen Drucker, Politiker und späteren Gründervater Franklin war das, zumindest für eine Weile, ein realistisches Szenario.
Die xenophobe Hysterie um die deutsche »Otherness« nahm teils groteske Züge an, als Franklin(2) ihnen in einem 1755 veröffentlichten Aufsatz sogar das Weißsein absprach. Die Deutschen hätten – wie die meisten Kontinentaleuropäer – »generell eine Hautfarbe, die wir dunkelhäutig (swarthy) nennen«, erklärte Franklin. Die einzige Ausnahme bildeten die Sachsen, die mit den von ihnen abstammenden Engländern oder Angelsachsen »den Hauptteil Weißer Menschen auf der Erde« ausmachten.
Auch diese Ressentiments durch die angloamerikanische Elite müssen wir mitdenken, wenn wir die rasche Assimilation der Deutschen sehen, die oftmals gleich als Erstes ihre Nachnamen verenglischten, ihre Umlaute strichen und deutsche durch englische Laute ersetzten: Aus Huber wurde so etwa Hoover, aus Gräf wurde Graff, aus dem deutschen Müller der englische Miller.
Trotz allem aber versprach das Leben gerade im vergleichsweise diversen und demokratischen Pennsylvania, »the best poor man’s country«, wie es hieß, ein deutlich besseres zu sein als in der alten Heimat. Wenn man denn erst einmal da war. Die Überfahrt von Europa konnte lebensgefährlich sein, nicht selten brach an Bord der Atlantiksegler(1) das »Schiffsfieber« aus, meist Ruhr, Typhus oder Pocken, übertragen durch verdorbenes Trinkwasser, Ungeziefer oder die Atemluft unter Deck. Mitunter war das Wasser in den modrigen Holzfässern schon bald nach Ablegen »sehr schwarz, dick und voller Würmer«, wie ein Deutscher mit Grausen berichtete. Wenn die Passage etwa wegen schlechter Winde zu lange dauerte, gingen Vorräte und das Trinkwasser aus. Ein Schreckensbeispiel war die Fahrt der »Good Intent«, die im Herbst 1751 nicht in Philadelphia(4) anlanden konnte, weil der Delaware River(1) bereits zugefroren war. Als nach Monaten der Irrfahrt im Juni 1752 endlich der Bestimmungshafen erreicht war, hatten von 200 Passagieren nur 19 überlebt. »Only a few left«, notierte man lapidar in der Passagierliste.
Als der lutherische Pastor Heinrich Melchior(1) Mühlenberg Ende November 1742 mit einem der letzten Schiffe der Saison in Philadelphia(5) ankommt, ist er mit 31 Jahren im typischen Auswandereralter. Drei Lutheranergemeinden in Pennsylvania, mehr schlecht als recht organisiert, haben in Deutschland dringend um einen ordentlichen Geistlichen nachgesucht. Mühlenberg, noch ledig und kinderlos, jedoch bereits mit Gemeindeerfahrung, ist nun von seinen Vorgesetzten entsandt worden.
Mühlenberg(2) und die deutsch-amerikanische Familie, die er in den folgenden 45 Jahren gründen wird, das sind die Hauptfiguren dieser Geschichte. Ein Mensch der alten Welt, der zum Zeitzeugen der Zeitenwende wird. Ein Deutscher mit Zuwanderungsgeschichte, der zunächst vor den gleichen Aufgaben steht wie alle Migranten – der sich auf eine ihm völlig fremde Kultur und Sprache einstellen muss, der in den unfertigen Provinzen aus dem Nichts einen Geltungsbereich aufzubauen sucht, sich einen Namen machen will. Eine automatische Autorität als Geistlicher wie im Deutschland seiner Zeit ist Mühlenberg in Nordamerika nicht. Es gilt hier der Sinnspruch: »Pennsylvania ist ein Himmel für Farmer, ein Paradies für Handwerker und eine Hölle für Offizielle und Prediger.« Die Organisation ist laxer. Das Klima, die Gesellschaftsstruktur, die langen Wege, alles scheint hier anders als in Kontinentaleuropa zu sein. Selbst die Zeitrechnung ist zunächst noch eine andere, Englands Domäne lebt noch nach »altem Stil« im Julianischen Kalender, während in Deutschland schon der genauere, Gregorianische, eingeführt ist. Erst 1752 zieht schließlich England nach und überspringt im September ganze elf Tage, inklusive Mühlenbergs 41. Geburtstag. Den 31. hatte er auf dem Atlantik(2) verbracht.
Doch der Pastor(3) ist anpassungsfähig, ein Sprachtalent und Menschenfänger. Innerhalb der deutschen Gemeinde in Amerika steigt er rasch zur Führungsfigur auf, wird kirchenväterliche Respektsperson. Spätere Lutheraner-Generationen werden ihn den Patriarchen nennen. Und natürlich ist es verlockend, seine Geschichte, sein Hadern mit der beginnenden Revolution, die seine Kinder bald mitreißt, heute eben auch so zu lesen: als die eines alternden, europäischen Mannes, der die Welt nicht mehr versteht. Eine Welt, die um ihn herum noch einmal ganz neu gedacht, ganz »neu begonnen« wird, wie es der amerikanische Revolutionär Thomas Paine(1) formuliert.
Schockwellen gehen durch die pietistische Familie: Zwei von Mühlenbergs Söhnen verlassen in der Revolution ihre Priesterämter und beschließen, der neu entstehenden Nation zu dienen, als Militärs, als Politiker. Das ist der eigentliche Skandal, der Riss im Weltbild des Vaters: Seine Kinder kehren ihrer gottgegebenen Berufung den Rücken, seiner Kirche, und versündigen sich damit vor Gott, dem Vater. Währenddessen entfremdet sich Mühlenberg selbst immer mehr von seinen Autoritäten im weit entfernten Europa, denen er zuvor mit kindlicher Demut begegnet ist. Eine Selbstermächtigung auf mehreren Ebenen also.
Heinrich Mühlenberg(4) ist der wortmächtigste und einflussreichste Deutsche in Nordamerika. Akribisch führt er über 45 Jahre hinweg ein tägliches Journal und eine erschöpfende Korrespondenz. Seine Schriften bilden einen Großteil der Quellen für dieses Buch. Doch für das Panorama der Zeit braucht es auch die anderen Stimmen aus Gesellschaft und Familie, all der Söhne und Töchter der Freiheit. Gerade die weibliche Perspektive ist essentiell, wird sie auch, wie bei allen Darstellungen der Zeit, durch die äußerst dünne Quellenlage erschwert. Doch natürlich haben die Frauen des 18. Jahrhunderts Einfluss und agency, sie sind Teil der Geschichte, formen sie mit. Seinen schnellen Aufstieg hat Heinrich Mühlenberg(5) nicht zuletzt seiner Heirat mit Anna Maria Weiser(1) zu verdanken, deren Vater Conrad Weiser(1) Chefdolmetscher und Diplomat der Kolonien bei den indigenen Stämmen der Region ist.
Es ist Anna Marias(2) guter Name, das politische Netzwerk ihrer Familie, das den Weg des Pastors ebnet. Ohne ihre Mitgift und ein späteres üppiges Erbe wäre die finanzielle Situation der wachsenden Familie – bald sind elf Kinder geboren, sieben von ihnen werden erwachsen – noch prekärer gewesen als ohnehin schon. Anna Maria ist es, die nicht nur den Haushalt schmeißt und bei ständiger Abwesenheit ihres Mannes die Kinder großzieht, sie kümmert sich auch um die Finanzen des Hausstandes, verwaltet das Erbe ihres Vaters selbst. Mühlenberg, der große Prediger, versteht nicht viel vom Wirtschaften.
Die Frauen sind es, die während der Revolution, die vor allem ein jahrelanger, zermürbender Bürgerkrieg ist, an der Heimatfront die Hauptlast der Mühen tragen und inmitten von rasender Inflation, Güterknappheit und zusammengebrochener Handelswege mit höchstem Einsatz das Leben managen. Sicher, rein äußerlich schien die Macht klar verteilt. Die Politik war ebenso wie die Geschäftemacherei Männersache. Und doch finden sich allerorten Beispiele, wo die alte Hierarchie bereits aufgebrochen wird, wo Frauen die Geschäfte ihrer verstorbenen Männern übernehmen und eigenmächtig fortführen. Frauen wie Clementina Rind(1) aus Williamsburg(1), die 1776 die Virginia Gazette betreibt und dort über die frührevolutionären Komitees der abtrünnigen Kolonie berichtet.
Aus all diesen Stimmen soll die Innenperspektive eines revolutionären Umbruchs entstehen, ein Bild der Jahre, in denen eine diverse und oft widersprüchliche Gesellschaft sich unter großen Mühen eine Verfassung gab, die bis heute nur leicht verändert in Kraft ist, als ein Ideenkonstrukt entworfen wurde, ein politisch-gesellschaftliches System, das in bald 250 Jahren der Prototyp für viele Weiterentwicklungen weltweit geworden ist – nicht zuletzt in Deutschland. Es war dabei das Ziel, die vorliegende wahre Geschichte möglichst nahbar zu erzählen, auf Fußnoten wurde daher verzichtet, verwendete Quellen, Literatur und Archive sind im Anhang belegt. Eine Erzählung über die Kolonialzeit muss sich deren Begrifflichkeiten stellen. Von den Indigenen Amerikas ist dabei nur dort als Indianer die Rede, wo die Schilderung besonders dicht an den historischen Figuren bleibt. In einem Zitat wird außerdem das N-Wort wiedergegeben (Kapitel »Am Ohio«).
Die Mühlenbergs stehen als Familie stellvertretend für Zehntausende von deutschen Einwanderern in Amerika. Zwei Mühlenberg-Kinder(6) saßen im ersten Kongress und entschieden wegweisende Abstimmungen der noch jungen Republik. Sie übten einen derart starken Einfluss auf die deutschstämmige Wählerschaft aus, dass sie bei Präsidentschaftswahlen wie der »Revolution von 1800« das Zünglein an der Waage waren – im Schlüsselstaat, der Pennsylvania damals schon war.
Als ethnische Minderheit sind sie – wie Iren, Schweden und andere – eben keine Marionetten, die bloß von der englischen Elite mitgezogen werden, sondern Akteure mit Bewusstsein und Agenda. Die Deutschen mögen vielleicht nicht die Ideen formulieren, auf denen der amerikanische Aufbruch in die Moderne basiert, doch sie sind definitiv deren Mitträger. Sie sitzen, wenn nicht direkt in der obersten Schaltzentrale der Macht, dann aber sehr wohl im Maschinenraum. Sie legen sich ins Zeug, setzen ihr Leben ein, sind nicht wegzudenken aus dieser Story, die oft genug als anglo-zentristische Heldengeschichte erzählt worden ist.
Überall stoßen wir auf die blinden Flecken dieser Erzählung. Hätte es das Boston(1) Massacre gegeben, ohne dass zwei Wochen zuvor ein deutscher Schuljunge von einem Königstreuen bei einem Tumult in Boston getötet worden wäre? Wäre die bewaffnete Revolution ohne die deutschen Scharfschützen bereits vor den Toren von Boston 1775 im Keim erstickt worden? Es ist unmöglich zu sagen. Wichtig ist es, um diese Stränge zu wissen, um die Beteiligung nicht-englischer Migranten, deren Handlungsraum und Bedeutung. Weil es den Blick auch auf die Gegenwart schärft, denn um die Frage, wie viel »Fremdheit« eine Gesellschaft, eine nationale Erzählung, verträgt, wird auch heute noch bitter gestritten – in Deutschland wie in den USA.
Fast sieben Millionen Deutsche sind in die heutigen Vereinigten Staaten migriert. Anfangs hat die herrschende Elite auf sie herabgeblickt. Sie waren die »swarthy Germans«, Neuankömmlinge mit dunkler Hautfarbe, Aliens, so sah sie jedenfalls die englische Mehrheit. Doch das Gerede vom mehrheitlich »weißen Amerika«, an das sich nicht wenige bis heute klammern, war immer schon ein haltloses Konstrukt. Eine Legende, wie die von der eingangs erwähnten Abstimmung über das Deutsche als Landessprache. Die sogenannte Mühlenberg-Legende. Frederick Mühlenberg(1), der Sohn des Pastors, soll im Kongress mit seiner Stimme das Deutsche als Amtssprache verhindert haben. Ausgerechnet er – der deutsche Einwanderersohn. Dabei gibt es bis heute gar keine Amtssprache in den Vereinigten Staaten. Das Englische hat sich schlicht als Gebrauchssprache durchgesetzt, es hat sich, nun ja: eingebürgert.
»Je schneller die Deutschen Amerikaner werden, desto besser«, so soll Mühlenberg seine anti-deutsche Stimme begründet haben. Das ist die Moral der (erfundenen) Geschichte: Der gute Deutsche, der sich für seine Unterordnung entschieden hat, gegen die eigene Herkunft und für die Assimilation.
Einmal, Anfang der 1970er Jahre, fiel die Wochenzeitung DIE ZEIT auf die Story herein. Eine Richtigstellung wurde gedruckt. »Wenn man es sich aber genauer überlegt, so ist die Geschichte ja völlig unmöglich«, befand dort der Historiker und Schriftsteller Golo Mann(1). »Die alten Kolonien im Osten waren ganz englisch, und englisch war die Revolution der 1770er und 80er Jahre … Sich etwa Jeffersons(1) ›Unabhängigkeitserklärung‹ in deutscher Sprache vorzustellen – völlig unmöglich.« Gerade mit diesem Beispiel aber hätte er nicht falscher liegen können, wie wir sehen werden.
I.
GOTT WIRD AMERIKANER
1776/77
»Leben, Freyheit und das Bestreben nach Glückseligkeit …« Unabhängigkeitserklärung auf Deutsch, Philadelphia, Juli 1776
»Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht«
Im Druckerviertel von Philadelphia(6) herrscht am späten Nachmittag des 4. Juli 1776 Hochbetrieb. Bei dem Nordiren John Dunlap(1) in der Second Street ist ein Eilauftrag des amerikanischen Kontinentalkongresses eingegangen. Die Wege in der Hauptstadt sind kurz, die Delegierten der 13 Kolonien tagen keine zehn Gehminuten entfernt im State House(1) von Pennsylvania in der Chestnut Street. Nach Tagen zäher Beratungen haben sie sich nun endlich auf den finalen Wortlaut ihrer Erklärung geeinigt.
Dunlap(2) und seine Leute arbeiten die ganze Nacht hindurch. Das Setzen ist eine mühselige, kraftraubende Arbeit. Jede der gut 8000 Bleilettern muss einzeln von Hand in die Druckform eingefügt werden. Um Zeit zu sparen, bricht man den Text in mehrere Teile herunter, die zeitgleich gesetzt und vor der Drucklegung wieder zusammengefügt werden. Am nächsten Morgen schon können die ersten Exemplare an den Kongress ausgeliefert werden, insgesamt 200 Stück. Ein berittener Bote wird zu General Washington(1) ins Feldlager der amerikanischen Armee geschickt. Zwei Kopien sollen mit dem nächsten Schiff an den britischen König(1) nach London(1) gehen. Um ihn geht es schließlich.
Fast zeitgleich machen sich 300 Meter die Straße hinauf zwei deutschsprachige Einwanderer an die erste und wichtigste Übersetzung dieser Erklärung. Melchior Steiner(1) und Charles Cist(1) sind sich der Größe ihrer Aufgabe zweifellos bewusst. Schnelligkeit und Genauigkeit sind gleichermaßen gefragt. Die Deutschen sind die größte nicht-englischsprachige Gruppe in Amerika. Sie machen nach Schätzungen mehr als zehn Prozent der Bevölkerung aus; in Pennsylvania wohl sogar mehr als ein Drittel, niemand weiß es genau. Sie sind jedenfalls viele, die deutschen Einwanderer. Sie müssen von der amerikanischen Sache überzeugt werden, ja, ohne die Unterstützung der Deutschen wird der Krieg gegen England schlicht nicht zu gewinnen sein.
Seit anderthalb Jahren befanden sich die dreizehn nordamerikanischen Kolonien nun schon in gewaltsamer Auflehnung gegen das Mutterland, seit im April 1775 in den beiden Bostoner(2) Vororten Lexington(1) und Concord(1) die ersten Schüsse gefallen waren. Was als Widerstand gegen die Steuerpolitik des Königs(2) und seines Parlamentes in London(2) begonnen hatte, hatte sich zu einem zähen Ringen um nationale Souveränität ausgeweitet. Der Kontinentalkongress, also das Behelfsparlament der Revolutionäre, in dem Delegierte aller Kolonien saßen, strebte nun die Gründung eines eigenen Staatenbundes an.
Melchior Steiner(2) und Charles Cist(2) waren, wie ihr irischer Kollege Dunlap(3), in Europa geboren. Cist stammte aus einer deutschen Familie in St. Petersburg und hatte an der Martin-Luther-Universität im sächsischen Halle(1) Medizin studiert, Steiner war ein Pastorensohn aus der deutschsprachigen Schweiz. Zu Werbezwecken nutzte er oft eine anglisierte Variante seines Nachnamens: Styner. Das weckte Vertrauen bei der englischsprachigen Mehrheit, die immer noch zahlreiche Ressentiments gegen die Deutschen hegte, diese »Pfälzer Bauernlümmel«, wie Philadelphias(7) bekanntester Bürger Benjamin Franklin(3) sie einst genannt hatte. Steiners Partner hatte aus diesem Grund gleich einen ganz neuen Namen aus seinen Initialen gebildet: Aus Carl Jacob Sigismund Thiel war das Englisch klingende »Cist« geworden.
Die beiden deutschen Drucker arbeiten sorgfältig und mit Sinn für ihre Leserschaft. Der englischen Vorlage folgend entscheiden sich Steiner(3) und Cist(3) beim Papier für große Einzelbögen, so genannte broadsides, wie sie für öffentliche Bekanntmachungen und Aushänge in der Stadt zur damaligen Zeit üblich sind. Einseitig bedruckbares Büttenpapier von 16 mal 12 ¾ Zoll, rund 41 mal 32 Zentimeter. Anders jedoch als John Dunlap(4), der die im Englischen gebräuchliche Antiqua-Schrift Caslon genutzt hatte, setzten Steiner und Cist ihre Version in Fraktur – ein Service an das deutsche Auge. Außerdem teilten sie ihr Layout in leserfreundliche zwei Spalten auf statt nur einer.
Fieberhaft brütet Charles Cist(4) über der Übersetzung ins Deutsche, wägt die Formulierungen dieses hochbrisanten Dokuments. Im Kern besteht es aus 27 Vorwürfen an den britischen König Georg III.(3) Sorgfältig prüft Cist die Schlüsselbegriffe, das lateinische Lehnwort usurpations etwa taucht gleich dreimal im Textverlauf auf. Es ist ein Spagat nötig zwischen Bedeutungskern und Zielgruppe, die meisten Deutschen in den Kolonien stammen nun einmal, da hatte Franklin(4) nicht ganz unrecht, aus einfachen, um nicht zu sagen: bäuerlichen, Verhältnissen. Usurpations, usurpations … Am Ende entscheidet sich Cist für »gewaltsame Eingriffe«, etwas sperrig vielleicht, aber immerhin unlateinisch.
Schon einen Satz später stockt er erneut: »To prove this«, liest der Drucker wieder und wieder den letzten Teil der Einleitung, »let Facts be submitted to a candid World.« Hier versteckte sich der wahre Adressat dieser Unabhängigkeitserklärung: Nicht nur dem König(4) und dem Parlament in London(3) wollten die Amerikaner ihre Forderungen präsentieren, sondern der ganzen Welt. Bloß wie war diese Welt am ehesten beschaffen? Redlich? Offen? Oder doch eher aufrichtig? »Unpartheyisch«, brummte Steiner(4) schließlich ungeduldig. Oder war es Cist(5) selber gewesen? Im stickigen Hinterzimmer des Druckhauses schien er sich in einen traumartigen Geisteszustand gearbeitet zu haben. Egal, damit konnte man jedenfalls arbeiten.
»Dis zu beweisen«, schreibt Cist(6), »wollen wir der unpartheyischen Welt folgende Facta vorlegen«. Zeile um Zeile überträgt er die englischen Worte ins Deutsche. Der Schweiß rinnt ihm in den Nacken. Immer schneller kommt er voran. Bald schon ist er beim letzten Anwurf gegen den König(5) angelangt:
Er hat unter uns häusliche Empörungen und Aufstände erregt, und gestrebt über unsere Grenz-Einwohner die unbarmherzigen wilden Indianer zu bringen, deren bekannter Gebrauch den Krieg zu führen ist, ohne Unterscheid von Alter, Geschlecht und Stand, alles niederzumetzeln.
Cist(7) merkt, dass er unwillkürlich zu nicken begonnen hat. Ja, das würde verfangen bei den deutschen Siedlern, von denen eine immer größere Zahl mit ihren Familien ins pennsylvanische Hinterland zogen, wo es, anders als hier in der Stadt, noch günstiges Land zu erwerben gab, oft direkt an der Grenze zu den Indianergebieten, an der frontier, wie man hier sagte. Wer für den Schutz der Siedler aufkommen würde, das war eine der drängendsten politischen Fragen. Immer wieder kam es zu Überfällen und wechselseitigen Gräueltaten zwischen den weißen Siedlern und den Ureinwohnern dieses Kontinents, deren grausame Einzelheiten sich rasch bis in die Städte verbreiteten. Der König(6) im fernen London(4) aber schien sich nicht verpflichtet zu sehen, seiner Verantwortung als väterlicher Herrscher nachzukommen und schützend die Hand über die weitere Expansion seiner Kolonien zu halten.
Endlich war Charles Cist(8) beim Schlussteil angelangt, nicht ahnend, dass ihm der Kongress weitere Mehrarbeit erspart hatte. Denn im ursprünglichen Entwurf hatte es noch einen 28., einen letzten Abschnitt gegeben, den längsten von allen, in dem man dem Monarchen(7) einen »grausamen Krieg gegen die Natur des Menschen selbst« vorwarf, die Verschleppung zehntausender unschuldiger Afrikanerinnen und Afrikaner in die Sklaverei. Ein eklatanter Verstoß gegen die »heiligsten Rechte von Leben und Freiheit eines fernen Volkes«, so hatte es der Hauptautor Thomas Jefferson(2) formuliert, der den Text als Untermieter einer wohlhabenden deutschen Familie, der Graffs, in Philadelphia(8) entworfen hatte. Diese letzte Passage jedoch bekamen weder Steiner(5) und Cist(9) noch die amerikanische Öffentlichkeit zu sehen. Sie war vom Kongress vor der Ratifizierung im Sinne der nationalen Einigkeit gestrichen worden. Die Sklaverei in den Kolonien blieb so im gesamten Text unerwähnt.
Als erste Zeitung vermeldete am 5. Juli der deutschsprachige »Pennsylvanische Staatsbote« die Neuigkeiten des Vortags. Herausgeber war Henrich Miller(1), bei dem Steiner(6) und Cist(10) das Druckerhandwerk gelernt hatten. Miller hatte auch ein Auge auf ihre Übersetzung geworfen. Am Sonnabend, den 6. Juli, erschien der englische Text der Declaration of Independence dann in der »Pennsylvania Evening Post«. In ihrem überhitzten Druckhaus wischen sich Melchior Steiner und Charles Cist nur wenig später den dunklen Schweiß vom Gesicht. Ein letztes Mal noch prüfen sie ihre Übersetzung ins Deutsche. »Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht«, liest Cist(11) halblaut vor, »daß alle Menschen gleich erschaffen worden, daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräusserlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freyheit und das Bestreben nach Glückseligkeit.«
Zufrieden wirft Steiner(7) einen letzten Blick auf die Fußzeile, in der die Adresse des Druckhauses vermerkt ist. Eine prächtige Werbung für das Geschäft! Dann eilten schon die Botenjungen aus der Tür. Die Erklärung der dreizehn britischen Kolonien, die sich fortan die »Vereinigten Staaten von America« nannten, würde sich rasch unter den Deutschen verbreiten, so viel stand fest. Ob diese sich jedoch auch überzeugen lassen würden, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, all die Entbehrungen der Auswanderung, die liebgewonnenen Freiheiten und ihren bescheidenen Wohlstand in der neuen Welt, all das für ein paar hehre Ideale und die vage Idee einer neuen Ordnung – das war wiederum eine ganz andere Frage. Sie blieb auch nach dem 4. Juli 1776 weiter offen.
Pastor Mühlenberg flieht
Die Worte waren das eine. Und ja, die Vertreter der abtrünnigen Kolonien hatten am Ende einen Kompromiss gefunden, eine gemeinsame Sprache. Ihre Erklärung war nun im Umlauf, bald würde sie auch den König(8) und sein Parlament erreichen. Aber wie es weitergehen sollte, darüber war man sich auch in Amerika weiterhin entschieden uneinig. Während die einen glühende Befürworter der Unabhängigkeit waren, wollten die anderen lieber Teil des britischen Empire bleiben. Und eine dritte, weitaus größte Gruppe wusste überhaupt noch nicht, was sie von all dem halten sollte. In dieser großen Mehrheit, zu der auch viele Deutsche zählten, war man weiterhin unentschlossen, desinteressiert bis apathisch. Man wollte von diesem Krieg nichts wissen.
Und doch setzte die Unabhängigkeitserklärung auch rasche Entscheidungen in Gang – so etwa beim wohl einflussreichsten Deutschen in Nordamerika. Nur wenige Tage nach dem 4. Juli packte Heinrich Melchior Mühlenberg(7), Pastor und Oberhaupt der deutschen Lutheraner in Amerika, in seinem Haus in Philadelphia(9) das Nötigste zusammen, er informierte die Kirchenältesten und ein paar engste Vertraute. Dann lieh er sich einen Pferdewagen und floh gemeinsam mit seiner Frau und seiner jüngsten Tochter vor der Revolution hinaus aufs Land.
Mühlenberg war als junger Geistlicher von Europa nach Pennsylvania gekommen, Anfang der 1740er Jahre, damals 31-jährig. Was als Auftrag seiner Kirche begonnen hatte, den deutschen Gemeinden in Philadelphia(10) und Umgebung für zunächst drei Jahre als Pfarrer zu dienen, war zu einem umfassenden Lebenswerk geworden. Mit einer Mischung aus unermüdlichem Einsatz, Organisationstalent, Autorität und Charisma war Mühlenberg ans Werk gegangen, hatte Gemeinden vereint und Hierarchien begründet, hatte Schulen und Kirchen bauen lassen, wo man vorher in windschiefen Scheunen untergekrochen war, und ein Netzwerk in Gesellschaft und Politik geknüpft. In dreieinhalb Jahrzehnten waren die deutschen Lutheraner von einem versprengten Häuflein zu einer der wichtigen Gruppen Pennsylvanias geworden.
Im Juli 1776 nun, in diesem Sommer der Umwälzung, war Heinrich Melchior Mühlenberg(8) 64 Jahre alt und blickte auf eine wahrhaft beeindruckende Lebensleistung zurück: Er hatte mit seiner Frau Anna Maria(3) eine neunköpfige Familie gegründet, drei Söhne, vier Töchter. Mühlenberg hatte seine Nachfolge geregelt, die Söhne Peter(1), Friedrich(2) und Heinrich waren allesamt Pastoren geworden, zwei seiner Töchter überdies mit lutherischen Predigern verheiratet. Es war im Kern ein sehr amerikanisches curriculum vitae: ein Einwanderer, der aus dem Nichts eine kleine Dynastie aufgebaut hatte.
Und dann brach der Krieg aus, die Revolution, das Chaos. Und das ganze Gebilde geriet mit einem Mal ins Wanken, Heinrich Mühlenbergs amerikanischer Traum.
Wovor genau floh er(9), was fürchtete der deutsch-amerikanische Pastor im Revolutionssommer 1776? Zum einen waren es die Wirren, die jeder Krieg mit sich bringt. Die Unordnung und Zwietracht, denn dies war keiner der üblichen Konflikte jener Zeit, in denen die europäischen Weltmächte, England, Frankreich(1), Spanien, ständig irgendwo um Territorien und Einfluss rangen, meist zur See oder im Hinterland einer ihrer Kolonien. Das hier war etwas anderes, im Kern ein Bürgerkrieg, ein bellum intestinum, der das Innerste der Gesellschaft aufrührte. Ein Krieg, den formell betrachtet zunächst einmal Engländer gegen Engländer führten. Selbst die Neutralität eines Gottesmannes, das spürte Mühlenberg, würde zwischen diesen Fronten bald nicht mehr akzeptabel sein.
Heinrich Melchior Mühlenberg (1711–1787)
Aber da war auch noch eine zweite Ebene, die Mühlenberg(10) ängstigte und verwirrte, ein tiefer persönlicher Konflikt. Es war nicht weniger als seine eigene Identität, die auf dem Spiel stand. Mühlenberg entstammte einer Welt, in der weltliche und geistliche Autorität eng mit einander verbunden waren, ja, in der die beiden voneinander abhingen. Eine Welt, deren Herrscher von Gottes Gnaden waren und von Bischöfen geweiht wurden und die Landeskirchen unter dem Schutz der Obrigkeit standen. Mühlenberg war überdies 1711 in Einbeck(1) geboren, was im Kurfürstentum Hannover(2) lag, aus dem auch der englische König(9) stammte. In dritter Generation stellte das House of Hanover bereits den Monarchen. Mehrfach hatte ihm Mühlenberg offiziell den Treueeid schwören müssen, bei seiner Ankunft in Amerika wie auch später bei seiner Naturalisierung, der Einbürgerung als Brite.
Und hatte nicht eben dieser König(10) dafür gesorgt, dass Mühlenberg(11) seine Religion hier, in dessen Kolonien, ungehindert ausüben konnte, dass er seine Kirche bauen und die Gemeinde vermehren durfte? So war es bereits seit den Zeiten des Apostels Paulus gewesen: »Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat«, hatte dieser in seinem Brief an die Römer geschrieben. »Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott.«
Nun aber hatte man begonnen, an all dem zu rütteln. Die Autoren der Declaration of Independence beriefen sich nicht auf die Bibel oder auf die Apostel, nicht auf jahrhundertealte Autoritäten, sondern vielmehr auf die Vernunft des Menschen. »Wenn es im Lauf menschlicher Begebenheiten für ein Volk nöthig wird die Politischen Bande, wodurch es mit einem andern verknüpft gewesen, zu trennen«, so hatten Steiner(8) und Cist(12) die einleitenden Worte Jeffersons(3) übersetzt, »wozu selbiges die Gesetze der Natur und des Gottes der Natur berechtigen, so erfordern Anstand und Achtung für die Meinungen des menschlichen Geschlechts, daß es die Ursachen anzeige, wodurch es zur Trennung getrieben wird.«
»Die Gesetze der Natur«? Ein »Gott der Natur«? Heinrich Mühlenberg(12) wusste, wo solcherlei Wortschatz zu verorten war: im Deismus, dieser neumodischen Strömung, der nicht nur Jefferson(4) anhing, wie man hörte. Die Deisten glaubten nicht an einen allmächtigen, dreifaltigen Gott als väterlichen Lenker der Menschen auf Erden, sondern an eine vage Schöpfergestalt, die die Erde und eine vernunftbegabte Menschheit geschaffen hatte, um sie fortan weitestgehend sich selbst und ihrem Verstand zu überlassen.
Für einen strammen Lutheraner wie Mühlenberg(13) dagegen war das eine überaus anmaßende Vorstellung, hatte doch Martin Luther(1) selbst überzeugend dargelegt, dass es ausgehend vom Glauben an einen alles wissenden und vorhersehenden Gott einen freien Willen weder im Menschen noch im Engel noch in sonst einer Kreatur geben konnte. Nein, Heinrich Mühlenberg verachtete den Deismus mit allem, was ihm heilig war. Diese theologische Verirrung stand für ihn auf einer Stufe mit Naturalismus, Freimaurertum, Atheismus gar. Deismus, fand der Pastor, das war nur ein anderer Begriff für Egoismus, und die Welt der Deisten war eine des reinen Chaos.
Mühlenbergs(14) Gott hingegen, der Vater Christi und der Menschen, offenbarte sich nicht vage in der Natur und dem Geist der Menschen, sondern Wort für Wort in der Bibel. Er hatte seinen Sohn auf die Erde gesandt, ihn sterben und wieder auferstehen lassen, sein Wille manifestierte sich jeden Tag aufs Neue in der Erfüllung seiner unfehlbaren Vorsehung. Und den Gläubigen auf Erden oblag es lediglich, diese Providenz so gut es ging zu befolgen, durch harte Arbeit und ein gottesfürchtiges Leben, durch Demut und den festen Glauben, »daß einer am Ruder sitzet, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden übergeben. Der nicht schläft noch schlummert, und seinem Volk gebeten hat zu beten: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe«.
In welche Richtung sich aber die Ruderpinne des Weltenlaufs nun inmitten dieser großen Krise wenden würde, das konnte im Juli 1776 weiß Gott noch niemand auf Erden sagen. Daher wusste Pastor Heinrich Mühlenberg(15) vorerst nur eines: dass er weg musste aus dem engen Philadelphia(11), der Stadt der tausend Ohren, wo Befürworter und Gegner dieser Revolution Tür an Tür lebten und passive Zurückhaltung so manchem schon verdächtig wurde.
Ob er für oder gegen die nun ausgerufene Unabhängigkeit war? Für Heinrich Melchior(16) Mühlenberg war das die völlig falsche Fragestellung. Ihn trieb auch nach geglückter Landflucht weiterhin eine ganz andere Frage um: Auf welcher der beiden Seiten in diesem Konflikt mochte wohl Gott, der Allmächtige, selbst stehen?
Unsichtbare Väter
Von Philadelphia(12) aus waren es etwa 30 Meilen in nordwestlicher Richtung bis ins beschauliche Providence(1) Township. Mit einem schwer beladenen Pferdewagen in der pennsylvanischen Sommerhitze seinerzeit eine durchaus beschwerliche Tagesreise. Man reiste zu dritt, Heinrich Mühlenberg(17), seine Frau Anna Maria(4) und ihre jüngste Tochter, die neunjährige Sally(1). Der Weg der Pastorenfamilie führte unter sengender Sonne über staubige Wege und durch dichte Mückenschwärme hindurch an goldgelben Feldern vorbei. Immer wieder mussten die Pferde im Schatten getränkt werden. Der Weg führte durch die beiden Furten der Flussläufe Skippack(1) und Perkiomen(1), die jedoch glücklicherweise im Sommer wenig Wasser führten. Brücken gab es hier noch keine.
Providence(2) war eine ruhige Siedlung von gerade einmal ein paar Dutzend verstreuten Häusern und Höfen, mit bester Anbindung in alle Richtungen. Im Jahr 1776 ein geradezu idealer Ort für ein Exilantenleben an der Kreuzung der Möglichkeiten. Die Mühlenbergs kannten sich aus in der Nachbarschaft. Hier in Providence hatten sie 30 Jahre zuvor ihre Familie gegründet, hier hatte Mühlenberg(18) als junger Gemeindepfarrer seine erste Kirche in Amerika bauen lassen, St. Augustus(1). Ein schlichter Steinbau mit Mansarddach, ohne Turm oder sonstige Ornamente, ein stolzes kleines Dorfkirchlein.
Das Haus war bereits bezugsfertig, ein geräumiger zweigeschossiger Bau aus rotem Sandstein direkt an der Hauptstraße, der in den Wochen zuvor gründlich instand gesetzt worden war: Man hatte den Keller ausräumen lassen, Zimmer und Flure frisch geweißt und drei Dutzend Scheiben der kleinteiligen Sprossenfenster ersetzt. Die 200 Obstbäume auf dem knapp drei Hektar großen Grundstück, im Frühjahr zurückgeschnitten, hatten bereits prächtig ausgetrieben. Ja, es war wirklich schön geworden, ein kleines Idyll auf dem Land, weit genug weg vom Krieg und den Wirren der Revolution.
Die Unabhängigkeitserklärung war der letzte Anlass für eine lange überfällige Familienentscheidung gewesen. Seit Jahren bereits hatten die Ärzte Anna Maria(5) zum Rückzug aufs Land geraten. Mühlenbergs Frau wurde von epileptischen Anfällen heimgesucht, »hysterischen Convulsionen«, wie ihr Mann sie mangels einer echten Diagnose nannte. Sie konnten eine Stunde oder sogar noch länger andauern. Eine Therapie gab es nicht. 15 Jahre Stadtleben hatten Anna Marias Zustand zweifelsohne verschlimmert. Im zurückliegenden Winter hatte sie nicht ein einziges Mal das Haus verlassen. Und auch ihr 16 Jahre älterer Mann war zuletzt selbst bei kurzen Gängen durch die Stadt außer Atem geraten. »Was wunder«, hatte er lakonisch resümiert, »daß es im Alter am Othen fehlt, wenn man in der Jugend zu viel Wind gemacht.«
Heinrich Mühlenberg(19) wusste, wovon er redete. Über drei Jahrzehnte lang war er rastlos von Gemeinde zu Gemeinde gehetzt. Hunderte von Stunden im Sattel lagen hinter ihm, ungezählte zehrende Reisen bei jedweder Witterung – im Schneetreiben des Februars, genauso wie in der Hitze der Hundstage, über verschlammte Wege im Frühjahr und durch reißende Furten im Herbstregen. Dabei hatte er stets die eigene Berufung im Kopf gehabt, die Erbauung der Gemeindeglieder, die Mehrung von Luthers(2) Kirche im Auftrag seiner europäischen Väter – ein viele Jahre schon übererfüllter Auftrag.
Und immer zu Hause, alleine, ohne ihren Mann, ihren Vater: Anna Maria(6) und die Kinder. Sieben von elf hatten die Kindheit überlebt, vier waren gestorben, bevor sie das Grundschulalter erreichten. All die einsamen Jahre als Frau und Mutter, die Mühsal und Sorge, Krankheit und Tod und dazwischen all das Leben – und der Pastor(20) stets im Dienst der Gemeinde, immer unterwegs, zum Gottesdienst, einer Tauffeier oder zur nächsten Synode. Und wenn er doch einmal zu Hause war, dann ewig brütend, Briefe schreibend und Tagebuch führend, immer irgendwo Rechenschaft ablegend vor Gott und der Welt.
Es ist ein paradoxer Gedanke, der sich aufdrängt: Wenn Gott tatsächlich ein väterlich lenkender Steuermann war, wie er glaubte, dann war Heinrich Melchior(21) Mühlenberg all die Jahre dessen genaues Gegenteil gewesen: eine ewig abwesende, schier unsichtbare Vaterfigur, selbst für die Standards seiner Zeit. Ein nebulöser Schöpfer also, ganz im Sinne der von ihm so verachteten Deisten, der eine Menschenfamilie in die Welt gesetzt hatte, um sie dann weitgehend sich selbst zu überlassen.
Mit einem Handwerker oder Farmer wäre sie besser dran gewesen, hatte Anna Maria(7) ihrem Mann einmal in einem Moment größter Enttäuschung gesagt. Die waren wenigstens jeden Abend daheim. Und doch war sie gewachsen über die Jahre, die Familie des Einwanderers, die erste Generation in Amerika. Meet the Mühlenbergs: Peter(2) (29), Betsy(1) (28), Frederick(3) (26), Peggy(1) (24), Henry(1) (22), Polly(1) (20) und Sally(2) (9). Schon hatten die Älteren geheiratet, die ersten Enkel waren geboren. Nur noch Sally, die Nachzüglerin, lebte im Haushalt der Eltern. Zwei Tage nach der Ankunft in Providence(3) feierte man ihren zehnten Geburtstag. Wir können uns einen strahlenden Sommertag unter Obstbäumen vorstellen. Eine trügerische Stille lag über dem Ort. Wer Kinder hat, kommt ohnehin nie wieder ganz zur Ruhe. Zumal im Krieg.
Da ist der zweitälteste Sohn Frederick (Friedrich)(4) mit seiner jungen Familie, die gerade noch aus dem von der britischen Flotte bedrohten New York(1) geflohen sind; da ist Fredericks jüngere Schwester Peggy(2), hochschwanger mit ihrem zweiten Kind im hitzigen Philadelphia(13). Ihr Mann, Pastor Kunze(1), will nicht fliehen – die Gemeinde brauche ihn … Was würde wohl noch auf sie alle zukommen in dieser mehr als »delikaten Angelegenheit«, wie Heinrich Mühlenberg(22) es ausdrückte? Er fürchtete Schlimmstes: »es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater«.
Schon ging der Riss auch mitten durch die Familie des Pastors. Sein Ältester hatte sich bereits verführen lassen von den weltlichen Läufen, so sah der Vater es jedenfalls. Peter(3) hatte seine Gemeinde in Virginia(1) verlassen, um stattdessen nun, für flüchtigen Weltenruhm, wie Mühlenberg annehmen musste, als Oberst in George Washingtons(2) Kontinentalarmee zu kämpfen – an der Spitze eines von ihm selbst rekrutierten Regiments deutscher Auswanderer. Seinen Vater hatte das tief gekränkt. Ein Pastor hatte doch eine heilige Berufung zu befolgen, die man nicht einfach abstreifen konnte wie einen lästigen Mantel.
Überhaupt, der unselige Krieg! Die amerikanische Seite taumelte von einer Niederlage zur nächsten. Ständig befand sich Washingtons(3) Armee auf dem Rückzug. Ende August wurde sie auf Long Island(1) empfindlich von den Briten geschlagen und floh danach schmählich im Schutze der Nacht südwärts. Am 15. September 1776 besetzte die britische Armee New York(2). Vier Tage nach der Einnahme der zweitgrößten Stadt der Kolonien meldete sich der König(11) aus England zu Wort.
In zwei knappen Absätzen ließ George III. mittels seiner militärischen Oberbefehlshaber in Amerika, der Brüder William(1) und Richard Howe(1), alle Forderungen nach Unabhängigkeit freundlich, aber bestimmt zurückweisen. Es war eine doppelte Botschaft: Die »wohlmeinenden Untertan« unter den Koloniebewohnern bat man höflich, aber bestimmt, um Unterstützung bei der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung. Wer dagegen weiter der Revolution nacheilte, gehörte zum »fehlgeleiteten« Teil der Bevölkerung. Es war ein kluger Schachzug, der die beiden Lager gegeneinander auszuspielen versuchte. Der Krieg zerrte an der Gesellschaft, die Spaltung verstärkte sich, je länger er dauerte. Die Menschen litten unter Inflation und Mangelwirtschaft. Schon nahte der Winter.
Von New York(3) aus wurden Washingtons(4) unerfahrene Truppen durch die gut organisierte britische Berufsarmee weiter und weiter Richtung Philadelphia(14) gedrängt, Fort um Fort musste die Kontinentalarmee aufgeben. Mitte Dezember passierten die ersten Flüchtlingstrecks Providence(4). Bald rollten die vollbepackten Wagen von früh bis spät am Haus der Mühlenbergs vorbei, Männer, Frauen, Alte, Kinder, alles floh aus der Stadt ins Hinterland.
Heinrich(23) und Anna Maria(8) bangten um ihre Kinder, auch und gerade um Peter(4). Bei der Verteidigung von Charlestown(1) (dem heutigen Charleston) in South Carolina hatte er sich erste Sporen verdient, doch in der ungewohnten Hitze des Südens waren er und seine Deutschen schwer dezimiert worden. Peter hatte sich ein Lungenleiden zugezogen, von dem er sich nur langsam erholte. Aus Virginia(2) schrieb er den Eltern nach Providence(5):
Gerade sind wir zurück von unserer mühseligen Kampagne. Mein Regiment hat fürchterlich unter Krankheit gelitten. Sobald genügend Ersatz rekrutiert ist, haben wir Befehl, auf Philadelphia(15) zu marschieren.
American Crisis
Kurz vor Weihnachten 1776 wird im Druckhaus von Melchior Steiner(9) und Charles Cist(13) in der Second Street ein prominenter Kunde vorstellig. Der Mann mit der markanten Nase und dem fliehenden Haupthaar muss sich den beiden Deutschen nicht weiter vorstellen. Steiner und Cist haben Anfang des Jahres für Thomas Paine(2) dessen 50-seitiges Pamphlet »Common Sense« gedruckt, sowohl im englischen Original als auch in deutscher Übersetzung.
The cause of America is […] the cause of all mankind: Paines »Common Sense«, ein flammender Appell für einen völligen Bruch mit England, war, praktisch über Nacht, zu einem frühen Schlüsseldokument der Revolution geworden. Ein erster amerikanischer Bestseller. Immer neue Ausgaben waren erschienen. Innerhalb weniger Wochen hatten sich Zehntausende Exemplare in Pennsylvania und den anderen zwölf Kolonien verkauft. Und obwohl anonym publiziert, kannte man den Autor dieser Kampfschrift bald überall. Was auch daran lag, dass Paine(3) sich ebenso heillos wie öffentlich mit seinem ursprünglichen Verleger, dem Schotten Robert Bell(1), über die Tantiemen zerstritten hatte. Bell betrieb sein Geschäft gleich neben der kleinen Anglikanerkirche St. Paul’s(1), drüben in der Dritten Straße.
Im Druckhaus der Deutschen verliert Paine(4) nun keine Zeit. Er wirkt, als habe er länger nicht geschlafen. Er komme direkt aus dem Feldlager von Generalmajor Greene(1), eröffnet er den beiden Druckern, mit einem dringenden Auftrag. Er kramt ein paar handbeschriebene Seiten aus der Tasche. The American Crisis lesen Steiner(10) und Cist auf dem Titel. Paine drängt: Wie schnell sie veröffentlichen könnten? Das Schicksal Amerikas hänge davon ab. Cist(14) und Steiner(11) wechseln einen schnellen Blick. Paines Starrsinn war legendär.
Der gebürtige Engländer war eine dieser irrlichternden Existenzen, für die in der alten Welt nicht genug Platz zu sein schien, ein geschiedener Schulabbrecher, der weder im väterlichen Beruf des Korsettmachers noch als Seefahrer oder Steuereintreiber glücklich geworden war. Immer wieder hatte er Probleme mit den britischen Autoritäten bekommen. Von Benjamin Franklin(5) nach Amerika empfohlen, hatte Paine(5) dort seit seiner Ankunft im November 1774 als Mitbegründer des »Pennsylvania Magazine« mit spitzer Feder gegen den Sklavenhandel angeschrieben, um schließlich in der beginnenden Revolution sein Lebensthema zu finden. Die Freiheit. Die Selbstbestimmung. Den Menschen.
Am 19. Dezember, dem Donnerstag vor Weihnachten, kam Paines(6) neuestes Werk aus dem Druck. Es war ein viel kürzerer Text als »Common Sense«, nur 3500 Wörter. Publiziert wurde er lediglich auf Englisch, für alles andere reichten weder Zeit noch Geld. Das Honorar betrug nur zwei schmale Kupfermünzen. Das Ganze sei als Serie konzipiert, stellte Paine den Deutschen noch hastig weitere Ausgaben in Aussicht, als er mit den ersten Exemplaren unter dem Arm bereits schon halb aus der Tür war.
Auf dem Deckblatt hatten Steiner(12) und Cist(15) nicht den Namen des Autors, sondern schlicht dessen größten Erfolg ausgewiesen: »by the Author of Common Sense«, stand dort zu lesen. Jeder wusste ohnehin, um wen es sich handelte. Paine(7) packte Amerika gleich im Einstieg seines Pamphlets bei der Ehre. »These are the times that try men’s souls«