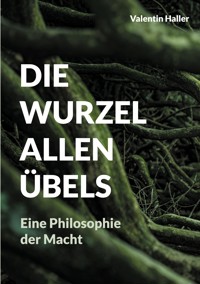
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Klimawandel, Krieg in der Ukraine, Migration, Inflation, Hungersnöte, extreme Armut, erstarkte Diktaturen - im jungen dritten Jahrtausend ist die Welt nichts als Polykrise. Um Ressourcen wird gestritten, um Meinungen, selbst um Begriffe wie «Freiheit» oder «Wahrheit». Viele von uns halten dies für einen Normalzustand. Sie denken, Chaos und Elend wären gezwungenermassen Wegbegleiter von Homo sapiens, unsere Gesellschaften hätten halt natürliche Unwuchten. Und wenn wir in der Geschichte zurückblättern, werden solche fatalistischen Denkmuster oft bestätigt, denn auch dort finden wir Krisen, Armut, Hunger und Krieg in unsäglichem Überfluss. Gleichwohl unterliegen wir einem Irrtum, denn nichts von alledem ist normal, natürlich oder unausweichlich. Anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse zahlreicher Fachrichtungen zeigt der Autor, dass unser Elend eine zentrale Ursache hat, die es zu bekämpfen gilt: Macht. Sie ist die eine Wurzel allen Übels. Doch woher kommt Macht, wodurch zeichnet sie sich aus, und mit welchen Massnahmen werden wir sie dereinst wieder los? Dieses Buch erklärt und liefert Antworten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Valentin Haller, geboren 1975 in der Schweiz, hat in jungen Jahren berufsbegleitend Betriebswirtschaft studiert, ohne sich substanziell dafür zu begeistern. Später, nach gereifter Selbsterkenntnis, bildete er sich mit Interesse und aus Leidenschaft in Journalismus und angewandter Ethik weiter. Bislang arbeitete er als Büroangestellter, Unternehmensberater, Programmierer, Projektmanager und Administrativleiter. Erwerbstätig war er bei einer Gemeindeverwaltung, einer Müllverbrennungsanlage, einem Handelsbetrieb, zwei Software-Beratungsunternehmen und einer gemeinnützigen Organisation. Seine Freizeit widmet er oft dem Schreiben, wie vorliegendes Buch ziemlich deutlich nahelegt. Er betreibt den kleinen Weblog verbosus.ch, um hin und wieder seine Gedankenwelt zu externalisieren, und unternimmt bei jedem Wind und Wetter Spaziergänge in der freien Natur, um seine Gedankenwelt sortiert zu kriegen.
So, und ab sofort wird die Ich-Form verwendet; das ist mir nämlich deutlich zu schräg und abgehoben, hier weiter sozusagen royal über mich selbst in der dritten Person zu reden.
Inhalt
Vorwort
Prolog
TEIL 1 ZUR GENEALOGIE DER MACHT
Kapitel 1 Einleitung
Kapitel 2 Biologische Sackgasse
Kapitel 3 Affige Sackgasse
Kapitel 4 Steinzeitliche Sackgasse
Kapitel 5 Intermezzo
Kapitel 6 Der selbstdomestizierte Mensch
Kapitel 7 Die Falle schnappt endgültig zu
Kapitel 8 Zur Genealogie der Macht
TEIL 2 ZUR PSYCHOLOGIE DER MACHT
Kapitel 9 Die Schande unserer Spezies
Kapitel 10 Die Zierde unserer Spezies
Kapitel 11 Macht und die Mächtigen
Kapitel 12 Macht und die Machtlosen
Kapitel 13 Zur Psychologie der Macht
TEIL 3 ZUR NATUR DER MACHT
Kapitel 14 Militärische Macht
Kapitel 15 Ideologische Macht
Kapitel 16 Wirtschaftliche Macht
Kapitel 17 Politische Macht
Kapitel 18 Zur Natur der Macht
TEIL 4 ZUM REQUIEM DER MACHT
Kapitel 19 Eine kleine Machtmusik
Kapitel 20 Politische Macht streuen
Kapitel 21 Ideologische Macht brechen
Kapitel 22 Wirtschaftliche Macht streuen
Kapitel 23 Militärische Macht streuen
Kapitel 24 Zum Requiem der Macht
Epilog
Nachwort
Quellenverzeichnis
«I see trees of green, red roses too
I see them bloom forme and you
And I think to myself what a wonderful world.
I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself what a wonderful world.
The colors of the rainbow so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands saying how do you do
They're really saying I love you.
I hear babies crying, I watch them grow
They'll learn much more than I'll never know
And I think to myself what a wonderful world
Yes I think to myself what a wonderful world.»
(Louis B. Armstrong)
Vorwort
Leute, wir müssen reden: So kann es wirklich nicht weitergehen. Blicken wir den Tatsachen in ihr blutunterlaufenes, trauriges Auge: Unsere Welt ist nicht halb so wundervoll, wie Louis Armstrong sie in seinem zeitlosen Meisterwerk besungen hatte, sondern in weiten Teilen ein geradezu unerschöpflicher Quell fürchterlichen Elends, ein tüchtig am Lebenswillen nagendes Konglomerat aus Armut, Hunger, Krieg, Umweltzerstörung usw. Diese düstere Feststellung dissoziiert man am liebsten möglichst schnell wieder weg – man will ja schliesslich nicht Tag für Tag sein Kopfkissen mit den Tränen abendlicher Resignation einnässen und sich bitterlich in den Schlaf weinen. Die blosse Existenz dieser Tatsachen, des mannigfaltigen Elends unserer Welt, stürzt uns aber unweigerlich in ein wenig erspriessliches Dilemma: Entweder können wir versuchen, als Medien-Junkies die Katastrophenlast des gesamten Planeten zu schultern. Oder wir blenden alles aus und strengen uns entschlossen an, unser frohes Gemüt nicht mit dem Übel der Erde zu kontaminieren.
Unserer Psyche sind jedoch beide dieser eher radikalen Bewältigungsstrategien nicht besonders zuträglich. Denn einerseits: Falls wir uns schutzlos dem Mahlstrom aus News-Tickern und täglichen Hiobsbotschaften aussetzen – only bad news are good news –, werden wir über kurz oder lang in chronisch-depressiven Gemütsfluten versinken, wenn nicht gar in die Hirnembolie getrieben. Und andererseits: Weder mit aktiver Verdrängung oder Leugnung noch mit anderen langfristig unwirksamen Abwehrmechanismen können wir vor den elenden Tatsachen unseres Zeitgeschehens in Deckung gehen – und das sollten wir auch nicht, denn wer sich nur den leisesten Hauch von Selbstachtung und Mitgefühl bewahrt hat, wird sich ausserstande sehen, vor dem Elend unserer Welt seine Augen zu verschliessen oder es achselzuckend hinzunehmen. Weil sich die Realität also wesentlich durch eine lästige Alternativlosigkeit auszeichnet, sollten wir tunlichst einen möglichst guten, gesunden und besonnenen Weg finden, uns mit eben dieser Realität auseinanderzusetzen.
Der Weg zur konstruktiven Auseinandersetzung beginnt nach meinem Dafürhalten bei der hellen Kehrseite der Medaille. Denn die Existenz des Elends zunächst einfach zu akzeptieren, hat schliesslich nicht zur Folge, dass auch sonst alles, was uns im Alltag widerfährt, gleichsam zum Strahlkotzen unerträglich wird. Niemandem ist gedient, wenn wir angesichts schlimmer Umstände bloss noch Trübsal blasen, die Flinte ins Korn werfen, den Teufel an die Wand malen, die Welt und womöglich gleich noch uns selbst aufgeben, in eine geradezu apokalyptische Apathie verfallen, zu Menschen mit chronischem Frustrationshintergrund verkümmern. Womöglich wären das angemessene Strategien, wenn es denn gar keinen Anlass zur Hoffnung mehr gäbe. Doch glücklicherweise offenbart das Leben auf unserem Planeten auch viel Schönes und Erquickliches, mitunter sogar Wundervolles, wie eben die hübschen Farben des Regenbogens, einen besinnlichen Spaziergang im naturbelassenen Walde, das herzhafte Lachen eines unbeschwert spielenden Kindes, Verliebtheit über beide Ohren, drollige Hundewelpen, eisgekühlte Holunderlimonade an einem heissen Sommertag – you name it. Wo immer wir solcherlei Anlass zur Freude finden, können wir Hoffnung und Antrieb schöpfen; psychohygienische Energie also, die uns unterstützt, in eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Elend der Welt zu treten und alsdann aktiv zu werden. Denn schliesslich könnten auch wir selbst irgendwann in unseren Leben zu Direktbetroffenen werden, und nur schon deswegen sollten wir ein Interesse an dieser Auseinandersetzung haben. Im Übrigen kann ein bisschen Empathie nie schaden. So oder so geht uns das Elend der Welt nur schon weil wir (Mit-) Menschen sind etwas an, egal ob uns das nun gefällt oder nicht.
Ich für meinen Teil begann schon in jungen Jahren über den knallharten Kontrast zwischen wundervoll Schönem und entsetzlichem Elend zu sinnieren und mir Fragen zu stellen wie: Warum nur bleibt die Menschheitsfamilie dermassen weit hinter einem harmonischen Idealzustand zurück? War das schon immer so? Was können wir gegen das Elend unternehmen, wie es endlich beseitigen? – Seltsamerweise wurden diese und ähnliche Gedanken im Zeitablauf immer lauter, nagender und drängender, obschon sie mit fortschreitendem Alter doch an Relevanz verlieren müssten; Restlebenszeit und Energie werden ja laufend knapper, um mit allfälligen Antworten in den verbleibenden Jahren noch etwas Nützliches anzustellen. Allerdings kann ich beim besten Willen nicht anders, als den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich möchte gerne abschliessend verstehen, weshalb es nach wie vor Armut und Hunger gibt, wieso sich Menschen bekriegen, warum sie für kurzfristigen Profit ihre Lebensgrundlagen zerstören, die Welt in eine grossflächige Unbewohnbarkeit hinunterkonsumieren. Dieses generelle und langjährige Bedürfnis, wenigstens die eigene Gedankenwelt vollständig, ordentlich und wohlsortiert zu halten, wurde durch zeitgenössische Entwicklungen noch weiter verstärkt: Die ohnehin stets fragile Nachkriegsordnung des 20. Jahrhunderts scheint vor unseren Augen sukzessive zu zerfallen, wenn nicht bereits komplett in geopolitischen Trümmern zu liegen. Wieso? Weshalb? Warum? Fragen über Fragen. Und nicht zuletzt treiben auch meine beiden kleinen Patenkinder Naima und Linus den Wissensdurst und Verständnishunger zusätzlich an. Sie haben ihre Leben noch vor sich und ich wünsche mir so sehr, dass nicht eintreten wird, wonach es derzeit leider stark aussieht: Diese Kinder werden einer Generation angehören, der es im Vergleich mit jener ihrer Eltern wesentlich schlechter gehen wird, die sich mit immer mehr statt endlich weniger Elend konfrontiert sehen wird. Mehr noch: Sie werden womöglich die erste Generation in der Menschheitsgeschichte sein, die tatsächlich die Katastrophenlast des gesamten Planeten wird schultern müssen. Der Grund? Voraussichtlich werden den Kindern von heute insbesondere die ökologischen Verfehlungen ihrer Vorfahren mit voller Wucht auf die Füsse fallen. Ihre Generation hat anscheinend die ultimative Arschkarte geerbt – ohne jede Möglichkeit, dieses toxische Erbe auszuschlagen.
Je älter ich werde, umso intensiver entfalten sich neben der Neugierde auch Trauer und Frust über das unsäglich weit verbreitete Elend unserer Welt. Da ich aber, nicht zuletzt dank im globalen Vergleich äusserst privilegierter Lebensumstände, glücklicherweise über ausreichend Freizeit verfüge, habe ich oft und lange an Lösungen für einzelne Probleme herumstudiert und -recherchiert, mich derweil nicht selten in Details verloren: Wie kriegt man Unternehmen dazu, in Entwicklungsländern keine Umweltschäden mehr zu verursachen oder dort lebende Menschen nicht weiter unter geradezu sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen auszubeuten? Was lässt sich gegen übermässigen Fleisch- und anderen Konsum unternehmen, der die Klimakatastrophe beschleunigt? Wieso ist die dritte Welt noch immer so arm und zerrüttet? Weshalb kommen Politiker mit ihren Lügen durch? Wie stellt man Lohnfairness her, wie endlich die Gleichberechtigung der Geschlechter, Hautfarben etc.? Warum erleben wir eine zunehmende Polarisierung und Radikalisierung der Gesellschaften? – Mit der Zeit kristallisierte sich im Zuge all dieser Überlegungen ein zunächst noch diffuses Muster heraus, alsdann eine klar umrissene zentrale Ursache, gewissermassen der Brenn- und Knotenpunkt sämtlicher grossen Probleme. Und so glaube ich inzwischen, die eine Antwort gefunden zu haben, sozusagen die irreduzible Weltformel des Elends: Unsere Welt ist so, wie sie ist, weil es darin die eine Wurzel gibt, auf die sich alle Grundübel und jedes Elend zurückführen lassen. Von dieser Wurzel soll mein Buch handeln: Von der Macht.
Es ist kein Feelgood-Buch geworden, keine leicht verdauliche Kost; nichts also, das als gemütliche Bettlektüre taugen würde, um danach glückselig auf einem trockenen Kopfkissen wegzudämmern. Menschen mit schwacher Impulskontrolle werden hier herausgefordert, und das tut mir zwar leid, aber es ist halt dem Thema geschuldet. Freilich strengte ich mich daher an, dieses Buch nicht bloss möglichst allgemein verständlich zu formulieren, sondern es mit Zitaten und Exkursen zu würzen, hie und da etwas Humor einzurühren, ein wenig bissige Satire. Und ich versuchte, allem Schatten, den der analysierte Gegenstand nun mal wirft, auch einen Scheinwerfer der Hoffnung entgegenzusetzen. Also verzagt bitte nicht, liebe Lesende, es ist noch längst nicht aller Tage Abend – die Welt kann wundervoll werden, wenn wir es nur wollen.
Wie wir das konkret anstellen können, werde ich im letzten Teil des Buchs detailliert ausführen; für den Moment lasse ich es beim schönen Entwurf des grossen Charlie Chaplin bewenden:
«Macht brauchst du nur, wenn du etwas Böses vorhast. Für alles andere reicht Liebe, um es zu erledigen.»
Bevor wir zum Eingemachten übergehen, noch kurz zwei Dinge in eigener Sache. Erstens: Wir leben leider in einer Epoche, in der sich einige auf ideologischen Krawall gebürstete Zeitgenossen nicht mehr um die Wahrheit scheren. «Alternativmedien», Teile der Wirtschaft, Religionsführer und auch gewisse Politiker haben sich in einen postfaktischen Orkus abgeseilt und dabei auch gleich noch ganze Bevölkerungsschichten mit sich hinabgerissen. In dieser zwielichtigen, antirealistischen Unterwelt zimmert man sich beliebige Pseudowirklichkeiten, die mit «krude» sehr schmeichelhaft umschrieben sind, schwurbelt selbst noch aus dem hirnverbranntesten Quatsch eine scheinbar zustimmungsfähige Idee zurecht, und sucht sich mit immer abenteuerlicheren Verschwörungstheorien gegenseitig zu unterbieten. Was tatsächlich der Fall ist, verkommt unter dem perfid vorgeschobenen Banner der freien Meinungsäusserung zunehmend zur Modelliermasse postmoderner Beliebigkeit und Willkür. Ich spiele bei diesem gegenaufklärerischen Unfug nicht mit. Mein Verhältnis zur Realität ist ein dauerhaftes, das sich nicht auf Gelegenheitsbesuche beschränkt, wann es mir gerade in den Kram passt. Will meinen: Obwohl vorliegende Analyse nicht nach streng wissenschaftlichmethodischen Kriterien strukturiert und formalisiert ist und ich weder Historiker noch Psychologe bin, erhebe ich dennoch einen unbedingten Wahrheitsanspruch. Ganz einfach deswegen, weil ich das Streben nach Wahrheit, eine aufrichtige Wahrhaftigkeit, als fundamentale und universelle moralische Tugend und Pflicht eines jeden Menschen begreife. Darüber hinaus besteht das Ziel dieser Analyse schliesslich und endlich in nichts anderem als der Wahrheitsfindung; wenn man einer Sache aufrichtig auf den Grund gehen will, macht es schlicht keinen Sinn, mit Desinformation herumzuwursteln, eine opportunistische Klaviatur aus Lügen und Behauptungen zu bespielen. Das hier soll ja kein Märchen werden, keine aus den Fingern gesogene Streitschrift, sondern die tatsachengetreue Beschreibung eines Ist-Zustandes und im vierten Teil dann die wohlbegründete Formulierung einer hoffnungsvollen Zukunftsvision. Im Unterschied zu Strenggläubigen ist mein Wahrheitsanspruch jedoch keineswegs absolutistisch. Ich bin Mensch und also fehlbar, daher kann ich nicht guten Gewissens behaupten, jede einzelne Silbe dieses Textes sei die reine und nichts als die ewige Wahrheit. Auch ich bin nicht davor gefeit, mich zu täuschen, und selbst naturwissenschaftliche Erkenntnisse sind bisweilen nicht für immer und ewig in Stein gemeisselt. Aber ich habe mich, damit ich auch morgen zuversichtlich und ohne Scham in den Spiegel blicken kann, redlich um eine bestmögliche Annäherung an die Wahrheit bemüht, das ist: Für alle Aussagen gute und überprüfbare Belege und Gründe zu recherchieren und sie stets auch mindestens doppelt abzusichern, und jede Argumentationslinie kohärent, stringent und wahr zu halten. Das Ergebnis meiner Recherchen findet sich nach Kapiteln und Themen geordnet im Quellenverzeichnis am Ende des Buches. Auf Fussnoten habe ich mir indes zugunsten des Leseflusses zu verzichten erlaubt. Und schon vorneweg: In dieser Schrift wird leidenschaftlich und oft gewertet und nicht selten ist die Ausdrucksweise eher unverblümt, was für ein Sachbuch eher unüblich ist. Mein Wahrheitsanspruch erstreckt sich jedoch, nur zum Sagen, auch auf die wertenden Passagen, denn Adjektive sind schliesslich keineswegs bloss strittige Meinungen oder gar per se unwahr. Was soll ein Völkermord denn sonst sein, wenn nicht grausam, was Sklaverei, wenn nicht ausbeuterisch? Na also.
Zweitens in eigener Sache: Wiewohl ich auf geschlechtsneutrale bzw. diesbezüglich ausgewogene Formulierungen geachtet habe, verwendete ich für vorliegendes Buch keine konsequent gendergerechte Sprache mit Sternchen oder Doppelpunkten. Wer mich bereits kennt, weiss, dass das nichts zu bedeuten hat, dass mir Diskriminierung so fremd ist wie nur irgendwas. Wer mich hingegen noch nicht kennt, soll bitte wissen: Mir ist gleichviel, welche biologische Geschlechtsausprägung du hast oder welchem sozialen Geschlecht du dich zugehörig fühlst. Du verdienst absolute Gleichberechtigung – ohne Wenn und Aber. Was für mich im Zwischenmenschlichen zählt, sind weder Geschlecht noch sexuelle Orientierung noch Hautfarbe noch sonst etwas, worauf man keinen Einfluss hat, sondern einzig, ob du aufrichtig und nach Kräften versuchst, ein guter Mensch zu sein. Wichtig ist nach meinem Dafürhalten kurz gesagt allein, wie ordentlich dein moralischer Kompass kalibriert ist. Zwar verstehe ich das Anliegen einer gendergerechten Sprache durchaus und halte alles, was an einer Gleichstellung und -berechtigung aller Menschen vorbeizielt, für komplett idiotisch, da es für Ungleichstellung und -berechtigung nun mal einfach keine guten Gründe geben kann. Mein Punkt ist bloss: Gendergerechte Formulierungen sind nicht allein eher umständlich zu lesen und schreiben, sondern in meinen Augen derzeit auch eine falsche Prioritätensetzung. Wir sehen uns mit dringlicheren Herausforderungen wie Klimawandel, Krieg und Armut konfrontiert und sollten unsere Zeit und Energie zunächst besser hier investieren – und in Anliegen, die in der Praxis deutlich schneller und wirksamer zur Gleichberechtigung beitragen als die Formulierung von Texten. Lasst uns bitte zuerst daran arbeiten. Lasst uns zuerst die Welt an sich gerechter und weniger elend machen, danach können wir meinetwegen gerne noch quasi zur Veredelung an der Sprache rumdoktern, bis alle zufrieden sind. Ich habe nicht das Geringste dagegen, doch im Moment gibt es meines Erachtens wesentlich Wichtigeres als Gendersternchen oder -doppelpunkte, okay? Kurzum: Auch wenn ich in der Folge bisweilen das (generische) Maskulinum verwende, sind in diesem Buch stets ausnahmslos alle Menschen gleichermassen angesprochen.
Prolog
Stell dir bitte folgendes vor:
Ein grosses Flugzeug muss notlanden. Es ist ein harter Aufprall, Feuer bricht aus, die Kabine füllt sich mit beissendem Rauch. Allen ist klar: Wir müssen schnell raus.
Jetzt überlege dir: In welcher dieser zwei Welten leben wir?
1. Die Situation verläuft mehrheitlich ruhig und gesittet. Insassen fragen einander aufmerksam, ob es ihnen gutgehe. Hilfsbedürftigen Personen wird Vortritt gewährt. Die Menschen sind sogar bereit, ihr Leben zu opfern, selbst für Fremde.
2. Die Situation gerät unverzüglich ausser Kontrolle. Jeder kämpft nur für sich allein, Chaos und wilde Panik brechen aus. Es wird geschrien, getreten und geschubst. Kinder, ältere und behinderte Menschen werden gnadenlos niedergetrampelt.
Lass mich raten: Du hast dich ohne viel Aufhebens für die zweite Antwort entschieden, ja? Wenig verwunderlich, denn damit schliesst du dich einer überwältigenden Mehrheit an: Studien zufolge glauben nahezu alle Befragten, dass es in solchen Situationen übel wird. Auch der englische Philosoph Thomas Hobbes hätte vermutlich ohne Wimpernzucken auf Chaos und Panik getippt – gesetzt den Fall, jemand hätte ihm zuvor erklärt, was ein Flugzeug ist. In seinem Hauptwerk Leviathan behauptete Hobbes zur Mitte des 17. Jahrhunderts, wir Menschen seien quasi bauartbedingt naturgegebene Egoisten, motiviert allein durch Wettstreben und Ruhmsucht, ohne Empathie und niemals von altruistischen Motiven geleitet. Aufgrund dieses grimmigen, selbstsüchtigen Naturzustands bedürfe unsere Spezies laut Hobbes eines möglichst absolutistischen Herrschers, der uns mit knallharter Hand bändige. Der Mensch sei seinen Mitmenschen ein hinterlistiger, argwöhnischer Wolf, und nur eine dünne Fassade von Zivilisation und Kultur übertünche das Raubtier in uns allen. Zu dieser vermeintlichen menschlichen Natur schrieb Hobbes:
«Sie scheuen keine Gewalt, sich Weib, Kind und Vieh eines anderen zu unterwerfen […] das Geraubte zu verteidigen […] sich zu rächen für Belanglosigkeiten wie ein Wort, ein Lächeln, einen Widerspruch oder irgendein anderes Zeichen der Geringschätzung.»
Na schön, lösen wir die Sache auf. Dank zeitgenössischer Erfahrungsschätze und soziologischer Forschung wissen wir inzwischen sehr genau, was bei Notlandungen normalerweise tatsächlich passiert: Die erste Antwort ist korrekt. Die überwältigende Mehrheit liegt falsch, du liegst falsch, und Hobbes lag sowieso völlig falsch. Extremsituationen wie Notlandungen spielen sich in der echten Welt völlig anders ab, als es uns in reizüberflutenden Katastrophenfilmen wie 2012 oder San Andreas suggeriert wird. Pompöses Popcorn-Kino zwar, allerdings fernab jeder Wirklichkeit. Die Realität ist nämlich eine ganz andere: Weder beim Untergang der Titanic noch bei den Flächenbombardierungen im zweiten Weltkrieg noch bei 9/11 noch bei [hier bitte beliebige Katastrophe einfügen] fielen die Beteiligten instinktiv und kollektiv in einen Raubtiermodus zurück. Blindwütiger Egoismus? Mit Scheuklappen bewehrtes Recht des Stärkeren? Macht triumphiert über Ohnmacht? – Nichts da, in realen Notsituationen sind stets Tapferkeit, Mut und Nächstenliebe die dominierenden Tugenden. Diese soziologische Erkenntnis ist durch unzählige Studien und Beobachtungen der vergangenen Jahrzehnte unzweifelhaft belegt. Sei es nun bei allen vorerwähnten Beispielen, beim Hurrikan Katrina im Südosten der USA anno 2005 oder beim Jahrhundert-Hochwasser im deutschen Ahrtal anno 2021, die Forschenden fanden bis auf ganz wenige Ausnahmen in sämtlichen Krisen immer dasselbe kristallklare Muster: Wenn es hart auf hart kommt, fahren wir keineswegs die spitzen Ellenbogen aus und prügeln wie wildgeworden drauflos, sondern nehmen einander in den wärmenden Arm und bieten eine helfende Hand. Nicht restlos alle von uns zwar, es gibt immer mal wieder Plünderer und dergleichen, aber solche kleinen Wolfsrudel oder Einzelgänger bleiben stets Randphänomene eines gutmütigen grossen Ganzen.
Dieselbe Tugendhaftigkeit prägt unseren Alltag. Nicht nur in ausserordentlichen Krisenzeiten sind die meisten von uns freundlich und zuvorkommend, sondern auch wenn die Dinge in ihren gewohnt geordneten Bahnen laufen. Dieser Befund bedarf nicht umfangreicher wissenschaftlichen Studien, wenngleich es auch solche zuhauf gäbe. Schon ein kurzer Blick in die Kriminalstatistik genügt, um die Friedfertigkeit des Durchschnittsmenschen zweifelsfrei zu belegen. Am Beispiel der Schweiz: Im Jahre 2021 wurden insgesamt etwa 130'000 Personen straffällig. Das klingt zwar zunächst nach viel, aber absolute Zahlen sind manchmal trügerisch – wir reden hier von kaum 1,5% der ständigen Wohnbevölkerung. Klammert man dann noch Diebstahl, Sachbeschädigung, Drogenkonsum, Vergehen gegen Ein-/Auswanderungsbestimmungen usw. aus, betrachtet also lediglich die heftigsten Gewaltvergehen (Tötung, schwere Körperverletzung, Vergewaltigung und Raub), verbleiben gerade mal 0,02% der Bevölkerung, die böse Dinge tun. Das heisst: Nur eine von 5'000 Personen wird für ihre Mitmenschen zum hobbesschen Wolf. Und dies obschon fast niemand auch nur einen kleinsten Teil der immens vielen Gesetze und Verordnungen überhaupt je gelesen hat – als ob die Menschen quasi aus sich selbst heraus wüssten, was in einer Gesellschaft erlaubt und was untersagt ist, sie irgendwie natürlich veranlagt wären, das Richtige und Gute statt das Falsche und Böse zu tun. Sogar für die gefährlichsten Länder der Erde wie Venezuela oder El Salvador sind diese Aussagen gültig. Wiewohl die dortigen Kriminalitätsraten zwar deutlich höher ausfallen und z.B. vergleichsweise sehr viel mehr Tötungsdelikte als in Westeuropa verübt werden, bleibt auch in diesen Ländern der Anteil straffälliger Menschen an der Gesamtbevölkerung in einem niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Die täglichen Nachrichten vermitteln demnach ein im doppelten Wortsinn gewaltiges Zerrbild der Realität, denn die schlimmen Dinge, die da fast pausenlos über unsere Mattscheiben flimmern, sind nirgendwo auf der Welt die Regel, sondern stets und überall die äusserst seltenen Ausnahmen von der Regel.
Wie man es auch dreht und wendet: Von der hobbesschen Fassadentheorie, wonach der Mensch hinter einem hauchdünnen Firnis zivilisatorischer Zwänge natürlich böse und egoistisch veranlagt sei, sehen wir in der Wirklichkeit kaum etwas. Der vermeintlich so abgründige Urzustand unserer Spezies wird am Schleifstein der Realität zu Staub zerbröselt und löst sich in Minne auf. Richtig ist zwar: Wir Menschen haben durchaus das Potenzial zu schlechten Taten, wir könnten jederzeit brandschatzen, vergewaltigen und morden. Richtig ist allerdings auch: Fast niemand von uns schöpft dieses Potenzial tatsächlich je aus, weder in Krisenzeiten noch im Alltag. Wir bleiben aber, und das ist der springende Punkt, nicht deshalb friedlich, weil uns Gesetze oder Leviathane von unserer naturgegebenen Boshaftigkeit abhielten, wir Strafe und Gefängnis fürchten, und auch nicht, weil man uns wie domestiziertes Vieh zur kulturellen Sanftmut konditioniert hat. Nein. Wir bleiben friedlich, weil wir friedlich sind. Hobbes täuschte sich in der menschlichen Natur also ausgesprochen gründlich, und das ist doch einigermassen erstaunlich, denn Boshaftigkeit und Egoismus widern uns geradezu reflexmässig und instinktiv an; Gewalt ruft Abscheu, Angst und Stress hervor, um Unholde machen wir am liebsten einen ganz grossen Bogen. Diese Erfahrungen sind uns allen bekannt, wieso also nicht auch Hobbes? Nun, womöglich wusste er es ja besser und sein Leviathan war, wie einige Forscher mutmassen, nicht viel mehr als ein übles Propagandapamphlet zur Rechtfertigung der Kolonialisierung Amerikas. Aber letztlich ist unerheblich, ob Hobbes einfach nur ein grober Stümperer oder doch eher ein submissiver Speichellecker von Machthabern war. Gewiss bleibt: Schlechte Taten verurteilen wir Menschen nicht erst, seit es ethische Theorien und Rechtsordnungen gibt, sie wurden schon immer verachtet und sanktioniert. Und weshalb? Weil schlechte Taten unserem ureigenen Wesen zuwiderlaufen, weil moralisches Empfinden und Mitgefühl archaische, tief verankerte Eigenschaften unserer Art sind. Wir können nicht dulden, dass Menschen einander schlecht behandeln, denn wir sind Herdentiere, eine natürlich prosoziale Spezies. Und ein Leben in Gesellschaft funktioniert nun mal grundsätzlich nicht besonders gut, wenn sich eine Mehrheit asozial verhält. Mehr noch: Eine Spezies mit nichts Besserem im Sinn, als sich tagein, tagaus gegenseitig zu massakrieren, wird sehr wahrscheinlich nur eine äusserst geringe evolutionäre Halbwertszeit geniessen. Doch der Mensch ist noch hier und beherrscht die Welt – q.e.d.
Weshalb aber steht unsere Intuition dieser Tatsache diametral entgegen? Warum sind wir dermassen stark darauf geprägt, unsere Art als kaum zähmbare Horde selbstsüchtiger und skrupelloser Schweinepriester zu sehen? Wieso glauben wir so fest daran, dass das Prinzip «jeder gegen jeden» eine universelle Konstante allen Lebens sei, die auch für uns Menschen gelten müsse, sodass Macht stets gegen Ohnmacht obsiege? Warum wählen so viele von uns in der eingangs gestellten Flugzeugfrage die zweite Antwort, Gewalt und Chaos? Den wesentlichen Grund finden wir in unserer Psyche: Wir leiden von Natur aus an einer kognitiven Verzerrung, dem Negativity Bias. Unser Gehirn verarbeitet Negatives besser, schneller und intensiver als Positives oder Neutrales, weil es dem prähistorischen Menschen während vieler Jahrzehntausende zum Überlebensvorteil gereichte, über den umherstreifenden Säbelzahntiger oder andere Gefahrenherde Bescheid zu wissen. Negatives wirkt auf unseren Wahrnehmungsapparat wie ein gleissendes Flutlicht, das alles überstrahlt und aus dem Sichtfeld drängt. Das Böse ist eine gellende Sirene, die uns taub macht für das Gute. Eben diese archaische, kognitive Verzerrung machen sich Medien zunutze, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen, und auch den Mächtigen aller Epochen blieb der menschliche Negativity Bias nicht verborgen. Sie verstanden bald, wie dieses Wesensmerkmal uns dazu verleitet, negative Wahrnehmungen gewissermassen automatisch überzubewerten und zu verallgemeinern, die Welt darob völlig irrational durch eine tiefschwarze Brille zu betrachten. Und also begannen die Mächtigen, diesen Aspekt unserer Psyche gezielt gegen uns zu instrumentalisieren. Der niederländische Historiker Rutger Bregman sagt dazu:
«Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Die ältesten Bücher und Schriften sind voller Propaganda von Staaten und Machthabern. Sie wurden von Unterdrückern geschrieben oder beauftragt, die sich selbst verherrlichten und auf den Rest herabsahen.»
Das heisst: Arglistige Machtmenschen erzählen uns seit Jahrtausenden in Wort und Schrift, wir alle seien von Grund auf böse – und irgendwann haben wir es ihnen geglaubt. Die Wölfe hatten das Sagen und prügelten den Lämmern ins Hirn, auch sie seien Wölfe und das Leben ein ewiger Rudelkampf und Revierkrieg. Diese Desinformation, diese hobbessche Schimäre frass sich über die Epochen tief in unser kollektives Bewusstsein. Mit jedem Krieg, in den boshafte Machthaber ihre Unterdrückten führten, mit jeder destruktiven Schandtat, die sie ihren Pöbel vollstrecken liessen, wurde der Irrglaube an eine natürliche Boshaftigkeit unserer Spezies stärker und stärker: Menschen tun böse Dinge, also sind alle Menschen böse. In seinem bahnbrechenden Buch Im Grunde gut: Eine neue Geschichte der Menschheit erläutert Rutger Bregman ausführlich und wohlbegründet, wie sich diese Indoktrination und Instrumentalisierung über die Jahrtausende entwickelte und festigte. Bereits im obigen Zitat klingt aber das zentrale Motiv an: Ein negatives Menschenbild spielt den Mächtigen in die Karten, ihr Herrschaftsanspruch wird dadurch daseinsbegründet und genährt. Macht funktioniert nur (oder zumindest deutlich besser), wenn die Machtlosen glauben, dass sie in der zweiten Flugzeugwelt leben: In einer gewalttätigen Welt, in der wir unseren Artgenossen unter keinen Umständen je über den Weg trauen dürfen. In einer Welt, in der ohne eine starke, ordnende Herrscherhand sofort Chaos, Panik, nachgerade blutrünstige Anarchie ausbrächen. Nur wenn wir uns als Raubtiere wähnen, gewinnt der Dompteur seine Legitimation. Wer stattdessen an das Gute im Artgenossen glaubt, braucht keine mächtigen Herrscher mehr, denn das Gute in uns allen stellt quasi aus sich selbst heraus eine stabile und friedliche Gesellschaftsordnung her. Wenn ohnehin alle artig sind, hat die Herde keinen Hirtenbedarf mehr. Wer an das Gute im Menschen glaubt, sieht die Welt ganz plötzlich, wie sie tatsächlich ist: Als einen Ozean der Güte und des Mitgefühls, den die Mächtigen über die Jahrtausende mit ihrer Niedertracht zugemüllt hatten. Wer an das Gute im Menschen glaubt (und auch wer das nicht tut), findet sich anlässlich der Notlandung eines Flugzeugs in der Welt der ersten Antwort wieder, einer Welt der Tugendhaftigkeit und Nächstenliebe.
Falls man der These über die natürliche menschliche Güte nicht folgen mag, sollte man zunächst einmal bitte Bregmans oben erwähntes Buch lesen; seine Beweisführung ist nicht bloss leicht nachvollziehbar, sondern auch wissenschaftlich grundsolide. Wenn man sich danach noch immer uneinsichtig zeigt und also in Fundamentalopposition zur modernen Forschung geht, kann man gelegentlich darüber nachdenken, wie man sein negatives Menschenbild eigentlich sachlich und nüchtern begründet, auf welche handfesten Belege man eine Idee wie «die Mehrheit der Menschen ist böse» abstützt. Jede Wette: Man wird keine Belege finden, die über anekdotische Evidenz hinausgehen, sondern bloss eine nie aufrichtig hinterfragte Meinung. Eben diese Meinungssau treiben wir jetzt spasseshalber noch ein wenig durchs Dorf. Dafür wollen wir uns zunächst ein paar simple Fragen über die Fiktionen stellen, die unsere Spezies seit Urzeiten in Sagen, Büchern, Filmen, Hörspielen, Märchen usw. erdichtet und erzählt. Ich verwende dafür hier und hin und wieder auch im weiteren Textverlauf Referenzen auf Der Herr der Ringe des britischen Schriftstellers J. R. R. Tolkien. Falls es da draussen tatsächlich noch jemanden gibt, der dieses Werk nicht kennt: Frodo ist der Held und die Hobbits aus dem Auenland sind die Guten, Sauron ist der Antiheld und die Orks aus Mordor sind die Bösen. Auf zur Fragerunde über unsere Fiktionen:
Wieso sind wir glücklich, wenn am Ende das Gute gewinnt?
Weshalb fühlen wir uns schlecht, wenn am Ende das Böse siegt?
Warum gewinnt am Ende fast immer das Gute und nur sehr selten das Böse?
Aus welchen Gründen handelt das Gute in einer Manier, die wir mit moralisch gebotenem Verhalten assoziieren und das Böse in einer als unmoralisch empfundenen Manier?
Weswegen wird das Gute in einer Weise personifiziert, mit der man sich sofort identifizieren kann und will: Als unbedarfter, süsser kleiner Naturbursche, als ganz Gewöhnlicher aus dem Volk, als knuffiger Hobbit Frodo im sonnig-saftigen, geradezu sozialistischen «alle haben sich ganz doll lieb»-Auenland?
Und weshalb wird das Böse als fremde, militärisch-industrialisierte Übermacht dargestellt, mit der sich niemand identifizieren mag: Als einen jedweder Menschlichkeit entkernten Herrscher, der über wilde Horden gebietet; als faschistoiden Sauron im lebensfeindlichen, «alle sind sich spinnefeind»-Mordor?
Der Punkt ist doch: Müsste das alles nicht genau andersrum sein, wenn wir tatsächlich von Natur aus schlecht wären? – Die Antwort ist eindeutig: Ja, es müsste gerade umgekehrt sein, aber das ist es eben nicht, weil wir im Grunde gut sind und uns das Böse sowas von abtörnt. Unsere Fiktionen sind demzufolge das Abbild unserer Natur.
Sofern man auch diese Schlussfolgerung nicht teilt, glaubt man vielleicht (oder hoffentlich) wenigstens der eigenen Erfahrungswelt. Also blättere doch bitte einmal dein soziales Umfeld gedanklich durch: Wie viele deiner Freunde und Bekannten sind so richtig widerliche Mistbratzen, mit denen du eigentlich lieber gar nichts zu tun hättest? Und wie viele von ihnen sind meistens oder immer lieb und nett? – Dasselbe Gedankenexperiment lässt sich auf sämtliche Menschen ausweiten, mit denen man es bislang zu tun gehabt hatte. Also frage dich auch hierzu: Wie oft in deinem Leben bist du betrogen worden, beraubt, verprügelt, vergewaltigt? Und wie oft wurdest du grosszügig, freundlich oder wenigstens neutral bis anständig behandelt? – Beide Selbstbefragungen führen regelmässig bei den allermeisten Menschen zum stets gleichen Ergebnis: Das Gute überwiegt – und zwar um viele, viele Faktoren! Diese Erkenntnis stellt sich jedoch oft erst ein, wenn wir sie nüchtern-analytisch angehen, denn auch unser Gedächtnis legt uns den Negativity Bias-Stein in den Weg. Aus evolutionären Gründen gewichtet es schlimme Erinnerungen deutlich stärker als schöne. Der offene Armbruch verharrt leider länger und lebhafter im Gedächtnis als der erste Zungenkuss. Unser Hirn will uns dadurch vor weiteren schadhaften Erfahrungen schützen: Je besser wir sie erinnern, umso vorsichtiger und wachsamer verhalten wir uns fortan in vergleichbaren Situationen. Streifen wir diese verzerrende Täuschung aber ab und lassen unsere bisherige Lebenszeit quasi wie unbeteiligte Dritte Revue passieren, stellen wir schnell fest, dass wir selten bis nie direkten Kontakt zu Raubtiermenschen, zu Gewalt und Psychoterror hatten, sondern dass wir die meiste Zeit über von sanftmütigen, prosozialen Artgenossen umgeben waren. Und wenn wir diese Frage dann noch mit Freunden und Bekannten diskutieren, merken wir, wie es ihnen genau gleich geht: Fast nirgends finden wir Wölfe, nahezu überall nur Lämmer. Die einzigen Raubtiere, die uns für gewöhnlich in den Sinn kommen, sitzen an den Machthebeln unserer Welt.
Es ist äusserst wichtig, diese fundierte Erkenntnis über unsere gute Natur zu verinnerlichen. Und bitte nicht bloss vorübergehend während der Lektüre dieses Buches, sondern möglichst permanent. Unser Menschenbzw. Eigenbild ist nämlich prägend für die Umstände, die wir erschaffen, und es wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung: Wenn wir glauben, wir als Spezies seien böse, werden wir unsere Mitmenschen anders behandeln und die Welt anders ordnen, als wenn wir glauben, wir seien gut. Genau das sind wir aber: Gut, von Geburt an. Deswegen sollten wir einander vernünftigerweise im Lichte dieser Erkenntnis begegnen und die Welt dahingehend gestalten: Nicht als dunklen und beengten Raubtierkäfig, um uns darin wider unsere Natur gegenseitig zu zerfleischen, sondern als sonnige und offene Weide, auf der wir einander im Einklang mit unserer Natur frei und unbeschwert begegnen können. Dabei sollten wir uns bitte auch nicht von unverdient legendären Untersuchungen der Psychologie wie dem Stanford-Prison- oder dem Milgram-Experiment beirren lassen, die ein hobbessches Menschenbild zu beweisen suchten. Heute wissen wir: Diese Versuchsreihen aus den 1960er und 1970er Jahren bewiesen rein gar nichts dergleichen. Unsere natürliche Güte ist zweifelsohne ein Faktum und es liegt an uns selbst, uns dieser Natur zuzuwenden oder ihr die kalte Schulter zu zeigen. Eine Weisheit der Cherokee formuliert diese Wahl, die wir jeden einzelnen Tag für uns treffen können, so:
Ein Grossvater sagte einst zu seinem Enkel: «In mir findet ein Kampf statt, ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Einer ist schlecht, böse, habgierig, eifersüchtig, arrogant und feige. Der andere ist gut – er ist ruhig, liebevoll, bescheiden, grosszügig, ehrlich und vertrauenswürdig. Diese Wölfe kämpfen auch in dir und in jeder anderen Person.» – Der Junge fragte: «Welcher Wolf wird gewinnen?» – Der alte Mann lächelte. «Der Wolf, den du fütterst.»
Mit diesem Prolog wollte ich illustrieren, dass das bedauerlicherweise weit verbreitete, grundfalsche Selbstbild einer ach so üblen Brut eng und quasi wechselseitig mit dem eigentlichen Thema dieser Untersuchung verknüpft ist: Negatives Menschenbild und Macht sind die beiden Seiten ein- und derselben Münze, sich gegenseitig vertiefende Abgründe, die zwei bestialisch stinkenden Enden der gleichen Kackwurst. Ein negatives Menschenbild ist der Acker, auf dem Macht als Wurzel allen Übels wie Unkraut wuchert – und Macht tut ihrerseits alles, um diesen Acker fleissig zu düngen. Erst wenn wir aufrichtig glauben, wir seien natürlich böse, setzen wir verzweifeltes Vertrauen in einen Herrscher, der unsere Boshaftigkeit mit harter Hand zivilisieren soll. Erst dann sind wir nahezu bedingungslos bereit, anderen Macht über uns zu verleihen, vermeintlich starke Männer anzuhimmeln, Führer zu ermächtigen. Genau dann wird es, wie wir im weiteren Verlauf dieses Buches noch sehen werden, so richtig elend für uns, denn am knorrigen Baum der Unterwürfigkeit wachsen so gut wie nie geniessbare Früchte. Wenn wir also an eine natürliche menschliche Boshaftigkeit glauben, spielen wir den Machtlüsternen direkt in die Karten.
Das negative Menschenbild können wir alle für uns selbst umdrehen und richtigstellen, das geht ganz leicht: Wir brauchen bloss die ermutigende Tatsache zu akzeptieren und verinnerlichen, dass fast alle von uns meistens putzig und lieb sind, damit hat es sich bereits. Ich für meinen Teil pflege dieses Menschenbild schon immer, die längste Zeit über nicht mal richtig bewusst, und bin damit bis auf ganz wenige Ausnahmen (zu deren Pauschalisierung ich mich nicht habe hinreissen lassen) ausgezeichnet durchs Leben gekommen. Seinen Mitmenschen aber in einer präventiven Verteidigungshaltung aus Argwohn und Misstrauen zu begegnen, ihnen a priori niedere Absichten zu unterstellen, ist nicht nur realitätsfremd und damit irrational, es strengt zudem auch noch brutal an: Viel Aufwand, fast null Ertrag. Am anderen Ende der Kackwurst, bei der Macht, ist es leider nicht ganz so einfach, hier bedarf die Heilung deutlich intensiverer Anstrengungen, denn Macht hat sich im Laufe der Zeit hartnäckig ins Gewebe unserer Gesellschaften eingezeckt; ihre unbarmherzige Wurzel reicht tief und weit und lässt sich von keiner Rhizomsperre aufhalten. Macht durchdringt einem Krebsgeschwür gleich den gesamten Körper unseres Zusammenlebens: Politik, Wirtschaft, Ideologie und Militär. Wir müssen uns deshalb zwingend und dringend mit Macht auseinandersetzen und aus dieser Auseinandersetzung die richtigen Schlüsse ziehen, um unseren Planeten und uns selbst endlich zu heilen. Um die Welt so wundervoll zu machen, wie sie sein könnte und sollte, sie von möglichst allem Elend befreien. Der erste und wichtigste Schritt ist bereits getan, wenn wir uns vom falschen, negativen Menschenbild verabschieden – dadurch entziehen wir dem toxischen Acker schon mal seine wichtigsten Nährstoffe. Und nun zum Unkraut, also Vorhang auf für das elende Gruselkabinett der Macht: Frisch ans Werk, bringen wir die Spitzhacke in Anschlag, um der Wurzel allen Übels den Garaus zu machen!
TEIL 1 ZUR GENEALOGIE DER MACHT
Worin ich die Entstehungsgeschichte und mithin die zentralen Ursachen der Macht über einen ziemlich langen Zeitraum untersuche, und dabei über einen ebenfalls ziemlich langen Zeitraum reichlich erfolglos bleibe.
Kapitel 1 Einleitung
In diesem Kapitel erläutere ich den Aufbau des Buches und definiere die wichtigsten Begrifflichkeiten.
Damit diese Untersuchung so etwas wie eine Struktur, einen roten Faden erhält, will ich zuallererst auflisten, welche Fragen ich darin zu beantworten trachte. Es sind diese vier, denen die entsprechenden Teile des Buchs gewidmet sind:
1. Was ist Macht und woher kommt sie (Teil 1)?
2. Wie beeinflusst Macht unsere Psyche (Teil 2)?
3. Welche Ausprägungen hat Macht (Teil 3)?
4. Wie zur Hölle lösen wir das Problem (Teil 4)?
Die erste Teilfrage beantworte ich gleich an dieser Stelle: Was ist Macht? Der deutsche Soziologe und Nationalökonom Max Weber lieferte die noch heute allgemein akzeptierte Definition:
«Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht.»
Macht lässt sich demnach stets nur in Verbindung mit wenigstens einem Gegenüber denken. Sie ist nicht isolierter Selbstzweck, sondern ein prägendes Merkmal unserer Beziehungen zu anderen. Wenn eine Seite der Beziehung über die Möglichkeit verfügt, das Verhalten der anderen Seite gegen deren Willen zu beeinflussen, dann hat diese eine Seite Macht und die andere Seite Machtlosigkeit – es besteht ein Machtverhältnis: Ich kann dir nicht bloss sagen, was du zu tun hast, sondern dich auch zwingen, es zu tun. So verstanden ist Macht zunächst wenig mehr als ein Potenzial oder, in Webers Worten, eine Chance. Solange man Macht also nicht ausübt, das Machtpotenzial nicht ausschöpft, seine Chance nicht nutzt, passiert kaum etwas – für den Moment abgesehen von möglichen psychologischen Auswirkungen des Machtverhältnisses an sich. Die entscheidenden Faktoren sind folglich, ob Macht überhaupt erst ausgeübt wird und falls ja, von wem, mit welchen Mitteln, zu welchen Zwecken und mit welchen Folgen. Macht ist somit nicht grundsätzlich negativ konnotiert, wie so oft sind die konkreten Umstände ausschlaggebend. So kann beispielsweise eine Machtausübung von Eltern gegenüber ihren Kindern durchaus konstruktiv und mithin legitim sein, insofern sie zum Wohle des Kindes erfolgt. In dieser Untersuchung wird es gleichwohl vorwiegend um die dunkle, destruktive Seite der Macht gehen, weil genau diese Seite alle grossen Probleme und jedes substanzielle Elend unserer Spezies verursacht, eben dort die Wurzel allen Übels wuchert. Mit dem berühmten englischen Dramatiker William Shakespeare gesprochen:
«Die Kraft eines Riesen zu besitzen ist wunderbar. Sie wie ein Riese zu gebrauchen ist Tyrannei.»
Das Wort «Tyrannei» leitet über zu einem weiteren wichtigen Begriff, der gleich hier erläutert werden soll, nämlich jenem der Moral. Auch dieser Begriff wird im weiteren Textverlauf noch des Öfteren auftauchen, jener der Ethik ebenso, zumal vorliegende Analyse ganz wesentlich eine ethisch motivierte und auch ethisch begründete ist. Ich möchte diese Begrifflichkeiten auch deswegen klären, weil nach meiner Wahrnehmung zu viele Menschen den Eindruck haben, es handle sich bei Ethik und Moral bloss um persönliche Meinungen, die zudem Zeitgeist oder Kultur unterworfen und ergo in vielerlei Hinsicht mindestens relativ, wenn nicht sogar völlig subjektiv wären. Falsch, das Gegenteil ist der Fall: Ethik und Moral sind weder relativ noch subjektiv, aber immer schön der Reihe nach. Zunächst handelt es sich bei der Ethik um jene philosophische und also geisteswissenschaftliche Theorie, die sich mit der Moral beschäftigt. Die Ethik will logisch und also objektivierbar entdecken (nicht: erfinden!), was wir als Menschen tun sollen. Ethische Aussagen teilen unsere Handlungen in «richtig», «neutral» und «falsch» ein und leiten daraus ein Regelwerk an moralischen Normen ab. Diese Normen wollen uns praktische Hinweise darüber geben, was wir tun sollen – nämlich das in unserer Natur liegende Gute und also Richtige –, und was wir unterlassen sollen – nämlich das wider unsere Natur gehende Böse und also Falsche. Solche moralischen Normen sind eine Teilmenge sittlicher Normen, denn nicht jede sittliche Norm ist zugleich eine moralische: Dass man sich grüssen soll, hat beispielsweise nur den Charakter einer womöglich sogar bloss regionalen oder temporären Gewohnheit, einer gesellschaftlichen Usanz, jedoch keinen moralischen Gehalt. Sich gegenseitig zu grüssen ist daher zwar moralisch neutral, aber gleichwohl ein sittliches Gebot zwischenmenschlicher Höflichkeit. Im Unterschied dazu sind Aussagen wie «du sollst keine Kleinkinder quälen» oder «du sollst nicht Rollstuhlfahrer in Swimmingpools schubsen» eindeutig moralische Normen, denn sie fordern, etwas Böses bzw. Falsches zu unterlassen.
Mit ihren moralischen Normen will die Ethik folglich die Frage «was soll ich tun?» für all jene Situationen begründet beantworten, in denen potenziell oder sicher andere Menschen resp. andere empfindungsfähige Lebewesen in Mitleidenschaft gezogen werden. Und bei «begründet» liegt der sprichwörtliche Hase im Pfeffer: Moralische Normen werden keineswegs mit gutmenschelnden Schwitzehändchen aus willkürlicher Empörungsluft gegriffen, noch durch graueminente Philosophie-Professoren in ihren Elfenbeintürmen verabschiedet, und schon gar nicht von religiösen oder anderen ideologischen Führern aus vermeintlichen Gottesworten zurechtinterpretiert. Nein. Moralische Normen werden samt und sonders aus der Vernunft gewonnen. Sie sind das Ergebnis logischen Nachdenkens und demzufolge für alle Menschen mit diesbezüglicher Befähigung einsichtig und nachvollziehbar – zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und weil sie also aus zeitloser Logik entspringen, haben moralische Normen universelle Gültigkeit: Es war schon vor Tausenden von Jahren falsch, Menschen zu foltern, und das ist es noch immer weltweit, obwohl sich damals wie heute einzelne Personen, oft Machthaber, dieser Einsicht beharrlich verweigern. Wer demnach beispielsweise behauptet, das iranische Regime hätte halt einfach kultur- oder glaubensbedingt andere Moralvorstellungen und es sei daher recht und billig, dass dort Homosexualität mit der Todesstrafe bewehrt sei, der hat von Ethik und Moral wenig bis gar nichts begriffen. Moralische Normen kennen bloss ein Eichmass, nämlich die Vernunft. Vernunft aber ist nicht beliebig dehn- und formbar: Sie diktiert objektiv eindeutig, weil logisch schlüssig, dass Homosexualität für sich genommen niemals die Todesstrafe begründen kann und darf. Naja, recht eigentlich vermag rein gar nichts eine Todesstrafe zu begründen, aber darüber sind bereits andere Bücher geschrieben worden. Daher behaltet bitte schon mal im Hinterkopf, liebe Lesende: Wann immer jemand unverfälscht und sauber ethisch resp. moralisch argumentiert, sind die vorgebrachten Gründe objektiv wahr und nachvollziehbar und dadurch prinzipiell universell. Nur was vor dem Gerichtshof der Vernunft standhält, zählt zur Ethik, alles andere ist Scheinmoral. Eben deshalb existiert auch nichts wie «meine Werte» und «deine Werte» – ein Wert, der nicht allgemeingültig ist, ist kein Wert, und eine Moral, die nicht universell ist, ist keine Moral.
Abzugrenzen von der wissenschaftlichen Ethik wie oben beschrieben ist vulgäres Moralisieren. Dieses wird heute an allen Flanken des politischen Spektrums als Kampfbegriff in Stellung gebracht. Wer moralisiert, spiegelt falsche moralische Tatsachen vor und überführt eine Diskussion, die an und für sich ethisch substanzlos ist, in unzulässiger Weise auf eine vermeintlich ethische Ebene. Einen Musterfall fürs Moralisieren, für einen oft wohlgemeinten, gleichwohl irrgeleiteten Übersprungsdiskurs, finden wir in der Debatte um kulturelle Aneignung. Hierin behaupten die Wortführenden, es sei moralisch unzulässig, dass sich Mitglieder einer dominanten Kultur Elemente einer Minderheitskultur aneigneten, beispielsweise indem sich Menschen weisser Hautfarbe ihre Haare zu Rastazöpfen flechten lassen. Diese moralisierende These ist aber auf so ziemlich jeder erdenklichen Ebene falsch: Erstens, weil es sich bei Kopfbehaarung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ansatzweise um eine moralische Frage handelt, und zweitens, weil es so etwas wie trennscharf abgrenzbare Kulturen resp. kulturelle Identitäten, der die vermeintlich angeeigneten Elemente gleichsam eindeutig zugeordnet werden könnten, in der Realität schlicht nicht gibt. Tatsächlich fährt der Zug der Ideenträger kultureller Aneignung in etwa auf demselben Gleis wie jener von rechtsradikal-identitären Bewegungen, indem sich überbeissender Antirassismus ungefähr derselben strunzblöden Stereotype bedient wie althergebrachter Rassismus: Man steckt vermeintlich homogene Menschengruppen in willkürlich und holzschnittartig festgelegte Schubladen. Leider ist weder in diesem Beispiel noch in anderen Fällen immer leicht zu erkennen, wann eine authentische, objektive moralische Aussage vorliegt und wann bloss ein vulgärer Moralismus. Bisweilen kommt man nicht umhin, sich vertieft mit den angeführten Gründen zu befassen und die jeweilige Argumentation auf Wahrheitsgehalt, Vollständigkeit und Kohärenz hin zu rekonstruieren. In aller Regel verhält es sich jedoch so, dass der Vorwurf des Moralisierens aus einer ganz bestimmten politischen Ecke kommt, der moralische Normen aus schierem Machtkalkül generell ein Dorn im Auge sind. Wir werden später noch sehen, um welche Ecke es sich dabei handelt.
Hätten wir das Definitorische schon mal geklärt, prima. Kurz zusammengefasst: Macht heisst, zu tun was wir wollen, insofern wir mächtig sind, und Moral heisst, zu tun was wir sollen, insofern wir Menschen sind. Wenden wir uns nun also der Ursachenforschung zu und versuchen zunächst einmal herauszufinden, wann und wie die Macht in unsere Welt hineingeboren wurde, oder ob sie allenfalls schon immer da war.
Kapitel 2 Biologische Sackgasse
In diesem Kapitel zeige ich, dass und weshalb Macht keine natürliche Eigenschaft der belebten Umwelt ist, die Biologie diesbezüglich also in eine erste Sackgasse führt.
Beim Nachdenken darüber, wie die Macht wohl in die Welt gekommen war, erinnerte ich mich an etliche Diskussionen, in denen man mich mit zynisch-resignativen Pseudoargumenten wie dem folgenden mundtot zu keulen versucht hatte:
«Die Welt ist halt einfach nicht gerecht, finde dich damit ab; schau doch nur mal bei den Tieren, da kämpft jeder gegen jeden, da gibt’s nur Konkurrenz, da herrscht das Recht des Stärkeren – da regiert allein Macht. Logisch ist das bei uns Menschen auch so.»
Die belebte Umwelt macht auf uns Menschen bisweilen tatsächlich einen grausamen Eindruck. Nehmen wir Saitenwürmer: Sie legen ihre Larven in Wasserpfützen ab, wo sie z.B. von durstigen Heuschrecken unbemerkt mitgetrunken werden und so in deren Verdauungstrakt gelangen. Die Larve des Saitenwurms frisst ihre neue warme Stube dann sukzessive von innen auf, bis sie den Körper der bedauernswerten Heuschrecke nahezu vollständig ausfüllt. Die Wirtin wird dabei nicht getötet, lebensnotwendige Körperteile spart die Larve nämlich aus Gründen clever aus. Sobald die Zeit reif ist, sondert das Saitenwurmbaby ein Protein ab, das die ausgehöhlte Heuschrecke zu einem fremdgesteuerten Zombie macht und dazu bringt, zur nächsten Pfütze zu hopsen. Dort verlässt der inzwischen geschlechtsreif gewordene Parasit seine Wirtin durch deren After, um sich in der Pfütze mit seinesgleichen zu paaren und ein paar neue Larven zu produzieren. Und während die jungen Saitenwürmer kopulieren, ersäuft die Zombie-Heuschrecke in derselben Pfütze, die nur allzu bald für eine ihrer Artgenossinnen ebenfalls zur Todesfalle werden wird.
Oder Pilze der Gattung Amanita, im englischen Sprachraum als Destroying Angel berüchtigt: Man braucht bloss ein kleines Exemplar zu futtern, dann hat man's üblicherweise hinter sich. Meist dauert es etwa acht bis zwölf Stunden, bis die Symptome einsetzen – die im Wesentlichen darin bestehen, dass man sich seine unsterbliche Seele aus dem Leib scheisst. Bereits am nächsten Tag fühlt man sich aber wieder deutlich besser und schmiedet hoffnungsvoll neue Lebenspläne, freut sich vielleicht auch schon darauf, sich die nächste Pilzschnitte in die Futterluke zu orgeln. Dummerweise ist das bloss noch die Walking Dead-Phase, denn der Körper hat den Laden inzwischen weitgehend dichtgemacht und Organe wie die Leber sind mehrheitlich unrettbar hinüber. Diese augenfällig unschöne Angelegenheit kann man mit einer bestenfalls marginalen Wahrscheinlichkeit überleben, wenn man unverzüglich mit 300 Sachen in die nächste Klinik brettert und dort gerade ein passendes Set an Spenderorganen vorrätig liegt. Gewöhnlich findet allerdings nach etwa acht Tagen aufgrund von Leber- bis Multiorganversagen die letzte Ölung statt. Man sollte wirklich besser vorsichtig sein mit Pilzen.
Zwei entsetzliche Beispiele, nicht wahr? Wer mit universeller natürlicher Brutalität pseudoargumentiert («die Welt ist nicht gerecht»), instrumentalisiert in aller Regel aber nicht Würmer oder Pilze oder Flechten oder Amöben, um seine wacklige These zu untermauern, sondern eher etwas in der Grössenordnung Löwe. Das wirkt auf den ersten Blick einigermassen zweckmässig, denn der Mensch ist nun mal nicht gerade ein enger biologischer Verwandter von niederem Gewürm und Gewächs. Allein: Das trifft auch auf den Löwen zu, dessen Artengruppe sich evolutionär vor etwa 90 Millionen Jahren von der unsrigen abspaltete. Eine argumentativ halbwegs schlagkräftige genetische Nähe zwischen Grosskatze und Mensch existiert demnach nicht wirklich. Bei beliebigen anderen Raubtieren ist’s auch nicht viel besser, und also wird das Pseudoargument schwächer und schwächer. Es war freilich von vornherein nichts anderes als eine überhastete Generalisierung, die keine nennenswerte Faktenbasis hat. Eine Aussage wird nicht allein dadurch wahr, dass man ein paar willkürlich gewählte Beispiele zu benennen vermag: Ich kann viele grüne Gegenstände aufzählen, aber das heisst nicht, dass alle Gegenstände grün sind. Gleichwohl verleiten solche einzelnen Fallbeispiele und irreführenden Analogien viele Menschen dazu, kurzerhand zu verallgemeinern, kompromisslose Machtausübung ohne jede moralische Beisshemmung sei ein Grundbaustein allen Lebens. Löwen reissen Gazellen – voilà, Diskussion beendet. Eventuell wird mit folgendem Argument nachgetreten: Das Recht des Stärkeren sei schliesslich auch evolutionär völlig plausibel, weil es im Endeffekt dem Überleben der jeweiligen Spezies diene. Dieses u.a. von historischen «Persönlichkeiten» wie Adolf Hitler und Friedrich Nietzsche bediente Konzept – Arterhaltung als Urtrieb allen Lebens um jeden auch noch so unethischen Preis – gilt jedoch seit über 50 Jahren als wissenschaftlich überholt. Es blieb eine nie bewiesene biologische Hypothese und wurde als solche archivarisch eingemottet. Nietzsche schrieb anno 1887 in seinem Jenseits von Gut und Böse:
«Die Physiologen sollten sich besinnen, [die Selbsterhaltung] als kardinalen Trieb eines organischen Wesens anzusetzen. Vor allem will etwas Lebendiges seine Kraft auslassen – Leben selbst ist Wille zur Macht.»
Die Natur ist nun aber faktisch nicht halb so machtversessen und böse, wie diese historischen Irrlichter sie zur Legitimation ihrer kruden Ideologien gerne gehabt hätten. Gerade die schier unermesslich vielen Beispiele für Symbiosen und Altruismus in Flora und Fauna strullern der irrigen These vom Universalrecht des Stärkeren einen ordentlichen Mittelstrahl ans Bein. Wer folglich die gesamte belebte Natur aufgrund einiger willkürlich gewählter Beispiele als erbarmungslosen, ewigen Krieg betrachtet, als bellum omium contra omnes, liegt mit seiner rosinenpickenden Faultier-Schlussfolgerung völlig neben der Realität. Denn sobald wir den Blick weiten, um das ganze Bild zu betrachten, finden wir Gegenbeispiele beinahe sonder Zahl. Wie wäre es denn mit Ameisen, die Blattläuse abmelken, weil sie sich gerne von deren Ausscheidungen ernähren, und zum Ausgleich die Blattläuse gegen deren Fressfeinde verteidigen? Oder mit Einsiedlerkrebsen, die auf ihren Rücken Seeanemonen transportieren und derweil von den Nesselzellen der Anemone beschützt werden? Oder mit Ratten, die leidende Artgenossen befreien, selbst wenn sie mit Futter von der Befreiungsaktion abgelenkt werden? Oder mit Kapuzineräffchen, die im Experiment völlig am Rad drehen, wenn das Futter ungerecht verteilt wird? Oder mit Schimpansen, die ihren kranken Artgenossen aufopferungsvoll helfen? All diese und viele weitere Gegenbeispiele werden von «Recht des Stärkeren»-Fanboys in selbstgewählter intellektueller Unredlichkeit einfach mal eben ausgeblendet. Der niederländische Primatologe und Verhaltensforscher Frans de Waal meint dazu:
«Glaube keinem der sagt, weil die Natur auf einem Kampf ums Überleben basiere, müssten wir Menschen auch so leben. Viele Tiere überleben nicht durch gegenseitiges Töten oder indem sie alles für sich selbst behalten, sondern durch Kooperation und Teilen.»
Der unerbittliche Kampf «jeder gegen jeden» mit dem Stärkeren als Sieger – ja, er findet in der Natur tatsächlich häufig statt. Allerdings sehen wir eben auch das genaue Gegenteil, und zwar nicht als ein paar vernachlässigbare Ausnahmen, die eine Regel bestätigen, sondern weit verbreitet über unzählige Lebensformen. Auch und gerade bei anderen sozialen Säugetieren wie Wölfen, Delfinen und Affen wird kooperatives oder selbstloses Verhalten beobachtet, das sich evolutionär zur Verbesserung der Gruppenzusammenarbeit herausgebildet hatte und wesentlich zum Fortbestand der jeweiligen Art beitrug. Ein universell gültiges Leitprinzip des bedingungslosen Machtstrebens existiert in der belebten Natur also schlichtweg nicht. Mehr noch: Kooperation finden wir mindestens gleich häufig wie Konkurrenz, und das hat einen simplen Grund. Wäre knallharter Wettbewerb in einem ewigen Kampf ums Überleben das dominierende biologische Prinzip, hätte sich das Leben auf unserem Planeten mutmasslich schon gar nicht erst entfalten können, bestimmt jedenfalls nicht zu höheren, komplexeren Arten auffächern. Denn Kooperation ist bereits auf Zellebene und bei Mikroorganismen unabdingbar, um evolutionäre Fortschritte zu erzielen. Forscher konnten unlängst experimentell zeigen, dass sogar das Darmbakterium Escherichia coli mit seinesgleichen kooperiert, um sich und Artgenossen am Leben zu erhalten. In Summe ist der Kampf «jeder gegen jeden» also weder ein allgemeingültiges Naturgesetz, noch lässt sich diesbezüglich überlebenskämpferisches Verhalten einzelner Arten auf uns Menschen extrapolieren - am allerwenigsten aus jenen Arten, die mit der unsrigen biologisch näher verwandt sind.
Man sollte bei Tier-Mensch-Vergleichen oder vice versa aber ohnehin sehr vorsichtig sein. Es gibt fast keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte, dass solche Vergleiche überhaupt in irgendeiner Weise eine substanzielle Aussagekraft besässen. Das Verhalten von Tieren lässt sich kaum bis gar nicht auf uns Menschen übertragen und umgekehrt gilt dasselbe. Nicht weniger Vorsicht ist geboten, wenn man die Entstehung eines spezifischen Verhaltens innerhalb einer bestimmten Lebensform erklären will. Wir wissen fast sicher, dass das Verhalten einer Art – und auch unser Umgang mit Macht ist ja eine Verhaltensweise – nicht allein genetische Ursachen hat und mithin vollständig angeboren ist. Die heutige Forschung erklärt Verhalten gerade bei komplexeren Lebewesen stets als multikausal, d.h. als zu Teilen evolutionär angeboren und zu anderen Teilen situativ und kontextbezogen erlernt. An einem Beispiel: Gewisse Primatenarten betreiben soziale Fellpflege – weshalb tun sie das?
1. Eher angeboren: Bei allen Beteiligten der sozialen Fellpflege steigt der Endorphinspiegel, was aggressionshemmend wirkt und das harmonische Zusammenleben in der Gruppe verbessert.
2. Eher erlernt: Die Primaten haben dieses Verhalten ihren Artgenossen abgeschaut und nachgeäfft (haha). Isoliert aufgewachsene Individuen beteiligen sich hingegen zunächst nicht an der sozialen Fellpflege, sie müssen das Verhalten zuerst von anderen lernen.
3. Eher erlernt: Freundlichkeit hebt soziale Bindungen auf ein höheres Level. Solche stärkeren Bindungen sind wechselseitig hilfreich und nützlich: Du hast mir mal die Läuse aus dem Pelz gepult, dafür helfe ich dir jetzt bei der Futtersuche.
4. Eher angeboren: Soziale Fellpflege als Ausprägung eines Brutpflegeverhaltens hat sich im Laufe der Zeit als evolutionär vorteilhaft erwiesen und alsdann genetisch verankert.
Die soziale Fellpflege der Primaten lehrt uns: Selbst eine spezifische Verhaltensweise innerhalb einer einzelnen Lebensform hat zahlreiche, sowohl angeborene als auch erlernte Anteile. Das Fazit dieses Kapitels ist demnach: Verhalten lässt sich insbesondere bei komplexeren Lebewesen nie auf simplifizierte, verallgemeinerte Ursachen wie Machtstreben zurückführen, schon gar nicht auf einen im Genom festgeschriebenen Algorithmus. In der belebten Umwelt existiert weder innerhalb einer Spezies noch artenübergreifend ein einheitlicher Anlasser; die Natur kennt keinen evolutionären Ur-Schaltkreis, der einzelne oder gar sämtliche Arten als skrupellose Killermaschinen hochfährt, die daraufhin ohne Erbarmen alles niedermetzeln, was ihrer Erhaltung im Wege steht. Richtig ist hingegen: Das Leben hat sich im Laufe der Jahrmilliarden in unzählige Richtungen entwickelt, einige davon nehmen wir als brutal und gnadenlos wahr, andere wiederum als friedfertig und empathisch. Diese Wahrnehmung ist aber bereits unzulässig vermenschlicht, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit kann nur unsere Spezies in solchen moralischen Wertekategorien denken. Saitenwürmer und Amanita-Pilze jedoch sind ihrer Biologie wegen nicht zu anderem Verhalten imstande, geschweige denn zur ethischen Reflexion befähigt. Auch der Löwe tötet nicht, weil er kalkuliert machthungrig ist, sondern weil er instinktiv gazellenhungrig ist. Das beobachtbare Verhalten von Pflanzen und Tieren gibt ergo schon im Allgemeinen wenig bis nichts über menschliches Verhalten her. Macht als eine besondere menschliche Verhaltensweise lässt sich demzufolge aus der belebten Umwelt schon im Grundsatz nicht erklären.
Kapitel 3 Affige Sackgasse
In diesem Kapitel zeige ich, dass und weshalb Macht auch keine natürliche Eigenschaft unserer genetisch nächsten Verwandten ist, die Primatologie diesbezüglich also in eine zweite Sackgasse führt.





























