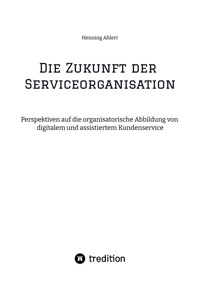
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ausgehend von einem etablierten assistierten Kundenservice, in dem Kundenberater Anliegen von Kunden persönlich bearbeiten, führen Serviceorganisationen in zunehmendem Maße digitalen, automatisierten Kundenservice ein. Proof of Concepts (POCs) und Pilotprojekte unter Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) sprießen aus dem Boden und Technologieanbieter genießen eine Hochkonjunktur – und das sowohl für die Unterstützung von Kunden, von Mitarbeitern als auch für Analysezwecke. Mit dieser Entwicklung teilen die beobachteten Serviceorganisationen eine weitere Gemeinsamkeit, wenn der Blick auf die organisatorische Einbettung des digitalen Kundenservice in die bestehende assistierte Serviceorganisation bzw. die grundsätzliche Organisationsstrategie zwischen digitalem und assistiertem Service fällt. Diese Organisationsstrategie ist in den meisten Fällen entweder gar nicht, nur schemenhaft oder zufällig vorhanden und digitaler Kundenservice entsteht losgelöst neben dem assistierten Service und seinen langjährig bestehenden Strukturen. Eine wirklich gezielte und geplante organisatorische Einbettung findet selten statt und bei näherem Hinsehen fällt auf, dass an vielen Stellen ein zukunftsgerichtetes Gesamtkonzept für eine wirklich hybride Serviceorganisation, das digitalen und assistierten Kundenservice gesamtheitlich plant und bewusst entstehen lässt, schlicht fehlt. Woran liegt es, dass Serviceorganisationen den Wandel zu einem zunehmend digitalen Kundenservice zwar mit der Einführung neuer Technologien (zum Teil mit enthusiastischer Begeisterung und Technikbesessenheit) initiieren, aber dieser Wandel nicht in einer klaren Zielorganisationsstruktur weitergedacht wird und wirklich in dieser ankommt? Mit diesem Ansatz startete das Vorhaben, die Zukunft der Serviceorganisation im Rahmen einer Expertenbefragung qualitativ zu untersuchen und Wege zu ermitteln, wie perspektivisch assistierter und digital automatisierter Kundenservice in einer hybriden Serviceorganisation bestmöglich zusammenwachsen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Diese Forschungsarbeit ist all denen gewidmet, die motiviert und angetrieben sind, Kundenservice stetig weiterzuentwickeln, um die Erwartungen von Kunden zu erfüllen – sowohl assistiert als auch digital automatisiert, in einer hybriden Serviceorganisation.
Henning Ahlert
Die Zukunft der
Serviceorganisation
Perspektiven auf die organisatorische Abbildung von digitalem und assistiertem Kundenservice
© 2025 Henning Ahlert
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
ISBN
Paperback
978-3-384-54649-4
e-Book
978-3-384-54650-0
Vorwort
Den Anstoß zu diesem Forschungsprojekt gaben persönliche Beobachtungen in verschiedenen Serviceorganisationen während der Einführung von digitalem Kundenservice. Diese haben in der Praxis auffallend große Übereinstimmungen in ihrer Ausprägung gezeigt: Ausgehend von einem etablierten assistierten Kundenservice, in dem Kundenberater1 Anliegen von Kunden persönlich bearbeiten, führen diese Serviceorganisationen in zunehmendem Maße digitalen, automatisierten Kundenservice ein. Proof of Concepts (POCs) und Pilotprojekte unter Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) sprießen aus dem Boden und Technologieanbieter genießen eine Hochkonjunktur – und das sowohl für die Unterstützung von Kunden, von Mitarbeitern als auch für Analysezwecke. Mit dieser Entwicklung teilen die beobachteten Serviceorganisationen eine weitere Gemeinsamkeit, wenn der Blick auf die organisatorische Einbettung des digitalen Kundenservice in die bestehende assistierte Serviceorganisation bzw. die grundsätzliche Organisationsstrategie zwischen digitalem und assistiertem Service fällt. Diese Organisationsstrategie ist in den meisten Fällen entweder gar nicht, nur schemenhaft oder zufällig vorhanden und digitaler Kundenservice entsteht losgelöst neben dem assistierten Service und seinen langjährig bestehenden Strukturen. Eine wirklich gezielte und geplante organisatorische Einbettung findet selten statt und bei näherem Hinsehen fällt auf, dass an vielen Stellen ein zukunftsgerichtetes Gesamtkonzept für eine wirklich hybride Serviceorganisation, das digitalen und assistierten Kundenservice gesamtheitlich plant und bewusst entstehen lässt, schlicht fehlt. Die Gründe dafür erscheinen unklar und nicht systematisch analysiert, sie sind vermutlich vielschichtig und daher entstand die Idee, sich im Rahmen eines Forschungsprojektes tiefer mit den Ursachen dieses gravierenden Versäumnisses von Serviceorganisationen und deren Verantwortlichen zu beschäftigen. Woran liegt es, dass Serviceorganisationen den Wandel zu einem zunehmend digitalen Kundenservice zwar mit der Einführung neuer Technologien (zum Teil mit enthusiastischer Begeisterung und Technikbesessenheit) initiieren, aber dieser Wandel nicht in einer klaren Zielorganisationsstruktur weitergedacht wird und wirklich in dieser ankommt? Wenn es für diesen Mangel an organisatorischer Zielkonzeption Gründe geben sollte und diese transparent gemacht werden könnten, dann ließe sich bewusst und gezielt an diesen Themen arbeiten, um sie abzustellen oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Mit der Erkenntnis, nämlich dem, was offensichtlich falsch läuft und wie es anders, ja besser gestaltet werden kann, ließen sich die immer wieder gleich (schlecht) ablaufenden sogenannten Transformationen möglicherweise in eine bessere und erfolgversprechendere Richtung lenken. Das könnte ein Versuch sein, sich wiederholende Fehler zu vermeiden und aus den Erfahrungen anderer zu lernen, um nicht nur Technologie für digitalen Kundenservice in Projekten einzuführen, sondern von Beginn an die richtige Organisationsstruktur für den Betrieb mitzudenken.
Mit diesem Ansatz startete das Vorhaben, die Zukunft der Serviceorganisation zu untersuchen und Wege zu ermitteln, wie perspektivisch assistierter und digital automatisierter Kundenservice in einer hybriden Serviceorganisation bestmöglich zusammenwachsen können.
Mein Dank gilt den 14 Experten, die mit ihrem Fachwissen und ihren Erfahrungen in den Experteninterviews einen elementaren Beitrag für die Erstellung dieser Forschungsarbeit geleistet haben. Ohne sie wäre der Erkenntnisgewinn, der zu den ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen beigetragen hat, nicht möglich gewesen.
Berlin, im März 2025
1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
1. Thematische Grundlagen
1.1 Begriffsdefinitionen
1.2 Ausgangslage und thematische Einordnung
1.3 Theoretische Einordnung
1.4 Überleitung zur Problemstellung
2. Methodisches Vorgehen
2.1 Bisheriger Erkenntnis- und Forschungsstand
2.2 Ausarbeitung der Ziele und Forschungsfragen
3. Studiendesign
3.1 Methodik der Forschung
3.2 Informationen zur Stichprobe
3.3 Messung
3.4 Informationen zur Datenerhebung
4. Datenanalyse und Ergebnisse
4.1 Beschreibung der Stichprobe
4.2 Vorgehen bei der Auswertung
4.3 Beantwortung der Forschungsfragen
4.3.1 Forschungsfrage 1
4.3.2 Forschungsfrage 2
4.3.3 Forschungsfrage 3
4.3.4 Forschungsfrage 4
4.3.5 Forschungsfrage 5
4.4 Interpretation der Ergebnisse
5. Empfehlungen für die Serviceorganisation
5.1 Veränderungsmanagement initiieren und steuern
5.2 Beschreibung der hybriden Serviceorganisation
5.3 Grundsätzliches zu Projekten und Betrieb
5.4 Fokus auf Projekte
5.5 Fokus auf den Betrieb
5.6 Beispielhafte Ziel-Serviceorganisation
5.7 Funktionen in der Ziel-Serviceorganisation
Schlussbetrachtung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Über den Autor
Hinweise für weiterführende Literatur
Die Zukunft der Serviceorganisation
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Hinweise für weiterführende Literatur
Die Zukunft der Serviceorganisation
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Diffusionsprozess
Abbildung 2: Kanal/Interaktionsmatrix
Abbildung 3: Präferenzen in der Nutzung der Kontaktkanäle
Abbildung 4: Bevorzugte Kanäle für Kundenservice Interaktionen
Abbildung 5: Nutzungspräferenz von Kanälen
Abbildung 6: Vier-Ebenen Modell der hybriden Serviceorganisation
Abbildung 7: Vertieftes Vier-Ebenen Modell
Abbildung 8: Varianten der Kontaktaufnahme
Abbildung 9: Entwicklung zur Service Kathedrale
Abkürzungsverzeichnis
AI
Artificial Intelligence
AHT
Average Handling Time
ASA
Average Speed of Answer
BtB
Business to Business
BtC
Business to Consumer
BPO
Business Process Outsourcing
CDO
Chief Digital Officer
CEO
Chief Executive Officer
CIO
Chief Information Officer
CRM
Customer Relationship Management
CX
Customer Experience
CS
Customer Service
IVR
Interactive Voice Response
IT
Information Technology
KI
Künstliche Intelligenz
KPI
Key Performance Indicator
LLM
Large Language Model
POC
Proof of Concept
NEV
New Energy Vehicles
NPS
Net Promotor Score
RPA
Robotics Process Automation
SLA
Service Level Agreement
Einleitung
Innovationen entstehen innerhalb von Entwicklungszyklen. Gemäß Hilbert2 lassen sich diese Zyklen in drei großen Phasen gliedern: Die erste konzentrierte sich auf die Umwandlung von Material, darunter Stein, Bronze und Eisen. Die zweite, die auch oft als industrielle Revolution bezeichnet wird, widmete sich der Umwandlung von Energie, einschließlich Wasser, Dampf, Elektrizität und Verbrennungskraft. Die jüngste Phase, der dritte Entwicklungszyklus, beinhaltet die Umwandlung von Informationen. Sie begann mit der Verbreitung von Kommunikation und gespeicherten Daten und befindet sich inzwischen im Zeitalter der Algorithmen, das auf die Schaffung automatisierter Prozesse zur Umwandlung der vorhandenen Informationen in verwertbares Wissen ausgerichtet ist.
Innovationen spielen im Informationszeitalter eine bedeutende Rolle. Innovationen bedingen die Notwendigkeit zum Wandel, bei Individuen, in Unternehmen und in anderen Arten von Organisationen. Wer sich dem notwendigen Wandel verschließt oder ihn nicht rechtzeitig berücksichtigt, läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Der Erfolg von Unternehmen und Organisationen hängt zu einem wichtigen Teil davon ab, ob diese in der Lage sind, ihre Strukturen dauerhaft den aktuellen Herausforderungen anzupassen.3 Die Automobilindustrie bietet hierfür ein jüngstes, wenn auch für Deutschland unrühmliches Beispiel. Während sich unter den 10 weltweit meistverkauften Elektro-Automarken (inkl. Hybridfahrzeuge) im Jahr 2023 insgesamt 6 chinesische Hersteller befanden, verkauften die 3 deutschen Marken in den Top 10 zusammen weniger als die Hälfte der Autos des Erstplatzierten BYD.4 Im chinesischen Markt selbst ist unter den Top 10 der New Energy Vehicles (NEV) im ersten Halbjahr 2024 mit Tesla nur ein ausländischer Hersteller außer chinesischen Marken vertreten.5 Dabei haben die deutschen Automobilhersteller zwei wichtige Trends nicht ausreichend berücksichtigt, die steigende Elektromobilität und die insgesamt schwierige wirtschaftliche Situation, in der die zunehmende Sparsamkeit der Konsumenten die Nachfrage nach deutschen hochpreisigen Autos hat einbrechen lassen.6 Das sorgt im chinesischen Markt dafür, dass die Umsätze deutscher Hersteller von Autos mit Verbrennermotoren bei Verkäufen deutscher Marken in China im ersten Halbjahr 2024 eingebrochen sind, charakterisiert durch einen Verbrenneranteil von über 90% aller abgesetzten deutschen Autos bei einem Gesamtmarkt-Verbrenneranteil aller Autos in China von inzwischen nur noch knapp 57%. Die Markt- und Kundenerwartungen können von den deutschen Herstellern nur noch bedingt bedient werden.
Weitere Beispiele aus anderen Bereichen, bei denen sich eine bis dahin erbrachte Leistung oder ein Produkt durch technologische Innovation transformiert und sich eine Innovation zunehmend durchgesetzt hat, gibt es viele. Automobile ersetzten Pferde für den Transport von Menschen und Gütern und in der Landwirtschaft, Computer revolutionierten die Büroarbeit, Offset-Druckmaschinen wurden durch Digitaldruck ersetzt und als weitere Folge digitale Printmedien zunehmend durch digital lesbare Formate an Endgeräten abgelöst. Auch die Digitale Fotografie ließ analoge Kameras nahezu vom Markt verschwinden und das mit spürbaren Folgen für betroffene Unternehmen wie Kodak oder Agfa. Diese Liste könnte umfassend erweitert werden und jedem Leser fallen vermutlich spontan eigene Beispiele ein.
Insbesondere spielen technologische Innovationen eine erwähnenswerte Rolle im derzeitigen Informationszeitalter, in dem Unternehmen und Organisationen eine digitale Transformation durchlaufen (müssen), die unausweichlich und die unumkehrbar ist, die schnell voranschreitet und die unsicher ist.7 Die vier genannten Charakteristika zeigen, dass die digitale Transformation ein Prozess ist, der sich selbst durch Regularien nur verlangsamen, jedoch nicht aufhalten lässt. Unternehmen sollten sich nicht dem Versuch einer Wahrung ihres bestehenden Geschäfts- und Betriebsmodells unterwerfen, sondern die Chancen neuer, digitaler Technologien kontinuierlich hinsichtlich ihres Potentials zur Weiterentwicklung überprüfen. Es geht nicht mehr nur wie in der Vergangenheit darum, die Entscheidung für einen technischen Standard zu treffen und diesen dann eine lange Zeit beizubehalten. Stattdessen müssen für den Einsatz im individuellen Unternehmenskontext Potentiale von neuen Technologien dauerhaft regelmäßig abgeschätzt werden, um den digitalen Transformationsprozess aktiv mitgestalten zu können.8 Wenn das nicht beachtet wird, können digitale Transformationen scheitern. Ein Scheitern entsteht häufig durch einen Mangel an ausreichender finanzieller und strategischer Planung in Verbindung mit einer möglichen Unterschreitung der zu erwartenden Ergebnisse durch die digitale Transformation. Auf der einen Seite stehen hohe Erwartungen an die Ergebnisse der Transformation, die mit finanziellen Investitionen verbunden sind und auf der anderen Seite kurzfristige Sichten auf operative wirtschaftliche Ergebnisse. Daher sollten technologische Entwicklungen als Teil eines Prozesses der Veränderungsinnovation gesehen werden, um potenzielles Wachstum zu ermöglichen. Sie sind aber keineswegs der alleinige Grund für wirtschaftlichen Erfolg.9 Parviainen et al. beschreiben Transformationen häufig als nicht gelungen, weil die Unternehmen ihre Denkweise und ihre Prozesse nicht geändert und keine Kultur aufgebaut haben, die einen Wandel fördern könnte. Das Fehlen einer umfassenden Digitalisierungsstrategie und konkurrierende Prioritäten beschreiben sie als die typischsten Hindernisse für die Digitalisierung, zusammen mit Sicherheitsbedenken und unzureichenden technische Fähigkeiten in der Organisation.10 Somit wird eine Sicht verständlich, die beschreibt, dass eine solche Transformation über die bloße Automatisierung bestehender Praktiken hinausgeht und zu einer radikalen Veränderung der Art und Weise, wie Geschäftsaufgaben betrieben werden, führen muss. Erfolgreiche digitale Transformation nutzt digitale Technologien, um den Kundennutzen neu zu gestalten, betriebliche Prozesse zu verändern und die Interaktion und die Zusammenarbeit mit Kunden zu verändern. Damit gewinnt digitale Transformation eine Priorität für Verantwortliche, die die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit ihrer Organisationen steigern und die Geschäfts- und Innovationsleistung verbessern wollen. Dafür müssen die Organisationen einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen, der einen veränderten Führungsstil erfordert und die richtigen Rollen mit den richtigen Fertigkeiten und Fähigkeiten aufbaut, das richtige Mindset und Verhalten fördert, die richtigen Hilfsmittel für die Veränderung bereitstellt und die Maßnahmen einleitet, die für die Transformation nötig sind.11 Parviainen et al.12 beschreiben eine Methode mit vier iterativen Schritten, um die Transformation vorzubereiten. Zunächst muss das Unternehmen seine Position in Bezug auf die Digitalisierung sowie die Ziele, die es erreichen will, definieren. Dann muss der Aufwand zur Erreichung dieser Ziele definiert werden, indem die Lücke zwischen den Zielen und dem Ist-Zustand ermittelt wird. Im Anschluss erfolgt die systematische Planung einer Roadmap für den Erfolg und die Umsetzung der Roadmap in die Praxis unter Verwendung von Proofof-Concepts, falls erforderlich.
Der Status des Innovationsmanagements im Bereich Kundenservice scheint nach wie vor ausbaufähig zu sein. Haffner/Henn beschreiben in diesem Zusammenhang die Beobachtung, dass Mut und Entschlossenheit im Kundenservice fehlen, um Innovationsmanagement umzusetzen. Vielfach stehen operative Themen und der Blick auf operative Ergebnisse im Vordergrund.13 Weiter beschreiben sie: „Innovationen beziehen sich häufig auf unmittelbare Verbesserungen und zum Teil auf aufkommende Chancen. Disruptive Innovationen sind an der Kundenschnittstelle kaum zu erkennen.“14
Individuen, die Innovationen akzeptieren und annehmen, spielen bei der Marktdurchdringung der Innovationen eine wichtige Rolle. Die Diffusionstheorie nach Everett M. Rogers hilft, plastisch einzuordnen, wie Innovationen in der Gesellschaft durch einen Diffusionsprozess in mehreren Phasen verlaufen und dieser Prozess in Abhängigkeit von unterschiedlichen Persönlichkeitstypen beeinflusst wird.15 Die Theorie beschreibt, wie Gruppen von Menschen Innovationen annehmen und so deren Erfolg oder Misserfolg beeinflussen. Die Theorie lässt sich auf Produkte, Dienstleistungen und gesellschaftliche Veränderungen anwenden. Rogers stellte fest, dass einige Menschen schneller neue Ideen übernehmen als andere. Der Begriff der Diffusion stammt aus der Naturwissenschaft und beschreibt die Ausbreitung von Substanzen. Rogers übertrug dieses Konzept auf soziale und wirtschaftliche Zusammenhänge. Die Theorie basiert auf verschiedenen Grundannahmen: Innovationen sind neue Ideen, Produkte oder Verfahren. Adaption ist ein Prozess, durch den Individuen oder Gruppen Innovationen annehmen. Kommunikationskanäle sind entscheidend für die Verbreitung von Informationen über Innovationen. Die Struktur und Kultur einer Gesellschaft beeinflussen die Diffusion und werden als Soziale Systeme bezeichnet.
Im Diffusionsprozess spielen verschiedene Arten von Individuen eine wichtige Rolle, wie auch grafisch in Abbildung 1 dargestellt. Diese Personen beeinflussen, wie schnell und weit sich eine Innovation verbreitet. Ihre Eigenschaften und Verhaltensweisen haben direkten Einfluss auf die Akzeptanz von Neuerungen in der Gesellschaft. Innovatoren sind die ersten, die eine neue Idee oder Technologie annehmen. Sie sind risikofreudig und bereit, neue Lösungen auszuprobieren. Ihr Interesse an Neuem treibt die Entwicklung voran. Danach folgen die frühen Übernehmer, die als Meinungsführer und damit auch als Vorbilder gesehen werden. Sie haben ein starkes Interesse an Innovationen und können deren Vorteile schnell erkennen. Nach ihnen folgt die Gruppe der sogenannten frühen Mehrheit, die keine Meinungsführer sind. Sie sind risikoaverser und erwarten Beweise für den Nutzen von Neuerungen. Die danach folgende späte Mehrheit betrachtet Innovationen eher zurückhaltend und übernimmt Neuerungen in der Regel erst dann, wenn der wirtschaftliche oder soziale Druck des Umfeldes zu stark wird und die Innovation weit verbreitet, akzeptiert und damit risikoärmer für sie ist. Empfehlungen von Freunden oder positiven Erfahrungen anderer helfen der späten Mehrheit, eine Entscheidung zu treffen. Da die späte Mehrheit häufig über vergleichsweise knappere (finanzielle) Ressourcen verfügt, können und wollen die hier verorteten Individuen nur wenig Unsicherheit akzeptieren. Nachzügler sind die letzten, die eine neue Idee annehmen. Sie sind grundsätzlich skeptisch gegenüber Neuerungen, sozial kaum eingebunden, zudem stark an der Vergangenheit orientiert und bevorzugen Bewährtes. Diese Gruppe braucht oft mehr Zeit, um sich an Veränderungen zu gewöhnen. Sie können durch sozialen Druck oder äußere Umstände zur Akzeptanz bewegt werden. Nachzügler sind wichtig, denn ohne ihre Zustimmung kann keine vollständige Verbreitung erzielt werden. Nachzügler müssen noch stärker mit begrenzten Mitteln wirtschaften und wollen in der Regel aus diesem Grund keine unsicheren Entscheidungen treffen.
Abbildung 1: Diffusionsprozess (in Anlehnung an Rogers)
Für den Kundenservice lässt sich Innovation von zwei Seiten betrachten. Zunächst von der Seite der Serviceorganisation in Unternehmen, die Service für ihre Kunden erbringt und ebenfalls von der Seite der Kunden, die die Serviceerbringung beansprucht. Aus Sicht der Serviceorganisationen sind es vor allem Innovationen, die der Serviceorganisation helfen, die Anliegen der Kunden zu bedienen und zu bearbeiten. In der Regel sind das technologische Innovationen, die unterstützen, Kunden und ihre Anliegen besser, schneller, richtiger und endgültig zu erledigen. Die Einsatzmöglichkeiten, insbesondere von KI sind in diesem Zusammenhang vielfältig und werden das perspektivisch in den nächsten Jahren auch bleiben.16 Aus Sicht der Kunden können Innovationen, die eine Serviceorganisation nutzt oder bereitstellt, zum Beispiel an den Schnittstellen zum Unternehmen wahrgenommen werden, an denen Serviceorganisationen zur Kontaktaufnahme und Lösungsfindung ausgewählte Technologien einsetzt, deren Nutzen der Kunde während und nach der Inanspruchnahme beurteilen wird. Die Kontaktaufnahme erfolgt über Kontaktkanäle und die Lösungsfindung über Kundenberater oder Maschinen, die Informationen bereitstellen oder Bearbeitungsvorgänge prozessieren und damit die Anliegen der Kunden beantworten oder bearbeiten. Auf der einen Seite lassen sich die Kontaktkanäle in traditionelle (nicht-digitale) Kanäle, wie z.B. Telefon, Brief, Fax und neuere, digitale Kanäle, wie z.B. E-Mail, Webseiten, Chat, App oder Conversational Bots unterscheiden. Die Kontaktkanäle entscheiden noch nicht zwangsläufig, ob eine Beantwortung oder Bearbeitung des Anliegens durch einen Kundenberater oder eine Maschine stattfindet. So kann beispielsweise ein Kontakt über den Kontaktkanal Telefon vollständig durch einen Kundenberater oder eine Maschine ausgeführt werden oder in einer Kombination. Es gibt also zwei Arten von Kundenpräferenzen, einmal die bezüglich des Kanals und die bezüglich der Art der Beantwortung bzw. Bearbeitung durch einen Mensch oder eine Maschine in der Kanal-/Interaktionsmatrix in Abbildung 2. So kann es sein, dass Kunden eher traditionelle Kanäle wie das Telefon bevorzugen und auf der Bearbeitung durch einen Menschen bestehen (Quadrant 1). Andere Kunden präferieren die Kommunikation über das Telefon, wären aber bereit, auch mit einem Sprachbot ihr Anliegen zu klären (Quadrant 2). Eine Dritte Kundengruppe mag digitale Kanäle, z.B. einen Chatkanal, aber bevorzugt eine Live-Chat Interaktion mit einem Menschen (Quadrant 3) und die vierte Kundengruppe nutzt gerne vollautomatisiert einen digitalen Kanal, der auch automatisiert das Anliegen bearbeitet (z.B. ein Chatbot oder die Hilfeseite der Webseite) (Quadrant 4).
Abbildung 2: Kanal/Interaktionsmatrix (eigener Entwurf)
Dass die Kanalpräferenz insbesondere in den unterschiedlichen Altersgruppen sehr heterogen ist, zeigen verschiedene Studien in den Abbildungen 3 bis 5. Diese verdeutlichen allesamt, wie unterschiedlich die Präferenzen von Kunden nach Altersgruppen bezüglich der Kanalwahl verteilt sind und sie lassen den Schluss zu, dass Unternehmen ihr Kontaktkanalangebot genau überprüfen sollten, um diesbezüglich Kundenerwartungen wirklich zu erfüllen. Es ist zu erwarten das der Wunsch der Kunden nach Optionen bei der Kanalwahl auch künftig bestehen wird, da sich Kanalpräferenzen nur langsam entwickeln und über erlebtes Nutzungsverhalten der Kunden bestimmen. Traditionelle und digitale Kanäle, die heute als einzelne Kanäle angeboten werden, verschwimmen künftig zunehmend über Sprache und Text unter Nutzung eines Devices aus Sicht der Kunden17, wie z.B. dem Smartphone, so dass diese Unterscheidung zunehmend unwichtiger wird und der Fokus auf der assistierten bzw. maschinellen Interaktion liegen wird.
Abbildung 3: Präferenzen in der Nutzung der Kontaktkanäle (Quelle: NTT Data: 2023 Global Customer Experience Report, 2023, S. 70)
Abbildung 4: Bevorzugte Kanäle für Kundenservice Interaktionen (Quelle: Genesys: Generationsdynamik und Erlebnisökonomie, 2024, S. 10)
Abbildung 5: Nutzungspräferenz von Kanälen (Quelle: AC Süppmayer, Kundenservicebarometer 2024, S. 9 und 31)
Auch bezüglich der von den Kunden präferierten Art der Interaktion gibt es Unterschiede in den Kundenerwartungen und den Vorlieben der Kunden. Genaue Rückschlüsse auf das, was richtig oder falsch ist, lassen sich heute kaum belastbar ziehen. Es gibt Ergebnisse, die zeigen, dass Kunden bei gleicher Lösungsqualität eines Kundenberaters und einer Maschine die erlebte Servicequalität mit der menschlichen Interaktion besser bewerten als die Interaktion mit der Maschine.18 Auf der anderen Seite zeigen Studien auf, dass die Qualität der Lösung an sich wichtiger ist als die Art und Weise, wie die Lösung übermittelt wird; kurz: primär zählt zunächst das Ergebnis.19 Auch eigene Befragungen in einem Kundenprojekt des Autors zeigen, dass eine Mehrheit der Kunden äußert, die Antwort einer Maschine zu akzeptieren, solange sie inhaltlich richtig ist. So wie bei der Festlegung des Kanalangebotes ist auch bei der Art der Interaktion, unabhängig davon, ob menschlich oder maschinell, genau zu prüfen, was die Kundenerwartungen sind und was Kunden bereit sind, als geeigneten Kundenservice tatsächlich zu akzeptieren.
An Anlehnung an die zuvor beschriebene Diffusionstheorie nach Rogers akzeptieren Kunden als Individuen Kontaktkanäle unterschiedlich, auch im Zeitablauf, ebenso wie das bei maschinell generierte Antworten der Fall ist. Das zeigt zunächst, wie heterogen die Erwartungen von Kunden an den Kundenservice sein können, sowohl an die Kontaktkanäle als auch bezüglich der Art und Weise, wie Anliegen gelöst werden (durch Kundenberater oder maschinell). Dass sich digitale Kontaktkanäle und maschinelle Anliegenlösung zunehmend im Angebot der Serviceorganisationen an die Kunden in ihrem Umfang verstärken werden und durch die Kunden schrittweise, in steigendem Maße akzeptiert und auch gefordert werden, erscheint insbesondere auch vor dem Hintergrund umfangreicher Marktdaten plausibel.20 Diese Entwicklung bedeutet gleichzeitig für die Serviceorganisationen, dass diese die zunehmende Digitalisierung in Projekten nicht nur einmalig initiieren und umsetzen sollten, sondern den digitalen Kundenservice neben dem durch Kundenberater assistierten Kundenservice auch organisatorisch in ihre Aufbau- und Ablaufstruktur einbauen müssen – und das mit klaren Rollen und Verantwortlichkeiten und mit der notwendigen Akzeptanz der betroffenen Mitarbeiter21. Als Versuch, Antworten für die organisatorische Herausforderungen zu finden sowie den Anspruch, diese dann auch wirklich in der Praxis erfolgreich umzusetzen und organisatorische Lösungsansätze für einen voll integrierten Kundenservice von menschlicher und maschineller Unterstützung zu entwerfen, wird das in dieser Arbeit beschriebene Forschungsprojekt aufgesetzt.
2 Hilbert, Marti: Digital technology and social change: the digital transformation of society from a historical perspective. S. 189 f.
3 Haupt, Sabine / May, Frank Christian / Müller, Hans Christian: Wettbewerbsvorteile durch Organisationswandel. Studie des Handelsblatt Research Institute, Mai 2024, S. 73
4 Statista: Anzahl verkaufter Elektroautos weltweit nach Marken im Jahr 2023. abgerufen am 12.11.2024, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/561568/umfrage/die-groessten-hersteller-von-elektroautosnach-absatz/
5 Schmid, Holger: BYD baut Dominanz auf dem chinesischen Elektroautomarkt aus. In: faz.net. 18. September 2024, abgerufen am 12.11.2024, https://www.faz.net/pro/digitalwirtschaft/mobility/byd-baut-dominanz-auf-dem-chinesischen-elektroautomarkt-aus-19989774.html
6 Hubik, Franz / Tyborski, Roman: Deutsche Autobauer verlieren Marktanteile. In: Handelsblatt vom 15.10.2024, abgerufen am 12.11.2024, https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/mercedes-vw-bmw-deutsche-autobauer-verlieren-weltweit-marktanteile/100077153.html
7 Oswald, Gerhard / Krcmer, Helmut: Digitale Transformation – Fallbeispiele und Branchenanalysen, Teil B – Grundlagen der digitalen Transformation. 2018, S. 7 ff.
8 Ebenda, S. 9 f.
9 Paul, Justin et al.: Digital transformation: A multidisciplinary perspective and future research agenda. 2024, S. 3
10 Parviainen, Päivi et al.: Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice. 2017, S. 65
11 Elia, Gianluca et al.: The digital transformation canvas: A conceptual framework for leading the digital transformation process. 2024, S. 389 f.
12 Parviainen, Päivi et al.: Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice. 2017, S. 74
13 Haffner, Nils / Henn, Harald (Hrsg): CEX Trendradar 2025. Januar 2025, S. 22
14 Ebenda, S. 6
15 Karnowski, Veronika / Kümpel, Anna Sophie: Diffusion of Innovations. In: Potthoff, Matthias: Schlüsselwerke der Medienwirkungsforschung, 2016, S. 97-107
16 MIT Technology Review Insights: Customer experience horizons. 2023, S. 13 (Figure 4)
17 Gartner: Strategy and Leadership Predictions for Service Leaders in 2025. (Whitepaper), 2025, S. 4-5
18 Castelo, Noah et al.: Understanding and Improving Consumer Reactions to Service Bots. 2023, S. 859 f.
19 Meyer-Waarden, Lars et al.: How Service Quality Influences Customer Acceptance and Usage of Chatbots?. 1/2020, S. 45
20 Vgl. hierzu vertiefend auch Ahlert, Henning: Service Transformation - Mit strukturierter Planung, Gestaltung und Umsetzung die Erwartungen von Kunden übererfüllen. 2024b, S. 7-16
21 Paluch, Stefanie / Wittkop, Thomas: Role and Risk on Employees’ Willingness to Collaborate with Artificial Intelligence and Its Impact on Wellbeing. 2023, S. 295-297
1. Thematische Grundlagen
Da die Begriffsdefinitionen im Kundenservice flexibel und nicht einheitlich in Theorie und Praxis verwendet werden, sind in einem kurzen Kapitel die in dieser Forschungsarbeit häufig wiederkehrenden Begriffe definiert, um sie in ihrer fortlaufenden Verwendung einordnen zu können und Interpretationsmissverständnisse möglichst zu reduzieren. Anschließend wird die Ausgangslage des Forschungsthemas beschrieben und thematisch eingeordnet. Da bereits hier deutlich wird, welche Rolle das Thema Change Management für die regelmäßige Entwicklung des Kundenservice spielt, werden danach einige theoretische Grundlagen für den Themenkomplex des Veränderungsmanagements gelegt, um anschließend konkret zur Problemstellung des Forschungsvorhabens mit seinen Details überzuleiten.
1.1 Begriffsdefinitionen
Das Forschungsthema dieser Arbeit leitet sich als vertiefende und weiterführende Exploration der Arbeiten von Ahlert aus dem Jahr 2024 ab. Daher lehnen sich einige der wichtigen Begriffsdefinitionen an die dort beschriebenen Definitionen an, die auch für diese Arbeit werden.
„Als Kundenservice (auch Customer Service) wird jegliche Art von Unterstützung verstanden, die ein Unternehmen oder eine andere Organisation (z.B. Behörde, Verein, Institution usw.) seinen Kunden vor, während oder nach dem Kauf oder der Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen bietet.“22 Auch in dieser Arbeit wird im Weiteren zur Vereinfachung ausschließlich der Begriff des Unternehmen benutzt, wobei andere Arten von Organisationen in die Deutung eingeschlossen werden.
Nach Ahlert23 „plant, organisiert und bereitet“ die Serviceorganisation als „organisatorische Einheit des Kundenservice die Anliegenbearbeitung im Unternehmen vor (z.B. für das Contact Center, für den automatisierten Self Service im Internet und gegebenenfalls auch für den Point of Sale) und führt die Anliegenbearbeitung selbst in einem Contact Center innerhalb der Serviceorganisation durch“. Ob und in welcher Form die Serviceorganisation auch die Anliegenbearbeitung im automatisierten Kundenservice durchführt, ist Teil der Analyse und Lösungsfindung dieser Arbeit. Auch werden in der vorliegenden Arbeit „die Begriffe Kundenservice und Serviceorganisation synonym verwendet, da im Sinne der hier verwendeten Definition die Serviceorganisation den Kundenservice von Unternehmen darstellt, den die Kunden als Unterstützung für Anliegen kontaktieren“24.
„Ein Contact Center ist eine wesentliche organisatorische Einheit innerhalb der Serviceorganisation, in dem Mitarbeiter über verschiedene Kommunikationskanäle Kundenanliegen bearbeiten.“25
„Digitaler Kundenservice beschreibt hauptsächlich zunächst einen Einstieg in die Anliegenbearbeitung, die in den meisten Fällen schon eine digitale Komponente oder einen digitalen Automatisierungsanteil hat, z.B. durch eine automatisierte Anliegenqualifizierung mit Hilfe von KI. Das kann in einem kompletten Self Service münden, bei dem der Kunde sein Anliegen eigenständig bearbeitet und löst oder nur bis zu einem gewissen Grad den Lösungsvorgang initiiert. Daher kann auch eine einfache Informationsvergabe über FAQ auf der Unternehmenswebseite per Definition digitaler Kundenservice sein. Es handelt sich um eine Anliegenklärung von einem Menschen (Kunde) zu einer Maschine (Serviceorganisation) (und ggf. in Zukunft sogar um eine Klärung von einer Maschine (Kunde) zu einer Maschine (Serviceorganisation), wenn der Kunde seine Anliegen selbst durch einen Bot klären lässt).“26 Der in der Serviceorganisation für den digitalen Kundenservice zuständige Betriebsteil wird im Verlauf der Arbeit auch als digitale Fabrik bezeichnet.
„Persönlicher Kundenservice beschreibt einen durch Kundenberater assistierten Service, bei dem der Kunde (Mensch) sein Anliegen mit einem Kundenberater (Mensch) persönlich klärt. Das kann initial, also ohne die Nutzung von digitalem Service passieren, z.B. wenn ein Kunde über eine Servicehotline und ohne Vorqualifizierung sofort mit einem Kundenberater spricht, aber auch als Folge einer Interaktion nach vorherigem digitalen Service, z.B. wenn aus dem digitalen Service heraus eine persönliche Klärung mit einem Kundenberater nötig ist.“27 Der in der Serviceorganisation für den persönlichen Kundenservice zuständige Betriebsteil wird im Verlauf der Arbeit auch als assistierte Fabrik bezeichnet.
Hybrider Kundenservice beschreibt die koordinierte und gesteuerte Koexistenz von digitalem und assistiertem Kundenservice mit der Zielsetzung, für den Kunden eine nahtlose Kundenerfahrung zu kreieren, unabhängig von der Wahl des Servicekanals und der Art der Beantwortung des Anliegen, ob durch einen Mensch oder durch eine Maschine. Der in der Serviceorganisation für den hybriden Kundenservice zuständige Betriebsteil wird im Verlauf der Arbeit auch als hybride Fabrik bezeichnet. Diese Definitionen rund um den hybriden Kundenservice sind elementar für diese Forschungsarbeit und sollten bei Bedarf zum Verständnis noch folgender Kapitel erneut hinzugezogen werden.
„Automatisierung bedeutet, dass Anliegen in Form von Geschäftsfällen oder Teilen von Geschäftsfällen automatisiert einer finalen Bearbeitung zugeführt werden. Für digitalen Service kann das sein, wenn ein Kunde im persönlichen Kundenbereich auf der Webseite des Unternehmens seine Stammdaten ändert und das automatisiert (z.B. über Schnittstellen oder Bots) in andere Systeme im Unternehmen übernommen wird. Für persönlichen Service kann das nach Aufnahme durch einen Kundenberater ebenfalls automatisiert in die anderen Systeme übernommen werden. Automatisierungsgrade können variieren, z.B. beim persönlichen Support von keinem Automatisierungsgrad, wenn der Kundenberater allein aus seinem gelernten Wissen eine Lösung präsentiert, bis hin zu einem gesteigerten Automatisierungsgrad, wenn mit Hilfe von KI-Unterstützung Lösungsvorschläge generiert und dem Kundenberater für die Beantwortung des Kundenanliegens angeboten werden.28
1.2 Ausgangslage und thematische Einordnung
Serviceorganisationen sind in ihrer Aufbau- und Ablauforganisation klassisch geprägt durch den persönlichen, kundenberaterassistierten Service.29 In diesem persönlichen Kundenservice gibt es traditionell die produzierenden Einheiten, besetzt mit Mitarbeitern, die für die direkte Bearbeitung der Kundenanliegen zuständig sind. In der Regel bestehen diese aus Kundenberatern, Teamleitern und, bei besonders großen Serviceorganisationen, z.T. darüber hinaus aus Abteilungsleitern. Insgesamt herrscht eine stark produktionsorientierte Organisation vor, die das Ziel hat, telefonische und schriftliche Kundenanliegen zu möglichst geringen Kosten und mit einer guten Qualität in technischer (Lösungsquote) und funktionaler (Art und Weise des Lösungsangebotes) Form zu erbringen. Unterstützt werden diese gegenüber dem Kunden produzierenden Einheiten durch Supporteinheiten, die Aufgaben wie unter anderem Reporting, Qualitätsmanagement, Training, Prozessmanagement oder Personaleinsatzplanung und -steuerung übernehmen, um die Leistungserbringung der produzierenden Mitarbeiter bestmöglich zu organisieren und Hilfestellung zu deren Aufgabenerfüllung zu geben. Diese
Die Serviceorganisation befindet sich seit einigen Jahren im Wandel von der assistierten zur digitalen Fabrik.30 Und dieser Wandel vollzieht sich schnell: Das Marktforschungs- und Analyseinstitut Gartner prognostiziert für 2029, dass ca. 80% der Kundenanliegen völlig automatisiert mit Hilfe von KI, also ohne Zutun durch einen Kundenberater, gelöst werden können.31 Laut einer Studie von Deloitte versuchen bereits heute 61% der Kunden bei einem Anliegen, dieses zunächst selbst zu lösen, z.B. über die Webseite des Unternehmens, und nicht sofort den assistierten Service zu kontaktieren.32 Der zunehmend digitale Kundenservice mit seinen Self Service Möglichkeiten über digitale Kontaktkanäle und zum Teil vollautomatisierten Bearbeitungsvorgängen33 führt zu neuen Herausforderungen für Servicebereiche und ihre Organisationsstrukturen. Um diesen vorausschauend zu begegnen, ist es für Serviceorganisationen wichtig zu verstehen, welche Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von der Ideenfindung über die Projektierung und den Betrieb bis hin zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des digitalen Kundenservice benötigt werden und wie diese in der bisherigen Organisationsstruktur abgebildet werden sollen oder in eine neue, zukunftsorientierte Struktur unter Berücksichtigung des digitalen und des persönlichen Service hineinwachsen können.
Aus der Beobachtung verschiedener Unternehmen im Markt und vielfältigen Gesprächen rund um diese Problemstellung besteht die Annahme, dass die digitale Fabrik in vielen Serviceorganisationen in den letzten Jahren häufig eher zufällig und unkoordiniert entsteht. In den seltensten Fällen wird sie strategisch geplant und zusammen mit der assistierten Fabrik während ihres Entstehens in eine neue, zukunftsfähige Organisationsform mit klaren Verantwortlichkeiten innerhalb des Service modelliert, obwohl das bereits seit einiger Zeit von Marktexperten gefordert wird. So beschreiben beispielsweise Delisi/Poole, dass Self Service als ein langfristiges Element, das kontinuierlich in der Serviceorganisation verwaltet werden muss und nicht als eine Reihe von Einzelprojekten behandelt werden sollte.34 Die digitale Fabrik entwickelt sich jedoch nach wie vor eher wie ein Silo neben der assistierten Fabrik. Ein Blick auf die Entstehung dieser digitalen Silo-Teilorganisation lohnt sich, um die Ursachen des hier angesprochenen Problems besser zu verstehen. Erste Aktivitäten eines digitalen und automatisierten Kundenservice entstehen durch die Bereitstellung digitaler Kontaktkanäle, die den Kunden beispielsweise Self Service Möglichkeiten auf der Webseite, einer App oder über einen Conversational-Bot anbieten.35 Die Lösung für den Kunden wird also nicht mehr von Mitarbeitern gefunden oder prozessiert, sondern auf Basis von vorhandenen Informationen und von automatisierten Prozessen, bei denen die IT-Systeme die Interaktion mit dem Kunden weitestgehend übernehmen. Für die Planung, die Umsetzung, das Testen, die Implementierung und den Betrieb der digitalen Fabrik, wiederum mit der Anforderung an die Findung und Umsetzung kontinuierlicher Optimierungsmöglichkeiten, werden andere Mitarbeiter benötigt, als die assistierte Fabrik mit ihren operativ orientierten Mitarbeitern für diese Zwecke zur Verfügung stellen kann. Auch die vorhandenen Supporteinheiten der assistierten Fabrik bieten häufig nicht die geeigneten fachlichen Kompetenzen dafür an, außer vielleicht in Form von generalistischen Projektmanagern, die neue Themen begleiten und steuern können. Aber fachliches und technisches Wissen in einem neuen, techniklastigen Themenbereich (z.B. bei der Implementierung eines Chatbot oder einer RPA Lösung (Robotics Process Automation) ist trotz einer anhaltenden Entwicklung in diesem Bereich selten in der klassischen Serviceorganisation vorhanden.36 Dieses Knowhow wird daher für die Ideen- und Projektphase häufig über externe Berater, interne Projektmitarbeiter oder die Projekteinheiten der Systemhersteller eingebracht, die den neuen Themenbereich auf Basis der Anforderung des Unternehmens koordinierend konzipieren, entwickeln und testen. Die Rolle der auftraggebenden Kundenserviceorganisation beschränkt sich in diesen Phasen auf den fachlich prozessualen Input und das Projektmanagement in der eigenen Organisation unter Einbindung der Externen. Damit steigt bereits in einer frühen Phase das Risiko, den Grundstein für ein Problem des späteren Betriebes zu legen. Diese Sicht auf eine Unterlassung der Gesamtintegration der beschriebenen technikorientierten Projekte wird sogar in Studien unterstrichen, in denen einzelne Pilotprogramme bei der Technologieeinführung bis hin zu ihrem Ausbau nach der Pilotphase beschrieben werden, jedoch ohne einen Ausblick auf die Integration in die bestehende Serviceorganisation zu geben.37 Die vorausschauende Planung einer Integration oder Empfehlungen für eine spätere Eingliederung in die Organisation wird hingegen nahezu überhaupt nicht thematisiert.
Wer später in der Organisation die digitale Lösung mit Reporting, Monitoring und Analyse betreibt und für die Qualität der digital und automatisiert produzierten Ergebnisse zuständig ist, bleibt in der Projektphase regelmäßig unklar, denn die Umsetzung des Projektes im Rahmen des Projektauftrages steht zunächst im Vordergrund. In vielen Fällen ist es niemand, der in dieser Zeit der Konzeption und initialen Bereitstellung der Lösung dabei war und der Auserwählte für den Betrieb bekommt die Aufgabe zudem noch zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben aufgeladen. Das ist keine gute Voraussetzung, um ein Thema, das neu ist und dessen Akzeptanz erst geschaffen werden muss, größer und zunehmend verlässlicher zu entwickeln. Damit besteht das Risiko, dass das neue Thema von Beginn an potenziell vernachlässigt wird und nicht die Aufmerksamkeit erhält, die ein neuer eingeführter (digitaler) Bearbeitungsprozess erhalten sollte.
Aber selbst wenn von Beginn an ein Mitarbeiter gefunden werden kann, der bereits Experte in dem neuen Themenbereich ist oder sich vor und während des Projektes in das Thema einarbeiten wird, so ist zu klären, ob dieser Mitarbeiter später auch für den digitalen Betrieb des Themas verantwortlich sein wird. Die Beobachtungen in der Praxis zeigen, dass genau das häufig mit diesen Experten passiert. Sie übernehmen nach Einführung im Regelbetrieb die Verantwortung für das Thema und mit jedem Thema aus dem Bereich Digitalisierung und Automatisierung, was hinzukommt und auch von weiteren Mitarbeitern betreut wird, bildet sich langsam aber stetig die digitale Fabrik, die abgekoppelt von der assistierten Fabrik agiert. Im schlimmsten Fall agieren diese zwei Fabriken unabhängig voneinander und verfolgen ihre individuellen Ziele, ohne dass die Interdependenzen untereinander bewusst betrachtet bzw. berücksichtigt werden.
Genau an dieser Stelle entstehen jedoch weitere Probleme. Wer für die übergeordnete Kundenreise eines Kunden zuständig ist, die digital über Self Service beginnt, ein Anliegen lösen zu wollen und dabei möglicherweise nicht erfolgreich ist und an den assistierten Support übergeben werden muss, bleibt unbestimmt. Ebenso wird diese Schnittstelle selten mit einem gezielten Reporting und Monitoring so überwacht, dass man Optimierungen aus den digital nicht lösbaren Anliegen entwickeln kann.38 Auch sind die Kundenberater über die Aktivitäten des Kunden bezüglich seiner digitalen Anliegenlösung nicht oder unzureichend informiert, wenn sie den Kunden in den persönlichen Support übernehmen, so dass der Kunde sein Anliegen und seine bisher unternommenen Schritte bei der Lösungsfindung erneut vortragen muss. All das sind zu definierende Themen, die bei einem jeweiligen Fokus ausschließlich auf die eigene Fabrik (digital oder assistiert) ungelöst bleiben, was dann nicht die Kundenerwartungen erfüllt. Und dass diese Erwartung von Kunden an einen nahtlosen Service zwischen digitaler und assistierter Lösungsstrecke existiert, belegen zahlreiche Studien, in denen das Wiederholen des Anliegens vom Kunden als Ärgernis angesehen wird bzw. dieser erwartet39, dass der Kundenberater bereits über das, was digital passiert ist, (vor)informiert ist.40
Ebenso zeigen Studien, dass die Erwartungshaltung der Kunden bezüglich der Kanalnutzung zunehmend digitale Kontaktkanäle, Selfservice, automatisierte Antworten sowie Bearbeitungen (z.B. von Bots gerade bei jüngeren Kundengruppen) umfasst41, die in den letzten Jahren in ihrer Nutzung stetig zugenommen haben.42 Dabei steht die schnelle Problemlösung im Vordergrund.43 Wenn das Anliegen gelöst wird, ist zu erwarten, dass es für den Kunden nicht so wichtig ist, ob seine Lösung durch einen Kundenberater oder eine Maschine produziert wird. Das bedeutet, dass mit einer positiven Erfahrung auch die Nutzungshäufigkeit von digitalem Service steigen kann. Und das wiederum zeigt, wie wichtig eine klare Strategie auch für den Betrieb von technischen Lösungen nach ihrer Einführung für die Serviceorganisation ist, um mit der richtigen organisatorischen Form und ihrer Einbettung in die Gesamtorganisation mit dem „neuen“ digitalen Betrieb ebenso vergleichbar umzugehen, wie das Management auch bisher in der Steuerung und Weiterentwicklung des assistierten Betriebes umgegangen ist.
Die beschriebene Entwicklung hat große Auswirkungen auf die zukunftsfähige Ausrichtung von Serviceorganisationen. Assistierter Kundenservice und digitaler Kundenservice sollten für ein nahtloses und gesamtheitliches Kundenerlebnis als Einheit geplant und umgesetzt werden. Das verlangt auch nach einer internen Organisation des Servicebereiches, die genau das abbilden kann. Die assistierte Fabrik arbeitet tagtäglich im Regelgeschäft und kämpft mit den alltäglichen operativen Problemen. Daher könnte es empfehlenswert sein, Neuerungen für die digitale Fabrik neben der assistierten Fabrik als Projekte zu entwickeln und einzuführen. Von Anfang an sollte das Zusammenspiel mit der assistierten Fabrik berücksichtigt und geplant werden, denn auch in der digitalen Fabrik sind Themen wie Reporting, Qualitätsverbesserungen, Messungen der Kundenzufriedenheit und Analysen für eine kontinuierliche Verbesserung des digitalen Service wichtig, ebenso wie für den assistierten Service.
Entweder können diese Aufgaben von der bestehenden Supportabteilung erbracht werden, egal ob diese in der Vergangenheit vornehmlich auf den assistierten Support fokussiert war. Dann muss der Support auch die Aufgaben sowohl für die assistierte als auch die digitale Servicestrecke übernehmen und ggf. auch neue oder sich verändernde Rollen vorsehen, wenn es beispielsweise um Wissen oder Wissensgenerierung auf der digitalen Strecke geht, die sich in Form und Inhalt von der für die assistierte Strecke benötigten Unterstützung unterscheiden kann. Diese Aufgabenergänzung bei den existierenden Supporteinheiten erscheint vor allem auch sinnvoll, da perspektivisch durch die zunehmende Digitalisierung die Anzahl der assistieren Kontakte zurückgehen sollte und Kapazitäten im bisher vornehmlich auf den assistierten Service fokussierten Supportteam frei werden. So wäre es möglich, dass die Supportorganisation Inhalte und Ergebnisse sowohl des assistierten als auch des digitalen Service im Blick hat und steuert, mit dem Ziel, eine Serviceerfahrung für den Kunden, egal über welche Kanäle, ohne Friktionen zu ermöglichen.
Eine alternative Möglichkeit könnte darin bestehen, dass die Experten, die ein neues Thema von der Projektierung bis zur Regelbetriebsaufnahme begleiten, sowohl für den Betrieb nach der Projektphase als auch für weitere Optimierungen während des Betriebes in dem neuen Thema verantwortlich sind. Es ist naheliegend, dass sich jemand, der sich beispielsweise von der Idee über ein Projekt bis zur betrieblichen Einführung mit dem Thema Conversational-Bots beschäftigt hat, auch eignet, um das Thema fortwährend zu betreuen und kontinuierliche Verbesserungen auf Basis seines Expertenwissens in dem Bereich zu entwickeln. In diesem Fall ist es jedoch unabdingbar, von der Kundenserviceleitung zu bestimmen, wie in der Serviceorganisation übergreifende Ziele zwischen digitaler und assistierter Fabrik vereinbart, beeinflusst und verteilt werden.
Beide dargestellten möglichen Organisationsalternativen setzen voraus, dass die technische und die fachliche Betriebsverantwortung sowie auch das Thema des kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozesses für digitale Themen klar definiert werden. Für assistierten Kundenservice gibt es drei Verantwortungsstränge, die bedient werden müssen: der fachliche, der ausführende und der technische Verantwortungsstrang. Der fachliche Strang wird weitestgehend durch Supporteinheiten in der Serviceorganisation wahrgenommen, der ausführende an der Kundenschnittstelle von den Kundenberatern und der technische von der IT-Abteilung oder einem kundenserviceinternen IT-Bereich. Der ausführende Strang ist für den Output, also die erzielte Qualität des ausgeführten assistierten Support verantwortlich und damit für das Arbeitsergebnis. Für den digitalen Kundenservice entfällt der ausführende Strang in seiner bekannten Form, denn dieser wird nicht mehr durch Kundenberater sondern durch die Maschine ausgeführt. Es verbleiben also der technische und der fachliche Strang. Beide könnten unter einer gebündelten Verantwortung vereint werden, müssen es aber nicht. Wenn beides durch eine Person (oder mehrere, je nach Größe des Themas) als digitale Fabrik betrieben wird, neben der bereits laufenden assistierten Fabrik, dann wird deutlich, dass es einen, die beiden Fabriken koordinierenden, Überbau geben muss. Werden für den digitalen Service die technische und fachliche Verantwortung getrennt und die bestehenden Supporteinheiten in der Serviceorganisation auch fachlich für ein digitales Thema verantwortlich gemacht, so sind diese nicht mehr nur für die Unterstützung des Betriebes verantwortlich, so wie bei der assistierten Fabrik, sondern auch für die Zielerreichung innerhalb der digitalen Fabrik und damit das Arbeitsergebnis, z.B. bzgl. der KPI, die durch die Leistung des Conversational-Bot erzielt wird und die ggf. zur Verbesserung nötigen Maßnahmen.
Für die Praxis bedeutet das zusammenfassend, dass parallel zu der Einführung von zunehmenden Self Service Möglichkeiten für Kunden durch digitalen Kundenservice auch die organisatorische Einbettung in die operative Aufbau- und Ablauforganisation innerhalb des Service geschaffen werden muss, um auf die Funktionen auch die benötigte Form und Struktur der Serviceorganisation auszurichten. Passiert das nicht, so besteht die Gefahr, dass einmal eingeführte Technologien nicht ausreichend in ihrer Wirkung beobachtet werden und die Verantwortungszuordnung zu Zielen und Ergebnissen fehlt. Digitaler Kundenservice verlangt nach einer Veränderung der Struktur der Serviceorganisation, um assistierte und digitale Fabrik weitestmöglich als Einheit zu denken. Smith et al.44 beschreiben in diesem Zusammenhang, dass diese „Metamorphose“ Agilität, einen vorausschauenden Blick und den Willen für kontinuierliches Lernen und Weiterentwicklung für Serviceorganisationen und deren Verantwortliche voraussetzt. Veränderung ist nicht alleine die Einführung neuer Technologien, sondern das Einnehmen eines „Mindset“, um eine Evolution und Transformation strukturiert zu begleiten.
Veränderungsbedarf in der Serviceorganisation ist hierfür notwendig, denn insbesondere aufgrund der veränderten Art der Serviceerbringung, zunehmend durch Maschinen anstatt vornehmlich durch Kundenberater, stellen sich bisher weitgehend unbekannte Anforderungen an die Projekt- und Betriebsorganisation. Insbesondere werden durch die zunehmende Einführung und Nutzung von KI die Einflüsse auf die Organisation größer und die Gefahr von Unsicherheit und Widerständen aus der Mitarbeiterschaft nimmt zu.45 Aus diesem Grund werden im Folgenden theoretische Überlegungen rund um das Thema Veränderungsmanagement (Change Management) angestellt, da zu vermuten ist, das diese einen wesentlichen Beitrag zur Strukturierung der später zu entwickelnden Handlungsempfehlungen leisten können.
1.3 Theoretische Einordnung
Jede Veränderung in Unternehmen ist ein Prozess des Übergangs von einem gegenwärtigen zu einem zukünftigen Punkt, der strukturiert begleitet werden sollte. Das Change Management, auch Veränderungsmanagement, beschreibt nach Schewe die „laufende Anpassung von Unternehmensstrategien und -strukturen an veränderte Rahmenbedingungen. Wandel repräsentiert heute in Unternehmen nicht mehr den Sondervorgang, sondern eine häufig auftretende Regelerscheinung. Alle Prozesse der globalen Veränderung, sei es durch Revolution oder durch geplante Evolution, fallen in das Aufgabengebiet des Change Managements.“46 Auch Moran/Brightman definieren Change Management in ähnlicher Form als „…den Prozess der kontinuierlichen Erneuerung der Ausrichtung, der Struktur und der Fähigkeiten einer Organisation, um die sich ständig ändernden Bedürfnisse der externen und internen Kunden zu erfüllen.“47
Nach diesen Definitionen lassen sich unter Change Management sämtliche Aufgaben, Maßnahmen und Tätigkeiten zusammenfassen, die eine umfassende, bereichsübergreifende und inhaltlich weitreichende Veränderung zur Umsetzung neuer Strategien, Strukturen, Systeme, Prozesse oder Verhaltensweisen in einer Organisation bewirken sollen. Veränderungsmanagement ist ein Prozess, der verschiedene Schritte und Instrumente umfasst, die darauf abzielen, die Umsetzung von Veränderungen strukturiert und reibungslos zu gestalten. Damit berücksichtigt das Change Management sowohl den technischen als auch den wichtigen menschlichen Aspekt der Veränderung. Eine erfolgreiche Veränderungsinitiative im Unternehmen wird von den Mitarbeitern getragen und unterstützt. Das Veränderungsmanagement hilft, Organisationen und deren Mitarbeiter in diesem Prozess zu begleiten.
Für die Anwendung des Veränderungsmanagements in der Praxis wurden spezielle theoretische Rahmenwerke und Methoden entwickelt. Sie können als Veränderungsmanagementmodelle bezeichnet werden. Da sich das Entwicklungstempo beschleunigt und sich damit das Geschäftsumfeld häufig ändert, benötigen die Unternehmen zunehmend umfassendere Fähigkeiten für das Veränderungsmanagement.48 Bestehende Change-Management-Modelle sollen Managern einen Leitfaden an die Hand geben, wie sie eine Change-Management-Strategie aufbauen und welche Fähigkeiten sie entwickeln sollten, um den Wandel optimal umzusetzen. Im Folgenden sollen zwei grundlegende und für die Change Management Theorie fundamentale Sichtweisen vorgestellt werden, jeweils aus den zwei Ansätzen in die derartige Modelle eingeordnet werden können, dem geplanten und dem emergenten Ansatz.
Der geplante Ansatz für Veränderungen wurde 1947 von Lewin49 entwickelt. Lewin beschrieb, dass vor einer Veränderung und einem neuen Verhalten, also bevor ein neues Verhalten erfolgreich angenommen werden kann, das vorherige Verhalten verworfen werden muss. Nach Lewin muss ein erfolgreiches Veränderungsprojekt daher drei Schritte durchlaufen50:
• Das Auftauen der gegenwärtigen Situation,
• der Übergang zu einer neuen Phase,
• das Einfrieren der neuen Situation.
Das Auftauen kann als die Ausgangssituation eines Unternehmens verstanden werden, in der eine gewisse Trägheit in der Organisation und unter den Mitarbeitern herrscht. Gründe können beispielsweise sein, dass der Mensch aus Gewohnheit Veränderungen nicht immer aufgeschlossen gegenübersteht, dass Veränderungen oftmals mühsam und mit Kosten verbunden sind und auch, wenn eine starke Unternehmenskultur vorhanden ist. Das kann dazu führen, dass sich Organisationen und deren Entscheidungsträger zu spät mit dem notwendigen Wandel auseinandersetzen.
Der Übergang ist der Veränderungsprozess selbst. Wenn dieser initiiert wurde kommt es oft zur Orientierungslosigkeit und zu Widerständen gegen den Wandel, deren Überwindung für einen erfolgreichen Change Management Prozess allerdings wichtig ist.
Das Einfrieren entspricht dem definierten Ziel. Wenn die Widerstände erfolgreich überwunden wurden, entsteht häufig das Problem, dass es in der Organisation und damit den Mitarbeitern an Orientierung im Hinblick auf das verfolgte Ziel fehlt.
Dieses Modell des Wandels beschreibt die Notwendigkeit, dass alte Verhaltensweisen, Strukturen, Prozesse und die Kultur zu verwerfen sind, bevor neue Ansätze erfolgreich eingeführt werden können. Auch wenn dieses dreistufige Modell als allgemeiner Rahmen für das Verständnis des Prozesses des organisatorischen Wandels angenommen wurde, ist es doch recht weit gefasst. Mehrere Autoren haben daher Lewins Arbeit weiterentwickelt, und versucht, es praktischer zu gestalten.51
Kritisch an Lewins Modell kann gesehen werden, dass das Modell die Wirklichkeit nur eindimensional und auf das Unternehmen selbst ausgerichtet betrachtet, während externe Faktoren aus der Unternehmensumwelt weitgehend unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren wird der Wandel selbst nicht als stetiger und dynamischer Prozess betrachtet, sondern eher als statische Periode, die zwischen zwei Phasen des Gleichgewichtes stattfindet.
Als Reaktion auf diese Kritik am geplanten Ansatz des organisatorischen Wandels hat der emergente Ansatz von Change Management an Relevanz gewonnen. Emergente Veränderungen werden als unvorhersehbar und oft unbeabsichtigt beschrieben, sie können von überall her entstehen und beinhalten eine relativ informelle Selbstorganisation.52 Der Wandel entsteht gleichzeitig mit der Organisation der Arbeit durch die Akteure in den gegebenen Strukturen, und er beinhaltet die Verbesserung der bestehenden Rahmenbedingungen im organisatorischen Umfeld. Die meisten Organisationen bewegen sich heute in einer Situation von Instabilität und Stabilität, die beide miteinander verwoben sind und sich nur schwer voneinander trennen lassen. Auch das Veränderungsmanagement muss sich fortwährend aktualisieren, das der Prozess des Veränderungsmanagements als kontinuierliche Erneuerung der Ziele, Strukturen, Ressourcen und Kompetenzen einer Organisation verstanden wird, die Effizienz ihrer Aktivitäten zu verbessern und die Bedürfnisse und Erwartungen insbesondere von Kunden besser zu erfüllen.53 In der Realität sehen sich die Unternehmen einer relativ großen und noch wachsenden Unsicherheit ausgesetzt, die sowohl von außen als auch von innen auf die Organisation zukommt. Die Technologie (insbesondere Informations- und Kommunikationstechnologie) ist ein besonderer Katalysator für Veränderungen in der Organisation, Ihre Wachstumsdynamik und die rasche Verbreitung üben einen großen Druck auf die Organisation aus, um Veränderungen einzuführen, um mit den Anforderungen des Wettbewerbsumfelds Schritt zu halten sowie Erwartungen und Vorlieben der Kunden zu erfüllen.54 Diese Ungewissheit des Umfelds führt beim emergenten Ansatz zu der Sichtweise, dass geplante Veränderungen unwichtiger und emergente Veränderungen wichtiger werden. Organisationen sind von ihrer Umwelt getrennt, aber mit ihr verbunden. Inwieweit die Umwelt Veränderungen innerhalb einer Organisation treibt und inwieweit die Organisation die Kontrolle über die eigenen Veränderungsprozesse selbst innehat, ist eine entscheidende Frage.55 Dahinter steht die Überlegung, dass das Tempo des Wandels so schnell und komplex ist, dass es für die oberste Leitung einer Organisation unmöglich ist, alle erforderlichen Maßnahmen zu ermitteln, zu planen und umzusetzen. Die Verantwortung für Wandel ist daher stärker dezentralisiert und erfordert infolgedessen große Veränderungen in der Rolle der Unternehmensleitung. Als natürliche Systeme müssen Organisationen lernen, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, da zu viel Stabilität und Kontrolle dazu führt, dass die Organisation nicht mehr auf ihre Umwelt reagiert und sich zurückentwickelt. Ungleichgewichte werden eine notwendige Bedingung für das Wachstum dynamischer Systeme und so wird der Wandel dann zunehmend konzeptualisiert als kontinuierlich und emergent.56
Anstatt den Wandel von oben nach unten zu steuern, tendiert der emergente Ansatz dazu, den Wandel von unten nach oben zu unterstützen. Der emergente Ansatz zum Wandel betont, dass der Wandel nicht als eine Reihe von linearen Ereignissen innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu sehen ist, sondern als kontinuierlicher, ergebnisoffener Prozess der Anpassung an sich verändernde Umstände und Bedingungen. Der emergente Ansatz unterstreicht den unvorhersehbaren Charakter des Wandels und betrachtet ihn als einen Prozess, der sich durch die Beziehung einer Vielzahl von Variablen innerhalb einer Organisation entwickelt. Er kann nicht nur als eine Methode zur Veränderung organisatorischer Praktiken und Strukturen verstanden werden, sondern auch als ein Prozess des Lernens.57 Nach Ansicht der Befürworter des emergenten Ansatzes für den Wandel ist es die Ungewissheit des externen und internen Umfelds, die diesen Ansatz sachdienlicher erscheinen lässt als der geplante Ansatz des Veränderungsmanagements. Um mit der Komplexität und Ungewissheit des Umfelds fertig zu werden, müssen Organisationen zu offenen, lernenden Systemen werden, in denen Strategieentwicklung und -änderung aus der Art und Weise hervorgehen, wie ein Unternehmen als Ganzes Informationen über die Umwelt erwirbt, interpretiert und verarbeitet. Erfolgreiche Veränderung hängt dann weniger von detaillierten Plänen und Projektionen ab, sondern vielmehr vom Verständnis für die Komplexität der betreffenden Fragen und die Ermittlung der Bandbreite der verfügbaren Optionen. Es kann daher angenommen werden, dass der emergente Ansatz für den Wandel mehr auf die Bereitschaft zum Wandel abzielt, als um die Bereitstellung spezifischer, im Voraus geplanter Schritte für jedes Veränderungsprojekt.58 Somit ist Wandel ein kontinuierlicher Prozess mit offenem, unvorhersehbarem Ausgang, bei dem Organisationen proaktiv auf Umweltreize reagieren. Traditionelle und geplante Veränderungsbemühungen konzentrieren sich oft auf die Verringerung restriktiver Umweltkräfte und deren Behebung - emergente Veränderungsbemühungen verfolgen einen anderen Ansatz und konzentrieren sich auf die Identifizierung der förderlichen Kräfte und deren Verbesserung.59 In diesem Sinne wird der Wandel als von unten nach oben und nicht von oben nach unten kommend konzipiert.60
Liebhart und Lorenzo versuchen, die Gegensätzlichkeiten der Ansätze zu kombinieren und sehen darin Vorteile sowohl für die Theorie als auch die Praxis, da die Unwägbarkeiten eines Change Prozesses auch bei einem strukturierten sequentiellen Vorgehen erkannt und berücksichtigt werden.61
Eines der bedeutendsten und bei Praktikern beliebten Modelle für Veränderungsmanagement, stammt von John P. Kotter. Sein Modell wurde erstmals 1995 in einem Artikel in der Harvard Business Review veröffentlicht.62 Im darauf folgenden Jahr wurde es ausführlicher in dem Buch mit dem Titel Leading Change veröffentlicht.63 Sowohl der Artikel von Kotter (1995) als auch das Buch von 1996 basierten auf seinen persönlichen Geschäfts- und Forschungserfahrungen und bezogen sich nicht auf externe Quellen. Dies war untypisch für eine akademische Arbeit und führte zu der Notwendigkeit, die vorliegende Thesen über einen längeren Zeitraum zu testen. Kotters Modell des Veränderungsmanagements wurde schnell ein Erfolg und es ist bis heute eine wichtige Referenz auf dem Gebiet des Veränderungsmanagements.64
Das Modell von Kotter beschreibt den Veränderungsprozess in 8 Schritten. Bekmukhambetova schlägt vor, die 8 Schritte des Kotter-Modells in 3 größere Phasen zu gliedern65, die anschaulich zusammenfassen, was bei einem Changeprozess zu beachten ist:
• Phase 1: Einbindung und Befähigung der Organisation (Schritte 1 bis 3)
• Phase 2: Schaffung der Voraussetzungen für den Wandel (Schritte 4 bis 6)
• Phase 3: Umsetzung und Erfolg des Wandels (Schritte 7 bis 8).
Phase 1: Einbindung und Befähigung der Organisation
Schritt 1: Schaffung eines Gefühls der Dringlichkeit





























