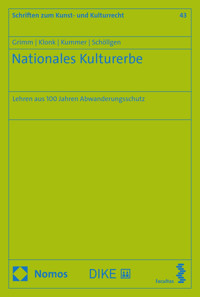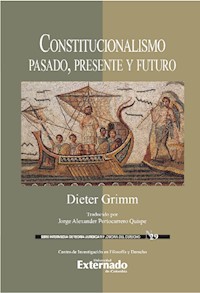21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Verfassung ist am Ende des 20. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung angekommen. Der Konstitutionalismus hat sich weltweit durchgesetzt, es gibt heute kaum noch Staaten ohne Verfassung. Gleichzeitig sieht sich die Verfassung mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die bei ihrer Entstehung noch nicht vorhersehbar waren. Während die inneren Erosionen Gegenstand des 1991 erschienenen Buches Die Zukunft der Verfassung waren, haben sich neuerdings die äußeren, die ihre Ursache in der Europäisierung und Globalisierung haben, in den Vordergrund geschoben. Öffentliche Gewalt wird nicht mehr nur von Staaten, sondern auch von internationalen Organisationen ausgeübt. Was bleibt unter diesen Umständen von der Staatsverfassung? Lassen sich Verfassungen auf internationaler Ebene denken? Das sind die Fragen, die in diesem Band erörtert werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Die Verfassung ist am Ende des 20. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung angekommen. Der Konstitutionalismus hat sich weltweit durchgesetzt, es gibt heute kaum noch Staaten ohne Verfassung. Gleichzeitig sieht sich die Verfassung mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die bei ihrer Entstehung noch nicht vorhersehbar waren. Während die inneren Erosionen Gegenstand des 1991 erschienenen Buches Die Zukunft der Verfassung waren, haben sich neuerdings die äußeren, die ihre Ursache in der Europäisierung und Globalisierung haben, in den Vordergrund geschoben. Öffentliche Gewalt wird nicht mehr nur von Staaten, sondern auch von internationalen Organisationen ausgeübt. Was bleibt unter diesen Umständen von der Staatsverfassung? Lassen sich Verfassungen auf internationaler Ebene denken? Das sind die Fragen, die in diesem Band erörtert werden.
Dieter Grimm war von 1987 bis 1999 Richter des Bundesverfassungsgerichts. Er lehrt Öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Yale Law School. Er ist Permanent Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin, dessen Rektor er von 2001 bis 2007 war. Im Suhrkamp Verlag sind zuletzt von ihm erschienen: Deutsche Verfassungsgeschichte (es 1271), Recht und Staat der bürgerlichen Gesellschaft (st 1358) und Die Zukunft der Verfassung (stw 968).
Dieter Grimm
Die Zukunft der Verfassung II
Auswirkungen von Europäisierung und Globalisierung
Suhrkamp
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-518-77270-6
www.suhrkamp.de
5Inhalt
Vorwort
I. ÜBERBLICK
1. Ursprung und Wandel der Verfassung
II. WAS BLEIBT VON DER STAATSVERFASSUNG?
2. Die Verfassung im Prozess der Entstaatlichung
3. Die Bedeutung nationaler Verfassungen in einem vereinten Europa
4. Zur Rolle der nationalen Verfassungsgerichte in der europäischen Demokratie
5. Das Grundgesetz als Riegel vor einer Verstaatlichung der Europäischen Union. Zum Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts
6. Von Lissabon zu Mangold
7. Die Zukunft des Staatsrechts
III. WAS KANN VERFASSUNG JENSEITS DESSTAATES BEDEUTEN?
8. Entwicklung und Funktion des Verfassungsbegriffs
9. Europas Verfassung
10. Integration durch Verfassung?
11. Über einige Asymmetrien der europäischen Integration
12. Wer ist souverän in der Europäischen Union?
13. Gesellschaftlicher Konstitutionalismus – eine Kompensation für den Bedeutungsschwund der Staatsverfassung?
IV. AUSBLICK
14. Die Errungenschaft des Konstitutionalismus und ihre Aussichten in einer veränderten Welt
6Nachweise
Sachregister
7Vorwort
So reich an Rückschlägen das 20. Jahrhundert für den Konstitutionalismus war, so glänzend hat er sich doch am Ende behauptet. Der Verfassungsstaat ist heute eine universal anerkannte Errungenschaft. Das bedeutet zwar nicht, dass die Verfassung überall ernst genommen wird. Aber selbst Regime, die nicht gewillt sind, ihr Verfassungsrecht unbedingt zu respektieren, möchten zumindest den Anschein erwecken, Verfassungsstaaten zu sein.
Während eine Reihe ehemals diktatorisch regierter Staaten jedoch noch dabei ist, ihre Verfassungskultur zu festigen, machen sich in vielen älteren Verfassungsstaaten Erosionserscheinungen des Konstitutionalismus bemerkbar, die ihren Grund nicht in Missachtungen der Verfassung haben, sondern in strukturellen Problemen. Insbesondere ist es der Wandel der Staatlichkeit, der die Geltungskraft der Verfassung schwächt.
Auf dieses Problem wollte ich in dem Buch Die Zukunft der Verfassung aufmerksam machen, das erstmals 1991 in dieser Reihe erschien und 2002 seine dritte Auflage erlebte. Als es erschien, war allerdings nur die innere Dimension des Problems sichtbar. Die Erosionstendenzen, die der Verfassung von außen durch Europäisierung und Globalisierung drohten, hatten zwar schon eingesetzt, aber noch keine Aufmerksamkeit gefunden.
Mittlerweile sind sie unübersehbar. Öffentliche Gewalt ist nicht mehr identisch mit Staatsgewalt. Infolgedessen kann auch die Staatsverfassung ihren Anspruch, die in ihrem Geltungsbereich ausgeübte öffentliche Gewalt umfassend zu regeln, nicht mehr einlösen. Was bleibt von ihr übrig? Gleichzeitig erhebt sich die Frage, ob die Errungenschaft des Konstitutionalismus auf die internationale Ebene gehoben werden kann.
Um diese beiden Fragen geht es in dem neuen Band, der denjenigen aus dem Jahr 1991 um die Außendimension ergänzt und deswegen kurzerhand den Titel Die Zukunft der Verfassung II erhalten hat. Der einleitende Beitrag schlägt die Brücke zwischen den beiden Bänden. Die folgenden Beiträge aus den Jahren 2004 bis 2012 (die Mehrzahl aus den letzten drei Jahren) nehmen die beiden Leitfragen auf.
8Zwischen diesen verläuft allerdings keine scharfe Trennlinie. Sie hängen zusammen und können deshalb nicht unabhängig voneinander beantwortet werden. Trifft es zu, dass der Bedeutungsverlust der nationalen Verfassungen auf die Entstehung einer internationalen öffentlichen Gewalt zurückgeht, liegt die Frage nahe, ob er sich dadurch kompensieren lässt, dass diese ihrerseits konstitutionalisiert wird.
Insbesondere hinsichtlich der zweiten Frage fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus. Viele Autoren zweifeln nicht an der Möglichkeit eines internationalen Konstitutionalismus. Häufig gehen sie jedoch von einem stark verdünnten Verfassungsbegriff aus. Demgegenüber wird hier auf der Differenz zwischen Verrechtlichung von öffentlicher Gewalt und Konstitutionalisierung beharrt und die Kompensationshoffnung entsprechend gedämpft.
Berlin, im Februar 2012
Dieter Grimm
9I. Überblick
111. Ursprung und Wandel der Verfassung
A. Entstehung der Verfassung
I. Die rechtliche Verfassung als Novum
Jede politische Einheit ist in einer Verfassung. Aber nicht jede hat eine Verfassung. Der Begriff »Verfassung« deckt beide Zustände.[1] Dennoch sind sie nicht deckungsgleich. Der Begriff besitzt zwei unterschiedliche Bedeutungen. »Verfassung« in dem ersten Sinn des Wortes bezeichnet die Beschaffenheit eines Landes bezogen auf seine politischen Verhältnisse. »Verfassung« in dem zweiten Sinn bezeichnet ein Gesetz, das die Einrichtung und Ausübung der politischen Herrschaft zum Gegenstand hat. Folglich handelt es sich bei dem ersten Verfassungsbegriff um einen empirischen oder deskriptiven, bei dem zweiten um einen normativen oder präskriptiven. Empirisch verwendet, gibt »Verfassung« Auskunft darüber, welche politischen Verhältnisse zu einer gegebenen Zeit in einem bestimmten Gebiet de facto herrschen. Normativ verwendet, legt »Verfassung« die Regeln fest, denen politische Herrschaft in einem Gebiet de jure gehorchen soll.
Während es Verfassungen im empirischen Sinn von jeher gibt, ist die Verfassung im normativen Sinn eine relativ junge Erscheinung. Sie entstand ausgangs des 18. Jahrhunderts im Zuge der amerikanischen und der Französischen Revolution und hat sich im Verlauf von 200 Jahren weltweit ausgebreitet. Damit soll nicht gesagt sein, dass es vor der Entstehung der normativen Verfassung keine rechtlichen Regeln gegeben hätte, die auf die politische Herrschaft bezogen waren und die Inhaber von Herrschaftsfunktionen banden. Nicht jede derartige Regel ist aber schon Verfassung im Sinn der Regelwerke, die mit den Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts aufkamen und bis heute begriffsprägend geblieben sind. Zwischen Verrechtlichung und Konstitutionalisierung muss vielmehr unterschieden werden. Die Konstitution stellt eine bestimmte Form der Verrechtlichung politischer Herrschaft dar, die an historische 12Bedingungen geknüpft ist, welche nicht immer vorlagen und im Lauf der Entwicklung auch wieder entfallen können.[2]
Über lange Zeit fehlte es für ein Gesetz, das auf die Normierung politischer Herrschaft spezialisiert ist, bereits am Regelungsgegenstand. Bevor sich die Gesellschaft nicht funktional differenziert hatte, besaß sie auch kein System, das sich unter Ausschluss anderer Systeme auf die Ausübung politischer Herrschaft spezialisierte.[3] Herrschaftsaufgaben waren vielmehr räumlich, gegenständlich und funktional auf zahlreiche voneinander unabhängige Träger verteilt. Geschlossene Herrschaftsverbände konnten sich auf diese Weise nicht bilden. Herrschaftsbefugnisse bezogen sich nicht primär auf Territorien, sondern auf Personen. Die Träger dieser Befugnisse übten sie nicht als selbständige Funktion, sondern als Annex eines bestimmten Status als Familienoberhaupt, Standes- oder Korporationsmitglied oder Grundeigentümer aus. Was heute als privat und öffentlich auseinandergehalten wird, befand sich unter diesen Umständen noch in einer Gemengelage, die auch kein eigenständiges öffentliches Recht zuließ.[4]
Das bedeutet nicht, dass die Herrschaftsbefugnisse rechtlich ungeregelt gewesen wären. Sie unterlagen im Gegenteil einem engen Geflecht rechtlicher Bindungen, die großenteils traditionell galten und häufig auf göttliche Stiftung zurückgeführt wurden. Deswegen gingen sie dem gesetzten Recht nicht nur im Rang vor, sondern durften von diesem auch nicht abgeändert werden. Gleichwohl bildeten diese Regeln keine Verfassung im Sinn eines besonderen, auf die Einrichtung und Ausübung von politischer Herrschaft spe13zialisierten Gesetzes. So wie Herrschaftsbefugnisse regelmäßig ein unselbständiger Annex anderer Rechtspositionen waren, wurden sie auch von dem einheitlichen Recht lediglich mitgeregelt. Die zahlreichen Untersuchungen, die der »Verfassung« in der Antike oder im Mittelalter gewidmet sind,[5] verlieren dadurch keineswegs ihre Berechtigung. Man darf diese »Verfassungen« nur nicht mit dem aufgrund einer politischen Entscheidung in Kraft gesetzten normativen Text mit herrschaftsregulierendem Anspruch verwechseln, der ein innovatives Produkt der Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts ist.
Ein konstitutionsfähiger Gegenstand entstand erst, als der mittelalterlichen Ordnung durch die Glaubensspaltung die Grundlage entzogen war und sich im Zug der konfessionellen Bürgerkriege des 16. und 17. Jahrhunderts auf dem Kontinent eine neue Form der politischen Herrschaft herausbildete. Sie beruhte auf der Überzeugung, dass der Bürgerkrieg nur durch eine überlegene Gewalt beigelegt werden konnte, die sowohl die Befugnis als auch die Macht besaß, eine neue, von der umstrittenen religiösen Wahrheit unabhängige Ordnung zu stiften und durchzusetzen und auf dieser Basis den Frieden wiederherzustellen. Von dieser Überzeugung geleitet, unternahmen es die Fürsten, beginnend in Frankreich, die zahlreichen zerstreuten Herrschaftsbefugnisse in ihrer Hand zu vereinigen und zur umfassenden, auf ein Territorium bezogenen öffentlichen Gewalt zu verdichten. Sie schloss auch das Recht zur Rechtsetzung ein, ohne dass dieses noch von einem höherrangigen, auf Gott zurückgehenden Recht begrenzt wurde. Was ehedem Rechtsgebot gewesen war, zog sich nunmehr in die Moral zurück, der aber die rechtliche Verpflichtungskraft gerade fehlte.
Für das neue Phänomen bürgerten sich alsbald neue Begriffe ein: für den Herrschaftsverband der des Staates, für seine Machtvollkommenheit der der Souveränität.[6] Seine primäre Bedeutung war nicht die äußere Unabhängigkeit, sondern die innere, die in dem 14Recht des Fürsten Ausdruck fand, für alle anderen Recht zu setzen, ohne dabei selber rechtlichen Bindungen zu unterliegen.[7] Die Herausbildung von Staat und Souveränität war freilich nicht Ereignis, sondern Prozess, der in verschiedenen Gebieten Kontinentaleuropas zu unterschiedlichen Zeiten einsetzte, in unterschiedlichen Formen und Geschwindigkeiten verlief und unterschiedliche Ergebnisse hervorbrachte, aber nirgends zum Abschluss kam. Überall behaupteten sich vielmehr intermediäre Gewalten, die dem Herrscher den Alleinbesitz der öffentlichen Gewalt streitig machten. Insbesondere ließ der absolute Staat, auch wenn es ihm gelang, die politische Mitsprache der Stände zu beseitigen, die ständische Gesellschaftsordnung und damit das grundherrlich-bäuerliche Verhältnis bestehen, durch welches die Staatsgewalt nicht hindurchgriff.
Dessen ungeachtet bestand in dem modernen Staat mit seiner Machtfülle, die sich zunehmend auf ein von der Lehensfolge unabhängiges Heer, eine eigene Beamtenschaft sowie eigene, nicht auf ständische Bewilligung angewiesene Einnahmen stützen konnte, nunmehr ein Gebilde, das Gegenstand eines einheitlichen rechtlichen Zugriffs werden konnte. Wenn die Epoche gleichwohl keine Verfassung im modernen Sinn hervorbrachte, so liegt dies daran, dass der Staat aus den angegebenen Gründen in Gestalt des absoluten Fürstenstaats entstand. Träger aller Machtbefugnisse war der Monarch, der sie aus eigenem Recht beanspruchte und sich bei ihrer Ausübung keiner rechtlichen Beschränkung unterworfen sah. Zwar fehlte es jetzt nicht mehr an einem konstitutionsfähigen Gegenstand. Es bestand aber kein Konstitutionsbedürfnis: Absolute Herrschaft ist gerade durch die Ablehnung rechtlicher Bindungen charakterisiert.
Anspruch und Wirklichkeit klafften allerdings auch insoweit auseinander. Die entstehende Fürstenmacht weckte schon bald das Bedürfnis nach rechtlichen Schranken. Bei günstiger Gelegenheit herrscherlicher Abwesenheit oder Schwäche schlug es sich vielfach in so genannten Regierungsformen nieder, Regelwerken, die die ständischen Rechte gegenüber der fürstlichen Gewalt sichern sollten. Wenngleich sich diese Regierungsformen gegen die staatsbildenden Kräfte nur selten zu behaupten vermochten,[8] übernahmen doch nach und nach so genannte Fundamentalgesetze, Herrschafts15verträge oder Wahlkapitulationen deren Funktion.[9] In der Regel vertraglich begründet, konnten sie vom Herrscher nicht einseitig aufgekündigt werden. Insofern gingen sie dem von ihm gesetzten Recht vor. Gleichwohl darf man auch sie nicht mit Verfassungen verwechseln. Sie ließen die tradierte Herrschaftsbefugnis des Fürsten unberührt und zwangen ihm lediglich einzelne Herrschaftsverzichte zugunsten der Vertragspartner ab. Auch die Hierarchisierung von Rechtsnormen ergibt noch keine Konstitutionalisierung.
Dementsprechend verdankt die moderne normative Verfassung ihre Entstehung nicht einer organischen Fortentwicklung dieser älteren Ansätze. Es war vielmehr erst der revolutionäre Bruch von 1776 und 1789, der dem Dauerproblem der rechtlichen Bindung politischer Herrschaft zu seiner bis heute gültigen Lösung verhalf. Die Trennung vom Mutterland in Amerika und der Sturz der absoluten Monarchie in Frankreich hinterließen ein Vakuum legitimer Herrschaft, das nach Ausfüllung verlangte. Dass dazu eine Verfassung für notwendig gehalten wurde, ist durch den revolutionären Bruch allein freilich nicht hinreichend erklärt. Wie zahlreiche gewaltsame Umbrüche, die diesen Revolutionen vorausgegangen waren, hätten sie sich in der Ersetzung des gestürzten Herrschers durch einen anderen erschöpfen können. Selbst wenn bei dieser Gelegenheit Bedingungen, unter denen eine neue Person oder Dynastie zur Herrschaft berufen wurde, formuliert worden wären, hätte der Umsturz damit noch nicht notwendig zum Konstitutionalismus geführt.
16Das bestätigt der englische Fall. Die englische Revolution des 17. Jahrhunderts hatte – obwohl es hier ebenfalls zum Bruch mit der angestammten Herrschaft kam – nicht die Verfassung zur Folge. In der englischen Revolution vereinigten sich Adel und Bürgertum im Widerstand gegen die Stuart-Dynastie, als diese ihre Herrschaft nach dem kontinentalen Vorbild auszuweiten trachtete, ohne sich auf die Gründe berufen zu können, die diese Ausweitung auf dem Kontinent gerechtfertigt hatten. Die Glorious Revolution zielte daher nicht auf die Veränderung, sondern auf die Verteidigung der bestehenden Ordnung. Dementsprechend führte sie keinen Wechsel des Herrschaftssystems, sondern nur einen Wechsel der Dynastie herbei, und das normative Dokument, das diesen Übergang begleitete, die Bill of Rights von 1689, war ein Vertrag zwischen dem Parlament und dem neuen Monarchen, in dem die alten Rechte bekräftigt wurden.[10] Nur für jenen kurzen Moment, als Cromwell die Monarchie abgeschafft hatte, kam es 1653 zur Oktroyierung einer Verfassung im modernen Sinn,[11] die aber nach seinem Tod durch die Restauration der früheren Verhältnisse obsolet wurde.
II. Die Entstehungsbedingungen der Verfassung
Wenn es mehr als 100 Jahre danach in den beiden großen Revolutionen des 18. Jahrhunderts zur Verfassung als bleibender Errungenschaft kam, so waren dafür vor allem zwei Umstände ausschlaggebend. Zum einen beschränkte sich das Missfallen der amerikanischen und französischen Revolutionäre nicht auf die Person des Herrschers, sondern erstreckte sich auf das Herrschaftssystem. Im Ausmaß wichen die beiden Länder freilich stark voneinander ab.[12] Anders als die französische Monarchie hatte sich die englische, der die Kolonien unterstanden, nicht zu einer abso17luten entwickelt. Das Parlament erfreute sich im Gegenteil einer steigenden Bedeutung. Überdies waren die Standesgrenzen durchlässig geworden und die feudalen und zünftischen Bindungen der Wirtschaft großenteils entfallen. England galt als das freiheitlichste Land der damaligen Welt, und selbst die Reste der älteren Ordnung hatten nicht den Weg in die amerikanischen Kolonien gefunden. Den Kolonisten ging es unter diesen Umständen nicht um ein besseres Recht, sondern um bessere Sicherung der Rechte, die ihnen vom englischen Parlament vorenthalten wurden, in das sie keine Vertreter entsenden konnten, und erst die Weigerung des Mutterlandes trieb sie zur Erklärung der Unabhängigkeit.
Frankreich besaß demgegenüber nicht nur einen besonders ausgeprägten Absolutismus. Vielmehr waren auch die physiokratisch inspirierten Anläufe zur Modernisierung der Wirtschaftsordnung gescheitert. Je mehr das Feudalsystem an innerer Berechtigung verlor, desto schärfer wurde es gegen Auflösungstendenzen und Kritik verteidigt. Andererseits hatte sich in Frankreich, großenteils durch die Bedürfnisse der absoluten Monarchie gefördert, neben dem traditionellen Bürgertum der zünftigen Handwerker ein neues Bildungs- und Wirtschaftsbürgertum entwickelt, das in der herrschenden Rechts- und Sozialordnung keinen seiner gesellschaftlichen Bedeutung und ökonomischen Stärke entsprechenden Platz fand. Durch die überkommene Rechtsordnung wurde es auch an der Entfaltung seines wirtschaftlichen Potenzials gehindert. Die Französische Revolution erschöpfte sich daher nicht wie die amerikanische in einer Änderung der politischen Verhältnisse. Sie zielte weiter auf die Abschaffung der ständisch-feudalen Gesellschaftsordnung, die im Rahmen der bestehenden politischen Ordnung nicht erreichbar gewesen war.
Zum anderen konnten sich die revolutionären Kräfte auf Vorstellungen von einer gerechten Ordnung berufen, die eine Umwandlung in geltendes Recht geradezu herausforderten. Diese Vorstellungen hatten bereits vor den Revolutionen Gestalt gewonnen und wurden durch sie nunmehr handlungsleitend. Nachdem die Glaubensspaltung der transzendentalen Legitimation politischer Herrschaft die Grundlage entzogen hatte, waren anstelle der göttlichen Offenbarung naturrechtliche Vertragstheorien getreten.[13] Um 18zu ermitteln, wie sich Herrschaft von Menschen über Menschen rechtfertigen ließe, versetzte sich die Sozialphilosophie der Zeit in einen gedachten herrschaftslosen Zustand, in dem alle per definitionem gleich und frei waren. Herrschaft konnte unter dieser Voraussetzung nur durch freiwillige Übereinkunft aller zustande kommen. Wie immer diese Übereinkunft inhaltlich aussah, stand damit jedenfalls fest, dass das Legitimationsprinzip politischer Herrschaft die Zustimmungsfähigkeit seitens der Herrschaftsunterworfenen war, und die verbleibende Frage lautete, wie die Herrschaft beschaffen sein musste, damit ihr vernunftbegabte Wesen zustimmen konnten.
Den Grund für die Bereitschaft, die natürliche Freiheit und Gleichheit gegen den Herrschaftszustand einzutauschen, erblickten die Vertragstheoretiker in der fundamentalen Unsicherheit der Freiheit im Naturzustand. Die Einrichtung einer organisierten Zwangsgewalt war daher vernunftgeboten. Entscheidend für das Herrschaftssystem wurde dann freilich die Frage, in welchem Maß der Einzelne seine natürlichen Rechte preisgeben musste, um in den Genuss der vom Staat gewährleisteten Sicherheit zu kommen. Unter dem Eindruck der konfessionellen Bürgerkriege hatte die Antwort darauf zunächst gelautet, dass der Staat Leib und Leben, Eigentum und Rechtsschutz nur zu garantieren vermöchte, wenn ihm zuvor sämtliche natürlichen Rechte abgetreten würden. In dieser Form konnten die Vertragstheorien, obwohl vom Konsens aller Herrschaftsunterworfenen ausgehend, doch nicht in verfassungsrechtliche Bahnen einmünden. In ihrer ursprünglichen Form dienten sie vielmehr der Rechtfertigung absoluter Herrschaft, die mit dem Konstitutionalismus unvereinbar ist.
Mit der erfolgreichen Beilegung der konfessionellen Bürgerkriege verlor diese Auffassung indes an Plausibilität und wich allmählich der Vorstellung, dass der Genuss von Sicherheit nicht die Abtretung sämtlicher natürlichen Rechte des Einzelnen an den Staat verlangte. Es genügte vielmehr, das Recht zur gewaltsamen Durchsetzung eigener Rechtsansprüche an den Staat abzutreten, während die übrigen Rechte als vorstaatliche und unaufgebbare beim Einzelnen bleiben konnten, ohne dass damit der gesellschaftliche Frieden aufs Spiel gesetzt wurde. Bald erschien es sogar notwendig, das In19dividuum aus den Bindungen der staatlichen Fürsorge, der feudalen und zünftischen Ordnung und der kirchlichen Tugendaufsicht zu lösen und auf sich selbst zu stellen. Für die einen folgte dies aus der Natur des Menschen, der seine Bestimmung als vernünftig-sittliches Wesen nur in Freiheit verwirklichen könne. Für die anderen war die Freiheit Voraussetzung eines gerechten Interessenausgleichs unter den Individuen sowie des wirtschaftlichen Wohlstands, der von der freien Entfaltung aller Kräfte und der Zulassung von Wettbewerb abhing.
Das Gerechtigkeitsproblem formalisierte sich dadurch. Der Staat bezog seine Existenzberechtigung nicht mehr aus der Durchsetzung eines ihm bekannten und anvertrauten materialen Gemeinwohls, dem sich alle Untertanen zu fügen hatten und dem gegenüber niemand Freiheit beanspruchen konnte. Vielmehr wurde die Freiheit nun selber Gemeinwohlbedingung. Die gerechte Sozialordnung ergab sich aus der freien Betätigung der Einzelnen, und dem Staat verblieb nur die Aufgabe, die Voraussetzung der Gemeinwohlverwirklichung, nämlich die individuelle Freiheit, zu sichern. Diese Aufgabe, die die Gesellschaft aus eigener Kraft nicht lösen konnte, weil die gleiche Freiheit aller Herrschaftsrechte Einzelner ausschloss, verlangte die Aufrechterhaltung des vom absoluten Staat beanspruchten Gewaltmonopols. Doch musste nun Vorsorge dafür getroffen werden, dass er es nicht zu anderen Zwecken als dem der Freiheitssicherung und -koordinierung einsetzte.
Mit diesem Inhalt versehen, stützte die Staatsvertragslehre nicht mehr den absoluten Fürstenstaat und die von ihm nicht grundsätzlich in Frage gestellte ständisch-feudale Gesellschaftsordnung, sondern nahm eine Stoßrichtung gegen beide an. Die bestehenden Verhältnisse mussten im Licht der sozialphilosophischen Lehren als naturrechtswidrig erscheinen. Wer sie überwinden wollte, konnte sich im Recht fühlen, freilich in einem höheren als dem geltenden. Auf ebendieses moderne Naturrecht wurde der Widerstand gegen die Monarchie gestützt, nachdem in Amerika die Berufung auf das »gute alte Recht« und in Frankreich der Ruf nach Reform des ständisch-feudalen und dirigistischen Rechts erfolglos geblieben waren. Eben in dieser Berufung auf das Naturrecht, mit der dem geltenden Recht die Legitimität bestritten und die Befolgung aufgekündigt wurde, bestand der Schritt vom Widerstand zur Revolution, die in eine neue Ordnung münden sollte.
20Wenngleich sich der Inhalt der späteren Verfassungen, die diesem neuen Ordnungsideal Ausdruck gaben, in der jüngeren Staatsvertragslehre weitgehend vorgeformt findet, darf der Staatsvertrag doch nicht mit der Verfassung gleichgesetzt werden. Der Staatsvertrag war ja lediglich ein gedachter, der die Bedingungen legitimer Herrschaft angab und so eine Kritik politischer Ordnungen ermöglichte, die dem nicht entsprachen. Er beanspruchte, den Maßstab für die Formulierung richtigen Rechts zu bilden, nicht aber geltendes Recht zu sein. Erst die revolutionäre Situation, die die angestammte Herrschaft und damit auch die Quelle des geltenden Rechts beseitigt hatte, gab Gelegenheit, die Ideen der Sozialphilosophie in geltendes Recht umzusetzen. Dass dies geschah, findet seinen Grund vor allem in drei Charakteristika dieser Ideen.
Das erste Charakteristikum bestand in der Grundprämisse der Staatsvertragslehren, wonach unter der angenommenen Voraussetzung eines Naturzustandes, in dem alle definitionsgemäß gleich frei waren, Herrschaft nur aus einem Vertrag aller mit allen hervorgehen konnte. In der Philosophie lediglich regulative Idee, mittels deren sich Anforderungen an eine gerechte Sozialordnung gewinnen und konkrete Ordnungen hinsichtlich ihrer Legitimität beurteilen ließen, wurde diese Prämisse nun selbst zum Legitimationsprinzip politischer Herrschaft. Dabei fiel es den Amerikanern nicht schwer, den Vertragsgedanken schon in ihrer Gründungsgeschichte durch die »covenants« der ersten Siedler verwirklicht zu sehen, an die sie nun anknüpften,[14] während die Franzosen lediglich die Konsequenz der Staatsvertragslehre: die Notwendigkeit der Legitimation von Herrschaft durch die Untertanen, übernahmen, ohne dafür einen Vertrag konstruieren zu müssen.
Das Ergebnis war aber in beiden Fällen dasselbe. Das transzendental oder traditional begründete Prinzip der Monarchensouveränität – im absoluten Frankreich rein verwirklicht, im absolutismusresistenten England dem »King in Parliament« zugeschrieben – wich dem rational begründeten demokratischen Prinzip, wenngleich mit unterschiedlichem Akzent. In Frankreich, dem Ursprungsland von Staat und Souveränität, wurde es, dieser Tradition 21gemäß, eher als Volkssouveränität verstanden. In Amerika, dem die kontinentale Souveränitätserfahrung ebenso fremd geblieben war wie dem englischen Mutterland, wurde es aufgrund der kolonialen Erfahrung eher als »self-government« gedeutet. Die unterschiedliche Wahrnehmung änderte aber nichts daran, dass Herrschaft unter dem demokratischen Prinzip nicht mehr als originäres, sondern nur noch als abgeleitetes Recht in Betracht kam, übertragen vom Volk an Amtsträger und ausgeübt in seinem Auftrag.
Allerdings führt auch eine vom Volk eingesetzte Herrschaft nicht mit Notwendigkeit zur Verfassung, sondern nur unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass der Herrschaftsauftrag nicht unbedingt oder unwiderruflich vergeben wird. Sonst würde sich das demokratische Prinzip in der erstmaligen Auftragserteilung erschöpfen und im Übrigen eine neue Form absoluter Herrschaft begründen, die sich von der alten allein dadurch unterschiede, dass sie nicht von Gottes, sondern von Volkes Gnaden stammt. Auch in diesem Fall erfordert die Einsetzung der Herrschaft einen Konstitutionsakt, doch mündet er nicht in eine Konstitution.[15] Eine derartige Vorstellung hätte sich indessen weder mit der naturrechtlichen Lehre von den angeborenen und unveräußerlichen Menschenrechten noch mit dem Verständnis des Auftragsverhältnisses als zeitlich befristet, widerrufbar und Verantwortlichkeit vor dem Auftraggeber begründend vertragen. Den Revolutionären lag sie daher fern. Volkssouveränität in ihrem Sinn verlangte im Gegenteil nach einer Organisation, die diesen Zusammenhang herstellte und aufrechterhielt.
Das zweite Charakteristikum ergab sich aus der Vorstellung der Aufklärung, dass die gleiche Freiheit aller Individuen oberster Grundsatz der gesellschaftlichen Ordnung sei und der Staat seine Daseinsberechtigung allein aus ihrem Schutz empfange. Damit er diesen Schutz gegenüber Störern im Innern und Angreifern von außen gewähren konnte, musste ihm das Gewaltmonopol zugestanden werden, das sich nach der Abschaffung aller zwischen Individuum und Staat stehenden intermediären Gewalten erst in der Revolution vollendete.[16] Im selben Atemzug war jedoch dafür zu sorgen, dass der Staat sein Gewaltpotenzial nur im Interesse der 22Aufrechterhaltung von Freiheit und Gleichheit einsetzte und auf alle über diesen Zweck hinausreichenden Steuerungsambitionen verzichtete. Er war nicht mehr zur Gestaltung der gesellschaftlichen Ordnung auf ein materiales Gerechtigkeitsideal hin berufen, sondern musste sich auf die Wahrung der unabhängig von ihm bestehenden, als gerecht unterstellten Ordnung beschränken.
Infolgedessen wurden die verschiedenen gesellschaftlichen Funktionsbereiche von politischer Steuerung entkoppelt und mittels der individuellen Freiheit der gesellschaftlichen Selbststeuerung überantwortet. Staat und Gesellschaft traten auseinander, Öffentlich und Privat ließen sich klar unterscheiden. Der Einsatz Öffentlicher Gewalt in der Gesellschaft wurde zum rechtfertigungsbedürftigen Eingriff. Auch das verlangte nach Regeln, die den Staat auf seine verbleibenden Aufgaben begrenzten und zwischen gesellschaftlichen und staatlichen Zuständigkeiten unterschieden sowie den Staatsapparat derart einrichteten, dass ein Missbrauch der Staatsgewalt möglichst unwahrscheinlich wurde. Schließlich mussten die getrennten Sphären von Staat und Gesellschaft wieder in einer Weise verknüpft werden, die es verhinderte, dass der Staat sich von den Bedürfnissen und Interessen der Träger der Staatsgewalt entfernte und seine institutionellen Eigenbedürfnisse oder die Interessen der Amtswalter in den Vordergrund rückte.
Das dritte Charakteristikum lag in der Veränderung des Gemeinwohls, das sich nach der Umstellung der Gesellschaftsordnung auf das Grundprinzip gleicher individueller Freiheit ohne Zutun des Staates aus gesellschaftlicher Selbststeuerung ergeben sollte. Das Gemeinwohl wurde dadurch als Grund der Vergesellschaftung und Zweck politischer Herrschaft nicht obsolet. Es verlor aber seine Eigenschaft als feststehende substanzielle Größe. Über die Frage, was dem Gemeinwohl dient, waren legitimerweise unterschiedliche Auffassungen möglich, zwischen denen nicht mehr im Rekurs auf Wahrheit ausgewählt werden konnte. Das Gemeinwohl wurde insofern pluralisiert. Über die gleichwohl unumgehbare Frage, was als Gemeinwohl zu gelten hat, musste dann in einem politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess entschieden werden. Insofern war das Gemeinwohl prozeduralisiert. Es verwandelte sich in die Resultante eines gesellschaftlichen Prozesses, dessen störungsfreien Verlauf der Staat zu garantieren hat.
Es war diese nicht endgültig abschließbare Bestimmungsbedürf23tigkeit des Gemeinwohls, die ebenfalls nach Regulierung verlangte.[17] Dabei traten zwei Bedürfnisse auf. Das erste ergab sich aus der Prozeduralisierung des Gemeinwohls, das zweite aus seiner Pluralisierung. In prozeduraler Hinsicht musste der Meinungs- und Willensbildungsprozess geordnet werden, aus dem es hervorgeht. Teilnahmeberechtigung und Definitionskompetenz bedurften der Bestimmung. Was die Pluralisierung angeht, wurde eine Begrenzung nötig. Da die Pluralisierung eine Folge der Umstellung der Ordnung von Wahrheit auf Freiheit war, musste diese samt ihren Voraussetzungen von der Pluralisierung ausgenommen werden. Dazu bedurfte es inhaltlicher Festlegungen, die im Prozess der Gemeinwohlbestimmung nicht disponibel waren, sondern ihm als Prämissen dienten.
III. Die Verwirklichung des konstitutionellen Programms
Die Aufgabe war so beschaffen, dass sie gerade im Recht ihre adäquate Lösung fand. Die Lösung musste aus einem gesellschaftlichen Konsens hervorgehen. Doch ist dieser schon im nächsten Moment ein historischer und als solcher flüchtig. Dauer und Geltung kann ihm nur das Recht verleihen. Das Recht stellt den Konsens unabhängig von den Personen, die an ihm beteiligt waren, erstreckt ihn in die Zeit und macht ihn allgemein verbindlich. Die Grundfrage, woher die handelnde Generation die Berechtigung bezieht, die künftigen Generationen in dieser Weise zu binden,[18] wird durch die Änderbarkeit des Rechts beantwortet. Überdies besitzt das Recht auch für die Regelungsprobleme, die das Programm der Staatsvertragslehren aufwarf, die geeignete Antwort. Bei Regelungen grenzziehender und organisatorischer Art erreicht es seinen höchsten Effektivitätsgrad.
Zuvor musste allerdings die Hürde überwunden werden, dass das Recht seit seiner Positivierung ein Produkt staatlicher Entschei24dung war, nun aber gerade den Staat binden sollte, und zwar auch bei der Rechtsetzung. Zur Lösung dieses Problems konnte man aber an die Legeshierarchie anknüpfen, die im Mittelalter geläufig gewesen war und sich später in den »leges fundamentales« und Herrschaftsverträgen erhalten hatte.[19] Sie wurde nun in eine neuartige und grundlegende Aufspaltung der Rechtsordnung in zwei Teile überführt. Ein Teil war der traditionelle des vom Staat ausgehenden Gesetzesrechts, das die Einzelnen band. Der andere war der neue, welcher vom Souverän ausging und den Staat band. Dieser wurde fortan als Verfassung bezeichnet, und mit der neuen Sache gewann auch der Begriff seine moderne Bedeutung.[20]
Die Konstruktion konnte freilich nur gelingen, wenn die beiden Teile der Rechtsordnung nicht nur unterschieden, sondern auch hierarchisch angeordnet wurden. Das Verfassungsrecht musste dem Gesetzesrecht und seinen Anwendungsakten vorgehen, damit Recht auf Recht angewendet werden und so seine Möglichkeiten steigern konnte.[21] Der Vorrang gehört daher begriffsnotwendig zur Verfassung.[22] Er macht sie aus, und wo es an der Anerkennung des Vorrangs fehlt, kann die Verfassung ihre Aufgabe nicht erfüllen. Durch den fehlenden Vorrang unterscheidet sich auch die englische »Verfassung« von denjenigen Verfassungen, die aus der amerikanischen und der Französischen Revolution hervorgingen. Alle Regeln der ungeschriebenen englischen Verfassung stehen unter dem Vorbehalt der Parlamentssouveränität. Erst jüngst ist darin durch die Inkorporierung der Europäischen Menschenrechtskonvention in englisches Recht eine Änderung eingetreten.
Dass der Vorrang zur Verfassung gehört, wurde schon in ihrer Geburtsstunde sowohl in Amerika wie in Frankreich vollkommen erfasst. Namentlich Sieyès, der der Umwandlung der nach 300 Jahren erstmals wieder einberufenen Generalstände in die Nationalversammlung die theoretische Grundlage geliefert hatte, fand 25dafür die bis heute gültige Unterscheidung zwischen dem pouvoir constituant und dem pouvoir constitué.[23] Der Erstere lag bei der Nation als Träger aller öffentlichen Gewalt. Der Letztere umfasste die vom Volk im Akt der Verfassunggebung errichteten Organe. Diese handelten im Auftrag des Volkes und unter den von ihm in der Verfassung niedergelegten Bedingungen und konnten sie daher nicht eigenmächtig ändern, wenn die gesamte Konstruktion nicht scheitern sollte. Sie durften nur auf der Grundlage und im Rahmen der Verfassung tätig werden, und ihre Akte konnten nur dann rechtliche Verbindlichkeit beanspruchen, wenn sie in Übereinstimmung mit der Verfassung ergangen waren.
Das Neue an der Verfassung war also weder der theoretische Entwurf eines Gesamtplans legitimer Herrschaft noch die hierarchische Stufung der Rechtsordnung. Beides hatte schon vorher bestanden. Neu war vielmehr die Zusammenführung dieser Entwicklungslinien. Der theoretisch entworfene Plan wurde mit Rechtsgeltung versehen und als dem Volk zugeschriebenes »supreme law« allen staatlichen Akten vorgeordnet. Herrschaft verwandelte sich dadurch in eine Auftragsangelegenheit, und insofern die Verfassung durch diesen Auftragscharakter bedingt war, gehört die verfassunggebende Gewalt des Volkes begrifflich zu ihr.[24] Erst auf der Grundlage der Verfassung wurden Personen zur Herrschaft berufen, die für ihre Herrschaftsakte nur dann Befolgung beanspruchen konnten, wenn sie sich im Rahmen ihres rechtlich bestimmten Auftrags hielten und ihre Befugnisse rechtsförmig ausübten. Es war diese Konstruktion, welche es erlaubte, vom Verfassungsstaat als einem »government of laws and not of men«[25] zu sprechen.
Die Begrenzung des Staates auf seine reduzierten Zwecke und damit zugleich die Sicherung der Individualfreiheit und vermittels ihrer die Autonomie der gesellschaftlichen Funktionssysteme über26nahmen Grundrechte, die sowohl in Frankreich wie in Virginia – der ersten amerikanischen Kolonie, die sich eine Verfassung gab – vor den Regeln über die Staatsorganisation in Kraft gesetzt wurden, während in der amerikanischen Bundesverfassung von 1787 eine Bill of Rights zunächst für entbehrlich gehalten, dann aber bald im Wege des »amendment« angefügt wurde. Bei der Formulierung orientierten sich die Franzosen überwiegend an der Philosophie der Aufklärung, die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts zunehmend detaillierte Menschenrechtskataloge entwickelt hatte. Die Amerikaner ließen sich dagegen von den englischen Rechtekatalogen leiten, denen sie inhaltlich nichts hinzufügten. Sie ordneten sie aber nicht nur der Exekutive, sondern nach ihren Erfahrungen mit Parlamenten auch der Volksvertretung vor und hoben sie damit von der Stufe der »fundamental rights« auf die der »constitutional rights«, machten sie also erst zu Grundrechten im verfassungsrechtlichen Sinn.[26]
Da sich die amerikanische Revolution aber im politischen Ziel der Unabhängigkeit vom Mutterland und der Errichtung eines »self-government« erschöpfte und die bestehende Gesellschaftsordnung ebenso wie das von England übernommene, bereits weithin liberale Recht unangetastet ließ, konnten sich die Grundrechte von vornherein auf die Abwehr staatlicher Freiheitseingriffe beschränken. Sie gingen in ihrer negatorischen Funktion auf. Dagegen zielte die Französische Revolution nicht nur auf einen politischen, sondern auch auf einen gesellschaftlichen Systemwechsel. Dieser erfasste die gesamte Rechtsordnung, die feudalistisch, dirigistisch und kanonistisch geprägt war. Den Grundrechten wurde hier die Aufgabe übertragen, den grandiosen Akt der Auswechslung eines ganzen Rechtssystems inhaltlich anzuleiten. Das war der erklärte Grund für die frühzeitige Verabschiedung der Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen am 26. August 1789. Unter diesen Umständen konnten sich die Grundrechte funktional nicht auf Staatsabwehr beschränken. Sie gaben dem Staat verbindliche Handlungsziele vor, und erst nach der Umstellung der Rechtsord27nung auf die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit konnten sie auch hier auf ihre negatorische Funktion zurückfallen.[27]
Die Staatsorganisation wurde in beiden Ländern so geregelt, dass Staat und Gesellschaft, die unter der Prämisse der gesellschaftlichen Selbststeuerungsfähigkeit auseinandertraten, durch eine vom Volk gewählte Vertretung wieder verknüpft wurden, der sowohl das Gesetzgebungsrecht wie das Recht, über Steuererhebung und Steuerverwendung zu entscheiden, eingeräumt wurde. Die staatliche Exekutive war an das parlamentarisch beschlossene Gesetz gebunden. Der Gefahr des Machtmissbrauchs wurde durch eine verhältnismäßig strikte Gewaltenteilung begegnet. Gewaltenteilung wurde in beiden Ländern nachgerade zum Wesensmerkmal der Verfassung, so dass in den Grundrechtskatalogen formuliert werden konnte, ein Land ohne Gewaltenteilung besitze keine Verfassung. Bei der Ausgestaltung dieses Grundmusters gingen Amerika und Frankreich indes verschiedene Wege, insbesondere bei der Wahl zwischen präsidentieller und parlamentarischer Demokratie und föderalistischer und zentralistischer Staatsorganisation.
Das Verfassungsrecht befand sich allerdings, so gut es ausgedacht sein mochte, aufgrund seiner Eigenart in einem prekären Zustand. Es erschöpfte sich ja nicht darin, die oberste Gewalt einzurichten. Vielmehr sollte sie auch in ihrer Ausübung rechtlichen Regeln unterworfen und gerade dadurch legitimiert werden. Damit unterschied sich das Verfassungsrecht aber in einer wichtigen Hinsicht vom Gesetzesrecht. Während dieses die organisierte Sanktionsgewalt des Staates hinter sich hat, so dass Zuwiderhandlungen mit Zwang begegnet werden kann, steht jenes, weil an die oberste Gewalt selbst gerichtet, ohne einen solchen Schutz da. Regelungsadressat und Regelungsgarant sind identisch. Es gibt keine höhere Gewalt, die die Anforderungen der Verfassung im Konfliktfall mit Zwang durchsetzen könnte. Darin liegt die eigentümliche Schwäche gerade des höchstrangigen Rechts.
28Auf diese Schwäche fand in der Entstehungsphase des Konstitutionalismus aber nur Amerika eine Antwort. Während Frankreich, das mehr als 300 Jahre in einer absoluten Monarchie ohne ständische Vertretungskörperschaften geschweige denn Parlament gelebt hatte, in der Einrichtung einer gewählten Volksvertretung eine ausreichende Sicherung der Freiheit sah, fehlte es den amerikanischen Kolonisten an einem derartigen Vertrauen in die Volksvertretung. Aufgrund ihrer Erfahrung mit den Übergriffen des englischen Parlaments und manchen Machtmissbrauchs der eigenen Parlamente, gerade in der Revolutionsphase, war ihnen bewusst geworden, dass der Verfassung Gefahr nicht allein von der Exekutive, sondern auch von der Legislative drohte. Deswegen sahen sie vor, dass die Justiz über die Einhaltung der verfassungsrechtlichen Institutionen des Föderalismus, der Gewaltenteilung und der Grundrechte wachte. Damit entstand in der Geburtsstunde des Verfassungsstaats auch die Verfassungsgerichtsbarkeit (»constitutional review«),[28] sollte jedoch mehr als 100 Jahre auf Amerika beschränkt bleiben.
Der Unterschied zwischen den älteren rechtlichen Bindungen politischer Herrschaft und der modernen Verfassung in der Form, in der sie Ende des 18. Jahrhunderts ins Leben trat, lässt sich nun genauer fassen.[29] Während die älteren Bindungen legitime Herr29schaft immer schon voraussetzten und sich nur auf Modalitäten ihrer Ausübung bezogen, wirkte die moderne Verfassung herrschaftskonstituierend, nicht nur herrschaftsmodifizierend.[30] Legitime Staatsgewalt wurde durch sie hervorgebracht und erst im Folgenden zweckentsprechend eingerichtet. Während die älteren Bindungen stets nur einzelne Ausübungsmodalitäten der als umfassend vorausgesetzten Herrschaft betrafen, wirkte die moderne Verfassung nicht punktuell, sondern umfassend. Sie ließ weder extrakonstitutionelle Träger von Herrschaftsbefugnissen noch extrakonstitutionelle Ausübungsmodalitäten zu. Während die älteren rechtlichen Bindungen lediglich zwischen den Vertragsparteien galten, waren die modernen Verfassungen auf das ganze Volk bezogen. Sie wirkten nicht partikular, sondern universal.
IV. Die Verfassung als evolutionäre Errungenschaft
Aufgrund dieser Eigenarten ist die Verfassung zu Recht als evolutionäre Errungenschaft bezeichnet worden.[31] Sie stellte die Rechtsbindung politischer Herrschaft, die mit dem Zusammenbruch der mittelalterlichen Ordnung verlorengegangen war, unter den veränderten Bedingungen des modernen Staates, der damit zusammenhängenden Positivierung des Rechts sowie des Übergangs zu funktionaler Differenzierung der Gesellschaft wieder her. Mittels der Verfassung wurde politische Herrschaft dem neuen Legitimationsprinzip der Volkssouveränität entsprechend eingerichtet und mit den Autonomie- und Harmonisierungsbedürfnissen einer funktional differenzierten Gesellschaft kompatibel gemacht.[32] Dadurch erlaubte die Verfassung es zugleich, legitime von illegitimen 30Herrschaftsansprüchen und Herrschaftsakten zu unterscheiden. Bei der Erfüllung dieser Funktion konnte sie zwar versagen oder ihre Akzeptanz verlieren. Der Charakter einer Errungenschaft zeigt sich aber gerade daran, dass ihre Funktion in diesem Fall nur von einer anderen Verfassung übernommen, nicht unabhängig von der Verfassung aufrechterhalten werden kann.[33]
Die Ausgangsbedingungen fanden in dem neuen Instrument der Verfassung ihren Niederschlag. Dem mit der Konstitutionalisierung verfolgten Zweck der Verrechtlichung von politischer Herrschaft entsprechend, knüpfte sie an diejenige Form an, die politische Herrschaft zur Zeit ihrer Entstehung gefunden hatte. Das war der Staat, wie er sich in Reaktion auf den Zerfall der mittelalterlichen Ordnung zuerst in Frankreich und später in anderen Ländern Europas herausgebildet hatte. Der Staat trat unter diesen Umständen als nationaler in Erscheinung. In dieser Form existierte er, ehe die Verfassung aufkam. In der Verfassung wurde der Nationalstaat daher vorausgesetzt.[34] Das hatte zur Folge, dass die Verfassungsidee, obwohl von Grundsätzen gespeist, die universale Geltung beanspruchten, partikular verwirklicht wurde. Es gab von Anfang an verschiedene Verfassungen, die das konstitutionelle Programm national abwandelten.
Infolgedessen war die Verfassung von Anfang an ebenso umfassend wie begrenzt. Sie war umfassend insofern, als sie beanspruchte, dass öffentliche Gewalt nur auf der Grundlage und im Rahmen ihrer Regelungen ausgeübt werden durfte. Sie war begrenzt insofern, als sich die öffentliche Gewalt, die ihren Regelungen unterstand, auf ein bestimmtes Territorium beschränkte, das von anderen Territorien durch Grenzen geschieden war. Jede Verfassung galt nur auf dem Territorium des von ihr konstituierten Staates, während in benachbarten Territorien andere Regeln galten, aber mit demselben Exklusivitätsanspruch. Der durch die Staatsgrenzen markierte Unterschied zwischen Innen und Außen war also Voraussetzung für die einheitliche und umfassende Staatsgewalt und damit auch für ihre Konstitutionalisierung. Das heißt aber gleichzeitig, dass die Errungenschaft der Verfassung in ihrer Wirksamkeit davon ab31hing, dass die Differenz zwischen Innen und Außen deutlich blieb und die Staatsgrenze das Territorium gegen fremde Herrschaftsakte wirksam abschirmte.
Als speziell auf den Staat bezogenes Recht konnte die Verfassung ihren Anspruch auf durchgängige Verrechtlichung der politischen Herrschaft nur einlösen, wenn diese mit der Staatsgewalt zusammenfiel. Nicht ohne Grund waren daher der Inkraftsetzung der Verfassung in Frankreich die Auflösung aller intermediären Gewalten und die Übertragung ihrer Herrschaftsfunktionen auf den Staat vorangegangen. Die verfassungshinderliche Gemengelage öffentlicher und privater Elemente in den älteren Gesellschaftsformationen sowie ihre Restbestände im Absolutismus waren damit beseitigt. Die Gesellschaft war aller Herrschaftsbefugnisse entkleidet und konnte erst unter dieser Voraussetzung zur Selbststeuerung über den Markt ermächtigt werden. Die Herrschaftsbefugnis war ebenso vollständig entprivatisiert, bedurfte aber gerade wegen der Konzentration im Staat der rechtlichen Bändigung. Im Verfassungsstaat gilt deswegen für die Gesellschaft grundsätzlich das Prinzip der Freiheit, für den Staat grundsätzlich dasjenige der Bindung.[35] Das ist nicht nur eine denkbare Ausgestaltung des Verfassungsstaats, sondern ein für ihn konstitutives Merkmal. Der Verfassungsstaat würde ausgehebelt, wenn der Staat die Freiheit von Privaten genösse und umgekehrt Private über die Herrschaftsmittel des Staates verfügen dürften.
Die veränderten Bedingungen der Rechtsbindung wirkten sich auch auf Art und Grad der Verrechtlichung aus. Als Bestandteil des positiven Rechts konnte die Rechtsbindung weder Fremdbindung sein noch invariant gelten. Fremdbindung schied aus, weil es im Staat keine vorpolitische oder apolitische Quelle des Rechts mehr gab. Auch das Verfassungsrecht macht davon keine Ausnahme.. Insofern ist die verfassungsrechtliche Bindung der Politik stets Selbstbindung.[36] Der Umstand, dass die Verfassung im Unterschied zum Gesetzesrecht auf den Souverän selbst, das Volk (wie in Amerika) oder die Nation (wie in Frankreich), zurückgeführt wurde, darf darüber nicht hinwegtäuschen. Obwohl die Verfassung legitime 32Staatsgewalt erst hervorbringt, kann der Souverän dies nicht bewirken, ohne schon vorläufig politisch organisiert zu sein oder sich von Organen vertreten zu lassen.[37]
Die grundlegende Differenz zwischen pouvoir constituant und pouvoir constitué wird dadurch aber nicht berührt. Sie ist vielmehr eine Differenz innerhalb des politischen Systems. Wie schon die ersten Verfassungen zeigen, kann sie so ausgestaltet werden, dass Entscheidungen über Verfassungsrecht sowohl von anderen Institutionen als auch in anderen Verfahren getroffen werden als Entscheidungen über Gesetzesrecht. Die amerikanische Verfassung und die französischen Revolutionsverfassungen gingen darin sogar besonders weit.[38] Aber selbst wenn Institutionen und Verfahren bei Entscheidungen über die Verfassung und Entscheidungen über Gesetze einander weitgehend gleichen (wie in Deutschland), behält die Unterscheidung ihren Sinn. Sie sorgt dafür, dass die Institutionen in verschiedenen Eigenschaften tätig werden, die nicht vermischt werden dürfen, und stabilisiert so den Vorrang der Verfassung.
Aus denselben Gründen kann das Verfassungsrecht kein invariantes Recht sein. So wie es durch eine politische Entscheidung zustande kommt, lässt es sich durch eine ebensolche Entscheidung auch wieder ändern. Selbst verfassungsrechtliche Änderungsverbote, die innerhalb des Verfassungsrechts nochmals eine Stufung erzeugen, wirken nur, solange die Verfassung, die ein solches Änderungsverbot enthält, bestehen bleibt und nicht durch konträre Beschlüsse außer Kraft gesetzt wird. Die Verrechtlichungsfunktion leidet darunter aber nicht, weil mit Hilfe der Verfassung die Entscheidung über die Prämissen politischer Entscheidungen und die politischen Entscheidungen selber getrennt werden. Der Vorrang der Verfassung verhindert nicht ihre Änderung, wohl aber, dass die verfassungsrechtlichen Prämissen, solange sie nicht geändert sind, bei politischen Entscheidungen außer Acht gelassen werden.
Die Rechtsbindung der Politik durch die Verfassung kann fer33ner keine Totalbindung sein.[39] Da im Staat alles Recht politisch erzeugtes Recht ist, käme eine Totalverrechtlichung einer Negation der Politik gleich. Diese wäre auf Verfassungsvollzug reduziert und würde sich damit letztlich in Verwaltung verwandeln. Indessen soll die Verfassung Politik nicht erübrigen, sondern kanalisieren und rationalisieren. Deswegen kann sie stets nur Rahmenordnung für politisches Handeln sein. Sie legt die Bedingungen fest, unter denen politische Entscheidungen Verbindlichkeit beanspruchen können, bestimmt aber weder den Input in die verfassungsrechtlichen Kanäle noch das Ergebnis der verfassungsrechtlichen Verfahren. Gleichwohl bleibt sie insofern umfassende Regelung, als sie keine extrakonstitutionellen Gewalten und keine extrakonstitutionellen Verfahren zulässt. Nur wenn die verfassungsrechtlich legitimierten Akteure handeln und sich dabei in den verfassungsrechtlichen Bahnen bewegen, kann das Ergebnis Verbindlichkeit beanspruchen.
Ihre Funktion als »rechtliche Grundordnung des Staates«[40] erfüllt die Verfassung dadurch, dass sie diejenigen Grundsätze des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der politischen Herrschaft, die auf einem breiten, gegnerübergreifenden Konsens beruhen, der laufenden politischen Auseinandersetzung entzieht. Sie dienen dieser als Richtmaß und Grenze, während für den der Auseinandersetzung überlassenen Bereich prozedurale Regeln eines geordneten Austrags aufgestellt werden. Indem die Verfassung auf diese Weise einen Vorrat an Gemeinsamkeiten bereithält und symbolisiert, in welchem sich die Anhänger unterschiedlicher Überzeugungen und die Träger divergierender Interessen einig wissen, beschreibt sie die Identität des politischen Systems und trägt zur Integration der Gesellschaft bei.[41] Das hat gerade für solche Gesellschaften besondere Bedeutung, in denen aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten Individualfreiheit die Integrationskraft anderer gemeinschaftsbildenden Institutionen tendenziell abnimmt.
Rechtstechnisch erbringt die Verfassung die Leistung dadurch, dass sie für Änderungen der Prinzipien und Spielregeln höhere Hürden errichtet als für die laufenden politischen Entscheidungen. 34Die Änderung der Prinzipien und Verfahren für laufende politische Entscheidungen und diese Entscheidungen selbst werden dadurch entkoppelt. Diese Trennung stellt für beide unterschiedliche Diskurse und unterschiedliche Zeithorizonte her. Damit verbinden sich verschiedene Vorteile. Die politische Auseinandersetzung wird zivilisiert, weil die Kontroversen vor dem Hintergrund eines Basiskonsenses ausgetragen werden können, der Gegner eint. Der Gewaltverzicht in der Politik wird dadurch begünstigt. Die Minderheit muss nicht um ihre Existenz fürchten und darf ihre Ziele weiter verfolgen. Zugleich wird die laufende Politik von ständig neuer Prinzipiensuche und Verfahrenswahl entlastet, die sie angesichts des permanenten Entscheidungsdrucks bei komplizierten Entscheidungsmaterien überfordern würden. Was in der Verfassung steht, ist nicht mehr Thema, sondern Prämisse politischer Entscheidungen.
Schließlich gliedert die Verfassung den politischen Prozess in zeitlicher Hinsicht. Die identitätsverbürgenden Grundsätze haben Aussicht auf längerfristige Geltung. In ihre Stabilität kann höheres Vertrauen gesetzt werden als in die laufenden politischen Entscheidungen. Die kurzfristige Anpassung an wechselnde Lagen und Bedürfnisse wird dadurch erleichtert. Sie finden in den langfristig gültigen Prinzipien Halt und rufen wegen der Begrenzung durch diese weniger Enttäuschung hervor. Die Verfassung sorgt auf diese Weise für Kontinuität im Wandel. Diese Vorteile des Konstitutionalismus sind allesamt eine Folge der Ebenendifferenzierung zwischen den Grundsätzen für politische Entscheidungen und diesen Entscheidungen selbst. Eben deswegen ist die Verfassung Grundordnung. Zwar gibt es für den Grenzverlauf keine verbindlichen Maßstäbe. Werden Verfassungen aber in einer Weise formuliert, die die Differenz einebnet, gerät ihre Funktion in Gefahr.[42]
Im Übrigen teilte die Verfassung diejenigen Begrenzungen, die dem Medium des Rechts generell eigen sind. Als rechtliche Grundordnung des Staates ist sie ein Inbegriff von Normen, denen das politische System entsprechen soll, keine Deskription. Sie bildet die soziale Wirklichkeit nicht ab, sondern richtet Anforderungen an sie. Die Verfassung bezieht also Distanz zur Wirklichkeit und gewinnt erst daraus das Vermögen, als Verhaltens- und Beurtei35lungsmaßstab für Politik zu dienen. Sie kann deswegen nicht ohne Funktionseinbußen in eine einmalige Dezision über Art und Form der politischen Einheit oder in einen kontinuierlichen Prozess aufgelöst werden. Sie verselbständigt sich als Norm vielmehr von der Dezision, der sie ihre Geltung verdankt, und gibt dem Prozess Halt, den sie voraussetzt.[43]
Andererseits genügt die Verfassung als Inbegriff von Rechtsnormen sich nicht selbst. Sie ist auf Verwirklichung angelegt. Doch kann sie ihre Verwirklichung nicht selbst garantieren. Ob und in welchem Maß die Verfassung ihren normativen Anspruch über die Zeit einzulösen vermag, hängt zum großen Teil von außerrechtlichen Faktoren ab. Der Ort, an dem diese aufgesucht werden, ist die empirische Verfassung. Diese wird durch die normative Verfassung nicht ersetzt. Beide stehen auch nicht beziehungslos nebeneinander. Zwischen ihnen ergeben sich vielmehr Wechselwirkungen. Die rechtliche Verfassung wird schon bei der Entscheidung, aber auch bei der Anwendung von der empirischen beeinflusst, wie sie wiederum auf diese zurückwirkt. Wo der politische Prozess die verfassungsrechtlich vorgeschriebenen Bahnen verlässt, kommt hinter der rechtlichen Verfassung meist die tatsächliche als Ursache des Scheiterns zum Vorschein. Das war es, was Lassalle meinte, als er die gesellschaftlichen Machtverhältnisse als die wahre Verfassung bezeichnete.[44]
Im Fall des Gelingens verläuft der politische Prozess dagegen in den Bahnen und nach den Maßgaben der rechtlichen Verfassung. Damit ist nicht gesagt, dass die sozialen Machtverhältnisse, die die empirische Verfassung mitbestimmen, ausgeschaltet oder neutralisiert werden. Jede normative Verfassung trifft auf Machtverhältnisse aller Art. Verfassungen, die, vermittelt über die Individualfreiheit, den gesellschaftlichen Subsystemen Autonomie einräumen und davon auch die Wirtschaft, die Medien etc. nicht ausnehmen, lassen 36ihre Bildung sogar ausdrücklich zu. Die rechtliche Verfassung bewirkt aber, dass soziale Macht nicht umstandslos in geltendes Recht oder andere kollektiv verbindliche Entscheidungen umgesetzt werden kann. Sie muss sich vielmehr auf einen Prozess einlassen, in dem bestimmte Regeln gelten, die unter der Prämisse formuliert wurden, dass sie zu gemeinverträglichen Ergebnissen führen. Für beides, Gelingen und Scheitern, liefern schon die Ursprungsverfassungen in Amerika und Frankreich Anschauungsmaterial.
B. Entwicklung der Verfassung
I. Die Ausbreitung des Konstitutionalismus
Wie diese auf die Ursprungsländer des Konstitutionalismus bezogene Rekonstruktion zeigt, war die moderne Verfassung kein Zufallsprodukt der Geschichte. Damit soll nicht gesagt werden, dass sie unausweichlich entstehen musste, wohl aber, dass sie nicht unter beliebigen Bedingungen entstehen konnte. Sie war an das Zusammentreffen verschiedener Voraussetzungen geknüpft, die nicht zu jeder Zeit und nicht überall bestanden. Sowenig sie in der Vergangenheit schon immer vorlagen, sowenig müssen sie in der Zukunft erhalten bleiben. Im Zuge des sozialen Wandels können auch sie sich verändern oder wegfallen. Welche Auswirkungen dies auf die Verfassung hätte, hängt davon ab, ob die Voraussetzungen allein für ihr Entstehen oder auch für ihr Bestehen konstitutiv sind. Nur wenn bestandswichtige Bedingungen entfielen, wäre damit auch das Ende der Verfassung eingeläutet. Falls sie gleichwohl überlebte, dann nur als überlebte Form ohne den ursprünglichen Sinn oder als Begriff für eine andere Sache.
Vorderhand haben wir es bei der Verfassung allerdings mit einer Erfolgsgeschichte zu tun. Auch wenn nicht überall die Voraussetzungen vorlagen, die ihr im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts in Amerika und Frankreich zum Durchbruch verholfen hatten, setzte sie doch das restliche Europa in Aufregung und rief allenthalben Verfassungsbewegungen hervor. Verfassung war das große Thema des 19. Jahrhunderts. Mit ihr verbanden sich so hohe Erwartungen, dass zahlreiche Menschen bereit waren, dafür selbst Beruf, Eigentum, Freiheit und Leben zu riskieren. Das 19. Jahrhundert 37lässt sich als ein Jahrhundert der Verfassungskämpfe beschreiben. Revolutionen bestimmen seine Periodisierung. Mehrere revolutionäre Wellen durchliefen zahlreiche europäische Staaten gleichzeitig, und nur wenige Länder blieben von Verfassungskämpfen ganz verschont, voran England. Als das lange 19. Jahrhundert mit dem 1. Weltkrieg zu Ende ging, hatte sich der Konstitutionalismus in fast ganz Europa und in vielen von Europa beeinflussten Teilen der Erde durchgesetzt.[45]
Das 20. Jahrhundert, das verheißungsvoll für die Verfassung begann, brachte ihr im weiteren Verlauf schwere Rückschläge durch Diktaturen der verschiedensten Provenienz. Am Ende des Jahrhunderts stand der Verfassungsstaat freilich unbestrittener da als je. Faschistische Diktaturen, Militärdiktaturen, zum Schluss auch Apartheidregime und sozialistische Parteidiktaturen gingen großenteils unter, oftmals durch militärische Niederlagen, manchmal durch Revolutionen, vielfach durch Implosionen. Auch wenn der Kampf nicht mehr wie im 19. Jahrhundert ausdrücklich um die Verfassung geführt wurde, so waren doch neue oder erneuerte Verfassungen durchweg die Konsequenz.[46] Die Rückschläge und die Erfahrungen mit wirkungslosen oder wirkungsarmen Verfassungen schärften auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit eigener Durchsetzungsinstanzen. Deswegen breitete sich, nach bescheidenen Anfängen im Gefolge des Ersten Weltkriegs, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch die Verfassungsgerichtsbarkeit universal aus.[47]
Man kann aus diesem pauschalen Überblick bereits ersehen, dass die Verfassung, nachdem sie als Werk zweier erfolgreicher Revolutionen vorhanden war, nicht mehr in jedem Nachahmungsfall von einer Revolution abhing. Die deutsche Verfassungsentwick38lung im 19. Jahrhundert belegt das. Zwar gingen etlichen Verfassungsschöpfungen in deutschen Einzelstaaten Revolutionen voran, doch war keine von ihnen erfolgreich in dem Sinn, dass sie zum Bruch mit der bestehenden Herrschaft führte. Verfassungen kamen nur zustande, wenn der angestammte Herrscher, aus welchen Beweggründen auch immer, in die Machtbeschränkung einwilligte.[48] Der ersten gesamtdeutschen Verfassung, der Reichsverfassung von 1871, fehlt jeder revolutionäre Hintergrund. Sie war die Folge der von souveränen Fürsten vertraglich vereinbarten Gründung eines neuen Staates, der in Form gebracht werden musste.
Tiefgreifende Zäsuren sind allerdings bis heute die häufigste Ursache für Verfassungsschöpfungen.[49] In vielen Fällen ist es aber gerade nicht die triumphale Revolution, sondern der katastrophale Zusammenbruch, der zur Verfassung drängt. Das trifft auch für die deutschen Verfassungen des 20. Jahrhunderts zu, die Weimarer Verfassung, das Grundgesetz und die Verfassung der DDR. Nach dem Zusammenbruch des SED-Regimes begab sich die DDR wiederum auf den Weg der Verfassungsschöpfung, ehe der Entschluss zur Wiedervereinigung unter dem Dach des Grundgesetzes diese Bemühungen überflüssig machte. Verfassungserneuerungen ohne derartige Zäsuren, wie etwa in der Schweiz im Jahr 2000, sind Ausnahmen. Hier gelang der Versuch erst, als man den revolutionär klingenden Begriff der Neuschöpfung aufgegeben und durch den Kontinuität versprechenden der »Nachführung« ersetzt hatte.[50]
Nachdem die Verfassung einmal erfunden war und Anziehungskraft entfaltete, wurde es auch möglich, die Form zu kopieren, ohne den Sinn zu übernehmen. Form und Funktion ließen sich trennen. Frankreich selbst gab unter Napoleon das erste Beispiel dafür. Zwar hielt er den Verzicht auf eine Verfassung für inoppor39tun, hinter ihr stand aber kein Selbstbindungswille des Kaisers. Viele der Verfassungen, die den Prototypen in Amerika und Frankreich zeitlich folgten, waren Pseudo- oder Semikonstitutionen. Auch die von den Herrschern gewährten deutschen Verfassungen des 19. Jahrhunderts blieben hinter dem konstitutionellen Projekt, wie es in der amerikanischen und der Französischen Revolution Gestalt gewonnen hatte, zurück.[51] Für viele heutige Verfassungen in aller Welt gilt dasselbe. Das Prädikat »Erfolgsgeschichte« behält dennoch seine Berechtigung, denn selbst diejenigen, die lieber rechtlich ungebunden regieren würden, umgeben sich zumindest mit dem Schein der Verfassungsmäßigkeit, um den Legitimationsgewinn abzuschöpfen, den eine Verfassung verspricht.
Die Existenz von Pseudo- und Semikonstitutionen wirft freilich begriffliche Schwierigkeiten auf. Was verdient die Bezeichnung »Verfassung« und was nicht? Eine allgemein gültige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Sie lässt sich vielmehr nur im Blick auf das jeweilige Erkenntnisinteresse beantworten. Geht es um einen Verfassungsvergleich mit dem Ziel, Unterscheidungen herauszufinden und Typen zu bilden, oder um Verfassungsgeschichte, nationale oder vergleichende, ist es nicht ratsam, den Untersuchungsgegenstand vorzeitig einzuengen. Sollen dagegen die Erfolgsaussichten des Konstitutionalismus in den verschiedensten Weltregionen oder seine Überlebenschancen im 21. Jahrhundert samt der Übertragbarkeit auf supranationale Einheiten geprüft werden, empfiehlt es sich, an einem anspruchsvollen Verfassungsbegriff[52] festzuhalten, wie er in der Entstehungsgeschichte des modernen Konstitutionalismus vorgezeichnet ist, damit man nicht vorschnell vom Namen auf die Sache schließt.
Angesichts der inhaltlichen Vielgestaltigkeit der Verfassung verdient dabei ein funktionaler Begriff den Vorzug vor einem materiellen. Die folgenden innerlich zusammenhängenden Merkmale ergeben sich aus den Ausführungen im ersten Teil:
1. Die Verfassung muss einen normativen Geltungsanspruch erheben. Verfassungstexte ohne rechtlichen Bindungswillen gehören nicht dazu.
402. Die Rechtsbindung muss sich auf die Einrichtung und Ausübung politischer Herrschaft beziehen. Es genügt nicht, dass nachgeordnete Instanzen gebunden sind, während die obersten frei bleiben.
3. Die Rechtsbindung muss umfassend in dem Sinn sein, dass weder extrakonstitutionelle Kräfte Herrschaft ausüben noch bindende Entscheidungen aus extrakonstitutionellen Verfahren hervorgehen können.
4. Die verfassungsrechtlichen Bindungen müssen zugunsten aller Herrschaftsbetroffenen, nicht nur zugunsten privilegierter Gruppen wirken.
5. Die Verfassung muss die Legitimationsgrundlage politischer Herrschaft bilden. Eine unabhängig von der Verfassung bestehende Legitimationsgrundlage reicht nicht aus.
6. Die Legitimation zur Herrschaft muss sich auf die Herrschaftsunterworfenen zurückführen lassen. Legitimation durch Wahrheit statt Konsens untergräbt die Verfassung.
7. Die Verfassung muss Vorrang vor den Ausübungsakten von Herrschaft haben. Eine Verfassung, die zur Disposition des einfachen Gesetzgebers steht, genügt nicht.
Im Folgenden geht es um die Frage, ob Verfassungen, die Anspruch auf Erfüllung dieser Merkmale erheben wie das Grundgesetz, den Anspruch angesichts veränderter Realisierungsbedingungen noch einzulösen vermögen. Bei den Veränderungen dieser Art ist an Großtendenzen gedacht, die den Konstitutionalismus überhaupt, nicht nur einzelne Verfassungen oder gar einzelne Verfassungsnormen betreffen. Dazu zählt zuerst der Übergang vom liberalen Staat zum Wohlfahrtsstaat, der vor allem die Begrenzungsfunktion der Verfassung in Mitleidenschaft zieht. Sodann gehört das Aufkommen neuer, vom Verfassungsstaat nicht bedachter Akteure, Instrumente und Verfahren dazu, das die verfassungskonstitutive Grenze zwischen Öffentlich und Privat aufweicht. Schließlich geht es um den Prozess der Internationalisierung und Globalisierung, dessen Kehrseite eine Entstaatlichung ist, welche die ebenfalls verfassungskonstitutive Grenze zwischen Innen und Außen verwischt.
41II. Die Verfassung im Wohlfahrtsstaat
Unter dem Begriff des Wohlfahrtsstaats sammeln sich zahlreiche je nach Zeit und Ort unterschiedliche Sachverhalte, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie eine Antwort auf Defizite des Liberalismus darstellen, die als Marktversagen charakterisiert zu werden pflegen. Die Verfassung wird dadurch insofern berührt, als gerade die in den Markt gesetzten Erwartungen das Bedürfnis nach Staatsbegrenzung weckten, welches dann von der Verfassung befriedigt wurde. Die sozialen Probleme, die infolge des Marktversagens auftraten, ließen sich dagegen nicht mittels Staatsbegrenzung lösen. Die wieder materialisierte Gerechtigkeitsfrage verlangte im Gegenteil nach einer Reaktivierung des Staates. Wenn am Ziel einer gerechten Sozialordnung festgehalten werden sollte, konnte er sich folglich nicht länger auf seine in der Verfassung angelegte Garantenfunktion beschränken, sondern musste wieder ordnungsgestaltend tätig werden.
Die Reaktionen darauf fielen verschieden aus. Zum Teil verhärtete sich der Liberalismus dogmatisch. Die Staatsbegrenzung durch Grundrechte wurde, entgegen ihrer Intention, nicht als Mittel zur Erreichung von Wohlstand und Gerechtigkeit betrachtet, sondern zum Selbstzweck erhoben und das liberale Freiheitsverständnis samt seiner verfassungsrechtlichen Entsprechung: der rein staatsabwehrenden Funktion der Grundrechte, ohne Rücksicht auf die gesellschaftlichen Folgen verteidigt. Die französische Juli-Monarchie bildet das Musterbeispiel für diese Haltung, die sich durchzusetzen vermochte, weil die politischen Partizipationsrechte in der Verfassung von 1830 auf eine kleine Gruppe Höchstbegüterter beschränkt worden waren. Die Revolution des Jahres 1848, die in Deutschland noch überwiegend eine Revolution zugunsten der Herstellung des Verfassungsstaats und zur Effektivierung des Grundrechtsschutzes gewesen war,[53] trug daher in Frankreich bereits vorwiegend soziale Züge.
Die entgegengesetzte Reaktion bestand in der radikalen Abkehr vom Liberalismus, die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den sozialistischen und faschistischen Staaten vollzog. So sehr diese beiden Richtungen auch inhaltlich voneinander abwi42chen, so wenig unterschieden sie sich doch hinsichtlich ihrer Folgen für den Konstitutionalismus. Beide legitimierten politische Herrschaft nicht über Konsens, sondern über Wahrheit. Individuelle Freiheit konnte vor dieser keinen Bestand haben. Eine Elite, die die Kenntnis der Wahrheit für sich beanspruchte, leitete daraus vielmehr das Recht ab, sie ohne Rücksicht auf andersartige Überzeugungen unter Einsatz der Staatsgewalt durchzusetzen. Der Verfassung als Mittel zur Machtlegitimation und -limitation war damit der Boden entzogen. Ihre zentralen Mechanismen, die der Erfüllung dieser Funktionen dienten, wurden zu Störfaktoren.
Gleichwohl besaßen auch diese Staaten ganz überwiegend Verfassungen. Die faschistischen Staaten ließen meist die alten Verfassungen bestehen, suspendierten aber wesentliche Teile oder ersetzten sie durch andere Bestimmungen, während in den sozialistischen Staaten in der Regel neue Verfassungen entstanden, die in der Form denen der traditionellen Verfassungsstaaten ähnelten. Doch konnten sie unter den geschilderten Bedingungen die wesentlichen Funktionen des anspruchsvollen Verfassungsmodells nicht erfüllen.[54] Da das Recht keine Autonomie genoss, sondern angesichts der legitimationsspendenden Wahrheit lediglich eine instrumentelle Rolle besaß, verband sich mit den Verfassungen keine Begrenzung der Herrschaftsgewalt. Soweit sie herrschaftsbegrenzende Texte enthielten, waren sie nicht mit Vorrang ausgestattet. Soweit sie das Gewaltenteilungsschema aufgriffen, wurde es durch Einheitsparteien mit Durchgriffsbefugnissen auf den Staatsapparat unterlaufen. Der Wahrheitsanspruch mündete auf diese Weise in einen Neoabsolutismus, der ungleich radikaler war als der monarchische Absolutismus des 16. bis 19. Jahrhunderts.
Die dritte Reaktionsweise bestand in der Öffnung der Verfassung für soziale Inhalte. Ehe es dazu kam, war allerdings unterhalb der Verfassung eine vor allem in Deutschland umfangreiche Sozialgesetzgebung in Gang gekommen, die in der Einführung der 43Sozialversicherung gipfelte.[55] Obwohl sie einen Bruch mit dem liberalen Sozialmodell darstellte, das für die Entstehung des Konstitutionalismus bestimmend gewesen war, erwuchsen ihr aus der Verfassung keine Hindernisse. Das lag nicht allein am Fehlen eines Grundrechtskatalogs in der Reichsverfassung von 1871. Auch das im Kaiserreich herrschende Grundrechtsverständnis hätte keine Berufung auf die Grundrechte erlaubt, weil ihnen die Geltung gegenüber dem Gesetzgeber abgesprochen wurde.[56] Im Übrigen wäre auch keine Institution vorhanden gewesen, die den Gesetzgeber in seine Grundrechtsschranken hätte verweisen können. Zum verfassungsrechtlichen Problem wurde die Sozialgesetzgebung daher bezeichnenderweise nur in demjenigen Land, das den Vorrang der Verfassung von Anfang an auch institutionell durch die Möglichkeit des »judicial review« abgesichert hatte, den USA.[57]
Bevor es dort zu einer Lösung im Wege der Verfassungsinterpretation kam, hatte die Sozialstaatsidee in Europa schon Einzug in den Verfassungstext gehalten.[58] In der Weimarer Verfassung von 1919 verband sich das neue Legitimationsprinzip der Volkssouveränität mit einer gleichfalls neuen sozialen Inhaltsbestimmung. Zwar behielt die Weimarer Nationalversammlung den Katalog der klassischen Freiheits- und Gleichheitsrechte bei, wie er in den Revolutionen Gestalt gewonnen hatte, ergänzte ihn aber um eine ansehnliche Zahl sozialer Grundrechte und ordnete die wirtschaftliche Freiheit dem Grundsatz sozialer Gerechtigkeit unter. Da die Staatsrechtslehre aber fortfuhr, den Grundrechten die Geltung gegenüber dem Gesetzgeber abzusprechen,[59] reduzierte sich ihre Bedeutung darauf, dass Grundrechtseingriffe der Verwaltung eine gesetzliche Grundlage benötigten. Den sozialen Grundrechten, die durchweg auf gesetzliche Vermittlung angelegt waren, ging unter 44diesen Umständen die normative Kraft gänzlich verloren. Sie galten lediglich als politische Programmsätze.
Das Grundgesetz hat dieser Deutung in Art. 1 Abs. 3 den Boden entzogen, aber auf soziale Grundrechte verzichtet und an ihre Stelle ein nicht weiter konkretisiertes Bekenntnis zur Sozialstaatlichkeit gesetzt. Dem Bundesverfassungsgericht dient dieses indes als Basis eines sozial angereicherten Verständnisses der liberalen Grundrechte.[60] Auf der Annahme fußend, dass gleiche individuelle Freiheit das Ziel der Grundrechte, Staatsbegrenzung lediglich ein Mittel sei, kulminiert es mittlerweile im Begriff der Schutzpflicht, die der Staat gegenüber allen Gefährdungen grundrechtlich gesicherter Freiheiten hat, die nicht ihm selbst zugerechnet werden können, sondern aus Handlungen Dritter oder gesellschaftlichen Entwicklungen folgen. Die aus den klassischen Freiheitsrechten abgeleiteten Schutzpflichten sind ebenso wie ihr Äquivalent in Form postliberaler Grundrechte oder Staatsziele ein Versuch, die Verfassung auf Probleme einzustellen, die sich bei ihrer Entstehung noch nicht erkennen ließen oder durch sie selbst heraufbeschworen wurden.[61]
Die Bedeutung dieses Anschlusses der Verfassung an veränderte Bedingungen wird besonders deutlich, wenn man berücksichtigt, dass heute jedenfalls in den wirtschaftlich entwickelten Staaten nicht mehr die soziale Frage des 19. Jahrhunderts die größte Herausforderung für den Konstitutionalismus darstellt. In den Vordergrund ist vielmehr ein Bedürfnis nach Sicherheit getreten, das insbesondere von den Gefahren bestimmt wird, die der wissenschaftlich-technische Fortschritt und seine kommerzielle Nutzung mit sich bringen. Hier findet die Schutzpflicht mittlerweile ihr größtes Anwendungsfeld.[62] Vom Staat wird eine generelle Risikovorsorge erwartet, die die traditionelle, auch vom Liberalismus nicht in Frage gestellte Staatsaufgabe der Gefahrenabwehr weit hinter sich lässt. Der Staat antwortet darauf mit einer Wende zur 45Prävention, die zwar auf anerkannte Rechtsgüter bezogen bleibt, aber von einer drohenden Verletzung gelöst wird. Sie richtet sich vielmehr auf die Erkennung und Verstopfung von Gefahrenquellen, bevor daraus eine konkrete Gefahr hervorgeht.[63]
Die Einstellung der Verfassung auf veränderte Realisierungsbedingungen individueller Freiheit geht allerdings nicht spurlos an ihrer normativen Kraft vorüber. Der Preis wird einerseits bei ihrer Begrenzungswirkung, andererseits bei ihrem Bestimmtheitsgrad gezahlt. Grundrechtliche Schutzpflichten verlangen vom Staat Handeln im Freiheitsinteresse. Definitionsgemäß zielt dieses Handeln auf Freiheitsbedrohungen, die nicht vom Staat selber, sondern aus der Gesellschaft stammen, in der Regel also ihrerseits Folgen grundrechtlich geschützter Aktivitäten sind. Hier liegt der Grund dafür, dass Schutzpflichten zugunsten bestimmter Grundrechte gewöhnlich durch die Beschränkung anderer Grundrechte erfüllt werden. Die Zahl der Grundrechtseingriffe steigt dadurch beträchtlich an, und da sie ihre Wurzel in Konflikten gleichrangiger Grundrechte haben, bleibt als Lösung nur die Abwägung unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände übrig, die stets mit Gewissheitsverlusten verbunden ist.
Die grundrechtliche Schutzpflicht wirkt freilich nicht nur entgrenzend. Sie begrenzt die Freiheit des Staates zur Untätigkeit. Das entbindet aber nicht von der Frage, wie sich die vermehrte Staatstätigkeit ihrerseits wieder verfassungsrechtlich regulieren lässt. Die Antwort darauf war eine Ausweitung des Gesetzesvorbehalts, zum einen durch eine Erweiterung des Eingriffsbegriffs, der den Gesetzesvorbehalt steuert, zum anderen durch seine Erstreckung auf alle wesentlichen Entscheidungen auch im Nicht-Eingriffsbereich. Darin kommt die zentrale Rolle des parlamentarisch beschlossenen Gesetzes für das Funktionieren des Verfassungssystems zum Ausdruck.[64] Demokratie wie Rechtsstaat hängen von ihm ab. Der Gesetzesvorbehalt bewirkt, dass das staatliche Handlungsprogramm aus einem demokratischen Meinungs- und Willensbildungsprozess hervorgeht. Das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung un46terwirft die staatliche Exekutive dem demokratisch formulierten Willen und macht das staatliche Verhalten für die Betroffenen kalkulierbar. Anhand des Gesetzes kann schließlich die Justiz die Rechtmäßigkeit des Staatshandelns überprüfen und rechtswidrige Akte korrigieren.