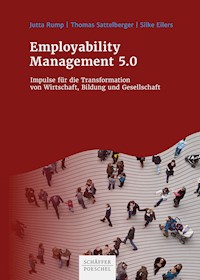Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Niemals zuvor waren Bildung und Kompetenzentwicklung ein so entscheidender Wettbewerbsfaktor und Karriere ein so facettenreicher Begriff wie heute. Das Buch beschreibt zentrale Trends und Entwicklungslinien der vergangenen 50 Jahre, die maßgeblichen Einfluss auf Bildung und Lernen genommen haben. Dabei erfolgt eine Differenzierung in ökonomische, technologische, demografische, politische und gesellschaftliche Trends. Außerdem widmet sich das Buch der Frage, wie sich die beschriebenen Trends und Entwicklungen auf die Konzeption von Bildungsangeboten und Karriereverläufen im öffentlichen Bereich, insbesondere aber auch im Unternehmenskontext, ausgewirkt haben. Es folgt der Blick in die Zukunft: Auf Basis einer wissenschaftlichen Untersuchung legen die Autorinnen dar, wie Bildung und Lernen künftig ausgestaltet sein müssen, um den Herausforderungen der Zukunft sowohl als Einzelne:r als auch als Unternehmen gut gerüstet gegenüberzustehen. Prof. Dr. Jutta Rump gehört zu den "40 führenden Köpfen des Personalwesens" und den 8 wichtigsten Professor:innen für Personalmanagement im deutschsprachigen Raum
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[7]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumVorwortTeil I Einordnung von »Future Learning« in zentrale Entwicklungen und deren Implikationen1 Zentrale Treiber in Bezug auf Bildung und Lernen1.1 Bildungspolitik1.1.1 Umgestaltung des Bildungswesens1.1.2 Öffentliche Weiterbildungsförderung1.2 Demografie 1.2.1 Einflussfaktoren des demografischen Wandels1.2.2 Verlängerung der Lebensarbeitszeit1.2.3 Verknappung der Jüngeren und der Personen im erwerbsfähigen Alter1.2.4 Generationendiversität1.3 Gesellschaft1.3.1 Individualisierung und Multioptionsgesellschaft 1.3.2 Wertewandel und Life-Balance1.3.3 Zunehmende Vielfalt in der Gesellschaft1.3.4 Veränderung des Gesundheitsbewusstseins1.3.5 Entwicklung zu mehr Partizipation und Demokratisierung1.4 Ökonomie1.4.1 Globalisierung1.4.2 Entwicklung zur VUCA-Welt1.4.3 Wissens- und Innovationsgesellschaft1.5 Technologie1.5.1 Grundsätzliches zur digitalen Transformation1.5.2 Internet und Konnektivität1.5.3 Künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung, Robotics sowie Augmented und Virtual Reality1.6 Zusammenfassende Betrachtung2 Effekte der Treiber mit Blick auf »Future Learning«2.1 Quantitative Beschäftigungseffekte2.1.1 Ein kurzer Blick zurück: Strukturwandel und Arbeitsmarktentwicklungen2.1.2 Der Einfluss der Digitalisierung2.1.3 Substituierbarkeitspotenziale im Zuge der Digitalisierung2.1.4 Entstehung neuer Tätigkeiten2.1.5 Quantitative Beschäftigungseffekte nach Funktionsbereichen2.2 Qualitative Beschäftigungseffekte – Welche Kompetenzen werden gebraucht?2.2.1 Kompetenzanforderungen – Entwicklungen seit den 1970er Jahren2.2.2 Studie »Future Skills – Welche Kompetenzen in Deutschland fehlen«2.2.3 Skill Shift – Automation and the future of the workforce 2.2.4 The Future of Jobs Report2.2.5 Future Skills – The Future of Learning and Higher Education International Delphi Survey 2.2.6 DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe 2.3 Bildungseffekte2.3.1 Wandel des Bildungsverständnisses2.3.2 Entwicklungen im Berufswahlverhalten2.3.3 Entwicklung der Bildungslandschaft2.3.4 Polarisierung der Bildungsverhältnisse2.3.5 Renaissance der Beschäftigungsfähigkeit (Employability)2.4 Zusammenfassende BetrachtungTeil II Die Zukunft von Bildung und Lernen3 Status quo: Wo steht das betriebliche Lernen heute?3.1 Weiterbildungsaktivitäten in Unternehmen3.2 Erwachsende Lernende: Motivation, wahrgenommene Unterstützung und Kompetenzen3.2.1 Motivation zum lebenslangen Lernen3.2.2 Wahrgenommene Unterstützung seitens der Arbeitgeber3.2.3 Ausprägung zukunftsrelevanter Kompetenzen3.3 Zusammenfassende Betrachtung4 Digitalisierung des Lernens4.1 Überblick über gängige digitale/E-Learning-Instrumente und -Konzepte4.1.1 Blended Learning und hybrides Lernen4.1.2 Digitale Bildungsmedien4.2 Verbreitung von digitalem Lernen4.3 Zusammenfassende Betrachtung4.3.1 Vorteile des digitalen Lernens4.3.2 Herausforderungen des digitalen Lernens5 Zentrale Anforderungen an zukünftiges Lernen in allgemein- und berufsbildenden Institutionen5.1 Schule5.2 Hochschule5.3 Ausbildung (Berufsschule)5.4 Weiterbildung außerhalb des Betriebs5.5 Lehrende in Bildungsinstitutionen5.6 Zusammenfassende Betrachtung6 Zentrale Anforderungen an zukünftiges Lernen im Betrieb: Prinzipien und Gestaltungshinweise für Future Learning 6.1 Grundprinzipien für betriebliches Lernen6.1.1 Lebensphasenorientierung und Life-Balance6.1.2 Diversity-Orientierung und Individualisierung6.1.3 Orientierung am Grundsatz der Nachhaltigkeit6.2 Zielgruppen betrieblicher Bildung6.3 Bezugsrahmen für Future Learning auf betrieblicher Ebene: Ausrichtung am Konzept des Employability Managements6.3.1 Unternehmenskultur6.3.2 Führung6.3.3 Arbeitsorganisation6.3.4 Personalentwicklung6.3.5 Schaffung von Motivation und Aufmerksamkeit für Lernprozesse6.3.6 Transfer des erworbenen Wissens in gelebte Kompetenz und nachhaltige Sicherung des Lernerfolgs6.4 Zusammenfassende BetrachtungTeil III Stimmen aus der Praxis7 Kompetenzen für die Arbeitswelt von morgen – Schlussfolgerungen für die quantitative und qualitative Ressourcenplanung 7.1 Schlussfolgerungen für die quantitative Ressourcenplanung 7.2 Schlussfolgerungen für die qualitative Ressourcenplanung 7.3 Verlinkung mit HR-Kernaktivitäten8 »Future of Learning & Development« in Zeiten der (digitalen) Transformation am Beispiel TRUMPF9 Lerne lieber vernetzt: Innovation beginnt bei den eigenen Mitarbeitenden9.1 Gut lernen, heißt vernetzt lernen9.2 Erstmalʼn Workshop? – Ok. Aber dann auch kontinuierlich lernen9.3 Offenheit und Lernbereitschaft schlagen Erfahrung und Lebenslauf9.4 Fazit10 Führung neu lernen10.1 Führung entwickelt sich weiter!10.2 Wie muss sich Führung weiterentwickeln und wohin?10.3 Der Weg der VPV: über die Leadership-Werkstätten zum Leadership-Camp – ein iterativer Prozess10.4 Fazit und Ausblick11 Bilden wir junge Menschen wirklich gut auf die Herausforderungen des 21. Jahrhundert hin aus? Oder halten wir uns zu stark an klassischen Vorstellungen, am Modus der Erfahrung, fest?11.1 Die Schlüsselgenerationen, um Welt- und Wirtschaftsprobleme zu lösen11.2 Monokulturen in Entscheiderkreisen bremsen uns aus11.3 Denkdiversität als Lösung, um den Modus der Erfahrung zu verlassen11.4 Wenn die Politik zu lange pennt 11.5 (Qualifizierte) Arbeitskraft wird zum mangelnden Rohstoff der Zukunft11.6 Mangelnder Mut und Experimentierfreude in Deutschland11.7 Die Spielregeln in der Welt verändern sich11.8 Erfolg der Zukunft: technologische Intelligenz plus menschliche IntelligenzLiteraturverzeichnisSachwortverzeichnisÜber die BuchautorinnenÜber die Gastautor*innenHinweis zum Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft - Steuern - Recht GmbH
[4]Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-4969-4
Bestell-Nr. 10564-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-4970-0
Bestell-Nr. 10564-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-4971-7
Bestell-Nr. 10564-0150
Jutta Rump/Silke Eilers
Die Zukunft des betrieblichen Lernens
1. Auflage, Juli 2021
© 2021 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
www.schaeffer-poeschel.de
Bildnachweis (Cover): © Boris SV, gettyimages
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Lektorat: Dr. Angelika Schulz, Zülpich
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
Ein Unternehmen der Haufe Group
[5]Vorwort
Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel – eine seit Jahren häufig zu lesende Aussage, die nicht selten Arbeitgeber wie Arbeitnehmer*innen ratlos zurücklässt. Auch wenn bestimmte Auswirkungen dieses Wandels bereits heute spürbar sind – zu denken ist an veränderte Beschäftigungsmodelle und Arbeitsverhältnisse –, erscheinen andere doch noch vergleichsweise abstrakt, wie beispielsweise die Implikationen der digitalen Transformation. Insbesondere wenn es darum geht, sich adäquat auf diesen bevorstehenden beziehungsweise in Teilen bereits vollzogenen Wandel vorzubereiten, fehlt es auf beiden Seiten nicht selten an einer klaren Strategie. Dies bezieht sich nicht zuletzt darauf, wie das Lernen für die Zukunft und in der Zukunft, also »Future Learning«, aussehen kann und soll. Das vorliegende Buch zeigt einen Orientierungsrahmen auf. Hierfür gilt es zunächst, die Thematik des Lernens in den Kontext der zentralen Trends und Entwicklungen in unserer Arbeitswelt zu stellen. Dies schließt auch einen kurzen Blick zurück mit ein. Wie hat sich unsere Lernkultur entwickelt? Welche Erfahrungen haben unser Verständnis von Lernen, Lehren und Bildung geprägt? Es folgen die Betrachtung der Art und Weise, in der wir heute lernen, und der Blick in die Zukunft, die an einigen Stellen in Institutionen und Unternehmen bereits begonnen hat.
Um Empfehlungen für »Future Learning« geben zu können, ist auch die Frage zu stellen, worauf Lernen uns vorbereiten soll – in vielerlei Hinsicht. Welche Kompetenzen sind erfolgskritisch in der Arbeitswelt von morgen, welche Berufsbilder und Tätigkeitsprofile haben Bestand, welche werden neu hinzukommen oder auch wegfallen? Es wäre vermessen zu glauben, eindeutige Antworten auf all diese Fragen geben zu können. Dies hat die von der Corona-Pandemie ausgelöste Krise sehr deutlich vor Augen geführt – innerhalb weniger Monate ereigneten sich disruptive Veränderungen, wie sie sich so wohl kaum jemand hätte vorstellen können. Vieles, was selbstverständlich schien, wurde plötzlich in Frage gestellt. Und doch lassen sich Tendenzen ableiten, die uns dabei helfen können, Lernen so zu gestalten und Lernende so zu befähigen, dass eine möglichst hohe Passgenauigkeit zwischen den Erfordernissen der Arbeitswelt und den Kompetenzen jedes und jeder Einzelnen erreicht wird – heute und in Zukunft. Dabei sind Arbeitgeber ebenso in der Pflicht wie wir als Individuen – in einem Wechselspiel aus Eigen- und Fremdverantwortung. Empfehlungen sind dabei gleichermaßen für das betriebliche Lernen und Lehren auszusprechen, auf das dieses Buch sein hauptsächliches Augenmerk legt, als auch für die Bildungspolitik, die letztlich gerade im Bereich von Schule und Ausbildung das Fundament für unser Lernen bildet. Nicht zuletzt kommen Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis zu Wort, die ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu bestimmten Aspekten des Lernens und Lehrens mit uns teilen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Jutta Rump und Silke Eilers
[11]Teil I Einordnung von »Future Learning« in zentrale Entwicklungen und deren Implikationen
Um sich der Frage zu nähern, wie »Future Learning«, also Lehr- und Lernkonzepte, und ein adäquates Lernverhalten für die Zukunft aussehen sollten, wird zunächst ein kurzer Blick darauf geworfen, wie sich das Verständnis von Lernen und Bildung über die vergangenen Jahrzehnte verändert hat und welche Treiber damals und heute die Weichen für »Future Learning« stell(t) en. Hier stehen
Bildungspolitik (s. Abschn. 1.1),
Demografie (s. Abschn. 1.2),Gesellschaft (s. Abschn. 1.3),Ökonomie (s. Abschn. 1.4) undTechnologie (s. Abschn. 1.5)gleichermaßen im Fokus.
Darauf aufbauend ergeben sich insbesondere die folgenden Effekte:
quantitative Beschäftigungseffekte (s. Abschn. 2.1),qualitative Beschäftigungseffekte(s. Abschn. 2.2), sowieBildungseffekte (s. Abschn. 2.3).Abbildung 1 gibt einen Überblick.
Abb. 1: Future Learning im Kontext zentraler Treiber und Effekte (eigene Darstellung)
[13]1Zentrale Treiber in Bezug auf Bildung und Lernen
Für viele Beschäftigte und ihre Arbeitgeber stellt es heute eine Selbstverständlichkeit dar, sich für ein langes Erwerbsleben mit der entsprechenden Qualifizierung zu rüsten, die eigenen Kompetenzen beständig zu hinterfragen und sich wandelnden Bedingungen anzupassen. Individualisierte Konzepte zielen auf ein gleichberechtigtes Fordern und Fördern ab, und jedem bzw. jeder Einzelnen stehen unterschiedliche Optionen offen, sich in der persönlichen Lebens- und Berufssituation optimal entwickeln zu können. Doch das war nicht immer so: Zahlreiche, teils widersprüchliche Paradigmen haben Bildung, Lernen und Lehren in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland geprägt. Einige haben seither Bestand, andere kamen neu hinzu, wieder andere verschwanden im Zeitverlauf wieder. Viele Aspekte der heutigen Bildungs- und Karrierepfade sind aktuellen und vorangegangenen Trends geschuldet, gewissermaßen als eine unmittelbare Reaktion auf Impulse von außen. Zu denken ist hier beispielsweise an die Digitalisierung als eine der jüngsten und tiefgreifendsten Entwicklungen. Andere Aspekte jedoch sind das Ergebnis jahrzehntelanger, insbesondere gesellschaftlicher Umbrüche wie zum Beispiel die zunehmenden Bestrebungen nach Diversity und Individualisierung. Um verstehen und einordnen zu können, worauf unser heutiges Bildungsverständnis basiert und wie Lernen heute und in Zukunft beschaffen sein muss, um den Herausforderungen an Individuen und Unternehmen gerecht zu werden, ist der Blick auf (bildungs-)politische, demografische, gesellschaftliche, ökonomische und technologische Trends unerlässlich. Dabei wird eines ganz besonders deutlich: Niemals zuvor war Bildung und Kompetenzentwicklung ein so entscheidender Wettbewerbsfaktor und Lernen ein so facettenreicher Begriff wie heute (Rump u. Eilers 2019).
1.1Bildungspolitik
In Bezug auf die zentralen Weichenstellungen in der Bildungspolitik, die Einfluss auf Bildung und Lernen nahmen und nehmen, stehen vor allem die Umgestaltung des Bildungswesens sowie die Entwicklung der öffentlichen Weiterbildungsförderung im Fokus.
1.1.1Umgestaltung des Bildungswesens
In diesem Kontext ist insbesondere die Bildungsreform 1970 hervorzuheben. Deren zentralen Ziele waren (Liebenwein 2019):
das Recht auf Bildung für alle entsprechend ihrer Begabungen zur Herstellung von Chancengleichheit (insbesondere umgesetzt durch die Stärkung des Unterrichtsprinzips der Differenzierung und Individualisierung),die Schaffung eines demokratischen, leistungs- und reformfähigen Bildungssystems,[14] eine bessere Abstimmung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem,die Umsetzung der Erziehungszieledemokratische Mitwirkung, Partizipation, Emanzipation, kritische Reflexionsfähigkeit, Mündigkeit, Selbstbestimmung, Kreativität und individuelle Initiative (insbesondere umgesetzt durch eine Umstrukturierung der Unterrichtsorganisation hin zu mehr offenen, sozialen Lernformen sowie problemlösendem und entdeckendem Lernen) sowiedie Förderung der Bereitschaft zu lebenslangem Lernen durch Weckung der Lernfreude.In der Konsequenz verdoppelten sich zwischen 1960 und 1975 die Zahlen der Lernenden an Gymnasien, ebenso erhöhte sich die Erfolgsquote an Gymnasien. Auch die Zahl der Studierenden verdreifachte sich (ebd.). Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote von Menschen ohne Schulabschluss sprunghaft an.
Langfristig ist eher eine ernüchternde Bilanz zu ziehen. Die mit der Bildungsreform angestrebte Chancengleichheit wurde nicht flächendeckend erreicht, die Passung zwischen Schul- und Beschäftigungssystem ist nach wie vor nicht optimal, und auch das ursprüngliche Ziel, dass die Gesamtschule als Einheitsschule das dreigliedrige Schulsystem komplett ablösen sollte, wurde in keinem einzigen Bundesland erreicht. Vielmehr wird ein Verfall des Bildungsanspruchs, vor allem an Gymnasien, durch die Erosion der Schulform »Hauptschule« beklagt (ebd.).
In engem Zusammenhang hierzu steht auch das Streben nach einer größeren Durchlässigkeit1 im Bildungssystem, das bereits in den 1960er Jahren artikuliert wurde. In den 1970er Jahren entstand die Forderung nach einer »sozialen Öffnung der Hochschulen« für mehr soziale Gerechtigkeit in der Verteilung der Studienchancen. Ausgang der 1980er wurde die Forderung nach einer institutionellen Umsetzung des Postulats der Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung lauter, doch erst Anfang der 1990er Jahre entstand das letztendliche Konzept der Gleichwertigkeit zwischen den beiden Bildungswegen. Der entscheidende Impuls kam schließlich von der damaligen Europäischen Gemeinschaft mit dem im Jahr 2000 veröffentlichen »Memorandum über Lebenslanges Lernen«, in dem insbesondere ein verbesserter Zugang zu Bildung und Bildungsabschlüssen für alle Bevölkerungsgruppen gefordert wurde, sowie der Empfehlung zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen durch das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union im Jahr 2008. 2009 beschloss die Kultusministerkonferenz eine weitgehende Neuregelung des Hochschulzugangs für berufliche qualifizierte Bewerber*innen ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung. 2013 schließlich einigten sich Bund und Länder in Deutschland auf die Einführung des »Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen – DQR«, in dem die Qualifikationen des deutschen Bildungssystems in acht unterschiedliche Niveaus [15]eingeordnet wurden (BiBB o.A.; Vogel 2017; Wolter 2013). Gerade in jüngster Zeit rückt die Durchlässigkeit wieder stärker in den Fokus – insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Fachkräftebedarfe, aber auch der gesellschaftlichen Forderung nach einer stärkeren Individualisierung und der im Zuge der Digitalisierung stark im Wandel befindlichen Qualifikationsanforderungen. Wenngleich die zunehmende Akademisierung nicht nur gesellschaftlich erwünscht ist, sondern auch politisch gefördert wurde, gehen nun die Bemühungen angesichts eines drastischen Rückgangs der Auszubildendenquote dahin, einen »Konkurrenzkampf« zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu verhindern, indem durch eine Annäherung der Bereiche die Vorteile beider Ausbildungswege genutzt werden können (Vogel 2017).
Hauptziele einer erhöhten Durchlässigkeit sind
die Gestaltung wechselseitiger Übergänge zwischen Berufsbildung und Hochschule (reziproke Durchlässigkeit),die Entwicklung innovativer, bereichsübergreifender Bildungsgänge mit Gültigkeit in Berufsbildung und Hochschule (konvergente Durchlässigkeit),die Kombination beruflicher und hochschulischer Bildungs- und Lernformen (hybride Durchlässigkeit) sowiedie Verbesserung der Chancengerechtigkeit im Bildungssystem und Anerkennung von erworbenen Kompetenzen (BiBB o.A.; Vogel 2017).Es ist allerdings zu konstatieren, dass die Effekte der Durchlässigkeitsbestrebungen bislang eher moderat ausgefallen sind. In der Konsequenz besteht nach wie vor erhöhter Handlungsbedarf in Bezug auf das Schnittstellen- und Übergangsmanagement, die Anerkennung und Anrechnung von Abschlüssen (unter anderem Fragen des Hochschulzugangs und der Hochschulzulassung) sowie die Information und Beratung. Zudem sollten noch mehr flexible Formate für ein Studium, zum Beispiel berufsbegleitend, online oder über ein Fernstudium, angeboten werden, die es bereits Berufstätigen erleichtern, diesen Weg einzuschlagen (BiBB o.A.; Wolter et al. 2014).
1.1.2Öffentliche Weiterbildungsförderung
Noch bis zu Beginn der 1970er Jahre fokussierten die beitragsfinanzierten Leistungen der beruflichen Weiterbildung insbesondere auf den beruflichen Aufstieg. Die dann aber rasch ansteigende Arbeitslosigkeit und damit verbundene Notwendigkeit, steigenden Teilnehmerzahlen an beruflicher (Um-)Qualifizierung gerecht zu werden, führten allerdings Mitte der 1970er Jahre bereits zu einer deutlichen Aufstockung der Beitragsmittel zur Weiterbildungsförderung durch Bundesmittel.
[16]Grundsätzlich erfolgte mit Beginn der 1970er Jahre erstmals der Wandel von einem rein aufklärerischen Bildungsbegriff zu einer engen Verknüpfung von Bildung und Qualifikation mit der wirtschaftlichen Standortfrage, was sich auch auf die Aufwertung und Neuausrichtung der beruflichen Weiterbildung auswirkte. Diese hatte nun insbesondere zum Ziel, zuvor entstandene Lerndefizite zu kompensieren und dafür Sorge zu tragen, dass eine entsprechende Anpassung der Kompetenzen an den technologischen und wirtschaftlichen Strukturwandel gewährleistet war (Baethge et al. 2003).
Anfang der 1990er Jahre wurden in großem Umfang Mittel der Arbeitsförderung und speziell der beruflichen Qualifizierung eingesetzt, um Erwerbstätige aus den neuen Bundesländern in einer breit angelegten Qualifizierungsoffensive auf die neuen Anforderungen vorzubereiten. Hintergrund war die Feststellung, das Beschäftigungssystem der damaligen DDR weise einen etwa 20-jährigen Rückstand gegenüber dem der damaligen Bundesrepublik auf. Die sogenannte Hartz-Reform im Rahmen der Agenda 2010 brachte den Grundsatz »Fördern durch Fordern« auf. Dabei veränderten sich insbesondere die Bedingungen der beruflichen Weiterbildungsförderung. So wurden fortan seitens der Arbeitsagenturen auf drei Monate begrenzte sogenannte Bildungsgutscheine an den infrage kommenden Personenkreis ausgegeben, in denen die Bildungsziele und die Maßnahmendauer festgelegt waren. Zudem wurden Bildungsmaßnahmen nur noch dann durch die damaligen Arbeitsämter unterstützt, wenn sowohl die Maßnahme selbst als auch der Bildungsträger von einer unabhängigen, akkreditierten Stelle zugelassen worden waren. In der Folge kam es zu einem stärkeren Konkurrenzdruck unter den Weiterbildungseinrichtungen und einer deutlichen Reduzierung der Teilnehmerzahlen und des Finanzierungsvolumens, insbesondere in den neuen Bundesländern (Dobischat 2004; Schneider u. Uhlendorff 2006).
Heute sind zentrale Instrumente der öffentlichen Weiterbildungsförderung Bildungsgutscheine für Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen, Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine, Förderungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (sog. »Meister-BAföG«), die Bildungsprämie und Bildungsgutscheine für Beschäftigte. Die letztgenannten Gutscheine stehen in Zusammenhang mit dem Programm »Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer*innen in Unternehmen« (WeGebAU), über das die Bundesagentur für Arbeit unter bestimmten Voraussetzungen zum einen geringqualifizierte Beschäftigte dabei fördert, einen anerkannten Berufsabschluss oder eine anschlussfähige Teilqualifikation zu erwerben, und zum anderen ältere Beschäftigte in kleinen und mittelständischen Betrieben bei der Teilnahme an Weiterbildungen unterstützt, die über die Vermittlung arbeitsplatzbezogener Kenntnisse und Fertigkeiten hinausgehen (Ambos et al. 2016). Das Anfang des Jahres 2019 in Kraft getretene Qualifizierungschancengesetz soll die Weiterbildungsförderung beschäftigter Arbeitnehmer*innen verbessern, »deren berufliche Tätigkeiten durch Technologien ersetzt werden können, die in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen sind oder die eine berufliche Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben« (BMBF 2019, S. 95). Diese Möglichkeit besteht für alle Arbeitnehmer*innen, unabhängig von ihrer Ausbildung, ihrem Lebensalter und der Größe [17]des Betriebs, in dem sie tätig sind. Lehrgangskosten und Zuschüsse zum Arbeitsentgelt werden durch die Arbeitsagenturen bzw. Jobcenter übernommen2 (BMBF 2019).
Auf einen Blick
Implikationen für Future Learning
Umgestaltung des Bildungswesens hin zu mehr Durchlässigkeit und Chancengleichheit,Hauptziele: Gestaltung wechselseitiger Übergänge zwischen Berufsbildung und Hochschule (reziproke Durchlässigkeit), Entwicklung innovativer, bereichsübergreifender Bildungsgänge mit Gültigkeit in Berufsbildung und Hochschule (konvergente Durchlässigkeit), Kombination beruflicher und hochschulischer Bildungs- und Lernformen (hybride Durchlässigkeit) sowie Verbesserung der Chancengerechtigkeit im Bildungssystem und Anerkennung von erworbenen Kompetenzen,zunehmende öffentliche Förderung der Weiterbildung.1.2Demografie
Der Blick auf die demografische Entwicklung in Deutschland zeigt, dass insbesondere die Veränderung der Altersstruktur – weg von einer jüngeren und hin zu einer zunehmend alternden Bevölkerung – Einfluss auf die Entwicklung von Belegschaften und Zielgruppen von Bildung nimmt. Seit den 1970er Jahren steigt das Medianalter der Bevölkerung, und auch die Veränderung des Altenquotienten spricht eine deutliche Sprache3 (Statistisches Bundesamt 2015a), wie Tabelle 1 zeigt.
JahrMedianalter der Bevölkerung in JahrenAltenquotient197033,825198036,227199037,124200039,627201044,134Tab. 1: Medianalter und Altenquotienten (eigene Darstellung mit Zahlen aus: Statistisches Bundesamt 2015a)
Auch das Bildungssystem wird seit Jahrzehnten von demografischen Prozessen geprägt – sowohl direkt als auch indirekt. Direkte Effekte sind beispielsweise die Geburtenzahl oder die Altersstruktur in der Bevölkerung, die Einfluss auf die Zahl der Bildungsteilnehmer*innen in den verschiedenen Stufen des Bildungssystems sowie deren Zusammensetzung im Hinblick [18]auf Altersgruppen und Sozialstruktur nehmen. Dabei können sich deutliche regionale Unterschiede, auch im Hinblick auf die Bildungsnachfrage und den Qualifikationsbedarf, ergeben. Der indirekte Einfluss der demografischen Entwicklung auf das Bildungssystem vollzieht sich vorrangig über den Arbeitsmarkt, der seinerseits durch die quantitative und qualitative Arbeitsnachfrage gewisse Anforderungen und Erwartungen an das Bildungssystem generiert. Umgekehrt wird allerdings auch der Arbeitsmarkt vom Bildungssystem beeinflusst. Als Beispiel sei hier die erhöhte Erwerbsbeteiligung von Frauen als Folge einer wachsenden Bildungsbeteiligung und gestiegener Bildungsabschlüsse genannt (Seeber et al. 2013; Rump u. Eilers 2019).
1.2.1Einflussfaktoren des demografischen Wandels
Die drei zentralen Einflussfaktoren des demografischen Wandels sind die Geburtenrate, die Lebenserwartung und die Zuwanderung. Während die ersten beiden Faktoren vergleichsweise gut vorhersehbar bzw. berechenbar sind, schwankt die Zuwanderung stark. Jüngstes Beispiel ist die unmittelbar nach der 13. koordinierenden Bevölkerungsvorausberechnung einsetzende Flüchtlingswelle des Jahres 2015, die weit über den getroffenen Annahmen zur Zuwanderung lag. In der Folge zeigt sich, dass die Vorausberechnungen und die tatsächliche Bevölkerungszahl vor allem bei den jüngsten Kohorten stark auseinander gehen, während die Zahl der 45- bis 70-Jährigen vergleichsweise gut getroffen ist. Hier schlägt sich nieder, dass die Zuwander*innen nahezu ausschließlich jüngeren Altersgruppen angehörten und sich viele von ihnen im Familiengründungsalter befanden, sodass sich dies auch auf die Zahl der Geburten auswirkte. Insgesamt ist festzuhalten, dass zwar die absolute Bevölkerungszahl nicht den Vorausberechnungen entspricht, die Alterung sich jedoch wie erwartet einstellt. Dennoch lässt sich auch nicht mit Sicherheit vorhersagen, inwieweit die höheren Bevölkerungszahlen längerfristig Bestand haben werden (Slupina 2018). Des Weiteren ist auch Vorsicht dabei geboten, durch den massiven Zuzug vorschnell eine Lösung des demografischen Problems im Hinblick auf drohende Fachkräfteengpässe in Deutschland zu erwarten. Denn die rein quantitative Betrachtung der demografischen Entwicklung muss auch um eine qualitative Betrachtung ergänzt werden. So lässt sich trotz aller Bemühungen nicht von der Hand weisen, dass die vollständige Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt aufgrund sprachlicher, qualifikatorischer und kultureller Barrieren erst mit einer gewissen Zeitverzögerung erfolgen wird.
Die Geburtenrate in Deutschland hat sich in jüngster Zeit positiver entwickelt als erwartet und liegt derzeit wieder gleich hoch wie im Jahr 1972. Dies liegt zum einen in den o. g. Entwicklungen begründet, zum anderen in einem sogenannten Echoeffekt, da derzeit die Kinder der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge deren Enkelkinder zur Welt bringen (ebd.). Dennoch sterben nach wie vor – und das ebenfalls bereits seit dem Jahr 1972 – mehr Menschen als Kinder geboren werden (Statistisches Bundesamt 2017a).
[19]Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt aktuell bei rund 80 Jahren. Ein Anstieg auf rund 85 Jahre bis zum Jahr 2050 wird prognostiziert. Allerdings wird kontrovers diskutiert, inwieweit sich der Trend zu einer steigenden Lebenserwartung ungebrochen fortsetzen wird. Hier spielen auch Faktoren wie der sozioökonomische Status oder der Bildungsstand eine zunehmende Rolle (Slupina 2018).
1.2.2Verlängerung der Lebensarbeitszeit
Während die Erwerbsbeteiligung der 55- bis 64-jährigen Männer im Jahr 1970 noch bei 84 % lag (bei Frauen galt dies lediglich für 30 %), war in den darauffolgenden zwanzig Jahren ein ständiger Rückgang dieser Quote zu beobachten, der 1990 einen gewissermaßen historischen Tiefstand erreichte, wie Abbildung 2 zeigt. Dieser Rückgang ist insbesondere auf den Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt und die großzügigere Ausgestaltung von Frühverrentungsmöglichkeiten in diesem Zeitraum zurückzuführen (BIB 2018). Etwa seit der Jahrtausendwende steigt der Anteil sowohl 55- bis 64-jähriger Frauen als auch Männer an den Erwerbstätigen stetig an und erreichte 2014 erstmals eine nahezu ausgeglichene Bilanz zum Anteil der 20- bis 25-Jährigen. Zu deren Anteil ist zu konstatieren, dass dieser nicht nur aufgrund demografischer Entwicklungen gesunken ist, sondern vielmehr auch wegen der Tendenz zur Akademisierung und des dadurch immer längeren Verbleibs im Bildungssystem.
Abb. 2: Entwicklung der geschlechtsspezifischen Erwerbstätigenquote bei den 55- bis 64-Jährigen von 1970 bis 2015 (BIB 2018)
[20]Einen nicht unerheblichen Einfluss auf diese Entwicklungen nahmen die Rentenreformen der vergangenen dreißig Jahre. Zu einer umfassenden Reform kam es zunächst im Jahr 1992, wobei unter anderem die schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 65 Jahre festgesetzt und gleichzeitig mit der Einführung einer Teilrente die Möglichkeit eines flexiblen Übergangs in die Rente geschaffen wurde. Bis zum Jahr 2009 wurde der vorzeitige Ausstieg aus dem Erwerbsleben finanziell durch die Bundesagentur für Arbeit gefördert. Genutzt wurde diese Option von einer Vielzahl von Arbeitnehmer*innen, überwiegend im sogenannten Blockmodell. Heute ist eine solche Altersteilzeit – wahlweise im Blockmodell oder in Form einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit – nur dann möglich, wenn der Arbeitgeber sie anbietet und entsprechend unterstützt. In einigen Branchen wurden hierfür Tarifabschlüsse auf Basis der zuvor geltenden finanziellen Konditionen getroffen. 2014 bezogen zwei Drittel der Neuzugänge von Versichertenrenten vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze von 65 Jahren eine vorgezogene Altersrente oder eine Erwerbsminderungsrente (Bäcker u. Kistler 2016). Das Flexirentengesetz bietet seit 2017 älteren Beschäftigten mehr Anreize, über das Rentenalter hinaus zu arbeiten – mit gedrosselter Stundenzahl und flexibler Teilrente (ebd.; Deutsche Rentenversicherung Bund 2014 u. 2019). Die Entwicklung stellt Abbildung 3 grafisch dar.
Speziell für die 60- bis 64-Jährigen zeigt sich, dass der Anteil der Beschäftigten in dieser Altersgruppe von 27,6 % im Jahr 2008 auf 51,7 % im Jahr 2018 angestiegen ist und sich bei den 65-bis 69-Jährigen im gleichen Zeitraum der Anteil der Beschäftigten von 4,1 % auf 11,3 % erhöht hat (Statistisches Bundesamt 2019a). In einer Umfrage der XING AG geben 58 % der Teilnehmer*innen an, damit zu rechnen, auch nach Eintritt des regulären Rentenalters beruflich aktiv zu bleiben (XING 2018). 37 % der Erwerbstätigen ab 65 Jahre sind selbstständig, 63 % abhängig beschäftigt. Darunter findet sich eine hohe Zahl an sogenannten Minijobbern (Statistisches Bundesamt 2019a). Befragungen zu den Gründen für die Fortführung einer Erwerbstätigkeit auch nach Erreichen des Rentenalters zeigen übereinstimmend, dass es weniger der finanzielle Aspekt alleine ist, der die Menschen treibt, sondern vielmehr eine Kombination unterschiedlicher Beweggründe wie der Spaß an der Arbeit, das Pflegen sozialer Kontakte oder die Strukturierung des Tagesablaufs (u. a. Deller u. Maxin 2008; Scherger et al. 2012; Hagemann et al. 2017). Es gibt also eine wachsende Zahl gut ausgebildeter Menschen, die sich vorstellen können, über das Renteneintrittsalter hinaus beruflich aktiv zu sein – wenngleich nicht zwangsläufig in den gleichen Strukturen beziehungsweise im gleichen zeitlichen Umfang oder auf der gleichen Hierarchieebene wie bisher.
Als Reaktion auf die Verlängerung der Lebensarbeitszeit lässt sich auch eine steigende Weiterbildungsteilnahme der 50- bis 64-Jährigen feststellen, am stärksten bei den 60- bis 64-Jährigen (Anstieg um 14 % zwischen 2007 und 2012). 2014 beteiligten sich 39 % der 55- bis 64-Jährigen an Weiterbildung – ein Wert, der in den 1970er oder 1980er Jahren noch undenkbar gewesen wäre (Bilger et al. 2017; DIE 2017; BMBF 2015).
Abb. 3: Durchschnittliches Rentenzugangsalter 1993–2019 (IAQ 2019a)
[22]1.2.3Verknappung der Jüngeren und der Personen im erwerbsfähigen Alter
Während es 2018 in Deutschland noch 51,8 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter (20–66 Jahre) gab, wird sich diese Zahl bis 2035 auf 45,8 bis 47,4 Millionen (abhängig von der Art des Szenarios bezüglich Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Nettozuwanderung) reduzieren. Danach folgt eine Phase der Stabilisierung, bevor die Zahl 2060 auf 40 bis 46 Millionen (abhängig von der Nettozuwanderung) absinkt (Statistisches Bundesamt 2019b).
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Alter bis 18 Jahre wird bis zum Jahr 2030 voraussichtlich zunächst weiter steigen. Je nach Nettozuwanderung und Geburtenrate sind anschließend unterschiedliche Szenarien denkbar. Eine Stabilisierung wäre bei einer steigenden Geburtenhäufigkeit möglich, für eine Steigerung bedürfe es zusätzlich eines dauerhaft hohen Wanderungssaldos von durchschnittlich mehr als 300.000 Personen pro Jahr. Ausgehend von einer eher moderaten Entwicklung beziehungsweise einem Sinken der Geburtenhäufigkeit würde nach 2030 die Zahl junger Menschen wieder abnehmen (ebd.).
Es liegt somit auf der Hand, dass sich die heute bereits in vielen Bereichen erkennbaren Knappheiten in Bezug auf Nachwuchs- und Fachkräfte mittel- bis langfristig noch weiter verschärfen werden. Die Diskussion um den Fachkräftebedarf muss um die sogenannte Mismatch-Problematik ergänzt werden. Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Fachkräftebedarf deutet auf ein Mismatch hin. Mismatch ist definiert als Ungleichgewicht zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage. Dabei ist zu unterscheiden zwischen einem qualifikatorischen Mismatching, wenn die Qualifikation der potenziellen Bewerber*innen nicht zu den Anforderungen der offenen Stellen passt, sowie einem regionalen Mismatching, wenn die räumliche Distanz zwischen den zu besetzenden Stellen und den Arbeitssuchenden nicht überwunden werden kann (Bauer u. Gartner 2014; Prognos 2015). Hinzu kommt der zeitliche Aspekt: Nicht selten entsteht ein Mismatch auch dadurch, dass die zeitliche Verfügbarkeit der potenziellen Kandidat*innen und die betrieblichen Erfordernisse des Unternehmens nicht zusammenpassen. Wann und in welchem Umfang einzelne Betriebe von Engpässen in Bezug auf das verfügbare Nachwuchs- und Arbeitskräftepotenzial betroffen sein werden bzw. ob sie es schon heute sind, hängt von mehreren Faktoren ab, wie der räumlichen Lage, der Branche und den gesuchten Kompetenzen. Von einem generellen Fachkräfteengpass zu sprechen, entspricht also nicht den Tatsachen. Allerdings steuert Deutschland Knappheiten an Fachkräften in Bezug auf bestimmte Qualifikationsstufen, Berufsgruppen und Branchen entgegen, die bereits heute zutage treten. Im Fokus stehen dabei zum einen die sogenannten MINT4-Berufe. Der MINT-Report des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e. V. zeigt: Während noch vor wenigen Jahren ein Mangel an MINT-Akademiker*innen beklagt wurde, sind es heute in steigendem Maße MINT-Facharbeiter*innen, -Meister*innen sowie -Techniker*innen, die fehlen, und dies insbesondere aus dem Bereich IT (Plünnecke 2019). Zum anderen wird immer stärker der strukturelle Fachkräftemangel in vielen [23]Gesundheits- und Pflegeberufen thematisiert, der sich im Zuge der demografischen Entwicklung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten massiv verschärfen wird. So fehlen bereits heute examinierte Altenpflegekräfte, und dies bei einem prognostizierten massiven Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen. Nicht zuletzt ist davon auszugehen, dass im Bereich »Erziehung und Unterricht« bis zum Jahr 2035 ein Mangel an Akademiker*innen besteht und auch in der Fertigung, im Vertrieb sowie in Forschung und Entwicklung mit Engpässen zu rechnen ist. Auch Handwerksbetriebe suchen seit einigen Jahren vielfach erfolglos nach Auszubildenden und Fachkräften, derzeit wird die Fachkräftelücke mit etwa 250.000 Personen angegeben (BDA 2015; BIBB 2014; Prognos 2015; Wollseifer 2019). Hierzu ist anzumerken, dass die Konsequenzen der Corona-Pandemie in all diesen Szenarien naturgemäß noch keine Berücksichtigung finden und abzuwarten bleibt, wie sich infolge existenzbedrohender Entwicklungen in einigen Branchen Angebot und Nachfrage an Fachkräften mittel- bis langfristig darstellen werden.
1.2.4Generationendiversität
Bis zu vier Generationen finden sich derzeit in Unternehmen und in Teams – unweigerlich treffen hier unterschiedliche Sozialisationserfahrungen, Werte und Erwartungen an die Arbeit aufeinander. Dabei bewegen sich insbesondere die Vertreter*innen der sogenannten Generation Y mit Geburtsjahrgängen von 1985 bis 2000 in Spannungsfeldern – zwischen Lebensgenuss und Leistungsorientierung, Familie und Beruf sowie Herausforderung und Entschleunigung. Sie streben in Bezug auf die Arbeitswelt gleichermaßen nach Respekt, Spaß und Sinnhaftigkeit. Diese Generation der heute unter 40-Jährigen wird im Jahr 2030 mit ihren Werten und Erwartungen an die Arbeit, die aufgrund der demografisch bedingten Knappheitssituation auch sehr offensiv eingefordert werden können, die Arbeitswelt maßgeblich prägen. Sie zeichnet sich im betrieblichen Miteinander durch ein hohes Interesse an persönlicher Weiterentwicklung sowie partnerschaftlicher Führung und ausgeprägter Kollegialität – auch über das berufliche Maß hinaus – aus. Ihre Loyalität für einen Arbeitgeber ist während der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses zwar gegeben, doch nicht bedingungslos und keinesfalls »lebenslang« ausgerichtet. Ihr durchaus vorhandenes Sicherheitsbedürfnis steht in engem Zusammenhang zu diesen Grundwerten, das heißt »Sicherheit um jeden Preis« kommt zumindest für die gut Qualifizierten nicht mehr in Frage (Klös et al. 2016). Die Generation Y ist mit den neuen technologischen Mitteln gewissermaßen aufgewachsen und weist eine sehr hohe Affinität zu neuartigen technologischen Produkten auf (Appel u. Michel-Dittgen 2013). Diese Generation profitiert von der Globalisierung sowie von der demografischen Entwicklung und nutzt die Vorteile zu eigenen Gunsten in der Berufsfindung, sodass nicht zuletzt häufigere Berufs- oder Arbeitgeberwechsel stattfinden und die Erfüllung der eigenen Grundbedürfnisse im Vordergrund steht (Bruch et al. 2010). Spannende Arbeitsaufgaben, immer wieder neue Herausforderungen und interessante Fragestellungen machen bei der Wahl eines Arbeitgebers und bei der Entstehung von Motivation und Bindung für viele Vertreter*innen dieser Generation den Unterschied. Zu einem interessanten und herausfordernden Arbeitsumfeld gehört für sie auch die Möglichkeit, selbst[24]ständig zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen sowie sich in gewisser Weise selbst zu verwirklichen und »Autonomie« zu erfahren (Rump u. Eilers 2015).
Der Generation Y zur Seite steht die heutige mittlere Generation, geboren zwischen 1966 und 1984, auch als Generation X bezeichnet, die bis zum Jahr 2030 in die Reihen der älteren Beschäftigten aufgerückt bzw. zum Teil auch bereits aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sein wird. Vertreter*innen dieser Generation wurden noch überwiegend traditionell sozialisiert und leben meist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Form des Zuverdienermodells. Die verschwimmenden Grenzen zwischen privater und beruflicher Sphäre akzeptieren sie, ohne sie jedoch vorbehaltlos zu befürworten. Vielmehr stehen sie einer Überschneidung eher skeptisch gegenüber, da sie eine zu starke Beeinflussung ihres Privatlebens durch den Arbeitgeber befürchten. Die Sozialisation der Generation X war geprägt durch einen Anstieg der Unsicherheiten im privaten und beruflichen Kontext (wie z. B. steigende Arbeitslosenquote, steigende Scheidungsrate, Wiedervereinigung Deutschlands) (Bruch et al. 2010; Appel u. Michel-Dittgen 2013). Dadurch ist auch die Arbeitseinstellung der in dieser Zeit geborenen und aufgewachsenen Personen typischerweise dadurch bestimmt, dass eher Sicherheit im Beruf, zur selben Zeit jedoch auch die berufliche Weiterentwicklung und materieller Wohlstand angestrebt werden. Gleichzeitig geht es nun nicht mehr primär darum, die Arbeitsleistung zu erbringen und dem Arbeitgeber durch Fleiß seine Loyalität zu erweisen, sondern Arbeitnehmer*innen dieser Generation fordern inzwischen vielmehr einen Ausgleich zum Berufsleben. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom »psychologischen Vertrag«, bei dem der Arbeitgeber im Hinblick auf seine eigenen Ziele die passenden Mitarbeiter*innen für einen definierten Zeitraum an sich bindet. Der oder die Mitarbeiter*in geht nur mit demjenigen Unternehmen einen Vertrag ein, das seine oder ihre Kompetenzen aktuell nachfragt und vor allem wertschätzt (Blancke et al. 2000; Rump u. Eilers 2015). Der technologische Wandel prägte die berufliche Sozialisation der Angehörigen dieser Generation bereits merklich und führte nicht zuletzt auch zu der veränderten Grundhaltung, sich fachlich weiter zu entwickeln und zunehmend nach Wissen zu streben (Bruch et al. 2010). Die jüngeren Vertreter*innen der sogenannten Babyboomer-Generation, die bis 1965 geboren wurden, sind in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs aufgewachsen, meist in materiellem Wohlstand und geprägt von einem hohen Maß an Eigeninitiative. Dies schlug sich auch auf ihre Haltung im späteren Berufsleben nieder, wo Ehrgeiz und Konkurrenzfähigkeit, neben hoher Sozialkompetenz, diese Jahrgänge charakterisieren (Oertel 2007). Viele Babyboomer agieren heute in Fach- und Führungspositionen und erleben den Wandel der Arbeitshaltung in den nachfolgenden Generationen mit (Appel u. Michel-Dittgen 2013). Sowohl die Babyboomer als auch die Generation X setzen auf einen kooperativen Führungsstil und sehen das Team im Zusammenhang mit der betrieblich gewollten Struktur und kollegialen Zusammenarbeit. Ihre Leistungsorientierung verbinden sie mit der Freude an der Arbeit, aber vor allem auch mit einem starken Pflichtgefühl und einem hohen Maß an Disziplin.
Für die meisten ab dem Jahr 2000 geborenen Vertreter*innen der Generation Z steht der Einstieg in das Berufsleben erst noch bevor. Ihnen werden in der aktuellen Shell-Jugendstudie ein hoher Pragmatismus, eine ausgeprägte Anpassungsfähigkeit sowie der Wunsch nach Sicher[25]heit und sozialen Beziehungen sowie nach der Möglichkeit, im späteren Berufsleben genügend Zeit für Familie und Freizeit zu haben, bescheinigt (Albert et al. 2015). Verschwimmende Grenzen zwischen Beruf und Privatleben entsprechen nicht ihren Vorstellungen, vielmehr streben sie ein angemessenes Maß an tatsächlich freier Zeit an (XING 2018; Rump u. Eilers 2020).
Auf einen Blick
Implikationen für Future Learning
Zunehmende Zahl von Menschen, die über das Renteneintrittsalter hinaus erwerbstätig bleiben,alternde Belegschaften führen auch zu mehr älteren Bildungsteilnehmer*innen,zunehmende Bedeutung der Beachtung von Generationenunterschieden im betrieblichen Miteinander und bei der Gestaltung von Weiterbildungsangeboten,Verknappung der Personen im erwerbsfähigen Alter und dadurch steigende Notwendigkeit einer adäquaten Qualifikation der Erwerbstätigen und der lebenslangen Beschäftigungsfähigkeit.1.3Gesellschaft
Bereits 1974 postulierte der Bildungsforscher Dieter Mertens, eine moderne Gesellschaft solle durch einen hohen technischen und wirtschaftlichen Entwicklungsstand, Dynamik, Rationalität, Humanität, Kreativität, Flexibilität und eine Multioptionalität der Selbstverwirklichung gekennzeichnet sein (Mertens 1974). Fast alle dieser Attribute können heute als zutreffend erachtet werden. Im Folgenden werden zentrale gesellschaftliche Treiber in Bezug auf die (Weiter-)entwicklung von Lernen und Bildung dargestellt.
1.3.1Individualisierung und Multioptionsgesellschaft
Der Begriff der Individualisierung wurde im Jahr 1986 von dem Soziologen Ulrich Beck geprägt. Er grenzte sich damit klar von den eher kollektivistischen Ansätzen der 1970er und beginnenden 1980er Jahre ab (Ewinger et al. 2016). Neben Selbstverwirklichung sind in Bezug auf die Individualisierung Begriffe wie Selbstkontrolle, Selbstverantwortung und Selbststeuerung zentral (Zinn 2006). Einzug in die öffentliche Diskussion erhielt die Thematik insbesondere mit dem Eintritt der Generation Y in den Arbeitsmarkt. Denn ihr Anspruch an Selbstverwirklichung ist deutlich höher als bei den Vorhängerkohorten, sind sie doch in die individualisierte Welt hineingeboren, während insbesondere die Vertreter*innen der zahlenmäßig sehr starken Gruppe der Babyboomer in ihrer Sozialisation wenig Individualisierung erfuhren.
Die Individualisierung äußert sich nicht zuletzt darin, dass Lebensentwürfe und Lebensläufe vielfältiger werden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Multioptionsgesellschaft, eine Begrifflichkeit, die in den 1990er Jahren durch den Schweizer Soziologen Peter Gross (1994) aufkam. Im Kern sagt er aus, dass Menschen sich einer immer größeren Anzahl an Optionen in allen möglichen Bereichen ihres Lebens gegenübersehen. Diese verschiedenen [26]Wahlmöglichkeiten führen dazu, dass Selbstfindung und Selbstverwirklichung einfacher zu realisieren sind und einen hohen Stellenwert im Leben einnehmen. Die »Freiheit der Wahl« geht allerdings auch einher mit dem Anspruch, sich den eigenen Lebensweg selbst zu suchen und aus der Vielfalt der gebotenen Möglichkeiten das Beste zu machen. Und so steht der Chance der Selbstverwirklichung in einem nie dagewesenen Umfang auch das Risiko des Scheiterns oder der Fehlentscheidungen gegenüber, dem sich durchaus viele, gerade junge Menschen bewusst sind. Allerdings gilt es auch festzuhalten, dass die besten Möglichkeiten, dem Streben nach Individualisierung auch Ausdruck im Leben und Arbeiten zu verleihen, für diejenigen bestehen, die über ein gewisses Bildungs- und Wohlstandsniveau verfügen (Rump u. Eilers 2017a).
Während noch bis in die 1990er Jahre berufliche und private Erwerbs- und Lebensverläufe vergleichsweise klar vorgezeichnet waren und für die meisten Menschen in ähnlichen Phasen verliefen, ist heute eine große Pluralität an sich abwechselnden biografischen Elementen zu erkennen (Haaf u. Bauer 2012). Wie ein Mosaik setzt sich die Berufsbiografie aus unterschiedlichen Phasen zusammen, in denen sich Selbstständigkeit und Angestelltendasein, Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung, Führungs-, Projekt- bzw. Fachlaufbahnen oder auch Auszeiten für außerberufliche Aufgaben und Interessen abwechseln (Schuldt u. Ehret 2015). Im privaten Bereich steigt die Komplexität der Familienformen ebenfalls stetig an. Zwar ist die klassische Form des Ehepaars mit einem oder mehr Kindern in Deutschland derzeit noch vorherrschend, doch hat sich die Zahl der unverheirateten sowie der gleichgeschlechtlichen Elternpaare, der Alleinerziehenden sowie der Stief- und Patchworkfamilien deutlich erhöht (BMFSFJ 2015). Aus der Normalbiografie der Vergangenheit, die sich in die drei Phasen Kindheit und Jugend, Berufstätigkeit und Familienzeit sowie Ruhestand differenzierte, wird die variantenreiche »Multigrafie«, ein Begriff, den das Zukunftsinstitut in Kelkheim geprägt hat und in dem die Normalbiografie durch die Postadoleszenz als Phase des Ausprobierens und der Selbstfindung nach der Kindheit und Jugend, durch die »Rushhour des Lebens« zwischen Ende 20 und Anfang 50 sowie durch den »Zweiten Aufbruch« von Menschen um die 50 ergänzt wird. Dies drückt sich auch in einer starken Varianz an Lebensstilen, ebenfalls identifiziert durch das Zukunftsinstitut Kelkheim, aus. So finden sich insgesamt 18 verschiedene Gruppen, von denen die sogenannten Neo-Hippies und Self-Balancer besonders stark vertreten sind. Während die Erstgenannten insbesondere auf Gemeinschaft als identitätsstiftende Kraft setzen und die Sharing- und Event-Kultur vorantreiben, streben Self-Balancer vor allem nach Beständigkeit und Balance. Sie wünschen sich zwar Erfolg im Beruf, jedoch nicht um den Preis, einen gestressten Lebensstil zu verfolgen (Zukunftsinstitut 2017; Zukunftsinstitut 2019).
1.3.2Wertewandel und Life-Balance
Bereits seit den 2000er Jahren lässt sich eine zunehmende Wertesynthese feststellen, das heißt ein Streben nach einem ausbalancierten Lebenskonzept, in dem unterschiedliche Werte gleichberechtigt nebeneinanderstehen und die Gesellschaft traditionelle und moderne [27]Werte gleichermaßen schätzt und verkörpert. In diesem Zusammenhang lässt sich eine Rückbesinnung auf Kernwerte wie Ehe und Familie ebenso erkennen wie die verstärkte soziale Anerkennung ehrenamtlicher und freiwilliger Tätigkeiten und die grundlegende Neubewertung von Arbeit und Leistung hin zu einer zunehmenden Sinnsuche in außerberuflichen Bereichen. Arbeits- und Privatleben werden dabei zunehmend als verbundene Bereiche wahrgenommen. Erst in den 1990er Jahren entwickelte sich allerdings allmählich auch im betrieblichen Kontext ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer ausgewogenen Balance zwischen beruflicher und privater Sphäre. Zuvor wurde der private Bereich in der Regel nicht zum Gegenstand der Diskussion im Arbeitsumfeld gemacht. Vielmehr arrangierten die Beschäftigten ihr Privatleben so, dass es den beruflichen Belangen gerecht wurde (Maitland u. Thomson 2011). Angesichts der zunehmenden Veränderungsgeschwindigkeit und Komplexität sowie der Verlängerung der Lebensarbeitszeit lässt sich jedoch ein stetiger Bedeutungszuwachs dieser Thematik beobachten. Heute ist eine ausgewogene Work-Life-Balance – so der noch immer geläufigste Begriff in einschlägigen Befragungen – gerade für jüngere Beschäftigte eine der Hauptforderungen an einen attraktiven Arbeitgeber. Ihnen ist bewusst, dass ein »Durchhalten« über ein mehr als 40-jähriges Erwerbsleben nur dann möglich ist, wenn von Anfang an eine ausgewogene Balance zwischen Be- und Entlastung gegeben ist (Rump u. Eilers 2015; BMAS 2015). Zudem gilt nicht zuletzt angesichts sinkender Erwerbspersonenzahlen und steigender Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften auch: »Work-life balance has always been a consideration in a career but never before have employees had the leverage to demand it.« (McCrindle u. Wolfinger 2009, S. 141) Gerade von den besser Qualifizierten der jüngeren Generation aus den höheren sozialen Schichten wird ein einseitiges Karrierestreben zunehmend abgelehnt, wie unter anderem die Shell-Jugendstudien, aber auch zahlreiche Absolventenbefragungen verdeutlichen. Sie sind es auch, die nicht selten bei Bewerbungsgesprächen offensiv ihre Ansprüche an die Vereinbarkeit der künftigen Tätigkeit mit privaten Belangen wie Hobbys oder der Familie bekunden.
Die Begrifflichkeit der Work-Life-Balance allerdings ist nicht unumstritten. An ihre Stelle treten weiter gefasste Umschreibungen wie die »Life-Domain-Balance« (Ulich 2005) oder der »Life-Domain-Fit« (Pangert u. Schüpbach 2012) mit der Begründung, dass auch die Erwerbsarbeit einen Lebensbereich darstellt. Väth (2016) plädiert für die Begrifflichkeit des »Work-Life-Blending«, um deutlich zu machen, dass es das Ziel sein muss, Arbeit und Privatleben so miteinander zu kombinieren, dass es nicht zu negativen Entgrenzungswirkungen kommt. Im Folgenden soll auf den Begriff der Life-Balance zurückgegriffen werden, wenngleich in zahlreichen Studien nach wie vor »Work-Life-Balance« Verwendung findet. Sowohl in der Literatur als auch in der betrieblichen Praxis wird Life-Balance nicht selten mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gleichgesetzt. Dies greift allerdings eindeutig zu kurz. Denn alle Beschäftigten – ganz gleich, welchen persönlichen Hintergrund sie mitbringen – sind auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen be- und entlastenden Aspekten angewiesen, um physisch und psychisch gesund und damit auch arbeitsfähig zu bleiben. Es ist daher gerade im betrieblichen Kontext ein »Life«-Begriff zu bevorzugen, der ganz bewusst Singles, kinderlose Paare, Eltern sowie pflegende Angehörige gleichermaßen in den Fokus rückt und neben familiären Verpflichtungen im privaten [28]Bereich auch ehrenamtliches Engagement, die Pflege sozialer Kontakte, Weiterbildung oder sportliche beziehungsweise gesundheitsförderliche Aktivitäten berücksichtigt. Nach der o. g. Definition ist »Work« ebenfalls Teil des erweiterten »Life«-Begriffs und umfasst mehr als die reine Erwerbstätigkeit. Vielmehr gehören in diesen Bereich auch ehrenamtliche Tätigkeiten oder ein etwaiger Nebenerwerb, der für viele Menschen inzwischen zur Existenzgrundlage geworden ist. Die »Life-Balance« impliziert im Sinne einer subjektiv empfundenen »Lebensqualität« neben einem entsprechend ausgewogenen Zeitmanagement auch die Übereinstimmung der persönlichen Situation (Einkommen, Wohnverhältnisse, Arbeitsbedingungen, Familienbeziehungen, soziale Kontakte etc.) mit den individuellen Bedürfnissen und Zielen (Haufe-Akademie u. Hochschule Deggendorf 2009). Wo, wann und in welchem Maße Personen Belastung empfinden und im Gegenzug »auftanken« und wie positiv oder negativ sie »Grenzüberschreitungen« zwischen den unterschiedlichen »Life«-Bestandteilen empfinden, hängt also in hohem Maße von der persönlichen Situation in Beruf und Privatleben, von Lebens- und Berufsphasen, von Neigungen und individuellen Einschätzungen ab. In der Folge sieht auch für jeden Menschen seine Life-Balance anders aus. Hinzu kommt, dass das Empfinden bezüglich dieser Balance einem beständigen Wandel im Laufe eines Erwerbslebens unterliegt, das von unterschiedlichen Berufs- und Lebensphasen gekennzeichnet ist (Rump u. Eilers 2020).
In gleichem Maße, wie die Notwendigkeit einer ausgewogenen Life-Balance steigt, wird es auch immer schwieriger, diese Balance zu erreichen, da die Anforderungen an Flexibilität und Mobilität – nicht zuletzt im Sinne einer »Flexibilisierung von privaten Routinen«, die Beschäftigten vielfach abverlangt wird – ebenfalls stetig steigen und moderne Kommunikationsmittel die Entgrenzung fördern. Hinzu kommt, dass in Bezug auf die Vereinbarkeit beruflicher und familiärer Verpflichtungen durch die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen ein traditioneller »Zeitpuffer« in Familien immer stärker wegfällt. Das heißt, die disponible Zeit, die Frauen für die Organisation des Familienlebens, die Hausarbeit, die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen aufwenden können, reduziert sich zusehends. Sie muss somit neu zwischen den Partnern aufgeteilt und »ausgehandelt« werden, während in der Vergangenheit Männer und Väter in der Regel primär die Rolle des »Familienernährers« übernahmen und insofern nicht in nennenswertem Maße unterschiedliche Lebensbereiche ausbalancieren mussten. Erschwerend kommt hinzu, dass gesellschaftliche Strukturen auf diese Veränderung noch nicht in ausreichendem Maße reagiert haben und vielfach die Verfügbarkeit eines Elternteils – beispielsweise für Unterstützung im schulischen Bereich oder für die Organisation von außerschulischen sportlichen oder musikalischen Aktivitäten – vorausgesetzt wird (Sachverständigenkommission zum Achten Familienbericht 2011). In der Literatur wird sogar darauf hingewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für Väter, einen Konflikt in diesem Bereich zu erleben, höher ist als für Mütter. Dies ist nicht zuletzt in einem Spannungsfeld begründet: Einerseits ist noch immer in vielen Köpfen (auch von Männern selbst) die Vorstellung vorherrschend, ein Mann müsse beruflich erfolgreich sein und »eine Familie ernähren«. Gleichzeitig wächst die Erwartungshaltung seitens der Gesellschaft bezüglich der Übernahme familiärer Verpflichtungen durch Männer (Maitland u. Thomson 2011; Rump u. Eilers 2014a).