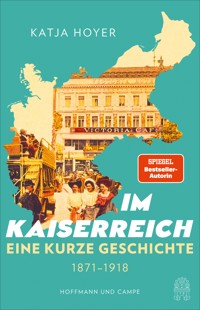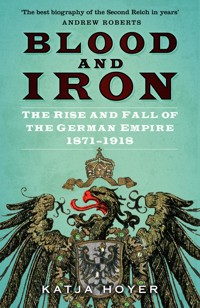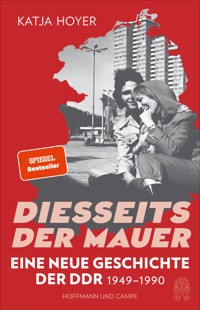
22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ein erfrischender Perspektivwechsel.« Sachbuchbestenliste von ZEIT, ZDF und DLF Kultur Juni 2023 Ein bahnbrechender neuer Blick auf das Leben in der DDR War die DDR ein graues Land voller hoffnungsloser Existenzen? Die renommierte Historikerin Katja Hoyer zeigt in ihrem überraschenden Buch auf profunde und unterhaltsame Weise, dass das andere Deutschland mehr war als Mauer und Stasi. Die Geschichtsschreibung der DDR wird bis heute vom westlichen Blick dominiert. Mit dem Fokus auf die Verfehlungen der Diktatur wird dabei oft übersehen, dass die meisten der 16 Millionen Einwohner der DDR ein relativ friedliches Leben mit alltäglichen Problemen, Freuden und Sorgen führten. Die Mauer schränkte die Freiheit ein, aber andere gesellschaftliche Schranken waren gefallen. Katja Hoyer schildert jetzt vierzig Jahre deutschen Sozialismus aus der Sicht derer, die ihn selbst erlebt haben. Dafür führte sie zahlreiche Interviews mit ehemaligen Bürgern der DDR aus allen Schichten. Das Ergebnis ist eine neue Geschichte der DDR, die nichts beschönigt, aber den bisherigen Blick auf die DDR auf ebenso lebendige wie erstaunliche Weise erweitert, präzisiert und erhellt. »Eine spannende Lektüre für diejenigen, die diese Zeit nicht erlebt haben.« Marcus Heumann, Deutschlandfunk »Ihr Buch trifft einen Nerv.« Maxi Leinkauf, der Freitag »Ihre Erzählweise ist angelsächsisch locker, sie stellt Menschen in den Mittelpunkt, die in der DDR geblieben sind.« Sabine Rennefanz, Der Spiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Katja Hoyer
Diesseits der Mauer
Eine neue Geschichte der DDR 1949–1990
Aus dem Englischen von Henning Dedekind und Franka Reinhart
Hoffmann und Campe
In Gedenken an Harry, treuester Begleiter, vertrautester Freund und immer ein Ruhepol in stürmischen Zeiten.
Vorwort
Halle, Sachsen-Anhalt, 3. Oktober 2021. Eine 67-jährige Frau in einem cremefarbenen Blazer und einer schwarzen Hose betrat die Bühne. Sie war die vielleicht mächtigste Frau der Welt, und man erkannte sie sofort. Ihre Hosenanzüge, ihr blonder Kurzhaarschnitt und ihr nüchternes Auftreten waren längst zum Markenzeichen geworden. Als sie ihren Platz zwischen den Flaggen Deutschlands und der Europäischen Union einnahm und die Mikrofone am Rednerpult justierte, spürten viele im Publikum, dass sie einem historischen Moment beiwohnten. Nach 16 Jahren an der Spitze der größten europäischen Demokratie war die scheidende deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gekommen, um über nationale Einheit zu sprechen.
Der 3. Oktober ist das, was einem deutschen Nationalfeiertag am nächsten kommt. Der Tag der Deutschen Einheit erinnert an die Wiedervereinigung des Landes im Jahr 1990, nachdem 41 Jahre lang zwei getrennte deutsche Staaten existiert hatten: die Bundesrepublik Deutschland im Westen und die Deutsche Demokratische Republik im Osten. Auf den Tag genau 31 Jahre waren seitdem vergangen. Nach dieser historisch relativ kurzen Zeitspanne war die Ära der deutschen Teilung jedoch keinesfalls Geschichte. Ganz im Gegenteil: Die Wiedervereinigung, so begann die scheidende Kanzlerin ihre Ansprache, sei ein Ereignis, »das die meisten von uns bewusst erlebt haben und das […] unser Leben verändert hat«.[1]
Das Jahr 1990 war nicht nur für die deutsche Nation, sondern auch für Merkel persönlich ein Wendepunkt. Es markierte den Beginn ihres steilen Aufstiegs an die Spitze der deutschen Politik. Im Jahr 1954 war ihr Vater mit der Familie von West- nach Ostdeutschland umgezogen, als sie gerade drei Monate alt war. Die ersten 35 Jahre ihres Lebens hatte Merkel östlich der innerdeutschen Trennungslinie verbracht. In diesen Jahren hatte sie sich von der Pastorentochter zur selbstbewussten Wissenschaftlerin entwickelt, was sie mindestens ebenso geprägt hatte wie die drei Jahrzehnte seit 1990.
Angela Merkels lange Karriere an der Spitze der deutschen Politik steht exemplarisch für die vielen Erfolge der Wiedervereinigung. Als der ostdeutsche Staat, der ihre Heimat gewesen war, plötzlich zerfiel und Teil des westdeutschen Systems wurde, welches man bislang als den »Klassenfeind« angesehen hatte, machte sich Merkel unverzüglich an die Arbeit, ohne zurückzuschauen. Oder zumindest, ohne dies öffentlich zu tun. Sie erkannte, dass ihre ostdeutsche Herkunft auf dem Papier einen politischen Vorteil in einem Land darstellte, das zeigen wollte, dass es nun eine geeinte Nation war. Tatsächlich aber galt dies nur, solange ihre Herkunft nicht vordergründig ihre Identität bestimmte. Das Establishment wollte nicht ständig daran erinnert werden, dass es länger dauern würde, die Mauern in den Köpfen der Ost- und Westdeutschen niederzureißen als die physische Mauer.
In den seltenen Fällen, in denen Merkel Einzelheiten über ihr Leben in der DDR preisgab, wurde dies in den Machtzirkeln, die auch heute immer noch weitgehend von ehemaligen Westdeutschen dominiert werden, mit Feindseligkeit aufgenommen. Als sie 1991 erzählte, sie habe 1978 für ihre Doktorarbeit einen Aufsatz mit dem Titel »Was ist sozialistische Lebensweise?« schreiben müssen, setzten Journalistinnen und Journalisten Himmel und Hölle in Bewegung, um die Arbeit zu finden. »Sie glaubten, da gäbe es Gott weiß was für einen Skandal zu enthüllen«, sinnierte Merkel später.[2] Solche politischen Arbeiten gehörten zum Universitätsleben in der DDR und wurden von vielen als lästig empfunden, so auch von Merkel selbst, die für diesen Aufsatz die einzige schlechte Note in einer ansonsten glänzenden akademischen Laufbahn erhielt. Wie viele andere Aspekte des Lebens in der DDR zeigte auch diese Episode, dass »es offenbar unheimlich schwer ist, heute zu verstehen und begreiflich zu machen, wie wir damals gelebt haben«, wie Merkel kurz vor ihrer Wahl zur Bundeskanzlerin im Jahr 2005 anmerkte.[3]
Merkel hatte sich zwar damit abgefunden, ihre ostdeutsche Vergangenheit am besten für sich zu behalten, doch blieb sie trotzdem ein Teil von ihr, den sie nicht loslassen konnte. Im Oktober 2021, als ihr politischer Ruhestand in Sicht war, nutzte sie die Gelegenheit ihres letzten Tages der Deutschen Einheit im Amt, um sich damit auseinanderzusetzen, dass ostdeutsche Lebensgeschichten wie die ihre als eine Art Leiche im nationalen Keller behandelt wurden. Eine Publikation der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung hatte die politische Anpassungsfähigkeit der Kanzlerin angesichts des »Ballasts« ihrer DDR-Biographie gelobt.[4] Diese unglückliche Formulierung ärgerte die Kanzlerin sichtlich. »Ballast?«, empörte sie sich über diese Bewertung ihres früheren Lebens. Der Duden definiere Ballast als »schwere Last […] bestenfalls zum Gewichtsausgleich tauglich, im Grunde aber als unnütze Last abzuwerfen«.[5] In diesem ungewöhnlich persönlichen öffentlichen Moment, so betonte sie, spreche sie nicht als Kanzlerin, sondern auch »als Bürgerin aus dem Osten […], als eine von mehr als sechzehn Millionen Menschen, die ein Leben in der DDR gelebt haben und die immer wieder solche Urteile erleben […], als ob dieses Leben vor der deutschen Wiedervereinigung nicht wirklich zählte […], egal welche guten und schlechten Erfahrungen man gemacht hat«.[6]
Merkels Frustration darüber, dass ihr früheres Leben in Ostdeutschland als unerheblich abgetan wurde, teilen viele ihrer ehemaligen DDR-Mitbürger. Seit 1990 haben Umfragen gezeigt, dass die Mehrheit sich im wiedervereinigten Deutschland weiterhin als »Bürger zweiter Klasse« behandelt fühlt. Zwei Drittel empfinden dies auch heute noch so.[7] Viele haben explizit oder implizit Druck erfahren, ihren ostdeutschen »Ballast« abzuwerfen und sich nahtlos einer für sie neuen Kultur anzupassen. Selbst Merkel, die sich äußerst erfolgreich an die Welt nach der Wiedervereinigung anpasste und eine steile politische Karriereleiter bis an die Spitze erklomm, wurde von der Presse stets daran erinnert, dass es gelegentlich »durchscheine«, dass sie »keine geborene Bundesdeutsche und Europäerin« sei[8] – als ob sie keine »gebürtige«, keine »ursprüngliche« Bürgerin des Landes sei, zu dessen Führung sie gewählt worden war. Nach 16 Jahren im höchsten politischen Amt des wiedervereinten Deutschlands musste sie als Ostdeutsche immer noch ihre Zugehörigkeit beweisen, indem sie ihre Vergangenheit verleugnete.
So wie einzelne Ostdeutsche gehalten sind, die Spuren ihrer Vergangenheit vor 1990 möglichst zu verwischen, scheint sich die Nation als Ganzes mit der DDR als Kapitel ihrer Geschichte äußerst unwohl zu fühlen. In vielerlei Hinsicht begann der Prozess, die DDR aus der nationalen Erzählung herauszuschreiben, schon vor ihrem endgültigen Untergang. Nach dem Mauerfall 1989 erklärte der ehemalige westdeutsche Bundeskanzler Willy Brandt: »Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.« Für viele Deutsche in Ost und West erschien die Teilung ihres Landes, die während des Kalten Krieges eine Tatsache gewesen war, nun als unnatürlicher Zustand, als Produkt des Zweiten Weltkriegs und vielleicht als Strafe für dessen Auswirkungen. Hatte Deutschland bis 1990 nicht genug getan, um dieses dunkle Kapitel seiner Vergangenheit zu überwinden? Hatte es nicht einen Neuanfang verdient, ohne ständig daran erinnert zu werden? Francis Fukuyamas Einordnung vom Ende des Kalten Krieges als »Ende der Geschichte« schien auf Deutschland besonders zuzutreffen. Die Nation wollte, ja, musste die Wiedervereinigung als glückliches Ende des wechselvollen 20. Jahrhunderts definieren. In den fortbestehenden Auswirkungen der jahrzehntelangen Teilung Deutschlands etwas anderes als ferne Geschichte zu sehen, zerstört diese tröstliche Illusion. Wenn die DDR überhaupt in Erinnerung bleiben soll, dann als eine der deutschen Diktaturen – ebenso weit entfernt, unheimlich und unverzeihlich wie der Nationalsozialismus.
Einen Schlussstrich unter beide deutsche Staaten zu ziehen und 1990 als Neuanfang für alle Deutschen zu begreifen, stand ebenfalls nicht zur Debatte. Die Westdeutschen hatten sich zu sehr mit der Vorstellung von 1945 als ihrer »Stunde Null« angefreundet, dem Zeitpunkt, an dem aus der Asche des Zweiten Weltkriegs die zarten Triebe der Demokratie erwuchsen. Welche Probleme die junge Bundesrepublik auch gehabt haben mochte, der Wohlstand und die Stabilität, die sie hervorgebracht hatte, waren wie ein Trostpflaster für eine Bevölkerung, die seit 1914 nichts anderes als Unruhen und Umbrüche erlebt hatte. Das war ein Deutschland, auf das man stolz sein konnte. Westdeutschland wurde zum Kontinuitätsstaat erklärt und Ostdeutschland zur Anomalie. Die Wiedervereinigung 1990 schien deshalb ein befriedigendes Ende der erzwungenen Trennung zu sein. Und für zahlreiche Ostdeutsche war sie auch genau das. In den Jahren 1989 und 1990 stimmten viele in Wort und Tat für die Auflösung ihres Landes.
Die von beiden Seiten gewollte Wiedervereinigung bedeutet nicht, dass das Leben in Ostdeutschland vergessen oder als irrelevante Geschichte abgehakt werden sollte. Das Auf und Ab der DDR als politisches, soziales und wirtschaftliches Experiment hat Spuren bei ihren ehemaligen Bürgern hinterlassen, die diese Erfahrungen mitgebracht haben – und zwar nicht nur als »Ballast«. Millionen heute lebende Deutsche können und wollen nicht leugnen, dass sie einmal in der DDR lebten. Die Welt, die sie geprägt hat, endete zwar 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer, aber ihr Leben, ihre Erfahrungen und ihre Erinnerungen sind nicht mit ihr untergegangen. In den Augen eines Großteils der westlichen Welt jedoch hatte die DDR den Kalten Krieg auf deutschem Boden verloren – wodurch alles, was mit ihr zu tun hatte, moralisch entwertet war. Als die Deutsche Demokratische Republik am 3. Oktober 1990 buchstäblich über Nacht verschwand, verlor sie das Recht, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Stattdessen war sie Geschichte geworden. Und Geschichte wird von Siegern geschrieben – auch die der DDR.
In weiten Teilen des Westens ist es schwer zu verstehen, warum sich überhaupt jemand an sein Leben hinter dem Eisernen Vorhang erinnern will. Der Sieg über den Kalten Krieg scheint alternative Lebensmodelle widerlegt zu haben. Während man sich farbenfroh an den westlichen Konsum und die liberalen Werte erinnert, wird die DDR als grauer, eintöniger, verschwommener Fleck dargestellt – als Welt ohne Individualität, Selbstbestimmung oder Sinn. In der westlichen Vorstellung verbrachten die Ostdeutschen 41 Jahre in einer ummauerten russischen Kolonie, die vom Ministerium für Staatssicherheit, besser bekannt als Stasi, kontrolliert wurde. Woran sollte man sich da erinnern wollen?
Die DDR pauschal als Fußnote der deutschen Geschichte abzutun, die man am besten vergisst, ist ahistorisch. Der ostdeutsche Staat bestand über 40 Jahre, länger als der Erste Weltkrieg, die Weimarer Republik und Nazideutschland zusammen. Er war nie das statische Land, das von 1949 bis 1989 von der Zeit vergessen wurde. In diesen Jahrzehnten vollzog sich ein immenser Wandel. Die Entwicklung der DDR wurde zum großen Teil von Ereignissen und Menschen bestimmt, deren prägende Jahre nicht nur in den Jahrzehnten vor dem Mauerbau 1961 lagen, sondern auch vor der Gründung des Landes selbst im Jahr 1949. Deutschland befand sich seit 1914 in einem nahezu konstanten Zustand des Umbruchs, und die wirtschaftlichen, politischen, sozialen und psychischen Folgen der turbulenten ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschwanden nicht schlagartig mit der Gründung der DDR.
Dieses Buch spürt den Wurzeln der DDR über ihre Gründung hinaus nach, um die Umstände zu verdeutlichen, aus denen das Land 1949 entstanden ist. Ich skizziere die Entwicklungen, die sich durch alle vier Jahrzehnte zogen, anstatt sie als statisches Ganzes zu betrachten. In den 1950er-Jahren war die junge Republik fast ausschließlich damit beschäftigt, ihre politischen und wirtschaftlichen Grundlagen zu stabilisieren. Dies geschah sowohl gemeinsam mit den Bürgern als auch über deren Köpfe hinweg, was in einem Jahrzehnt resultierte, das sowohl von einer Aufbruchstimmung als auch von gewaltsamen Ausbrüchen der Unzufriedenheit geprägt war.
Als 1961 die Berliner Mauer errichtet wurde und damit die Abwanderung von Fachkräften nach Westdeutschland zum Stillstand kam, schien das Land zur Ruhe zu kommen. Ehrgeizige Bauprojekte wie die Neugestaltung des Berliner Alexanderplatzes mit seinem ikonischen Fernsehturm schufen – in Verbindung mit der Raumfahrtbegeisterung und wissenschaftlichen Durchbrüchen – ein echtes Gefühl von Fortschritt und nationaler Identität. Viele Ostdeutsche waren stolz auf ihre Errungenschaften, denn die soziale Mobilität eröffnete den Arbeiterschichten nie da gewesene Möglichkeiten.
Als die Früchte ihrer Arbeit in den 1970er-Jahren den höchsten Lebensstandard in der kommunistischen Welt hervorbrachten, etablierte sich die DDR auf der Weltbühne, wurde Mitglied der UNO und von vielen Ländern weltweit anerkannt. Ostdeutsche Produkte wurden bis nach Großbritannien und in die USA exportiert. Doch die Ölkrisen des Jahrzehnts machten die Schwächen der DDR und ihre Abhängigkeit von der UdSSR, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, deutlich. Als Moskau seine versprochenen Öl- und Gaslieferungen nicht mehr einhielt, konnte die DDR den Lebensstandard, an den sich die Bevölkerung gewöhnt hatte, nicht länger aufrechterhalten, ohne dabei bankrottzugehen.
Das alternde Regime verlor allmählich den Überblick und hatte keine Ideen mehr. Mitte der 1980er-Jahre war das System verkalkt, unflexibel und brüchig geworden und bedurfte dringend einer Überholung. Als Reformen ausblieben, ergriff das ostdeutsche Volk selbst die Initiative, um einen Wandel herbeizuführen. In jedem Jahrzehnt gab es Phasen der Öffnung gegenüber dem Westen und des Rückzugs auf sich selbst, und die Erfahrungen der Ostdeutschen, gute wie schlechte, wurden von diesen komplexen Gezeiten der Geschichte geprägt.
In jeder Phase der DDR-Geschichte überwachte die Stasi das Leben der Menschen und griff auch häufig in dieses ein, aber sie machte die ostdeutsche Bevölkerung nicht handlungsunfähig. Ebenso war der Staat selbst, obwohl er vom guten Willen Moskaus abhängig war, nie ein passiver sowjetischer Satellit. Die Ostdeutschen lebten und gestalteten ein eindeutig deutsches Experiment, das sich über einen Großteil der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erstreckte. Die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Eigenheiten der DDR verdienen eine historische Bewertung, die sie nicht nur als ummauertes »Stasiland« behandelt, sondern ihr einen angemessenen Platz in der deutschen Geschichte einräumt.
Dieses Buch stützt sich auf Interviews, Briefe und Aufzeichnungen und lässt eine Vielzahl ostdeutscher Stimmen zu Wort kommen. Ihre Lebensgeschichten sind integraler Bestandteil meiner Darstellung des Staates, den sie geprägt haben und von dem sie geprägt wurden. Zu meinen Interviewpartnern gehörten Politiker wie Egon Krenz, einer der letzten Machthaber der DDR, und Entertainer wie der Schlagersänger Frank Schöbel. In der Mehrzahl aber waren es diejenigen, die den Staat funktionieren ließen: von Lehrerinnen, Buchhalterinnen und Fabrikarbeitern bis hin zu Polizisten und Grenzsoldaten. Das Ergebnis ist eine neue Geschichte der DDR, die alle Facetten dieses verschwundenen Landes zeigt – von der großen Politik bis zum Alltagsleben.
Im Kontext des Kalten Krieges entstanden auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs vereinfachte Bilder des jeweils anderen. Die DDR stellte den Westen plakativ als Feind dar, während sie ihrerseits zu einer Karikatur der monochromen Welt des Kommunismus geriet, die man jenseits der Mauer vermutete. Mehr als drei Jahrzehnte sind seit dem Ende der DDR vergangen, und eine neue Generation von Deutschen ist ohne physische Grenzen und Trennlinien aufgewachsen. Sie hat weder die Systemkonkurrenz zweier deutscher Staaten noch die Existenz zweier deutscher Armeen erlebt, die ein erschreckendes Waffenarsenal gegeneinander richteten. Da der Kalte Krieg und die tiefe Feindseligkeit, die er hervorbrachte, immer weiter in die Vergangenheit rücken, haben wir nun die Möglichkeit, Ostdeutschland mit emotionaler und politischer Distanz neu zu betrachten.
Vielleicht waren die Wunden der Trennung, der verlorenen und gewonnenen Identitäten, unmittelbar nach der Wiedervereinigung noch zu frisch, um untersucht zu werden, weshalb man es vorzog, sie verkrusten zu lassen. Jetzt ist es endlich an der Zeit, einen neuen Blick auf die DDR zu wagen. Wer dies mit offenen Augen tut, wird eine bunte Welt entdecken, keine schwarz-weiße. Es gab Unterdrückung und Brutalität, ja, aber auch Chancen und Zugehörigkeit. In den meisten ostdeutschen Gemeinden haben die Menschen sowohl das eine als auch das andere erlebt. Es gab Tränen und Wut, und es gab Lachen und Stolz. Die Bürger der DDR lebten, liebten, arbeiteten und wurden alt. Sie fuhren in den Urlaub, machten Witze über ihre Politiker und zogen ihre Kinder auf. Ihr Schicksal verdient einen Platz in der gesamtdeutschen Geschichte. Es ist Zeit, einen ernsthaften Blick auf das Deutschland diesseits der Mauer zu werfen.
Kapitel 1 Gefangen zwischen Hitler und Stalin (1918–1945)
»In Sibirien wird dir dein großes Maul zufrieren!«
Deutsche Kommunisten
Swerdlowsk, Sibirien, 16. August 1937.Der 24-jährige Berliner Erwin Jöris wurde in eine kleine Zelle gestoßen. In der Dunkelheit stank es nach Schweiß, Exkrementen und Angst. Von den 58 anderen politischen Gefangenen, die dort bereits vor sich hin vegetierten, drehten nur eine Handvoll müde ihre hageren Gesichter zur Tür, um den Neuankömmling zu mustern. Erwin schaute sich nach einem Sitzplatz um, aber der Boden war eng und überfüllt. Also stellte er sich an den einzigen Ort, den er finden konnte, nämlich neben die Latrine – ein großes Fass mit Deckel. Dort stand er Stunde um Stunde, dann Tage, dann Wochen. Seine Füße schwollen an, sein Mund wurde trocken, und seine Kehle brannte bei jedem raspelnden Schlucken. Eines Tages brach er zusammen und hielt sich mit kraftlosen Händen die Brust, als man ihn zum Krankenrevier schleppte. Dort untersuchte ihn ein Arzt, befand, dass er nur so tue, als wäre er krank, und schickte ihn zurück in die Zelle.
Die Essensrationen im Gefängnis von Swerdlowsk waren für einen kerngesunden jungen Mann wie Erwin Jöris kaum ausreichend. Einmal am Tag wurde ein Stück »Stalin-Kuchen« ausgegeben – altbackenes Brot mit einer Kelle Kaffee. Als Erwin erneut zusammenbrach, schenkte ihm niemand Beachtung. In seinem Delirium hörte er, wie die Gefängnistür geöffnet wurde. Ein Soldat rief einen Namen in die Zelle. »Hier!«, antwortete jemand. »Sie haben zehn Jahre. Rauskommen mit Sachen.« Die Häftlinge um ihn herum begannen von Prozessen und »Verhaftungswellen« zu sprechen. Einer sagte: »Die blättern die Akten durch, und wenn sie gut geschlafen haben, kannst du Glück haben: fünf Jahre. Sind sie besoffen: fünfundzwanzig Jahre.« Jedes Mal, wenn sich die Tür öffnete, wurde es still unter den Gefangenen. Wer wohl dieses Mal an der Reihe war?[9]
Erwin Jöris war einer von vielen deutschen Kommunisten, die in den 1930er-Jahren nach Sowjetrussland ausgewandert waren. Nachdem Kommunismus und Sozialismus Mitte des 19. Jahrhunderts ihren diffusen intellektuellen Wurzeln entwachsen waren, hatten sie sich in Deutschland zu Massenbewegungen entwickelt, die durch Industrialisierung und Urbanisierung befeuert wurden. Zwar waren die deutschen Politiker und Aktivisten der extremen Linken daran gewöhnt, dass ihre Ideologie in unterschiedlichem Maße mit staatlicher Gewalt bekämpft wurde, doch der Aufstieg Adolf Hitlers stellte eine Zäsur dar. Erwin und seine Genossen waren gezwungen, vor dem nationalsozialistischen Regime in Deutschland zu fliehen, das nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 mit aller Härte gegen die Linke vorging. Sie suchten Zuflucht in der Sowjetunion, deren politische und ideologische Wurzeln in der Oktoberrevolution von 1917 lagen. Das Land war damit die erste und einzige Verwirklichung der politischen Utopie, von der sie während der entbehrungsreichen Jahre nach dem Ersten Weltkrieg geträumt hatten. Dort wollten sie ihre Dankbarkeit zeigen, indem sie alles in ihrer Macht Stehende taten, um zum Aufbau einer besseren Welt beizutragen. Nach Angaben des Historikers Peter Erler lebten Mitte des Jahrzehnts etwa 8000 erwachsene deutsche politische Emigranten und Emigrantinnen in Russland.[10] Darunter befanden sich nicht nur politisch aktive Kommunisten, sondern auch Arbeiter, Schauspieler, Musiker, Künstler, Architekten, Wissenschaftler, Lehrer, Schriftsteller und viele andere Menschen. Was sie verband, war die Enttäuschung über alles, was seit 1914 in ihrem Vaterland schiefgelaufen war.
Der 1912 in einem östlichen Vorort von Berlin geborene Erwin Jöris gehörte zu einer Generation junger Sozialisten, die ihre Erfahrungen eher auf den Straßen deutscher Städte gemacht hatten als in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Er war noch ein kleiner Junge, als sein Vater während der deutschen Revolution von 1918 mithalf, den letzten deutschen Monarchen, Kaiser Wilhelm II., ins Exil zu treiben. Seine Kindheit war geprägt von den blutigen Geschichten über den Spartakusaufstand im Januar 1919 und von der Armut und dem Hunger, die seine Familie während der Hyperinflation im Jahr 1923 erlitten.
Die Wut, das Elend und die Gewalt in den umliegenden Arbeitervierteln bildeten den Rahmen, in dem Erwin Jöris aufwuchs. Der Kapitalismus hatte die Arbeiterklasse enttäuscht, für die es zeit seines Lebens nichts als Elend gegeben hatte. Deshalb war es kein Wunder, dass er 1928 im Alter von 16 Jahren beschloss, es müsse einen anderen Weg für seine Generation geben. Erwin trat dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands (KJVD) bei, der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Sie organisierten Aufmärsche, gaben eine Zeitung namens Die Arbeit heraus und schulten ihre Nachwuchsmitglieder im Straßenkampf sowie im Verfassen und Verteilen von Propagandablättern. Damit sollten die jugendlichen Neulinge darauf vorbereitet werden, den Klassenkampf ihrer Eltern fortzusetzen. Zwischen 35000 und 50000 junge Deutsche traten dem KJVD bei und kämpften, wie sie hofften, für ein besseres Deutschland.
Nachdem Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum deutschen Reichskanzler ernannt worden war, gerieten Erwin und seine Kameraden in ernste Schwierigkeiten. Als einen knappen Monat später, am 27. Februar 1933, ein Brandanschlag auf den Reichstag verübt wurde, behaupteten die Nazis, dass es sich bei dem Täter um einen jungen niederländischen Kommunisten namens Marinus van der Lubbe handele, welcher die Tat unter Folter gestand. Hitler überzeugte den 85-jährigen und zunehmend gebrechlichen deutschen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg erfolgreich davon, ihm Notstandsbefugnisse zu erteilen, damit er die kommunistische Revolution niederschlagen könne, die der Niederländer angeblich habe anzetteln wollen. Der auch geistig bereits angeschlagene Hindenburg stimmte zu, machte von den Notstandsbefugnissen Gebrauch, die Artikel 48 des Grundgesetzes dem Bundespräsidenten einräumte, und unterzeichnete die berüchtigte Reichstagsbrandverordnung. Diese Verordnung setzte die bürgerlichen Freiheiten außer Kraft und erlaubte Hitlers Männern, Gegner nach Belieben und ohne Anklage oder Prozess zu verhaften. Für viele deutsche Kommunisten kam sie einem Todesurteil gleich.
In Preußen wurden innerhalb von zwei Wochen nach dem Brand rund 10000 Kommunisten inhaftiert. Unter ihnen befand sich Erwin Jöris, der zu Schutzhaft verurteilt und in einem der ersten Konzentrationslager interniert wurde, dem KZ Sonnenburg, das am 3. April 1933 bei Kostrzyn im heutigen Polen eröffnet wurde. Jugendliche wie Erwin waren für die Nazis unbedeutende Kinder. Sie hatten es auf die Führer der KPD abgesehen, die im deutschen Parlament, dem Reichstag, die Verabschiedung von Gesetzen blockieren könnten, die zum Abbau der Demokratie unter einem legalen Deckmantel erforderlich waren. Seit der letzten Wahl im November 1932 hatten kommunistische Abgeordnete noch 100 der 584 Sitze inne. Jeder Einzelne von ihnen wurde jetzt erbarmungslos verfolgt.
Nur wenige Tage nach dem Brand, am 3. März 1933, verhafteten die Nazis den KPD-Führer Ernst Thälmann, auch bekannt unter seinem Spitznamen »Teddy«. Am selben Tag hob eine preußische Kommission die rechtlichen Beschränkungen für die neu gegründete Geheime Staatspolizei auf – die Gestapo. Damit hatte die Gestapo hinsichtlich Polizeimethoden und Bestrafung praktisch freie Hand. Thälmann sollte das erste Opfer dieser rücksichtslosen, entfesselten Organisation werden. Während die Behörden versuchten, Informationen für seinen Prozess zu gewinnen, wurde er wiederholt misshandelt. Mehrmals schleppte man ihn aus seiner Zelle im Gefängnis Moabit in die Gestapo-Zentrale in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin. Dort erlitt er die schlimmsten Strafen, zu denen ein gesetzloser Sicherheitsapparat fähig war. Am 8. Januar 1934 verlor er vier Zähne, und er wurde mit einem Sjambok blutig geschlagen, einer Nashornpeitsche, die später sinnbildlich für das Apartheidregime in Südafrika stand, wo sie von den Polizeikräften häufig eingesetzt wurde. 1944 wurde Thälmann im KZ Buchenwald schließlich ermordet.
Um Hitlers Schergen zu entkommen, flohen viele deutsche Kommunisten ins Ausland. Einige waren weiterhin politisch aktiv und bauten mit Hilfe der Kommunistischen Internationalen (Komintern), einer von der Sowjetunion gelenkten Organisation zur Förderung des Weltkommunismus, Widerstandszellen in Prag und Paris auf. Viele ehemalige KPD-Mitglieder gingen direkt nach Moskau, wo sie dem kommunistischen Staat ihre Dienste anboten. Sie nahmen ihre Ehepartner und Kinder mit und bildeten neue Gemeinschaften an einem Ort, den sie während ihrer Kämpfe in den 1920ern und frühen 1930ern idealisiert hatten. Nicht in Berlin, sondern in Moskau keimten die ersten Ideen für einen Kommunismus auf deutschem Boden.
Leben im Paradies
Moskau, Ende Oktober 1936. Wladimir Leonhard gewöhnte sich langsam an das Leben in der russischen Hauptstadt. Im Sommer 1935 war der Teenager mit seiner Mutter Susanne Leonhard, einer kommunistischen deutschen Schriftstellerin, dorthin gezogen. Sie standen sich nahe, verbunden durch ihre gemeinsame politische Einstellung, für die sie beide ins Exil gezwungen worden waren. Susanne hatte ihren einzigen Sohn sogar nach ihrem großen Idol, Wladimir Iljitsch Uljanow, benannt, besser bekannt als Lenin. Solange sich der Junge erinnern konnte, waren sie immer nur zu zweit gewesen. Die Mutter hatte sich 1919 nach nur einem Ehejahr von seinem Vater Rudolf Leonard scheiden lassen und war von Berlin nach Wien gezogen, wo sie in der sowjetischen Botschaft gearbeitet und sich in den Botschafter Mieczysław Broński verliebt hatte. Auch diese Ehe wurde nach kurzer Zeit wieder aufgelöst, und das Paar ging getrennter Wege. Mutter und Sohn behielten den Namen von Susannes erstem Mann und zogen zurück nach Berlin, wo sie als Journalistin arbeitete und sich ganz dem kommunistischen Engagement widmete. Wie so viele ihrer Kameraden mussten sie vor dem Naziregime fliehen und emigrierten nach Russland.
Da die alleinerziehende Mutter in Moskau keine geeignete Unterkunft für sich und den 14-jährigen Wladimir finden konnte, wurde der Junge im Kinderheim Nr. 6 untergebracht, einem Waisenhaus, das für die Unterbringung der Kinder vornehmlich österreichischer Kommunisten bekannt wurde, die getötet worden oder in den Untergrund gegangen waren. Der Teenager genoss das privilegierte Leben, das ihm das Heim bot, war aber stets froh, seine Mutter zu sehen, die als Untermieterin in einer armseligen Wohnung in einem anderen Teil Moskaus lebte.
Als sie sich an einem Nachmittag Ende Oktober 1936 trafen, war Wladimir bester Stimmung, wie jedes Mal, wenn die beiden Zeit miteinander verbrachten. Sie ging mit ihm in seinen Lieblingsladen Wostotschnyje Sladosti (»Östliche Süßwaren«). Er erzählte ihr, dass er Probleme mit einigen technischen Zeichnungen habe, die er als Hausaufgaben fertigstellen müsse, und sie versprach, ihm dabei zu helfen. Als sie sich verabschiedeten, eilte Wladimir davon, da er noch mehr Arbeit zu erledigen hatte. Seine Mutter stand auf der Straße und winkte ihm nach. Als sich der Junge am nächsten Tag erneut mit seiner Mutter treffen wollte, war sie nicht da. Sie war verhaftet worden und sollte in das Arbeitslager Workuta verschleppt werden, wo in den nächsten zwei Jahrzehnten etwa eine Viertelmillion Häftlinge umkam.
Die Verhaftung seiner Mutter war für Wladimir ein großer Schock. Wie Tausende ihrer deutschen Landsleute glaubten auch die Leonhards, dass sie von einer Emigration in die UdSSR nur profitieren könnten. Sie würden nicht nur den verheerenden Übergriffen der Nazis entgehen, die so viele ihrer Freunde und Kollegen in Konzentrationslager und Gefängnisse gesteckt hatten, sondern obendrein die Chance erhalten, am Aufbau einer besseren Welt mitzuwirken. Mit der Russischen Revolution von 1917 hatte das erste echte kommunistische Experiment begonnen. Deutsche Sozialisten und Kommunisten hatten vergeblich auf die Revolution gehofft, die ihr Landsmann Karl Marx Mitte des vorangegangenen Jahrhunderts prophezeit hatte. Auch der Erste Weltkrieg hatte sich nicht als Stunde der Wahrheit für ihr Vaterland erwiesen. Gleichwohl hatte der Gedanke einer Weltrevolution als Erlösung für die Arbeiterklasse für viele der ärmsten Werktätigen nie seine Anziehungskraft verloren. Die endlosen gewaltsamen Straßenkämpfe und die prekäre Arbeit, die nie genug Geld einzubringen schien, das Chaos und die Not der 1920er-Jahre wurden in dem Glauben ertragen, dass Marx recht hatte. Die Revolution würde kommen.
In den Nachkriegsjahren der 1920er- und frühen 1930er-Jahre schufteten Millionen desillusionierter, hungriger und erschöpfter Arbeiter in den deutschen Industriestädten. Sie wurden von einer wohlhabenden städtischen Elite ignoriert, die so sehr mit ihrem eigenen Verlangen nach oberflächlicher Unterhaltung beschäftigt war, dass sie den Invaliden auf der Straße, den zuckenden »Kriegszitterern« und den Geschichten der Menschen mit verletztem Stolz und zerplatzten Träumen wenig Beachtung schenkte. Die deutschen Arbeiter wiederum wurden zunehmend verbittert und unversöhnlich. Sie sahen, wie ihre mageren Ersparnisse aufgezehrt wurden, während ihre Arbeitsplätze bestenfalls unsicher waren und nicht selten ganz wegfielen, als im Gefolge des Börsenkrachs von 1929 die Weltwirtschaftskrise begann. Sie sahen, wie ihre oft konservativen Werte von denjenigen mit Füßen getreten und herabgewürdigt wurden, die eine zunehmende Amerikanisierung der deutschen Kultur begrüßten. Was dem städtischen Bürgertum aufregend, neu und abenteuerlich erschien, wirkte auf diejenigen, die weder die Zeit noch das Geld hatten, sich der neuen Kultur hinzugeben, frivol und amoralisch.
Viele deutsche Arbeiter brauchten ein Ziel und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Kommunistische Versammlungen, die sozialen Aktivitäten der Arbeitervereine und sogar die gewalttätigen Zusammenstöße auf der Straße mit den nationalistischen Veteranengruppen, den Freikorps und später mit Hitlers Schlägern der Sturmabteilung (SA), boten die dringend benötigte Fluchtmöglichkeit in einer Welt, die ihnen scheinbar keine Zukunft bot. In diesem Kontext spielte eine Broschüre aus dem Jahre 1925 mit dem Titel Was sahen 58 deutsche Arbeiter in Rußland? eine wichtige Rolle dabei, dass ein geradezu paradiesisches Bild von der Sowjetunion entstand. Sie wurde von dem Kommunisten Hermann Remmele inspiriert, der eine Gruppe seiner Genossen auf eine Art große Reise durch Russland geführt hatte. Das Pamphlet basierte auf ihren Berichten und rühmte die »Arbeiterinnen, die stolz von ihrer Gleichbehandlung sprachen«[11] und von »33 Prozent höheren Löhnen«, nicht zu vergessen, dass die Arbeiter mietfrei wohnten und eine ausgezeichnete Gesundheitsversorgung hätten. All dies musste den Arbeitslosen und Mittellosen wie auch den idealistischen Intellektuellen die Sowjetunion als Gelobtes Land erscheinen lassen. Ältere deutsche Kommunisten, die den Ersten Weltkrieg und seine verheerenden Folgen erlebt hatten, wollten an eine bessere Alternative glauben und sahen in der Sowjetunion einen Hoffnungsschimmer, insbesondere nach den Verhaftungswellen in Berlin im Jahr 1933.
Für die meisten politischen Flüchtlinge aus Deutschland begann ihre Zeit in Moskau wie ein großes Abenteuer. Ob es denn hier in Moskau Deutsche gebe, wollte der Teenager Wladimir Leonhard wissen, als er mit seiner Mutter am Moskauer Bahnhof ankam und in die Granowskistraße 5 gefahren wurde, wo ein Bekannter sich bereit erklärt hatte, sie für ein paar Tage zu beherbergen.[12] Zu seiner Überraschung lebten in der Nachbarschaft Tausende von Deutschen. Es war eine bunt gemischte Gruppe von Exilanten und Exilantinnen, die alle hofften, hier eine gerechtere und bessere Gesellschaft vorzufinden. Wie nicht anders zu erwarten, waren darunter zahlreiche Arbeiter und Politiker, aber auch Schauspieler, Künstler und Bauhausarchitekten, die sich in der pulsierenden urbanen Atmosphäre der Weimarer Republik einen Namen gemacht hatten und wegen ihrer linken Einstellung von den Nazis verfolgt worden waren. Daneben gab es auch viele emigrierte Juden, für die das Leben in Deutschland seit 1933 noch gefährlicher geworden war.
Die meisten der hochrangigen deutschen kommunistischen Exilanten waren im Hotel Lux in Moskau einquartiert. Die Gästeliste las sich wie ein Who’s who des Weltkommunismus. Zu den berühmtesten Bewohnern gehörten der vietnamesische Revolutionär Ho Chi Minh, Johannes R. Becher, ein Schriftsteller, der sich später in der DDR einen Namen machte, der Ungar Imre Nagy, der wegen seiner Rolle im Ungarischen Aufstand von 1956 hingerichtet wurde, und Clara Zetkin, eine der ersten deutschen Kommunistinnen und Frauenrechtlerinnen, die in Moskau starb und deren Urne von keinem Geringeren als Josef Stalin persönlich zur letzten Ruhe getragen wurde. Im Jahr 1933 verfügte das Hotel Lux über 300 Zimmer, in denen insgesamt 600 Gäste untergebracht werden konnten. Besucher, die ab 1921 zu Konferenzen der Kommunistischen Internationalen angereist waren, hatten das Hotel anfänglich in den höchsten Tönen gelobt. Inzwischen war das Gebäude um zwei Geschosse aufgestockt, platzte aber nach der Massenflucht aus Deutschland Mitte der 1930er-Jahre trotzdem aus allen Nähten. Ab 1933 ist in den Quellen häufiger von zerbrochenen Türscharnieren und Ratten die Rede als von aufwendigen Banketten und Seidenvorhängen.
Unter den Gästen des Hotel Lux fanden sich auch deutsche Bauhausarchitekten. Auch sie waren von der Idee angezogen worden, eine neue Welt aufzubauen – in ihrem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre linke Gesinnung war bereits in den Weimarer Jahren mit dem deutschen Konservatismus in Konflikt geraten, und viele waren bereit, ein neues Leben in der Sowjetunion zu beginnen, lange bevor die Nazis in Berlin die Macht übernahmen. Die produktivste Gruppe deutscher Exilarchitekten war die sogenannte Brigade Meyer, eine heterogene Gemeinschaft aus Studentinnen und Studenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Dessauer Bauhauses. Sie waren dem Schweizer Meisterarchitekten Hannes Meyer gefolgt, der von Dessau in die Sowjetunion übersiedelt war. 1930 nahm er eine Stelle in Moskau an, wo er Vorträge über Architektur hielt und einen Kreis deutscher Anhänger um sich scharte.
Die deutsche Bauhausenklave war hinsichtlich ihrer Arbeit in Russland sehr schnell desillusioniert. Zunächst als elitäre Visionäre begrüßt, wurden sie zunehmend durch die sowjetische Bürokratie, den Mangel an Baumaterialien und frustrierend niedrige Qualitätsstandards eingeengt. Die Risse in ihren neu gebauten Gebäuden spiegelten die Risse in ihren Beziehungen zu den Sowjets in ihrem Umfeld wider. Diejenigen, mit denen sie zusammenarbeiteten, missgönnten ihnen ihre privilegierte Stellung, während die höheren politischen Ränge den Ausländern mit Misstrauen begegneten. Meyer selbst hatte schließlich genug und zog zurück in die Schweiz – was für ihn problemlos möglich war, da er über einen Zufluchtsort verfügte, im Gegensatz zu seinen deutschen Anhängern, die nun zwischen Hitler und Stalin festsaßen.
Margarete Mengel, eine deutsch-jüdische Kommunistin, die Meyers Sekretärin, Lebensgefährtin und Mutter seines Sohnes Johannes war, konnte kein Visum für die Schweiz erhalten und musste bleiben. Sie wurde verhaftet und am 20. August 1938 erschossen. Johannes war erst elf Jahre alt, als seine Mutter ermordet wurde, und kam in ein Heim für kriminelle Jugendliche. Noch als ein Teenager wurde er in die Uralregion deportiert, wo er in Bergwerken Zwangsarbeit leisten musste. Erst 1993 erfuhr Johannes, was mit seiner Mutter geschehen war, und beschloss im Alter von 67 Jahren, nach Deutschland zu emigrieren.[13]
Anderen aus Meyers Gruppe erging es kaum besser. Philipp Tolziner, ein in München geborener jüdischer Architekt, wurde 1938 verhaftet und zu zehn Jahren Haft in einem Gulag bei Solikamsk verurteilt. Unter Folter gestand er, ein deutscher Spion gewesen zu sein, und verriet die Namen zweier weiterer Kollegen, von denen er irrtümlich annahm, sie hätten das Land verlassen.
Stalins »Deutsche Operation«
NKWD-Befehl 00439 von N. Jeschow, 25. Juli 1937.
»Durch neuestes Material von Agenten und durch Ermittlungen ist bewiesen worden, dass der deutsche Generalstab und die Gestapo umfangreiche Ausspähung und Spionage in den wichtigsten Industrien und insbesondere in der Rüstungsindustrie organisiert haben und dass sie zu diesem Zweck die deutschen Staatsangehörigen benutzen, die jetzt dort leben […]. Um diese Tätigkeit der deutschen Aufklärung vollständig zu unterdrücken, BEFEHLEICH:
Ab 29. Juli dieses Jahres die Verhaftung aller deutschen Staatsangehörigen, die in Rüstungsbetrieben oder in Betrieben, die Rüstungsgüter oder Güter für das Eisenbahnwesen herstellen, arbeiten oder aus einem dieser Bereiche entlassen worden sind.«[14]
Dieser Befehl wurde unter dem Namen von Nikolai Jeschow ausgestellt, Chef des NKWD, des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten, trägt jedoch nicht dessen eigenhändige Unterschrift und stammt vermutlich von Stalin selbst. Im Jahr 1937 war der Diktator davon überzeugt, dass die scharfe Rhetorik der Nazis gegen die Sowjetunion bald in eine reale Invasion umschlagen würde. Bereits 1926 hatte Hitler im zweiten Band seines Buches Mein Kampf behauptet: »Im russischen Bolschewismus haben wir den im 20. Jahrhundert unternommenen Versuch des Judentums zu erblicken, sich die Weltherrschaft anzueignen.«[15] Den Kampf zwischen Deutschland und seinem russischen Feind hatte er als Überlebenskampf zwischen sich gegenseitig ausschließenden Zivilisationen dargestellt. Mitte der 1930er-Jahre wurden Hitlers eklatante Verstöße gegen den Versailler Vertrag bei seinem Aufrüstungsprogramm öffentlich zur Schau gestellt, während ein Großteil des Westens zusah und ihm gratulierte. Für Stalin war ein Einmarsch der Nazis eine Frage des Wann, nicht des Ob, und er war überzeugt, dass Russland allein dastehen würde, wenn es dazu käme.
Stalin neigte von Natur aus zu Paranoia und machte »die bürokratischen Institutionen der Sowjetunion zu Erweiterungen seiner inneren Persönlichkeit«, wie der politische Psychologe Raymond Birt schreibt.[16] Zu den vielen Merkmalen der paranoiden Persönlichkeit, die Birt in Stalin sieht, gehöre die Neigung, das Opfer zu spielen, und das Bedürfnis »zu beweisen, dass die Verfolgung real ist«.[17] Stalin begann, überall Agenten Hitlers zu sehen, die mit der Vorbereitung des baldigen Angriffs beschäftigt waren. Er hatte seine neuen Städte von deutschen Architekten bauen lassen. Deutsche Politiker schienen die Komintern zu unterwandern, was Stalin schon lange verdächtig vorkam, da die Deutschen ein Fünftel der Mitglieder ausmachten und es trotzdem nicht geschafft hatten, die Machtübernahme der Nazis in ihrem Heimatland zu verhindern. Deutsche Männer und Frauen arbeiteten in Bergwerken und Munitionsfabriken. Deutsche Schulen und Kinderheime bildeten direkt vor seiner Nase neue Mitstreiter aus. Kurzum, Deutsche gab es überall, und wenn sie sich zusammenrotteten, um ihren Landsleuten in der Heimat zu helfen, könnten sie großen Schaden anrichten.
Stalins Angst schwelte schon seit 1933, und 1936 hatte sie ihren Siedepunkt erreicht. Hitlers fünfte Kolonne musste ausgelöscht werden. Vollständig. Stalins Verdacht richtete sich nicht nur gegen die kürzlich ins Exil gegangenen Deutschen. Jeder, der Deutsch sprach, die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, ethnisch deutsch war oder auch ohne Staatsangehörigkeit irgendeine Verbindung zu Deutschland hatte, wurde zur Zielscheibe. Das waren Zehntausende Menschen.
Mit dem NKWD-Befehl 00439 wurde die sogenannte Deutsche Operation eingeleitet, bei der insgesamt 55005 Personen verhaftet wurden. Davon wurden 41898 erschossen und 13107 zu langen Haftstrafen verurteilt.[18] Hierzu gehörten auch drei Viertel aller politischen Emigranten. Ganz gleich, wie wohlwollend das Sowjetregime sie einst behandelt hatte, nun war niemand mehr sicher. Ganze Familien, Wohnblocks, Straßen und Fabriken wurden ausradiert. Durch Stalins Maßnahmen starben mehr Mitglieder des Politbüros der KPD als durch die Hand Hitlers.
Hermann Remmele, Leiter der Gruppe, die für die Propagandabroschüre Was sahen 58 deutsche Arbeiter in Rußland? verantwortlich zeichnete, erlitt ein Schicksal, das stellvertretend für viele deutsche Kommunisten stand. Der einstige Liebling der sowjetischen Politelite (Grigori Sinowjew hatte ihn als »das beste und wertvollste Kapital der deutschen Partei, das Gold des Proletariats« bezeichnet) wurde im Mai 1937 in Russland unter dem Vorwurf der Spionage und Sabotage verhaftet. Zwei Jahre später wurde er zum Tode verurteilt und noch am selben Tag, dem 7. März 1939, erschossen. Sein Sohn Helmuth starb auf dem Transport in ein sibirisches Straflager, und seine Frau Anna erlag den gesundheitlichen Problemen, die durch den qualvollen Aufenthalt im Moskauer Butyrka-Gefängnis verursacht worden waren. Solche Familientragödien sollten sich noch Tausende Male wiederholen, denn Stalins kommunistische Utopie entpuppte sich als dystopische Hölle.
Eine bittere Ironie des Schicksals war, dass diejenigen, die 1933 von den Nazis in den ersten Konzentrationslagern inhaftiert worden waren, ganz oben auf der Liste der verdächtigen Personen standen. In den Augen von Stalin und seinen Schergen musste jeder, der Hitlers Fängen entkommen war, den Nazis eine Gegenleistung erbracht haben. Vielleicht das Versprechen, in die Sowjetunion einzudringen, einen Job in einer Munitionsfabrik anzunehmen und systematische Sabotageakte zur Vorbereitung einer deutschen Invasion zu organisieren.
Als Erwin Jöris 1937 an seinem Arbeitsplatz in Sibirien verhaftet wurde, fanden die Behörden schnell heraus, dass er aus einem KZ der Nazis entkommen war. Nun arbeitete er in einem von Stalins Industriezentren. Nach vier Monaten im Gefängnis von Swerdlowsk in Sibirien wurde Erwin in das Lubjanka-Gefängnis in Moskau verlegt. Das stattliche neobarocke Gebäude mit seiner charakteristischen gelben Backsteinfassade war um die Jahrhundertwende an der Stelle errichtet worden, an der die Geheimpolizei von Katharina der Großen einst ihr Hauptquartier unterhalten hatte. Jetzt leitete Stalins berüchtigter Sicherheitschef Nikolai Jeschow von seinem Büro im dritten Stock aus die Große Säuberung. Wie viele seiner deutschen Exilgenossen war sich Erwin nicht bewusst gewesen, welche Ausmaße die Säuberungen hatten und in welch großer Gefahr er selbst schwebte.
Die Deutsche Operation bildete nur einen Bruchteil des Terrors. Da Stalins persönliche Paranoia zur Staatspolitik geworden war, wurden ganze Fabriken, Straßen und Gemeinden leer gefegt. Zwischen 1936 und 1938 wurden Millionen von Menschen verhaftet, meist unter dem Vorwurf »konterrevolutionärer« Aktivitäten. Die Gesamtzahl der Todesopfer während des Großen Terrors wird auf etwa eine Million geschätzt. Hinrichtungen im Lubjanka-Gefängnis, in dem Erwin inhaftiert war, wurden in einer eigens dafür eingerichteten Kammer im Keller oder in einem nahe gelegenen Gerichtsgebäude in der Nikolskaja-Straße vollstreckt, das viele Moskauer später das »Erschießungshaus« nannten. Das Lubjanka-Gebäude wird bis heute genutzt – als Gefängnis und als Sitz der KGB-Nachfolgeorganisation FSB (Föderaler Sicherheitsdienst der Russischen Föderation).
Die Gefängniszellen in der Lubjanka hatten keine Fenster. Es ist immer noch fraglich, ob sie sich im Keller des Gebäudes oder im fensterlosen Obergeschoss befanden, da die Häftlinge mit verbundenen Augen dorthin gebracht und durch Schlafentzug vorsätzlich desorientiert wurden. Was wir aus den Aussagen von Überlebenden wissen, ist, dass Männer und Frauen in der Lubjanka ohne Gerichtsverfahren festgehalten und gefoltert wurden, bis sie gestanden, Mitglieder einer faschistischen oder trotzkistischen Verschwörung gewesen zu sein. Manche wurden gedemütigt, indem sie nackt an den kalten Boden gefesselt und von den Wachen beschimpft und geschlagen wurden. Andere wurden erschossen, erhängt oder begingen Selbstmord. Diejenigen, die überlebten, wurden in Gulag-Lager im Osten deportiert. Mit Galgenhumor sagte man, die Lubjanka sei das höchste Gebäude der Hauptstadt – von ihrem Keller aus könne man bis nach Sibirien sehen.
Das NKWD hatte für den Häftling Erwin Jöris eine einfachere Lösung. Als deutscher Staatsbürger wurde er zur Deportation verurteilt. So erging es vielen deutschen Exilkommunisten, denn dieses Urteil erfüllte eine Doppelfunktion: Man wollte Hitler im Vorfeld des Molotow-Ribbentrop-Pakts besänftigen, indem man seinen Feinden eine sichere Zuflucht verweigerte, und gleichzeitig verdächtige ausländische Elemente beseitigen, ohne sich dabei selbst die Hände schmutzig zu machen. Beim NKWD wusste man, dass man die ehemaligen Kameraden direkt in die Fänge von Heinrich Himmlers Sicherheitsapparat lieferte. Im April 1938 wurde Erwin in einen Zug gesetzt. Noch bevor er die polnische Grenze erreichte, wartete bereits ein Gestapo-Offizier auf den lästigen Kommunisten. In Berlin angekommen, wurde er ins Gefängnis Moabit verlegt, in dem auch der KPD-Führer Ernst Thälmann geschmachtet hatte, während er von der Gestapo verhört und gefoltert worden war.
Selbst prominente Persönlichkeiten wie Willi Budich, ein deutscher Kommunist der alten Garde, der seit 1910 Mitglied sozialistischer Parteien war, konnte sich nicht den Anschuldigungen entziehen, er hätte irgendwie mit den Nazis paktiert, um aus der Haft entlassen zu werden. Sein Schicksal ist eine weitere erschütternde Geschichte eines deutschen Kommunisten, der Hitler entkommen war, um dann ins Visier Stalins zu geraten.[19] Budich hatte ein Leben lang für seine kommunistischen Ideale gekämpft. Als seine zukünftige Frau, eine russische Jurastudentin namens Luba Gerbilskaja, ihn im Dezember 1922 auf dem Weltkongress der Komintern kennenlernte, trug er bereits die seelischen und körperlichen Narben seines Kampfes. Sie erinnerte sich später daran, dass er älter gewirkt habe als seine 32 Jahre: »Das war auf das schwere und gefahrvolle Leben dieses Revolutionärs und heldenhaften Kommunisten zurückzuführen.«[20] Als die Nazis 1933 an die Macht gelangten, war Budich Reichstagsabgeordneter der der KPD. Bereits 1932 hatte er bewiesen, dass er die »braune Pest« mit allen Mitteln bekämpfen würde. Bei einer heftigen Prügelei mit Nazischlägern im Plenarsaal wurde ihm mit einem Stuhl die Kniescheibe zertrümmert. Er konnte das Bein nie wieder richtig gebrauchen.
Nach dem Reichstagsbrand 1933 wurde er von der SA gefasst und in das Konzentrationslager Columbia in Berlin verbracht, wo man ihn halb zu Tode folterte. Als er freigelassen wurde, hatte er gebrochene Beine und war schwer seh- und hörbehindert. Seine Frau, die mit ihren beiden kleinen Töchtern Irina und Marianne-Leonie nach Moskau geflohen war, organisierte seine Ausreise dorthin. Doch weder der jahrzehntelange ideologische Kampf noch sein verkrüppelter Körper, der von diesem Kampf zeugte, reichten aus. Er hatte eine längere Inhaftierung in den Lagern der Nazis überstanden, und das allein machte ihn verdächtig. Im September 1936 wurde Budich als Mitglied der »Wollenberg-Hoelz-Organisation« verhaftet – einer fiktiven Gruppe, die der NKWD erfunden hatte, um 70 deutsche Kommunisten als Mitglieder einer »konterrevolutionären, terroristischen und trotzkistischen Verschwörung« anklagen zu können.[21] Budich wurde im März 1938 vor Gericht gestellt und noch am selben Tag erschossen. Erst drei Jahre nach Stalins Tod im Jahr 1956 wurde er post mortem rehabilitiert.
Dass in der UdSSR deutsche Spione ihr Unwesen treiben könnten, spielte genau in die irrationale Angst vor einer Konterrevolution hinein, die westliche Agenten in der UdSSR angeblich schürten. Es war eine mächtige Saat des Misstrauens, die in den durch jahrelange Gewalt verrohten Köpfen auf fruchtbaren Boden fiel. Auf den blutigen Schlachtfeldern an der Ostfront des Ersten Weltkriegs war das Leben nicht viel wert gewesen, noch weniger aber in den Jahren des Russischen Bürgerkriegs von 1917 bis 1922, in dem acht bis zehn Millionen Menschen gestorben waren. Im Jahrzehnt nach Lenins Tod 1924 forderten der Machtkampf, aus dem Stalin als Sieger hervorging, und das anschließende Modernisierungsprogramm zahllose weitere Opfer durch Getreidebeschlagnahmungen, Hungersnöte, Industrieunfälle, unerträgliche Arbeitsbedingungen und weitere politische Repression. Die Zehntausenden verhafteten und ermordeten Deutschen ließen Stalin demgegenüber ruhig schlafen.
Unterdessen löste die enorme Verhaftungswelle von 1937 in den Reihen der Exilkommunisten Panik aus. Den Beweis unerschütterlicher Loyalität gegenüber Stalin zu erbringen, war nun nicht länger Sache von Karrieristen und ideologischen Extremisten. Es war zu einer Frage von Leben und Tod geworden. Die einzige Möglichkeit zu demonstrieren, dass man kein »rot lackierter Faschist« war, bestand darin, diejenigen zu denunzieren, die angeblich genau das waren. Als Stalin im Februar 1937 plötzlich die Beherrschung verlor und behauptete, »alle in der Kommunistischen Internationalen arbeiten für den Feind«,[22] geriet die deutsche Delegation in helle Aufregung, woraufhin es zu einer wahren Flut von Denunziationen kam. Grete Wilde, eine deutsche Kommunistin, die 1921 kurz nach Gründung der KPD Parteimitglied geworden war, arbeitete damals in der Kaderabteilung der Komintern in Moskau. Ohne zu zögern, verfasste sie über 20 Seiten mit Denunziationen deutscher Kommunisten. Darin skizzierte sie die Biographien von 44 ihrer Kollegen und behauptete, es handele sich um Trotzkisten und andere feindliche Elemente in den Reihen der KPD.[23] Doch selbst dieser unsägliche Verrat konnte sie nicht retten. Das NKWD war überzeugt, dass sie die wahren Schuldigen deckte. Grete wurde am 5. Oktober 1937 verhaftet und in das Arbeitslager Karaganda in Kasachstan deportiert, wo sie vermutlich 1944 starb. Solche Muster von Verdächtigungen, Denunziationen und Verrat hinterließen bei den deutschen Kommunisten, die sie überlebten, tiefe Spuren, die sie nach dem Krieg in ihr Heimatland mitnahmen.
Kommunistische Kinder
Moskau, Sowjetunion, 1937.Die Verhaftungswellen während des Großen Terrors hinterließen eine große Zahl deutscher Kinder, die entweder auf sich allein gestellt oder verwaist waren. Wenn sie für alt genug befunden wurden, um sich politisch zu äußern, wurden sie mitunter ebenfalls deportiert. Oft landeten sie in Waisenhäusern oder erhielten neue Namen und wurden in Heimen für kriminelle Jugendliche untergebracht. Selbst die Kinder der kommunistischen Elite, die bis dahin ein privilegiertes Leben geführt hatten, bekamen den Terror zu spüren, der die Hauptstadt fest im Griff hatte.
Die meisten Kinder der deutschen kommunistischen Exilgemeinde besuchten die Karl-Liebknecht-Schule, eine 1924 gegründete deutschsprachige Einrichtung in Moskau. Sie wurde von deutschen Intellektuellen unterhalten, die im Land des Sozialismus die »Schule ihrer Träume« aufgebaut hatten,[24] da dies ihrer Meinung nach in Deutschland zusehends problematisch geworden war. Hier wollten sie eine neue Generation von Idealisten heranziehen. Linke deutsche Lehrer und Lehrerinnen waren von dieser Idee so angetan, dass sie nach Moskau zogen, um dort zu unterrichten. Die Schule war eine Blase, die ihre Schüler von der russischen Außenwelt abschirmte, und das erstaunlich lange Zeit. Doch auch diese Blase platzte, als der Große Terror allumfassend wurde. Wladimir Leonhard schilderte dies in seinen Memoiren:
»Von März 1937 an wurde nach und nach ein Lehrer nach dem anderen verhaftet. Zuerst verschwand unser Deutschlehrer, Gerschinski, ein deutscher Kommunist, der als Jugendlicher die Karl-Marx-Schule in Berlin-Neukölln besucht hatte und nach 1933 in die Sowjetunion gekommen war. Es folgte unser Geschichts- und Geografielehrer, Lüschen, ebenfalls Absolvent der Karl-Marx-Schule. Schließlich wurde auch unser Lehrer für Mathematik und Chemie, Kaufmann, verhaftet. […] Die wenigen Lehrer, die übrig blieben, waren völlig übermüdet, da sie alle Stunden der inzwischen Verhafteten übernehmen mussten. Aber sie litten nicht nur an Übermüdung, sondern auch an Angst. Jeder wusste, dass auch er morgen an die Reihe kommen konnte. Dadurch verloren sie ihre Sicherheit und konnten, was wir Schüler natürlich merkten, oft nur mit großer Anstrengung die Stunden zu Ende führen.«[25]
Die deutschen Kinder und Jugendlichen leisteten kaum Widerstand, als die Erwachsenen in ihrem Leben nach und nach verschwanden. Man hatte sie gelehrt, dass man Leid ertrug. Die ihnen eingeimpfte Ideologie besagte, dass Fraktionismus der schlimmste Feind der Weltrevolution sei und interne Zweifler und Dissidenten zum Schweigen gebracht und aus der Bewegung entfernt werden müssten, bevor ihre bösartigen Lügen die Einheit des Kommunismus spalteten und es seinen Feinden ermöglichten, ihn zu besiegen.[26] Leonard berichtet, wie ein zehnjähriges Mädchen in seinem Kinderheim in Moskau auf die Verhaftung und Deportation ihres Vaters reagierte. Als sie abends in einer Gruppe zusammensaßen, verrieten ihre Worte den verzweifelten Wunsch, die Säulen ihrer Welt aufrechtzuerhalten und zu erklären, warum Stalin ihren Vater geholt hatte:
»Ich glaube, man kann die Sache am besten durch ein Beispiel erklären. Stellen wir uns vor, jemand von uns hat einen Apfel, auf den er sehr viel Wert legt, weil es sein einziger ist. In diesem Apfel ist nun eine faulige oder sogar giftige Stelle. Wenn man den Apfel retten will, wird man gezwungen sein, die giftige oder faule Stelle herauszuschälen, um das Übrige zu erhalten. Beim Herausschneiden wird man vielleicht, um sich nicht zu vergiften, nicht nur die schlechten Stellen entfernen, sondern auch weitere Teile herausschneiden, damit nur der wirklich gesunde Teil des Apfels übrig bleibt. So ähnlich ist es jetzt vielleicht bei der Säuberung.«[27]
Die Karl-Liebknecht-Schule brachte einen Kader junger Kommunisten hervor, die nie eine andere Ideologie kennengelernt hatten. Ihre Eltern gehörten durchweg zum harten Kern deutscher Kommunisten und hatten beschlossen, sie nach Sowjetrussland zu bringen, als der Stalinismus gerade das Land zu verändern begonnen hatte. In ihrer Schule waren sämtliche ihrer Lehrer von ähnlicher Gesinnung, welche sich mit Beginn der Säuberungen sogar noch festigte. Für diese Kinder ergab es ideologisch Sinn, dass ihre Eltern geopfert wurden.
Diejenigen unter den deutschen kommunistischen Kindern, die wie Wladimir etwas älter waren, begriffen zudem, dass sie vorerst nicht in ihr Vaterland zurückkehren konnten. Es war eine schreckliche Situation, die eine tiefe Wirkung auf die Psyche hatte. Da die Schüler der Karl-Liebknecht-Schule noch so jung waren, dass sie durch Stalins mörderisches Sieb fielen, bildeten viele Abgänger später den Kern derer, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland zurückkehrten, um den Sozialismus in ihrem Land mit aufzubauen. Wolfgang Leonhard, wie sich Wladimir später nannte, konnte deshalb 1997 in einem Interview mit einigem Recht behaupten, dass die Geschichte der DDR vermutlich in der Karl-Liebknecht-Schule begonnen habe.[28]
Selbstzensur
Sowjetunion, 1938–1939. Wie das zehnjährige Mädchen in Wladimir Leonhards Kinderheim vermochten sich auch viele erwachsene deutsche Kommunisten selbst von der Notwendigkeit der Säuberungen zu überzeugen. Eine noch mächtigere und beständigere Vorstellung war, dass der »weise Vater Stalin« nichts von der exzessiven Gewalt wusste, die seine Untergebenen in seinem Namen verübten. Helmut Damerius, ein deutscher Kommunist, der im Rahmen der »Deutschen Operation« am 17. März 1938 unter falschen Anschuldigungen verhaftet wurde, ist ein typisches Beispiel. Er ging durch die Hölle, zuerst im Lubjanka-Gefängnis in Moskau und dann im Straflager in Solikamsk, wo er sieben Jahre Zwangsarbeit verbüßte. Während dieser Zeit schrieb er insgesamt 17 Briefe an Stalin. Später erklärte er, er habe dies in der Hoffnung getan, auf diese Weise Gerechtigkeit zu erlangen. Er habe darauf vertraut, dass sich alles aufklären werde. In der Zwischenzeit habe er als guter Kommunist hart für das Wohl der Sowjetmacht arbeiten wollen.[29] Seine Briefe wurden nie beantwortet.
Dieser mächtige Gedanke erfasste auch Hedwig Remmele, die Tochter von Hermann und Anna Remmele. Obwohl ihr Vater, ihr Bruder und ihr Mann vom NKWD ermordet worden waren und sie mit ihren Töchtern noch lange nach Kriegsende in Sibirien bleiben musste, hielt sie an der Vorstellung fest, dass Stalin ihr helfen würde. Auch sie schrieb immer wieder Briefe an die Behörden, in der Hoffnung, man würde ihr die Rückkehr aus dem sibirischen Exil, wohin sie nach der Verhaftung ihrer Eltern gebracht worden war, nach Deutschland bewilligen. Sie war immer noch dort, als sie 1953 vom Tod Stalins erfuhr. Als sie die Nachricht erhielt, erlitt sie einen Nervenzusammenbruch. In ihrer Vorstellung hatte sich ihre letzte Hoffnung auf Freiheit in Luft aufgelöst. Im Jahr 1956 kehrte sie schließlich nach Deutschland zurück, 20 Jahre nachdem sie das Land verlassen hatte.
Die Stalintreue derjenigen, die die Großen Säuberungen von 1936–38 überlebt hatten und vom Kommunismus sowjetischer Prägung nicht völlig desillusioniert waren, wurde durch den Molotow-Ribbentrop-Pakt auf eine neue Probe gestellt. Als Hitlerdeutschland und Stalins UdSSR in der Nacht vom 23. auf den 24. August 1939 einen Nichtangriffspakt schlossen, änderte dies alles für die deutschen Kommunisten in der Sowjetunion. So schrecklich die Säuberungen auch gewesen waren – wer einen psychologischen und ideologischen Weg suchte, damit fertigzuwerden, fand ihn. Ganz gleich, wie viele Genossen durch die Hand des NKWD zu Tode gekommen waren, alles diente einem höheren Ziel: dem Sieg über den »Hitlerismus« und den Faschismus im eigenen Land. Die antifaschistische Agenda, die von der KPD in Moskau immer noch propagiert wurde, war das mächtigste Instrument in ihrem ideologischen Repertoire. Der Hitler-Stalin-Pakt zerstörte diese Illusion.
Dennoch war die KPD-Führung im Exil unter der Leitung von Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht bereit, ihre Propaganda so zurechtzubiegen, dass sie der merkwürdigen Übereinkunft von Freund und Feind entsprach. Unverzüglich propagierten sie ein neues Narrativ: Der bevorstehende Krieg sei von den imperialistischen Nationen Frankreich und England provoziert worden. Die Sowjetunion unterstütze die »friedlichen« Absichten Deutschlands. Die kommunistischen Widerstandszellen in London, Paris und Prag waren verständlicherweise empört darüber, dass sie nun aufgefordert waren, Hitlers Regierung anzuerkennen. Kurt Hager, ein deutscher Kommunist im britischen Exil, schrieb unter dem Pseudonym Felix Albin, dass »wir deutschen Antifaschisten unter keinen Umständen den Kampf gegen das Naziregime aufgeben werden«.[30]
Sogar in Moskau selbst hatte die KPD Mühe, die Reste der kommunistischen Enklave zu überzeugen, die nach zwei Jahren brutaler Säuberungen verängstigt und entkräftet war. Am 9. September 1939, nur wenige Tage nach dem deutschen Angriff auf Polen, wurde Walter Ulbricht beauftragt, dem Politbüro Vorschläge zu unterbreiten, wie dies zu erreichen sei. Ulbrichts Notizen für die Sitzung geben einen interessanten Einblick, wie viel argumentative Kreativität gefordert war: »Der Pakt der Sowjetunion mit Deutschland unterstützt die internationale Arbeiterklasse, da er den deutschen Faschismus unter den Stiefel der Sowjetunion zwingt und damit dessen Lügen über die Sowjetunion widerlegt.«[31] So lautete die Devise. Wörter wie »faschistisch« und »hitleristisch« wurden aus dem Material der KPD verbannt; die Parteibüros anderswo sollten geschlossen werden, insbesondere das in Paris, das sich als zu unabhängig von den Komintern-Marionetten in Moskau erwiesen hatte.
Nach dem Großen Terror, der KPD-internen Säuberung und der lächerlichen ideologischen Kehrtwende nach dem Hitler-Stalin-Pakt hatte sich der innere Kreis der kommunistischen Enklave in Moskau auf einen fanatischen Kern reduziert. Diese kleine Gruppe sollte Stalin bedingungslosen Gehorsam leisten und alle Verbindungen zu ihren früheren deutschen Kameraden abbrechen. Im Zentrum dieser erlesenen Clique saßen Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck, die später damit beauftragt werden sollten, den Sozialismus in Deutschland in Stalins Sinne aufzubauen.
Führungsfiguren
Weder Pieck noch Ulbricht zeichneten sich durch eine besonders charismatische Persönlichkeit oder rhetorisches Geschick für eine Führungsrolle aus. Beide hatten seit der Revolution von 1917 bedingungslose Loyalität zu Moskau bewiesen und konnten sich auf den Schutz und die Unterstützung der Sowjetunion verlassen, soweit das überhaupt möglich war. Wilhelm Pieck war ein Kommunist der alten Garde. Geboren 1876, war er 1895 in die SPD eingetreten und fand in deren linksradikalem Flügel eine ideologische Heimat. Einen Großteil des Ersten Weltkriegs verbrachte er im Gefängnis, da er weiterhin mit den Führern der Kriegsopposition – Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg – zusammenarbeitete. Als im Winter 1918/19 die KPD aus der Taufe gehoben wurde, gehörte er zu ihren Gründungsmitgliedern und sprach sich sofort für die freiwillige Unterordnung unter Moskau aus. Im Herbst 1921 begegnete er sogar Lenin persönlich, als er auf einer Tagung der Komintern-Führung Instruktionen erhielt. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit ideologischer Reinheit und Loyalität gegenüber Sowjetrussland überstand Pieck die Säuberungen in Moskau unbeschadet. Sein freundliches, offenes Gesicht täuschte jedoch über einen rücksichtslosen Charakter hinweg. Wer Stalins Terrorwelle überstehen wollte, konnte sich nicht allein auf seinen Ruf verlassen, und so war Pieck eifrig damit beschäftigt, frühere Genossen zu denunzieren und die Säuberung seiner Partei voranzutreiben, um dem Regime in Moskau zu zeigen, dass er nach wie vor loyal war. Als Hitler im Juni 1941 in Russland einfiel und die Operation Barbarossa begann, war Pieck bereit, seiner Wahlheimat beizustehen.
Auch die Biographie von Piecks Genossen Walter Ulbricht zeigt, dass nicht Charisma oder Führungsqualitäten, sondern Gehorsam und Nützlichkeit über die Karrieren – und das Überleben – deutscher Kommunisten in den 1930er- und 40er-Jahren entschieden. Ulbricht war ein schlicht aussehender, untersetzter Mann, etwa 1,65 Meter groß, der mit dem regionalen Dialekt seiner sächsischen Heimat sprach, was für sein überwiegend städtisches Publikum ein wenig komisch klang. Seine Stimme hatte eine ungewöhnlich hohe Tonlage und konnte sich bei Ansprachen vor großen Menschenmassen nicht wirklich durchsetzen. Seine Texte waren voller leerer Phrasen und Wiederholungen – nicht gerade der Stoff, der zu Revolutionen anregt. Seine rhetorischen Duelle als KPD-Abgeordneter im Reichstag mit dem Propagandachef der Nazis in Berlin, Joseph Goebbels, brachten Ulbrichts mangelnde Redekunst besonders deutlich zutage. Nichtsdestotrotz führten ihre verbalen Zweikämpfe häufig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen ihren jeweiligen Anhängern. So auch, als die beiden Ideologen am 22. Januar 1931 im Saalbau in Berlin-Friedrichshain vor 4000 Menschen sprachen – das Ergebnis war eine Massenschlägerei mit hundert Verletzten. Der Zündstoff lag aber stets in der Situation selbst und nicht in den Worten Ulbrichts. Der steife Apparatschik war Goebbels’ rhetorischem Feuerwerk nicht gewachsen. Nach einem Schlagabtausch im Reichstag notierte dieser am 6. Februar 1931 in sein Tagebuch: »Kleines Intermezzo mit dem K.P. Disten Ulbricht, der nur gegen mich wettert – vor leerem Hause –, und dann kommt meine Stunde. Ich bin fabelhaft in Form. Rede eine ganze Stunde vor überfülltem Hause. […] Es ist ein Bombenerfolg und wird auch vom ganzen Hause so gewertet.«[32]
Der 1893 geborene Ulbricht gehörte ebenfalls zu einer älteren Generation deutscher Kommunisten, wenn er auch fast 20 Jahre jünger war als Pieck. Er trat 1912 in die SPD ein und kämpfte während des Ersten Weltkriegs in Polen, Serbien und Belgien. 1919 gehörte er zu den Gründern der KPD und reiste Anfang der 1920er-Jahre nach Russland, wo er eine Rede Lenins hörte, die ihn zeitlebens prägte. Wie Pieck verbrachte auch Ulbricht die Jahre des Nationalsozialismus im Exil – zunächst in Paris, dann in Moskau, wo auch er seine unerschütterliche Loyalität gegenüber Stalin unter Beweis stellte.
Ulbrichts Verhalten während der Säuberungen war von moralischer Ambivalenz geprägt. Einerseits schrieb er im Namen deutscher Emigranten, die unter der sowjetischen Unterdrückung gelitten hatten, Briefe an Georgi Dimitroff, den Chef der Komintern, und Lawrenti Beria, Stalins berüchtigten Sicherheitschef. So setzte er sich am 28. Februar 1941 für deutsche Frauen ein, deren Ehemänner verhaftet oder ermordet worden waren.[33] Andererseits denunzierte er regelmäßig ehemalige Kameraden, um sich bei Stalins Terrorregime beliebt zu machen. Beispielsweise zeigte er eine gewisse Frau Baumert wegen antisowjetischer Propaganda an. Diese habe gesagt, dass einige tschechische Einwanderer ihre Übersiedlung in die UdSSR bedauerten, weil es ihnen noch nie so schlecht gegangen sei wie jetzt.[34] Während seiner Zeit in Moskau zeigte Ulbricht, dass er keinen festen moralischen Kompass und kein anderes Ziel hatte, als Sowjetrussland zu dienen. Auf seine Loyalität konnte man sich verlassen.
Als Hitler am 22. Juni 1941 die Sowjetunion angriff, änderten Ulbricht und Pieck die Propaganda der KPD ein weiteres Mal. Buchstäblich über Nacht kehrten sie zu den alten Parolen vom »gnadenlosen Kampf gegen den Hitlerfaschismus« zurück, und die verbliebenen kommunistischen Führer schlossen sich ihnen an. Ulbrichts Aufgabe war es, das deutsche Volk über die Übel des Nationalsozialismus zu »unterrichten« und den Bann zu brechen, in welchen Hitler seine Landsleute gezogen hatte. Er war verantwortlich für die Planung und Durchführung deutschsprachiger Radiosendungen auf Radio Moskau und leitete ein Umerziehungsprogramm für die deutschen Kriegsgefangenen, die von der Sowjetunion gefangen genommen und in Lagern interniert waren.
In seiner ersten Rundfunksendung am 26. Juni 1941 appellierte er an seine Landsleute: »Das arbeitende Volk Deutschlands und das Sowjetvolk müssen durch den gemeinsamen Kampf zum Sturz der faschistischen Brandstifter die Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden und für eine echte Freundschaft zwischen beiden Völkern schaffen.«[35] Das hatte jedoch nur geringe Wirkung. Nicht nur, dass die deutschen Radios, die sogenannten Volksempfänger, von den Nazis in Massenproduktion hergestellt und so konstruiert wurden, dass der Empfang ausländischer Radiosender eine Umrüstung der Geräte erforderte, auch das Signal selbst war schwach und nicht besonders stabil.
Außerdem hatte Ulbricht sein Vaterland 1933 verlassen und den Nationalsozialismus nie selbst dauerhaft erlebt. Seine Zeit im Moskauer Exil hatte ihn von seinen deutschen Landsleuten entfremdet. Viele hatten sich mit Begeisterung der nationalsozialistischen Ideologie angeschlossen, aber auch diejenigen, die das nicht getan hatten, waren oft von bestimmten Errungenschaften Hitlers beeindruckt, etwa von den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, dem Programm »Kraft durch Freude«, das den Urlaub erschwinglich machte, oder der Wiederbewaffnung und den ersten Erfolgen im Krieg. Ulbricht war völlig perplex, als seine KPD-Delegation im Oktober 1941 versuchte, zu allen 1500 deutschen Kriegsgefangenen im Übergangslager Temnikow zu sprechen, aber eine feindselige Resonanz erhielt. In seinem Bericht beklagte er, dass zehn Jahre des Lebens und Denkens in zwei verschiedenen Systemen sämtliche Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen ausgelöscht hätten.[36]
Ulbrichts geistige Distanz zu den deutschen Männern, die im Osten einen blutigen Kampf für ihren Führer ausfochten, zeigte sich schließlich in Stalingrad. Im Winter 1942/43 saß die 6