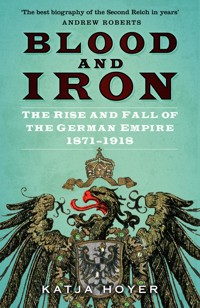21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach Diesseits der Mauer der neue Bestseller von Katja Hoyer Vor 1871 war Deutschland noch keine Nation, sondern lediglich eine Idee. Otto von Bismarck stand vor einer gewaltigen Aufgabe. Wie sollte er neununddreißig Einzelstaaten unter das Joch eines einzigen Kaisers bringen? Konnte der junge europäische Staat nach seiner Vereinigung genug Macht ausüben, um es mit den Imperien Großbritanniens und Frankreichs aufzunehmen – ohne sich dabei selbst zu zerstören? In einer einzigartigen Erzählung über fünf Jahrzehnte, die den Lauf der modernen Geschichte veränderten, zeichnet Katja Hoyer die Geschichte des Deutschen Kaiserreichs von seinen gewaltsamen Anfängen bis zu seinem verhängnisvollen Ende. Ein Buch, das Geschichte auf brillante Weise zum Leben erweckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Katja Hoyer
Im Kaiserreich
Eine kurze Geschichte 1871 – 1918
Sachbuch
Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz
Inhalt
Einleitung 7
1. Aufstieg 1815–1871 17
2. Bismarcks Reich 1871–1888 65
3. Drei Kaiser und ein Kanzler 1888–1890 127
4. Wilhelms Reich 1890–1914 137
5. Die Katastrophe 1914–1918 201
Schlussfolgerungen: Das Ende? 251
Anmerkungen 257
Bibliographie 263
Abbildungen 270
Einleitung
An dem hellen, kalten Wintermorgen des 17. Januar 1871 machte der preußische König Wilhelm I. eine Krise durch. Irgendwann verlor der alte Mann den letzten Rest an Selbstbeherrschung, den er noch besaß, und fing an zu schluchzen: »Morgen ist der unglücklichste Tag meines Lebens. Da tragen wir das preußische Königtum zu Grabe. Und daran sind Sie, Graf Bismarck, schuld.« Der 73-jährige König war ein denkbar ungeeigneter Kandidat für den Mantel des mystischen Kaisers, der eines Tages kommen sollte, um alle Deutschen zu vereinen. Doch genau das wurde von ihm erwartet. Am nächsten Tag, dem 18. Januar 1871, gegen Mittag, versammelten sich mehrere Hundert preußische Offiziere, Angehörige des Adels und Vertreter aller deutschen Regimenter, die im Deutsch-Französischen Krieg gekämpft hatten, im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles. Der Klang von Marschkapellen drang durch die hohen Fenster in den prächtigen Saal und vermischte sich mit dem aufgeregten Geflüster der wartenden Menge. Dann öffneten sich die großen Flügeltüren am Ende der atemberaubenden Halle, und Wilhelm I., Kronprinz Friedrich und die Repräsentanten der deutschen Staaten zogen in einer feierlichen Prozession ein. Eine angespannte, erwartungsvolle Stille stellte sich ein. Es herrschte das Gefühl, dass die Anwesenden einen historischen Moment – von geradezu mythischem Ausmaß – miterlebten.
Wilhelm war es gelungen, sich zusammenzureißen. Er nahm steif den Titel an, der ihm im Laufe der Zeremonie förmlich von den deutschen Fürsten angeboten wurde. Und doch hatte man bereits den Eindruck, dass die neu gegründete Nation es auf der bevorstehenden Reise nicht leicht haben würde. An ihrem Ruder stand künftig ein Monarch, der den Titel »Deutscher Kaiser« abgelehnt hatte und sich nur widerwillig mit dem neutraleren »Kaiser Wilhelm« anreden ließ. Er würde für immer an erster, zweiter und dritter Stelle preußischer König bleiben. Auch Otto von Bismarck, der Architekt des frischgebackenen Staates und sein erster Kanzler, war kein deutscher Nationalist. Für ihn war Deutschland eine Ausdehnung der preußischen Macht und seines Einflusses. Er hatte sogar den Tag der Ausrufung des Deutschen Kaiserreiches so gewählt, dass er mit dem preußischen Nationalfeiertag zusammenfiel. Gemeinsam versuchten König und Kanzler fortan, mit Hilfe eines politischen Konstrukts zu regieren, dem die widerspenstigen südlichen Mitgliedstaaten lediglich beigetreten waren, um ihre Bevölkerung vor der wahrgenommenen Gefahr einer französischen Invasion zu schützen, die Bismarck so raffiniert inszeniert hatte. So entstand ein zerbrechliches und potenziell kurzlebiges Band, um dessen Erhalt der »Eiserne Kanzler«, wie er genannt wurde, hart kämpfen musste. Er hatte es nicht einmal gewagt, die Zeremonie zur Ausrufung des Kaiserreiches in einem der deutschen Staaten zu veranstalten. Stattdessen fand sie im Königspalast von Versailles statt, dem Herzen der besiegten Nation Frankreich – ein passendes Symbol für die zentrale Bedeutung der Vorstellungen von Kampf und Krieg im neuen Kaiserreich.
Einerseits konnte Bismarck auf Jahrhunderte der Mythenbildung zurückgreifen, um aus dem Flickenteppich einzelner Staaten eine Nation zu machen. In den ersten Jahren und Jahrzehnten verwandte das Kaiserreich viel Zeit zum Bau von Denkmälern für alte Legenden, von denen man annahm, sie würden dem frisch gegründeten Deutschland eine Bedeutung und ein kollektives Gedächtnis vermitteln. Wilhelm I. wurde sogar zur Wiedergeburt des mittelalterlichen Kaisers Friedrich Barbarossa erklärt. In der Sage heißt es, Barbarossa schlafe lediglich unter dem Kyffhäuser in Thüringen und werde eines Tages wiederkehren, um Deutschland erneut zu seiner Größe zu erheben. In den 1890er Jahren wurde aus diesem Anlass ein riesiges Denkmal errichtet. Dieses Gefühl einer gemeinsamen Mythologie wurde durch viele deutsche Denker – darunter die Brüder Grimm – noch gesteigert, die schon seit langem argumentierten, dass die deutsche Kultur, Sprache und historische Tradition ein stärkeres Band als die lokale Kleinstaaterei bildeten. Darüber hinaus erforderten die unwiderstehlichen wirtschaftlichen Strömungen der industriellen Revolution, die seit mehr als einem Jahrhundert ganz Westeuropa erfassten, eine stärkere Koordination der Ressourcen, Arbeitskräfte und Politik, wenn die deutschen Staaten nicht hinter ihren französischen und britischen Nachbarn zurückbleiben wollten. Die aufstrebende Mittelschicht erkannte das gewaltige Potenzial der Bodenschätze, günstigen Geographie und Arbeitstraditionen der deutschsprachigen Länder – wenn man es nur durch die Vereinigung freisetzen konnte.
Andererseits reichten kulturelle, wirtschaftliche und politische Bande nicht aus. Wie Bismarck selbst in seiner berühmten Rede von 1862 darlegte, war es Krieg, der das deutsche Volk einte. Das erwies sich vor 1871 als ebenso zutreffend wie danach. Als Bismarck beschloss, einen brandneuen Nationalstaat im Gefechtsfeuer der Kriege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich zu schmieden, schuf er ein Deutschland, dessen einziges verbindendes Erlebnis der Konflikt gegen äußere Feinde war. Das Konglomerat der ehemals 39 Einzelstaaten unter einer föderalen Regierung zusammenzuhalten erwies sich als schwierig, und erste Risse zeigten sich, noch bevor die Tinte der neuen Verfassung trocken war. Bismarck erkannte, dass die Nation nicht über Jahrhunderte hinweg zu einem einheitlichen Ganzen herangewachsen war, sondern eher einem Mosaik glich, das man eilends mit dem Blut seiner Gegner zusammengefügt hatte. Bismarck hatte es sich deshalb zum Ziel gesetzt, den Kampf fortzusetzen, um sein neues Deutschland zu erhalten.
Das war eine riskante Strategie. Der Kanzler war ein gewiefter Politiker, vielleicht einer der geschicktesten Staatsmänner aller Zeiten, und er begriff sehr wohl, wie fragil das sogenannte Konzert Europas im Jahr 1871 war. Eine neue Großmacht in seiner Mitte einzuführen, war vergleichbar damit, ein Kind mit einer Trompete mitten in ein erstklassiges Symphonieorchester zu setzen. Er wusste, dass die neue Musikerin eine Zeit lang stillhalten musste, bis sie ihr Handwerk gelernt und sich den Respekt der bewährten Musikerinnen verdient hatte. Deshalb konnte Bismarck in absehbarer Zeit keinen äußeren Konflikt anstreben. Stattdessen konzentrierte er sich auf die inneren Feinde, gegen die er die Mehrheit der deutschen Bevölkerung vereinen konnte. Dem neuen Staat gehörten viele Minderheiten wie polnische, dänische und französische Gemeinschaften an, gegen die Bismarck die deutsche Staatszugehörigkeit als Unterscheidungsmerkmal einführen konnte. Verglichen mit einem Franzosen würden sich die Deutschen eher als Deutsche und nicht als Bayern oder Preußen betrachten. Darüber hinaus schien die Religion ein weiteres nützliches Schlachtfeld. Zwei Drittel der Bevölkerung im Kaiserreich waren Protestanten und ein Drittel Katholiken. Mit Hilfe der Säkularisierung der deutschen Gesellschaft versuchte Bismarck, Religion durch Nationalbewusstsein zu ersetzen. Auf diese Weise wollte er neue Bezugspunkte schaffen und die Unterschiede zwischen den Deutschen verringern. Zu guter Letzt erschien ihm der Internationalismus der sozialistischen Bewegung als eine gefährliche Gegenströmung zur nationalen Identität. Bismarck erklärte Sozialisten und Sozialdemokraten zu Staatsfeinden und konnte so auch diesen Faktor dazu nutzen, den Kampf der Mehrheit gegen gemeinsame Feinde zu schüren.
Als Wilhelm II. im Jahr 1888, dem turbulenten Dreikaiserjahr, den Thron bestieg, geriet er schon bald mit Bismarck über die Frage der deutschen Einheit aneinander. Er erkannte dasselbe Problem – dass eine gemeinsame wirtschaftliche und kulturelle Basis nicht ausreichen würde, um das Kaiserreich zusammenzuhalten –, schreckte aber vor Bismarcks Lösung zurück, Deutsche gegeneinander aufzuhetzen. Wilhelm wollte der Kaiser aller Deutschen sein, von seinen Untertanen geliebt. Wenn sein Großvater Wilhelm I. sich weigerte, Friedrich Barbarossa wiederaufleben zu lassen, so war es an ihm, sein Volk zu einstiger Größe zurückzuführen. Statt nach Feinden innerhalb des Reiches zu suchen, argumentierte er, müsse Deutschland nach außen um seinen Platz unter den großen Nationen kämpfen. Auf diese Weise werde ein so starkes Band aus Blut und Eisen geschmiedet, dass niemand es jemals wieder zerschlagen könne. Die Vorstellung, dass Deutschlands äußerer Kampf um »einen Platz an der Sonne«, nach einem Imperium auf Augenhöhe mit dem Großbritanniens und Frankreichs, eine innere Einheit herbeiführen werde, war natürlich ein Irrglaube und wurde dem Kaiserreich letztlich zum Verhängnis. Doch mit seinen 29 Jahren mangelte es dem hitzköpfigen Kaiser an der politischen Klugheit des Eisernen Kanzlers. Letzterer trat 1890 verbittert und gekränkt von seinem Amt zurück und überließ Wilhelm die Zügel einer instabilen Nation. Ein Deutschland ohne Bismarck hatte es noch nicht gegeben, und als der erfahrene alte Staatsmann zurücktrat, brach eine ungewisse Zukunft an.
Wilhelm stellte schon bald fest, dass die dauerhaft spaltenden Faktoren Religion, Klasse, Geographie, Kultur und Herkunft – um nur einige zu nennen – nicht einfach durch die alleinige Kraft der Persönlichkeit und des majestätischen Charismas ausgemerzt werden konnten, die er nach seiner festen Überzeugung doch gewiss besaß. Sozialisten streikten weiter unablässig, Katholiken betrachteten den preußischen König immer noch voller Misstrauen, und polnische Separatisten forderten weiterhin einen eigenen Staat. Womöglich könnten sie alle überzeugt werden, dass Deutschland alles sei, wenn sie ein Kolonialreich hätten, auf das man stolz sein konnte. Wilhelms großspuriges Trachten nach einem »Platz an der Sonne« sollte die junge Nation schließlich in einen Kampf führen, der sie an den Rand der Vernichtung brachte.
Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, war Kaiser Wilhelm II. anfangs geschockt. Der lokal begrenzte Balkankrieg, auf den er gehofft hatte, hatte sich zu einem umfassenden europäischen Konflikt ausgewachsen. Eine Chance, alle Deutschen endlich zusammenzuführen, sah er dennoch. Am 1. August 1914 erklärte er: »Wir sind heute alle deutsche Brüder, und nur noch deutsche Brüder.« Jüngste Forschungen haben zwar die Legende von der verbreiteten Euphorie bei Kriegsausbruch widerlegt, aber es herrschte doch das Gefühl, dass das »Vaterland« verteidigt werden musste. Am Ende sollte sich allerdings herausstellen, dass der Erste Weltkrieg dem jungen Staat zu viel Blut und Eisen abverlangte. Im November 1918 lag die deutsche Nation besiegt am Boden, ihre Krone dem Monarchen vom Haupt geschlagen, ihr Schild und Schwert in Trümmern und der Kampfgeist gebrochen. Der Erzfeind Frankreich wartete nur darauf, sie zu zerschlagen und aufzulösen, mit dem Argument, dass von einem Staat, dessen nationale Identität auf Krieg aufgebaut sei, nur weiteres Blutvergießen ausgehen könne. Das Reich würde dort zerschlagen werden, wo es ausgerufen wurde: im Spiegelsaal von Versailles.
Aber Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika sahen in der glimmenden Asche des Reiches ein anderes Deutschland. Die Saat der Demokratie und des wirtschaftlichen Wohlstands, die Bismarck gelegt hatte, hatten zum langsamen und zarten Aufkeimen einer anderen nationalen Vision für Deutschland geführt: ein Land, das seine Identität und seinen Platz unter den Nationen der Welt über den Handel, Stabilität und Demokratie finden würde. Sie hatten recht, aber es sollte einen weiteren Krieg geben, der die Gräuel des Ersten Weltkriegs in den Schatten stellen sollte, bevor Deutschland seine gewaltsamen und militaristischen Anfänge abschütteln konnte.
Das Deutsche Kaiserreich wurde unablässig von den Konflikten heimgesucht, die dem Gründungsprozess innegewohnt hatten. Einerseits erkannte Bismarck liberale Traditionen an, indem er ein allgemeines Männerwahlrecht einführte, welches die Entwicklung eines wirklich pluralistischen Mehrparteiensystems ermöglichte, andererseits stand dieses System unablässig durch die autoritäre Vorgehensweise Preußens unter massivem Druck. Das unermüdliche Ringen entgegengesetzter Identitäten, die der nationalen Identität Konkurrenz machten und sie bisweilen überschatteten, veranlasste sowohl Bismarck als auch Wilhelm II., bewusst Konflikte zu schüren, um eine Plattform zu bekommen, mit deren Hilfe eine nationale Einheit geschaffen werden konnte. Keiner der beiden gründete zu ihren Lebzeiten einen blühenden und vereinten Staat, aber sie trugen beide (wissentlich oder nicht) dazu bei, die Saat für das wirtschaftliche und demokratische Schwergewicht zu legen, das Deutschland später werden sollte.
KAPITEL 1Aufstieg 1815–1871
»Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden […], sondern durch Eisen und Blut.«
Otto von Bismarck
1815: Die Deutschen lehnen sich auf
»An mein Volk« lautete die Überschrift des emotionalen Appells des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. von 1813 an all seine Untertanen, bei der Befreiung der deutschen Länder von der französischen Besatzung mitzuhelfen. Wer sein Volk eigentlich war, wusste der Monarch allem Anschein nach nicht einmal selbst mit Sicherheit. Der erste Abschnitt seines Appells richtet sich an »Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern, Litthauer«. Als er jedoch einen emotionaleren Ton anschlägt, wechselt er zu »Preußen« und schließlich zu »Deutschen«, als er die Nation auffordert, sich angesichts eines »fremden« Feindes zusammenzuschließen. Friedrich Wilhelm schien sich der Tatsache bewusst, dass seine Untertanen mehrschichtige Identitäten hatten. Starke regionale Loyalitäten standen in Friedenszeiten einem Nationalbewusstsein entgegen, traten jedoch in den Hintergrund, sobald Deutsche gegen eine feindliche äußere Kraft kämpften. Das fast schon zwanghafte Muster des deutschen Strebens nach nationaler Einheit war für das kommende Jahrhundert vorgezeichnet.[1]
Passenderweise war das Jahr, in dem Napoleon endgültig bei Waterloo geschlagen wurde, auch das Jahr, in dem Otto von Bismarck zur Welt kam: 1815. Seine Kindheit war – wie die der meisten Deutschen, die um diese Zeit aufwuchsen – massiv von Geschichten über den Kampf gegen die Franzosen geprägt. Als Napoleon im Jahr 1806 Preußen in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt eine vernichtende Niederlage beigebracht hatte, wurde ganz Preußen der französischen Oberherrschaft unterworfen. Noch schlimmer als das militärische Scheitern war in den Augen vieler der Frieden von Tilsit im Jahr 1807, in dem der preußische König knapp die Hälfte seines Gebiets und Volkes an Frankreich abtrat, indem er alle Länder westlich der Elbe aufgab. Das war ein demütigendes Zugeständnis, und Friedrich Wilhelm geriet massiv unter Druck, etwas zu unternehmen. Er wurde bereits als schwacher und unentschlossener Monarch wahrgenommen, der angesichts der französischen Aggression viel zu lange gewartet hatte. Der Gegensatz zu seinem legendären preußischen Ahnen Friedrich dem Großen hätte nicht deutlicher zutage treten können. Der »Alte Fritz« hatte sich seinen liebevollen Spitznamen mit einer Reihe aufeinanderfolgender militärischer Siege (auch gegen Frankreich 1757) erworben, wobei er häufig seine Männer persönlich in den Kampf geführt und sich so großer Gefahr ausgesetzt hatte, dass mehrere Pferde unter ihm weggeschossen wurden. Friedrich Wilhelms einzige Rettung war hingegen seine beliebte Frau Luise. Die kluge, willensstarke und charismatische Frau hatte bekanntlich in Tilsit versucht, sich Napoleon zu stellen und bessere Konditionen für Preußen auszuhandeln. So vergeblich der Versuch auch war, machte er aus ihr eine Person mit hohem Ansehen in der Öffentlichkeit. Er ließ jedoch ihren Gatten noch schwächer aussehen. Friedrich Wilhelm war aus Berlin bis an den Rand seines Herrschaftsgebiets in Ostpreußen geflohen und hatte seine Schlachten, seine Hauptstadt, seine Würde und die Unterstützung seines Volkes verloren. Für Preußen war dies ein wahrer Tiefpunkt, doch er vereinte viele deutsche Völker in ihrer Empörung. Ein kollektives Gefühl der Erniedrigung und Schande mag nicht gerade der Stoff nationaler Folklore sein, doch es schuf ein defensives Band zwischen Deutschen, auf das künftige Führungspersonen zurückgreifen konnten.
Die Eltern von Otto von Bismarck waren frisch verheiratet, als die französische Armee ihre nur wenige Kilometer östlich der Elbe gelegene Gemeinde Schönhausen besetzte. Die Soldaten führten sich damals geradezu brutal auf und plünderten das ganze Dorf. Als Friedrich Wilhelm im Jahr 1813 endlich zu den Waffen rief, war das für Karl Wilhelm Ferdinand und Luise Wilhelmine von Bismarck genau wie für die meisten Menschen in den besetzten deutschen Gebieten ein befreiender und erhebender Moment. Kein Opfer war zu groß, um die nationale Würde und Ehre wiederherzustellen. Dafür lohnte es sich zu kämpfen und sogar zu sterben. Ironischerweise lag es nicht zuletzt an der Schwäche des preußischen Königs, dass ein immer stärkeres Gefühl des nationalen Trotzes aufkam. Als Königin Luise 1810 tragisch im jungen Alter von 34 Jahren starb, wurde sie zur Ikone einer deutschen Bewegung, die eine Reihe preußischer Regierungen nacheinander unter Druck setzen sollte, alle Deutschen hinter einer gemeinsamen Sache zu versammeln. Das Bild der jungen Luise, die für Preußen und Deutschland einstand und sich nicht scheute, dem mächtigen Napoleon die Stirn zu bieten, versetzte ihrem trauernden Gatten einen starken moralischen Schub. Als Napoleons Heer dann im Winter 1812 während des Russlandfeldzugs eine schwere Niederlage hinnehmen musste, fand Friedrich Wilhelm endlich den Mut zu handeln. Seine aufrüttelnde Rede im Frühjahr 1813 scharte das preußische Volk hinter den König und hinter eine immer konkretere Vorstellung vom »Vaterland«. Unabhängig von Klasse, Konfession, Geschlecht, Alter oder Region folgten viele einfache Menschen seinem Aufruf. Sie schlossen sich Freiwilligenverbänden an, spendeten »Gold für Eisen«, gründeten wohltätige Vereine und Gesellschaften und halfen bei der Behandlung der Verwundeten.
Allerdings war es alles andere als einfach, Napoleons Truppen aus den deutschen Gebieten zu vertreiben. In einer Reihe langer, zermürbender Zusammenstöße wurden insgesamt 290000 Deutsche zum Kampf aufgerufen. Der spektakuläre Höhepunkt dieses Feldzugs war die Schlacht von Leipzig im Oktober 1813, in der über 500000 Mann kämpften – die größte Feldschlacht in Europa vor dem 20. Jahrhundert. Die Völkerschlacht, wie sie später genannt wurde, ging in die deutsche Geschichte als Meilenstein auf dem Weg zum Nationalstaat ein. Das deutsche Volk erhob sich nach diesem Narrativ gegen seine französischen Unterdrücker und befreite sich so selbst von dem Joch der Fremdherrschaft. Schon im Jahr 1814 plädierten manche dafür, ein Denkmal am Ort der Schlacht zu errichten, und Philosophen wie Ernst Moritz Arndt verliehen diesen Forderungen zusätzlich Nachdruck. Das Denkmal, das 1898 schließlich in Auftrag gegeben wurde, ragt 91 Meter hoch auf – ein Wahrzeichen, das weithin zu sehen ist, noch heute ebenso beeindruckend wie damals. Bemerkenswerterweise wurde es anfangs hauptsächlich durch Spenden aus der Bevölkerung und von der Stadt Leipzig finanziert statt durch Reichsmittel oder den Kaiser. Mehr als 100000 Menschen nahmen 1913 an der Einweihung teil, was lediglich beweist, wie populär die Mythen und Legenden der Entstehung Deutschlands inzwischen waren.
Bismarck und seine Zeitgenossen wuchsen folglich in einer Welt voller Geschichten über die heldenhaften Anstrengungen und den wunderbaren Geist der Befreiungskriege auf, wie man sie später nannte. Die Freiwilligen, die der preußische König mit seinem Aufruf von 1813 zu den Waffen gerufen hatte, wurden »Landwehren« genannt. Sie stellten 120565 der 290000 Mann im Feldheer. Hinzu kamen verschiedene »Freikorps« und zusätzliche Freiwillige aus Preußen und den anderen deutschen Staaten. Nicht allein die Tatsache, dass diese Männer einen so großen Anteil am Kampfgeschehen hatten und deshalb die Vertreibung der Franzosen erst ermöglichten, machte sie zum Stoff unzähliger Legenden. Wichtiger war: Sie legten im Gegensatz zum regulären Heer keinen Treueeid auf Preußen ab. Ihr Zugehörigkeitsgefühl galt dem deutschen Vaterland. Die Farben des berühmten Freikorps Lützow, das am Ende ein Achtel der Kampfkraft Preußens stellte, sollte eine patriotische Bewegung mit einem lang anhaltenden Vermächtnis inspirieren. Sie trugen schwarze Gewänder, rote Bordüren und goldfarbene Messingknöpfe. Die deutsche Trikolore war geboren.
Bemerkenswerterweise erlangte die Schlacht von Waterloo am 18. Juni 1815 nie denselben zentralen Stellenwert für die deutsche nationale Psyche wie im britischen oder französischen kollektiven Gedächtnis. Gewiss, Napoleon war für immer besiegt, und ja, Preußen und Österreich wurden bei den Verhandlungen um die Zukunft Europas wegen ihres Beitrags zur antifranzösischen Allianz ernst genommen. Dennoch wurde die deutsche Geschichte bei Leipzig geschrieben, zumindest für die deutschen Patrioten. Die Völkerschlacht im Herzen der deutschen Lande hatte eine weit größere Anziehungskraft als Höhepunkt eines heldenhaften Kampfes um die nationale Einheit als ein preußischer Beitrag zu einer Schlacht, die auf damals niederländischem Boden ausgetragen wurde. Nichtsdestoweniger war 1815 für Deutschland ebenso eine Wasserscheide wie für den Rest Europas. Es war der Beginn eines neuen Kräftegleichgewichts und eine Chance für die deutschen Staaten, sich darin einen Platz einzurichten.
Die Verhandlungen beim Wiener Kongress (1814/15) erwiesen sich für Preußen als frustrierend. Es meinte bei der Neuverteilung der Gebiete mitreden zu können und strebte die Einverleibung des Königreichs Sachsen an, um sein Herrschaftsgebiet weiter nach Mitteldeutschland auszudehnen. Der britische Außenminister Robert Stewart Viscount Castlereagh unterstützte den preußischen Plan. Er wünschte sich einen geeinten und verlässlichen deutschen Staat, der in Mitteleuropa das Sagen hatte und als eine Barriere gegen jede künftige Aggression seitens Frankreichs fungierte. Allerdings stieß dieses Ansinnen auf energischen Widerstand des Gastgebers der Konferenz, des österreichischen Außenministers Klemens Fürst von Metternich. Österreich war damals in ökonomischer und politischer Hinsicht noch der reifere und mächtigere deutsche Staat. Es musste ein Kompromiss gefunden werden. Am Ende wurde Sachsen geteilt, und Preußen erhielt rund 40 Prozent seines Gebiets. Im Übrigen bestand Preußen darauf, auch die Stadt Wittenberg zugeteilt zu bekommen, wo Martin Luther 300 Jahre zuvor seine 95 Thesen an das Tor der Schlosskirche geschlagen und damit womöglich die Reformation ausgelöst hatte. Diese Episode der deutschen Geschichte war bereits ein zentraler Bestandteil der Nationalbewegung geworden. Studenten und Intellektuelle veranstalteten politische Massenkundgebungen auf der Wartburg, wo sich Luther 300 Tage lang versteckt hatte, nachdem die Kirche ihn zu einem Ketzer erklärt hatte. Und vor allem war dies auch der Ort, wo er die Bibel ins Deutsche übersetzte. Er wurde nicht nur für seinen vereinheitlichenden Einfluss auf die Sprache gefeiert, sondern auch weil protestantische Patrioten große Parallelen zwischen der Reformation und den Befreiungskriegen gegen Frankreich sahen. Deutschland würde immer das Joch fremder Unterdrückung durch die reine Stärke und Willenskraft seines Volkes abwerfen – sei es Napoleon oder der Papst in Rom –, hieß es nach diesem Narrativ. Die preußischen Repräsentanten konnten es sich einfach nicht leisten, Wien ohne den Lohn Wittenberg zu verlassen. Damit hatte das katholische Österreich jedoch keine Probleme, also einigte man sich auf den Kompromiss.
Die für die spätere Reichsgründung folgenreichste Entscheidung in Wien war die Zuteilung eines großen Gebietsstreifens entlang des Rheins an Preußen. Großbritannien wollte dafür sorgen, dass es in Mitteleuropa ein sicheres und zuverlässiges deutsches Bollwerk gab, um eine potenzielle französische Aggression in Schach zu halten und das Machtvakuum zu füllen, das durch den Rückzug der Habsburger aus Belgien entstanden war. Österreich hatte die undankbare Aufgabe satt, die aufmüpfigen Belgier zu regieren, und gab die Wächterrolle am Rhein nur zu gerne an Preußen ab. So war allen Seiten gedient, und einer Einigung stand nichts mehr im Wege. Der preußische Einfluss erstreckte sich – eher zufällig als geplant – nunmehr über die ganze nördliche Hälfte Deutschlands. Das einzige Haar in der Suppe war die Tatsache, dass die neuen Gebiete vom preußischen Kernland im Osten durch die Kleinstaaten Hannover, Braunschweig und Hessen-Kassel getrennt waren. Dennoch bedeutete dies eine gewaltige Erweiterung der Macht, Ressourcen und Bevölkerung, die in den kommenden Jahrzehnten die preußische Dominanz noch verstärken sollten.
Somit markierte das Jahr 1815 in der Geschichte des aufkeimenden Deutschen Reiches einen bedeutenden Wendepunkt. Schon vor der Invasion Napoleons hatte zwar ein Nationalbewusstsein als starke kulturelle Unterströmung anderer Entwicklungen in den deutschen Staaten existiert, doch diese existenzielle äußere Bedrohung war nötig, um die Massen hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. Der leidenschaftlichen Unterstützung für das Vaterland, die in den Landwehren und Freikorps zu beobachten war, deren Freiwillige den entscheidenden Beitrag zu den Befreiungskriegen leisteten, entsprachen die unermüdlichen Anstrengungen der »Gold gab ich für Eisen«-Kampagnen und anderer ziviler Bewegungen. Somit hatten jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in den deutschen Ländern die gleiche nervenaufreibende Bedrohung ihrer Kultur, Sprache und des aufkeimenden Nationalstaats empfunden; überdies hatten viele beträchtliche Opfer gebracht, um sich dagegen zu wehren. Diese kollektive Erfahrung hatte eine enorme psychologische Bindekraft. Wie der Historiker Neil MacGregor in seiner epischen Schilderung der deutschen Kulturgeschichte gezeigt hat, konnten sich lediglich die Gräuel des Dreißigjährigen Krieges 200 Jahre zuvor in der einigenden Kraft mit der Erfahrung der Napoleonischen Kriege messen. Der Geist eines defensiven Nationalismus hatte sich fest verwurzelt und sollte ebenso zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches wie zu seiner Zerstörung führen.
1815–1840: Zwei deutsche Rivalen
Der Wiener Kongress wurde auch von vielen deutschen Nationalisten mit Spannung verfolgt, weil sie hofften, dass die Veränderungen der europäischen Landkarte ein stärker vereinigtes Deutschland hervorbringen werde. Sie waren bitter enttäuscht, als sich Österreich eifrig bemühte, einen von Preußen angeführten Vorstoß in Richtung deutscher Einheit einzudämmen. Preußen erkannte immer noch die österreichische Überlegenheit an und strebte ein System an, das es den beiden großen deutschen Mächten gestatten würde, die kleineren Staaten in irgendeiner Form von Union zu kontrollieren. Zu diesem Zweck, argumentierte Preußen, brauche man eine nennenswerte Zentralregierung, über die eine politische, wirtschaftliche und soziale Linie beschlossen und durchgesetzt werden könne. Österreich fürchtete hingegen, dass damit eine Gleichstellung mit Preußen verbunden wäre, und bemühte sich vielmehr, den Status der höheren Macht zu erhalten. Also plädierte der österreichische Außenminister Klemens von Metternich für eine lose Konföderation deutscher Staaten unter österreichischer Führung. Weil sich die beiden dominierenden Mächte in Wien, Großbritannien und Österreich, in diesem Punkt einig waren, fiel die Entscheidung gegen das preußische Modell. Der Deutsche Bund, eine Art Konföderation, wurde ins Leben gerufen.
Der Bund war als Form der deutschen Vereinigung nicht nur für die preußischen Eliten eine gewaltige Enttäuschung, sondern auch für viele einfache Leute, die bis vor kurzem mit allen Mitteln für ihr Vaterland gekämpft hatten und sich nach einem greifbaren Ergebnis ihres opferreichen Kampfes sehnten. Das Positive an der Sache: Das Ziel des Bundes war nicht eine Rückkehr zu der Vielzahl an Staaten und Fürstentümern des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Für Napoleon war es wichtig gewesen, dass er die eroberten deutschen Staaten auch im Zaum halten konnte. Und deshalb überredete, drohte, schmierte und prügelte er die deutschen Kleinstaaten zum sogenannten Rheinbund, dem 180836 Staaten angehörten. Lediglich Österreich, Preußen und deren Vasallen waren ausgeschlossen. Der Deutsche Bund ahmte dieses Konzept mehr oder weniger nach und umfasste in der endgültigen Form 39 deutsche Staaten. Das erschien als Fortschritt gegenüber den Hunderten von Verwaltungseinheiten des zerfallenden Heiligen Römischen Reiches, doch das Problem war, dass es so gut wie keine zentralisierte Macht gab. Das einzige Bundesorgan, die Bundesversammlung, war im Grunde ein regelmäßig tagender Kongress von Diplomaten statt ein Parlament mit legislativer Gewalt über die Mitgliedstaaten. Unter einem derartigen System war keine bedeutsame wirtschaftliche, politische oder soziale Koordination möglich. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wurde der Vorsitz des Bundes dauerhaft Österreich zugesprochen, ohne Rotation oder Wahl. Unlängst haben Historiker angefangen, die Vorstellung, dieses System stelle lediglich eine lose Konföderation dar, infrage zu stellen, weil es keinem Staat erlaubt war auszutreten und weil Bundesrecht im Prinzip über dem Staatsrecht stand. Beide Behauptungen treffen zwar zu, doch in Wahrheit zwang der Bund niemals Entscheidungen auf Bundesebene der Gesamtheit seiner Mitgliedstaaten auf, abgesehen von einer Verpflichtung zum gegenseitigen Beistand im Fall eines Angriffs von außen. Die Konföderation war im Vergleich zum Heiligen Römischen Reich ein Schritt in Richtung Vereinigung, wobei die Hauptunterschiede darin bestanden, dass die Zahl der Mitgliedstaaten leichter kontrollierbar war und dass diese Staaten zum Kampf gezwungen werden konnten (das Heilige Römische Reich hingegen war auf fragile ausgehandelte Bündnisse angewiesen). Letztlich handelte es sich bei dem Bund jedoch um kaum mehr als ein Verteidigungsbündnis.
Diese Lösung sorgte für großen Frust unter den patriotischen Idealisten, die sich eine substanziellere Antwort auf die deutsche Frage erhofft hatten als die, die der Deutsche Bund unter österreichischer Führung zu bieten hatte. Ihr Traum von einem deutschen Nationalstaat war noch genauso weit außer Reichweite wie zuvor. In dem nationalen Nachglühen der Befreiungskriege waren etliche Vehikel für derartige Empfindungen anzutreffen. Ein Beispiel war die Gründung von Burschenschaften, also national gesinnten Studentenverbindungen an deutschen Universitäten. Die Universität Jena war (und ist noch heute) die spirituelle Heimat dieser Verbindungen. Die sogenannte Urburschenschaft, Deutschlands erste derartige Organisation, wurde dort 1815 gegründet und übernahm die schwarz-rot-goldene Fahne als ihre Farben. Diese glühenden jungen Intellektuellen empörten sich, als ihre nationalen Träume in Wien zerschlagen wurden, und fingen an, Kundgebungen und Demonstrationen zu organisieren, die am Ende zur Revolution von 1848 beitragen sollten. Veranstaltungen wie das Wartburgfest von 1817 oder der Studentenmarsch auf das Hambacher Schloss im Jahr 1832 lieferten einen berauschenden Mix aus Ideen, in dem der Ruf nach Einheit mit Forderungen nach mehr Demokratie, Persönlichkeitsrechten und Liberalismus kombiniert wurde.
Unterstützt wurden sie durch andere Intellektuelle wie die Philosophen Johann Gottlieb Fichte und Georg Friedrich Wilhelm Hegel (die beide Verbindungen nach Jena hatten). Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass es nicht ganz korrekt ist, sie als »deutsche Nationalisten« zu brandmarken, sondern dass man sie im Kontext der Stimmungen des späten 19. Jahrhunderts sehen muss. Gelehrte des Kaiserreiches in den 1880er und 1890er Jahren hielten nach ideologischen Gründungsvätern Ausschau und hafteten den beiden Philosophen ein allzu vereinfachendes Etikett an, das sich lange halten sollte. Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass sie als bedeutende Denker beträchtlichen Einfluss hatten und zur Ausrichtung der liberal-nationalen Bewegung der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beitrugen. Nationale Schriftsteller wie Ernst Moritz Arndt hatten ebenfalls maßgeblichen Anteil an der Nationalbewegung. Sein Lied »Des Deutschen Vaterland« fungierte de facto als Nationalhymne.
In der Alltagskultur hatten die Brüder Grimm ihren Anteil an der kulturellen Vereinigung nach den Napoleonischen Kriegen. Ihre 1812 und 1815 veröffentlichte »Sammlung Deutscher Märchen« brachte inhaltlich nichts Neues. Geschichten von bösen Wölfen, in Türmen eingeschlossenen Mädchen und Hexen in Wäldern machten deutschsprachigen Kindern schon seit Jahrhunderten Angst, doch der große Beitrag der Brüder Grimm lag in der Standardisierung dieser mündlichen Überlieferungen in schriftlicher Form. Sie machten sich ganz bewusst daran, ein gemeinsames Kulturgut für die deutschsprachige Bevölkerung zu schaffen, ihre Ausdrucksweise, die Werte, an die sie glaubte, und ihre Kindheitserlebnisse zu vereinheitlichen, sodass über Generationen hinweg ein kulturelles Band entstand. Gehorsam ist ein Motiv vieler Märchen, und Kinder erleiden häufig ein furchtbares Schicksal, nachdem sie nicht auf ihre Eltern gehört haben. Rotkäppchen ist ein solcher Fall. Ihre Mutter hatte ihr, als sie das Mädchen mit Kuchen und Wein durch den dunklen Wald zur Großmutter schickte, ausdrücklich befohlen, den Weg nicht zu verlassen. Die Brüder Grimm fügten diese mütterliche Warnung ein, die in der französischen Fassung von Charles Perrault fehlt. Selbstverständlich lässt sich Rotkäppchen von den falschen Verführungen des bösen Wolfs nur zu leicht vom Weg locken. Als Folge dieses Umwegs gelingt es dem Untier, schneller zum Haus der Großmutter zu kommen. Er verschlingt die alte Dame und danach, in einer raffinierten Verkleidung, auch die Enkeltochter. Welche Gefahren mit dem kindlichen Ungehorsam verbunden sind, wurde so jedem deutschen Kind lebhaft eingeimpft. Der Wald ist in den Märchen häufig die Kulisse. Er ist immer ein gefährlicher und finsterer Ort, im Gegensatz zur Sicherheit und Ruhe des Dorfes. In diesem Kontext taucht häufig der Jäger – ein mutiger Mann, der solchen Gefahren die Stirn bietet – als Held auf. Auf diese Weise entstanden gemeinsame Bild- und Moralvorstellungen. Die Versuchung ist groß, dies als trivial abzutun, doch die psychologische Funktion gemeinsamer kultureller Kindheitserlebnisse kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Im Verein mit dem mächtigen Band, das die Opfer der Befreiungskriege geschaffen hatten, steigerte der sprachliche und kulturelle Einfluss von Jacob und Wilhelm Grimm das Bewusstsein des Volkes – die Vorstellung eines deutschen Volkes.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird das Wort Nationalismus so stark mit rechter Politik assoziiert, dass es sich lohnt, daran zu erinnern, dass die Form, die nationale Gefühle im 19. Jahrhundert annahmen, stark von liberalen und romantischen Idealen geprägt war. Wie die Brüder Grimm waren viele überzeugt, die nationale Kultur, Identität und Sprache berge eine gewisse Schönheit. Romantische Künstler wie Caspar David Friedrich erfreuten sich einer enormen Popularität. Seine Bilder zeigen häufig nachdenkliche Figuren mit einem Blick auf ikonische deutsche Landschaften, die ein beinahe mystisches Band zwischen Volk und Land betonen. Das Gemälde von 1818Der Wanderer über dem Nebelmeer ist das bekannteste Beispiel. Ihm folgten später heldenhafte Darstellungen der Germania, einer weiblichen Personifizierung der nationalen Identität, die gewöhnlich stark, breitschultrig und kampfbereit gezeigt wird. Im Gegensatz dazu wird die französische Marianne tendenziell in einer feminineren Gestalt gemalt, die Freiheit und Schönheit statt Auflehnung und Tapferkeit hervorhebt. Romantik, Liberalismus und Nationalgefühl gingen Hand in Hand.
Die konservativen Eliten in ganz Europa kämpften im Nachspiel des Wiener Kongresses immer noch damit, die Schockwellen der Französischen Revolution einzudämmen. Unterdessen forderten deutsche Nationalisten einen zentralisierten Staat in der Hoffnung, dieser Schritt werde die Gründung eines wirkmächtigen Parlaments gestatten und zugleich den Einfluss willkürlicher monarchischer Herrschaft schwächen. Sie waren bitter enttäuscht, als sie erkannten, dass die großen europäischen Mächte sich verschworen hatten, die bestehende politische Ordnung zu bewahren, statt sie zu reformieren. Doch die Räder des Liberalismus waren in Gang gesetzt worden, und es war inzwischen schwierig, sie aufzuhalten. Friedrich Wilhelm hatte es in seinem Ruf nach Freiwilligen von 1813 für nötig befunden, seinem Volk Zugeständnisse zu machen; und diese Rechte jetzt zurückzunehmen riefe lediglich Empörung hervor. Die ganzen 1830er Jahre über kam es immer häufiger zu Unruhen, wenn auch mit geringer Reichweite. Im April 1833 versuchten Studenten sogar, eine Sitzung der Bundesversammlung in Frankfurt zu stören. Die Lage wurde als so gefährlich eingeschätzt, dass sowohl Preußen als auch Österreich Truppen aussandten, um die Stadt zu befrieden. Ungeachtet der heftigen Rivalität zwischen den beiden deutschen Mächten konnten sie sich darauf einigen, dass sämtliche Versuche, eine radikale politische Reform durchzusetzen, unterdrückt werden mussten. Gemeinsam setzten sie sich an die Spitze einer konservativen Bewegung gegen die liberalen Ideale, die in den deutschen Staaten Fuß gefasst hatten, und führten die Zensur und strenge Kontrollen der politischen Aktivität des deutschen Volkes ein. Das hatte jedoch lediglich zur Folge, dass die Wut unter dem Deckel der Repression weiter schwelte, bis sie 1848 endlich überkochte.
Wirtschaftlich machte Preußen in den 1815 erworbenen Gebieten entlang des Rheins enorme Gewinne. Allein das Kohlegebiet an der Ruhr war damals eines der größten der Welt, und in der Nähe von Aachen und im Gebiet der Saar gab es weitere Kohlevorkommen. Darüber hinaus konnten große Mengen an Eisenerz aus Vorkommen in der Nähe von Koblenz geschürft werden; weitere essenzielle Bodenschätze wie Blei, Zink, Kupfer und Schiefer waren ebenfalls reichlich vorhanden. Das weitaus wichtigste Produkt war Kohle. Als weitgehend agrarisch geprägtes Land und weil Mitteleuropa industriell noch in den Kinderschuhen steckte, sah Österreich nicht den großen wirtschaftlichen Vorteil voraus, den diese Landgewinne Preußen verschafften. Das Rheinland ist zu Recht als das »reichste Juwel in der Krone Preußens« bezeichnet worden.[2]
Das einzige Problem bestand jetzt darin, dass Preußen den Deutschen Bund nicht nutzen konnte, um aus seinen neuen Ressourcen im Westen den größtmöglichen Gewinn zu ziehen. Weil das Staatsgebiet in der Mitte gespalten war, war Preußen gezwungen, mit einzelnen Staaten die verschiedensten Dinge auszuhandeln, von Verkehrsverbindungen bis hin zu Zollbestimmungen. Die Ressourcen im Rheinland ermöglichten und förderten einen Boom beim Schienenbau. Von den bescheidenen Anfängen der ersten Bahnlinie von Berlin nach Potsdam im Jahr 1838 hatte Preußen noch viel Arbeit vor sich, um mit dem Tempo der industriellen Revolution in anderen westeuropäischen Ländern, allen voran Großbritannien, Schritt zu halten. Eine Koordination der Wirtschaft war nicht nur wünschenswert, sondern lebenswichtig. Weil von Österreich keine Hilfe zu erwarten war, preschte Preußen auf eigene Faust vor und gründete im Jahr 1834 ein einheitliches Zollgebiet, den Zollverein. Fürst Metternich war nicht beeindruckt, und Österreich trat der Organisation nie bei. Der Zollverein ermöglichte es schließlich, die Infrastruktur, Bodenschätze und Bevölkerung so zu koordinieren, dass das industrielle Potenzial der ihn umfassenden Gebiete ausgeschöpft wurde. Von den Großmächten in Wien 1815 nicht vorhergesehen, hatten sie Preußen die Mittel verschafft, Deutschland auf wirtschaftlicher Ebene zu vereinen. Im Jahr 1866 glich eine Karte des Zollvereins bereits bemerkenswert einer Karte des deutschen Kaiserreiches, das im Jahr 1871 entstehen sollte. Der Historiker William Carr nannte ihn zutreffend »den mächtigen Hebel der deutschen Vereinigung«.[3]
Aber wie stark die ideologische, kulturelle und wirtschaftliche Verschmelzung in den 1830er Jahren auch sein mochte, war es wiederum die Bedrohung durch einen äußeren Feind, welche die Deutschen weit stärker vereinte, als Worte und Geld es jemals vermocht hätten. Dieser Gegner trat in der Gestalt des deutschen Erzfeinds Frankreich auf den Plan. Die zweite Französische Revolution von 1830 stürzte die restaurierte Monarchie der Bourbonen unter Karl X. und setzte Louis-Philippe aus dem Hause Orléans als König ein. Auch wenn der Herrscher nunmehr an das Konzept der Volkssouveränität geknüpft war und seine Autorität vom französischen Volk statt von Gott erhielt, wurde die Monarchie in Frankreich weiterhin unablässig vonseiten republikanischer Elemente unter Druck gesetzt, die sie am liebsten ganz abgeschafft hätten. Die Herrschaft Louis-Philippes war deshalb von einem Streben nach Popularität und Konsens geprägt. Die Monarchie wurde zusätzlich geschwächt, als die Orientkrise von 1840 nach einem erfolglosen Versuch, sich in Ägypten Einfluss zu verschaffen, Frankreich einige ernste politische Peinlichkeiten zu Hause und im Ausland bescherte. In dem Bestreben, von diesem Fehltritt abzulenken, brach der französische Regierungschef[4] Adolphe Thiers einen Konflikt an den eigenen Grenzen vom Zaun. Er wollte den Rhein von Neuem als natürliche Grenze zwischen Deutschland und Frankreich etablieren und berief fast 500000 Rekruten ein, um seine Entschlossenheit zu demonstrieren. Fairerweise muss man sagen, dass König Louis-Philippe davon überhaupt nicht begeistert war und Thiers im Oktober durch den diplomatischeren François Guizot ersetzte. Unterdessen bewies der Deutsche Bund auf der anderen Seite des Rheins, dass er als nützliches diplomatisches Werkzeug dienen konnte, und tat sein Bestes, die Krise friedlich beizulegen. Es war jedoch bereits zu spät. Die bitteren Erinnerungen an die Napoleonischen Kriege und ältere Konflikte wurden auf beiden Seiten zu einem nationalistischen Wahn hochgespielt. In Deutschland wurden patriotische Lieder wie Nikolaus Beckers »Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein«, Max Schneckenburgers »Die Wacht am Rhein« und allen voran Hoffmann von Fallerslebens »Deutschlandlied« komponiert, dessen dritte Strophe heute die deutsche Nationalhymne ist. Deutschland als Kontinentalmacht eingezwängt zwischen Russland und Frankreich und ohne die Sicherheit klarer und schwer einnehmbarer physischer Grenzen machte die deutsche nationale Psyche hypersensibel für die Gefahr einer Invasion. Der intensive, defensive Nationalismus, den ein äußerer Feind in deutschen Herzen und Köpfen heraufbeschwören konnte, sollte in seiner Bedeutung niemals von politischen Argumenten, Märchen oder wirtschaftlichen Interessen erreicht werden.
1840–1848: Eine deutsche Revolution
»Die deutsche Geschichte erreichte ihren Wendepunkt und versäumte es zu wenden.«[5] Obwohl sein Werk inzwischen über 75 Jahre alt ist, hat Alan J.P. Taylors bekannte Einschätzung der Revolutionen von 1848 noch heute Bestand. Aufstände und Unruhen flammten in ganz Europa auf, als der Kampf für die Ideen der Französischen Revolution auf den hartnäckigen Widerstand seitens der konservativen Eliten stieß. Doch in Deutschland nahm die Revolution eine etwas andere Form an. Hier war ein Volk mit einem wachsenden Bewusstsein der nationalen Zugehörigkeit, das aber über den Charakter der Union, die es aufbauen wollte, zunehmend gespalten war. So vergeblich die Revolution von 1848 versuchte, einen sofortigen, nennenswerten Wandel herbeizuführen, setzte sie doch starke und lang anhaltende Kräfte in Bewegung, welche die deutsche Geschichte im Guten wie im Bösen gestalten sollten.
Als die aus der Rheinkrise von 1840 resultierende nationale Euphorie allmählich nachließ, schwand zugleich auch die Unterstützung für die Eliten, die den Deutschen Bund lenkten. Die alte Unzufriedenheit wegen fehlender sozialer und politischer Reformen stellte sich von Neuem ein. Das Volk erwartete nichts anderes von dem alten Fürsten Metternich aus Österreich, dessen politische Karriere sich nunmehr über drei Jahrzehnte erstreckte und der noch ganz dem Ancien Régimeverhaftet war. Stattdessen wurden an Preußen Hoffnungen auf liberale und reformorientierte Innovationen geknüpft. Hatte nicht Friedrich Wilhelm III. wiederholt eine Verfassung versprochen, zuletzt im Zuge des Wiener Kongresses 1815? Die Demonstrationen der 1830er Jahre versuchten ihn auf dieses Versprechen festzunageln, aber als er 1840 nach einem langwierigen Fieber starb und neben seiner geliebten Frau Luise beigesetzt wurde, waren viele bereit, dem alten König zu verzeihen, und erhofften sich von seinem Sohn Friedrich Wilhelm IV. einen Wandel. Sie sollten bitter enttäuscht werden. Er erklärte bekanntlich: »Zwischen mir und mein Volk soll sich kein Blatt Papier drängen.« Eine Form von Vertrag zwischen ihm und seinen Untertanen würde seinem unerschütterlichen Glauben an das göttliche Recht der Könige widersprechen. Seine Autorität kam von Gott, nicht vom Volk.
Unter anderen Umständen hätte das deutsche Volk solche Ansichten womöglich verziehen, aber Friedrich Wilhelm IV. war seit Generationen der am wenigsten charismatische preußische Monarch. Seit seiner Kindheit nannten sogar seine Freunde und Angehörigen ihn in Anspielung auf seine pummelige Figur, den kurzen Hals und die schlechte Haltung »Butt«. Sein Mangel an politischem Scharfsinn und seine plumpe Wortwahl deckten sich mit dem Aussehen. Die 1840er Jahre hindurch erwarb er sich den Ruf eines wankelmütigen, unmännlichen und weichen Dummkopfs, und zwar beim ganzen politischen Spektrum, von seinen Gegnern bis hin zu den Anhängern. Seine ersten Versuche, mit den Reformern Frieden zu schließen, indem er die Zensur ein wenig lockerte und einige politische Gefangenen freiließ, wurden als Schönfärberei angesehen. Erschwerend kam hinzu, dass sein jüngerer Bruder Wilhelm, der spätere erste deutsche Kaiser, die Kavallerie des Königs unter sich hatte und versuchte, sich in dieser Stellung einen Namen zu machen. Während Friedrich Wilhelm IV. jedes Mal zögerte, wenn es zu Unruhen oder Demonstrationen kam, drängte sein Bruder darauf, die Aufstände gewaltsam zu unterdrücken. Wilhelm merkte bekanntlich einmal an: »Gegen Demokraten helfen nur Soldaten!« Die Kombination aus Butt und Despot war bei Radikalen ebenso unbeliebt wie bei Moderaten und trug in den 1840er Jahren dazu bei, die Flammen der Revolution zu schüren.
Die Atmosphäre politischer Unterdrückung wurde für die Anhänger von Reformen beinahe unerträglich. Die Karlsbader Beschlüsse, die man 1819 in allen Staaten des Deutschen Bundes eingeführt hatte, erlaubten die Inhaftierung und sogar die Hinrichtung politischer Reformer. Sie richteten sich gerade gegen die wachsenden liberalen und nationalen Bewegungen und verboten patriotische Bruderschaften, linke Zeitungen und die Verbreitung liberaler Ideen an Schulen und Universitäten. Menschen wie Karl Marx wurden so ins Exil getrieben, aber viele Denker und Philosophen wie er ließen sich in Paris oder London nieder, wo sie ihre Gedanken frei veröffentlichen konnten.
Die Revolution hätte durchaus ein intellektueller Wunschtraum bleiben können, wenn Deutschland und Europa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und insbesondere in den 1840er Jahren nicht gravierende soziale Probleme geplagt hätten. Die