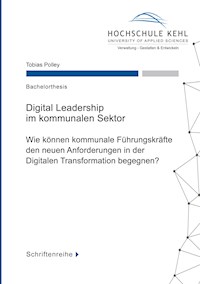
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie können Führungskräfte den neuen Anforderungen in der Digitalen Transformation begegnen? Diese Frage hat Sie als Führungskraft sicherlich auch schon beschäftigt. Doch wie funktioniert sie nun, die digitale Führung? Dieses Buch stellt die Veränderungen und Schwerpunkte der Führung öffentlicher Verwaltungen im Kontext der digitalen Transformation dar und zeigt wissenschaftlich begründete Wege auf, wie Sie als Führungskraft damit umgehen können. Beispielsweise erfahren Sie, dass... - Führungskräfte die Mitarbeitenden und deren Motivation stärker in den Fokus ihrer Arbeit rücken müssen, - Führung mit digitalen Technologien der Anpassung von Arbeits- und Organisationsformen bedarf, - Sozial-, Methoden- und Digitalkompetenzen gänzlich neu ausgerichtet werden müssen, - die öffentliche Verwaltung ein neues Verständnis von Zusammenarbeit benötigt, - klassische Führungstheorien auf die digitale Arbeitswelt übertragen werden müssen und - kommunale Interessengruppen eine stärkere Einbindung fordern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abstract
Diese Bachelorarbeit analysiert für die öffentliche Verwaltung die Veränderungen und Schwerpunkte der Führung im Kontext der digitalen Transformation. Die notwendigen Daten entstammen Experteninterviews und einer Online-Befragung unter Studierenden. Daraus werden konkrete praktische Umsetzungsempfehlungen und weitere Forschungsansätze entwickelt.
Die Forschung zeigt, dass Mitarbeitende und deren Motivation stärker in den Fokus der Führungsarbeit rücken müssen. Führung mit digitalen Technologien bedarf der Anpassung von Arbeits- und Organisationsformen, der Weiterentwicklung von Sozial-, Methoden- und Digitalkompetenzen der Führungskräfte sowie eines neuen Verständnisses von Kollaboration. Zur Umsetzung digitaler Führung müssen klassische Führungstheorien auf die digitale Arbeitswelt übertragen und kommunale Interessensgruppen stärker eingebunden werden.
Diese Arbeit richtet sich neben der Wissenschaft vordergründig an Führungskräfte in Kommunen und angehende Führungskräfte, um diesen den Einfluss der Digitalen Transformation zu verdeutlichen und eine Hilfestellung zur Entwicklung von Digital Leadership zu geben.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einleitende Betrachtung
1.1. Problembeschreibung und Relevanz des Themas
1.2. Zielsetzung und Struktur der Arbeit
1.3. Abgrenzung der wissenschaftlichen Arbeit
Grundlagen des Digital Leadership
2.1. Begriffsdefinitionen und Erläuterungen
2.1.1. Digitale Transformation
2.1.2. Führung
2.1.3. Digital Leadership
2.2. Digitale Transformation als gesamtgesellschaftliche Entwicklung
2.3. Einfluss der Digitalen Transformation auf die Arbeitswelt
2.4. Führung in der Digitalen Transformation – Digital Leadership
2.4.1. Grundhaltung zu digitaler Führung – „VOPA+“ Modell
2.4.2. Rollen und Aufgaben von Führungskräften
2.4.3. Klassische Kompetenzanforderungen an Führungskräfte
2.4.4. Neue Kompetenzanforderungen an Führungskräfte
2.4.5. Führungskonzepte im Digital Leadership
2.5. Ansätze für digitales Arbeiten in Kommunalverwaltungen
2.5.1. New Work
2.5.2. Agiles Arbeiten
2.5.3. Projektmanagement mit Scrum, Kanban und OKR
2.6. Besonderheiten der Führung in Kommunen
2.6.1. Strukturelle Unterschiede des öffentlichen Sektors
2.6.2. Determinanten für digitale Führung in Kommunen
Forschungsdesign
3.1. Forschungsfrage, Methodik und Zielsetzung
3.2. Design der qualitativen Studie
3.2.1. Vorgehen zur Datenerhebung
3.2.2. Vorgehen zur Datenauswertung
3.3. Design der quantitativen Studie
3.3.1. Vorgehen zur Datenerhebung
3.3.2. Vorgehen zur Datenauswertung
Empirische Erkenntnisse zum Einsatz von Digital Leadership im kommunalen Sektor
4.1. Ergebnisse der qualitativen Studie
4.1.1. Interessensgruppen im Digital Leadership
4.1.2. Voraussetzungen für Digital Leadership
4.1.3. Einführung von Digital Leadership
4.1.4. Führungsverhalten im kommunalen Digital Leadership
4.1.5. Zukunftsausblick
4.1.6. Fazit der qualitativen Studie
4.2. Ergebnisse der quantitativen Studie
4.2.1. Charakteristika der Stichprobe
4.2.2. Hypothese 1: Erwartungen an die Arbeitsorganisation
4.2.3. Hypothese 2: Führungskompetenzen
4.2.4. Hypothese 3: Motivation
4.2.5. Hypothese 4: Einstellung zur Digitalisierung
4.2.6. Hypothese 5: Personenspezifische Anforderungen
4.2.7. Fazit der quantitativen Forschung
Integration und Diskussion
5.1. Interpretation der Ergebnisse
5.2. Grenzen der Arbeit
5.3. Implikationen der Arbeit
5.3.1. Handlungsempfehlung für die Praxis
5.3.2. Ansatzpunkte für weitergehende Forschung
Fazit
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
Abs.
Absatz
AZ
Arbeitszeit
DL
Digital Leadership
EW
Einwohner
FB
Fachbereich
FRLT
Full Range Leadership Theory
GG
Grundgesamtheit
HK
Hauptkategorie
IKT
Informations- und Kommunikationstechnik
Kap.
Kapitel
LOB
Leistungsorientierte Bezahlung
MMD
Mixed-Methods-Design
OKR
Objectives and Key Results Modell
SMAC
Social, Mobile, Analytical, Creative
SMART
Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Timed
Tab.
Tabelle
UE
Untersuchungseinheiten
UK
Unterkategorie
VOPA
Vernetzung, Offenheit, Partizipation, Agilität
VUCA
Volatility, Uncertainity, Complexity, Ambiguity
WLB
Work-Life-Balance
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Gesellschaft 5.0 (angelehnt an Altenburg et al. 2018, S. 5. Quelle: eigene Darstellung)
Abbildung 2: Forschungsdesign (Quelle: eigene Darstellung)
Abbildung 3: Mittelwerte „Nutzung Digitaler Technologien im Privaten“ (Quelle: eigene Darstellung)
Abbildung 4: Mittelwerte „eigene digitale Kompetenz“ (Quelle: eigene Darstellung)
Abbildung 5: Mittelwerte „Beurteilung der Digitalisierung in Kommunen“ (Quelle: eigene Darstellung)
Abbildung 6: Mittelwerte „Zukunftserwartung aus Bürgersicht“ (Quelle: eigene Darstellung)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Führungskompetenzen im Digital Leadership (Quelle: eigene Darstellung)
Tabelle 2: Qualitativer Stichprobenplan (Quelle: eigene Darstellung)
Tabelle 3: Aus Theorie und qualitativer Forschung abgeleitete Thesen (Quelle: eigene Darstellung)
Tabelle 4: Aus den Thesen abgeleitete statistische Hypothesen (Quelle: eigene Darstellung)
Tabelle 5: Mittelwerte "Arbeitsorganisation" (Quelle: eigene Darstellung)
Tabelle 6: Mittelwerte "Führungskompetenzen" (Quelle: eigene Darstellung)
Tabelle 7: Mittelwerte "Motivation" (Quelle: eigene Darstellung)
Tabelle 8: Mittelwerte "Digitalisierung als Chance" (Quelle: eigene Darstellung)
1. Einleitende Betrachtung
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit wurde an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl zur Erlangung des Grades Bachelor of Arts im Studiengang gehobener Verwaltungsdienst - Public Management verfasst.
1.1. Problembeschreibung und Relevanz des Themas
„The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday‘s logic.“1 – Peter Drucker.
Die Digitale Transformation ist ein weitreichender Veränderungsprozess, der in der gesamten Gesellschaft und Wirtschaft zu großen Veränderungen des Lebens und Arbeitens führt – auch in der kommunalen Führung. Durch die zunehmende Digitalisierung von Wirtschaft und Privatleben steigt die Erwartungshaltung an Kommunen – sämtliche Interessensgruppen fordern die Anpassung ihrer Dienste an die digitale Welt.2
Dazu braucht es nicht nur den Einsatz neuer Hard- und Software, sondern die Neugestaltung von Arbeits- und Organisationsformen sowie ein neues Verständnis von Führung und Zusammenarbeit.3 Viele Kommunen befinden sich hierbei noch im Anfangsstadium.4 Die „effizient durchorganisierte[n], bisher hervorragend funktionierende[n] […] Organisationsstrukturen stoßen […] durch die Digitalisierung an […] Grenzen.“5 Die Kompetenzprofile sowie die Aufbau- und Ablauforganisation sind für diese Veränderungen nicht ausgelegt – oder nach Steve Jobs: „It doesn‘t make sense to hire smart people and then tell them what to do.“6
Es liegt an den Führungskräften, als „Dreh- und Angelpunkt jedweder gelingenden organisatorischen Veränderung – und damit auch einer Digitalen Transformation“7, diesen Change-Prozess zu bewältigen. Digital Leadership wird mir fortschreitender Transformation für jede kommunale Führungskraft relevant, da die Digitalisierung alle Organisationen beschäftigt und beschäftigen wird.8
1.2. Zielsetzung und Struktur der Arbeit
Ziel der Arbeit ist die Beantwortung der Forschungsfrage: wie können kommunale Führungskräfte den neuen Anforderungen in der Digitalen Transformation begegnen? Dazu werden „Erwartungen, Bedürfnisse und Rahmenbedingungen“9 an Führungskräfte in der Digitalen Transformation dargestellt und anschließend Lösungsvorschläge erarbeitet und diskutiert.
Hierfür sind von der Forschungsfrage weitere Teilfragen abgeleitet:
Welche Anforderungen haben Stakeholder an die digitale Führung in Kommunen?
Welche Führungskompetenzen sind für Digital Leadership nötig?
Wie lassen sich Mitarbeitende für digitales Arbeiten vorbereiten, motivieren und qualifizieren?
Welches Arbeitsumfeld benötigt Digital Leadership in Kommunen?
Welche Zukunftsaussichten bietet Digital Leadership?
Zuerst erfolgt die Darstellung des theoretischen Rahmens (Kap. 2). Es werden notwendige Begriffe definiert (Kap. 2.1) und der Einfluss der Digitalen Transformation auf die Gesellschaft (Kap. 2.2), die Arbeitswelt (Kap. 2.3) und die Führung (Kap. 2.4) dargestellt. Dann werden Ansätze für digitales Arbeiten (Kap. 2.5) und die Besonderheiten kommunaler Führung (Kap. 2.6) analysiert. Kapitel 3 umfasst das Untersuchungsdesign zur empirischen Datenerhebung. In Kapitel 4 werden die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse der qualitativen (Kap. 4.1) und quantitativen (Kap. 4.2) Teilstudie dargestellt. Diese werden in Kapitel 5 unter Bezugnahme auf Teilfragen und die Darstellung von Chancen und Grenzen interpretiert, bevor in Kapitel 6 ein Fazit den Bezug zur Forschungsfrage herstellt.
Ziel ist kein Ablaufkonzept zur Bewältigung der Digitalen Transformation, sondern die Darstellung von Anforderungen an Führungskräfte und die Erarbeitung möglicher Lösungen. Diese werden nicht auf ihre tatsächliche Wirksamkeit und die Anwendbarkeit auf andere Organisationen untersucht. Das sind vielmehr Ansatzpunkte für weiterführende Forschung.
1.3. Abgrenzung der wissenschaftlichen Arbeit
Die Arbeit fokussiert die öffentliche Verwaltung, genauer Kommunen. Diese sind als Gebietskörperschaften mit Selbstverwaltungsrecht die unterste Ebene im dreigliedrigen Verwaltungsaufbau. Die Begriffe Kommune und Gemeinde werden synonym verwendet. Grund für diese thematische Einschränkung ist der Stellenwert von Kommunen als „zentraler Ort“10 der Gesellschaft und ihr Potential als Treiber in der Digitalen Transformation.11 Der Forschungsbedarf wird durch den geringen digitalen Fortschritt vieler Kommunen begründet.12
Die Arbeit fokussiert Kommunen mit maximal 10.000 Einwohnern (EW). Dies umfasst ca. 77% aller Kommunen Baden-Württembergs.13 Grund für die Einschränkung ist deren Organisationsstruktur, da neue Technik im Digital Leadership neue Arbeitsmodelle und somit auch organisationale Veränderungen erfordert.14 Organisationsstrukturen sind nach der Kontingenztheorie von der Organisationsgröße abhängig.15 Laut Streibl hängt die Größe einer Kommunalverwaltung neben anderen Faktoren stark von der EW-Zahl ab.16 Demnach unterscheiden sich kleine und große Kommunen in ihrer Organisation: Aufgaben, die in größeren Kommunen eigene Ämter bilden, fallen in kleinen Kommunen weniger oft / intensiv an, weshalb sie dort mit anderen in einem Amt zusammengefasst werden.17 Dies führt zu durchmischten Teams, die wegen ihrer Aufgabenvielfalt organisatorisch schwächer reglementiert sind als solche in großen Kommunen.18 So haben Führungskräfte in kleinen Kommunen einen weiteren Handlungsspielraum, neue Strukturen und Arbeitsformen in ihren Teams zu etablieren und digital zu führen – in Kommunen mit weniger als 10.000 EW ergibt sich so der größte Forschungsbedarf und Ansatzpunkt für ganzheitliches Digital Leadership im öffentlichen Sektor.19
1 Drucker 1980, S. 226.
2 Vgl. Streicher 2020, S. 349.
3 Vgl. Wolan 2020, S. 8.
4 Vgl. Hornbostel et al. 2019, S. 12 f.
5 Schwarzer 2018, S. 7.
6 Jobs o.J., zitiert nach Rifkin 2018, S. 79.
7 Kirf, Eicke & Schömburg 2018, S. 84.
8 Vgl. Wörwag & Cloots 2020, S. 208.
9 Moser 2012, S. 88.
10 Schröder 2011, S. 25.
11 Vgl. Hartwig & Kroneberg 2017, S. 19.
12 Vgl. Winners 2020, S. 123.
13 Vgl. Brachat-Schwarz 2006, S. 47.
14 Vgl. Uhl & Loretan 2019, S. 1.
15 Vgl. Liebig & Matiaske 2016, S. 137.
2. Grundlagen des Digital Leadership
Dieses Kapitel dient der Skizzierung des theoretischen Rahmens der Bachelorarbeit. Neben der Definition wichtiger Begriffe werden die Digitale Transformation, deren Auswirkungen sowie der aktuelle Forschungsstand zu Digital Leadership und der kommunalen Führung dargestellt.
2.1. Begriffsdefinitionen und Erläuterungen
Bevor Digital Leadership wissenschaftlich untersucht wird, werden die für ein einheitliches und durchgängiges Verständnis der Arbeit elementaren Begriffe definiert.
2.1.1. Digitale Transformation
Der erste zu definierende Fachausdruck ist die „Digitale Transformation“. Der Begriff besteht aus den Termini „digital“ und „Transformation“. Digital findet im Sprachgebrauch häufig Verwendung und gilt als Gegensatz zu „analog“. Neben der originären Bedeutung als ziffernmäßige Darstellung drückt „digital“ aus, dass Prozesse durch Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) beherrscht und physische Sachverhalte computertechnisch dargestellt werden.20Transformation beschreibt eine fundamentale, dauerhafte Veränderung, eine Umgestaltung von Strukturen von einem Ausgangs- in einen Zielzustand ohne Inhalts- und Substanzverlust.21 Häufig wird der Begriff „Systemveränderung“ synonym verwendet.22
Die beiden Termini kombiniert, erfasst die Digitale Transformation „weitreichende strategische, organisatorische sowie soziokulturelle Veränderungen“23 einer Gesellschaft und ihrer Lebens- und Arbeitsweisen durch zunehmenden Einsatz von IKT, bspw. in Form intelligenter, vernetzter und selbstkommunizierender Produkte (z.B. Internet of things oder Industrie 4.0).24 Einige Autoren bezeichnen die Digitale Transformation wegen ihrer mit der Industrialisierung des 18. Jahrhunderts vergleichbaren Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft als vierte industrielle Revolution.25
Anders als die Digitale Transformation beschreibt die Digitalisierung den rein technischen Prozess der Umwandlung analoger Sachverhalte in computertechnische Daten, losgelöst von ihrem Einfluss auf Organisationen und Individuen.26 Die Digitale Transformation ist somit umfangreicher, da sie auch die durch den Einsatz digitaler Technologien ( Digitalisierung) evozierten Veränderungen des Lebens und Arbeitens erfasst.27
2.1.2. Führung
Führung ist zielgerichtete zwischenmenschliche Interaktion, um Individuen unter Einsatz von Ressourcen in eine Richtung zu steuern.28 Im Organisationskontext unterscheiden sich die Definitionen für Führung. Für Wunderer ist Führung die soziale Beeinflussung der Mitarbeitenden zur Erhöhung der Wertschöpfung einer Organisation.29 Von Rosenstiel fokussiert die Ableitung individueller Ziele aus den Unternehmenszielen.30 Auch Burns hebt die Erreichung gemeinsamer Ziele hervor, während Yukl den Konsens zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden thematisiert.31 Die von Walenta herausgestellten Gemeinsamkeiten dieser Ansätze bilden in der Arbeit die Definition von Führung: „(a) Führung [ist] ein Prozess […], [der] (b) die Beeinflussung anderer beinhaltet, (c) im Kontext einer Gruppe passiert, (d) die Erreichung von Zielen beinhaltet, und (e) diese Ziele von Führenden und Geführten geteilt werden.“32
Daneben existieren weitere Fachbegriffe der Führungsforschung, wie Führungsmodell (systematisch zusammengehöriges Managementwissen), Führungsstil (konstante, situationsunabhängige Persönlichkeitsmerkmale einer Führungskraft), Führungstechnik (konkrete, zielbezogene Maßnahme in einer spezifischen Führungssituation) und Führungsinstrument (Werkzeug zur Bewältigung einer Führungsaufgabe).33 Einige Autoren verwenden diese Begriffe synonym, andere bemühen die o.g. Unterscheidung – aufgrund der geringen Relevanz der Begriffe für diese Arbeit und mangels einheitlicher Definitionen werden sie hier synonym verwendet.34
In der englischen Literatur wird häufig zwischen Leadership und Management differenziert. Die gebräuchlichste Unterscheidung ist die nach Kotter. Er versteht Leadership als „process that helps direct and mobilize people and / or their ideas.“35 Für ihn besteht Leadership aus den drei Elementen „establishing direction […] aligning people […] motivating and inspiring“36, die eigentliche Personalführung steht im Vordergrund.37Management ist Planen, Organisieren und Kontrollieren von Prozessen und Strukturen, die Aufbau- und Ablauforganisation.38 Es herrscht Uneinigkeit, wie diese Begriffe in der deutschsprachigen Führungsforschung einzuordnen sind – einige Autoren setzen Führung wegen seiner englischen Übersetzung mit Leadership nach Kotter gleich, während andere Leadership und Management als Teilbereiche der Führung begreifen (vgl. Kap. 2.1.3.).39
2.1.3. Digital Leadership
Zur Definition von „Digital Leadership“ werden die Digitale Transformation und die Führung in einem gemeinsamen Kontext betrachtet. Aufgrund des veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmens entstehen für Führungskräfte neue Herausforderungen. Die Gesamtheit der Ansätze, diese zu bewältigen, wird als Digital Leadership bezeichnet.40
Dem Wortsinn nach hat ein Digital Leader eine Digital-First-Denkweise und strebt danach, digitale Technologien zu verbreiten und damit zu führen.41 Mit der Einführung neuer Technologien ist auch die Anpassung von bestehenden Prozessen und Arbeitsweisen verbunden, was wiederum eine Neuausrichtung der Organisationsstruktur erfordert.42 Dies bedarf einer, auf die neuen Rahmenbedingungen angepassten Organisationskultur, wo Mitarbeitende ein Bewusstsein für die Digitalisierung haben und in den Veränderungsprozess eingebunden werden.43 Darauf aufbauend müssen klassische Führungskonzepte in die digitale Welt transferiert und das eigene Führungsverhalten daran neu ausgerichtet werden.44
Viele Tätigkeiten im Digital Leadership entsprechen der Definition von Leadership nach Kotter, während einige der erwähnten Aufgabenbereiche eher dem Management zuzuordnen sind.45 Unter Digital Leadership werden in dieser Arbeit also entgegen seiner wörtlichen Bedeutung sowohl leadership- als auch managementorientierte Aufgaben erfasst. Digital Leadership ist aufgrund seiner Vielfältigkeit als Sammelbegriff zu verstehen: es umfasst die durch die Digitale Transformation evozierte Anpassung von Aufbau-, Ablauforganisation und Arbeitsweisen sowie die damit verbundene, auf Visionen, Innovation, Motivation und Sinnerfüllung basierende Veränderung von Mindset, Kultur und Führungsverhalten.46
2.2. Digitale Transformation als gesamtgesellschaftliche Entwicklung
Nachdem grundlegende Begriffe definiert wurden, erfolgt die Skizzierung des für Digital Leadership maßgeblichen gesellschaftlichen Rahmens. Die Digitalisierung gilt als „einer der großen Megatrends unserer Zeit“47, da sich durch den verstärkten Einsatz von IKT ganze Bereiche der Gesellschaft fundamental verändern (vgl. Abbildung 1).48
Abbildung 1: Gesellschaft 5.0 (angelehnt an Altenburg et al. 2018, S. 5. Quelle: eigene Darstellung)
Wegbereiter für diese Veränderungen war die Kommerzialisierung des Internets in den 1990er Jahren, wodurch sich Bedürfnisse und Ansprüche der Menschen laufend verändern.49 Individuen werden zunehmend mobiler und flexibler, vieles geschieht unabhängig von Zeit und Ort, neue Denk- und Handlungsmuster entwickeln sich.50 Beziehungen zwischen Menschen und ihre eigene Identifikation unterliegen auch einem Wandel.51
Die nötige technische Entwicklung beschreibt das Mooresche Gesetz, wonach sich die Leistungsfähigkeit von Mikrochips alle 18 bis 24 Monate verdoppelt.52 Dieses exponentielle Wachstum hat größere und schnellere technologische Entwicklungen zur Folge – die Digitalisierung gilt daher als Zeitalter der Beschleunigung und als selbstverstärkender Prozess. Andere Quellen sehen auch die Kompatibilität digitaler Technologien als Grund für das Wachstum und branchenübergreifende Verschiebungen, da sich Innovationen wegen der starken Vernetzung digitaler Technologien gegenseitig auslösen und verstärken – im Alltag wird dies durch zunehmende Vernetzung und Interaktion digitaler Technologien deutlich.53
2.3. Einfluss der Digitalen Transformation auf die Arbeitswelt
In dieser Arbeit wird vordergründig der Lebensbereich „Arbeiten und Einkommen“ behandelt (vgl. Abb. 1). Das durch die Digitalisierung





























