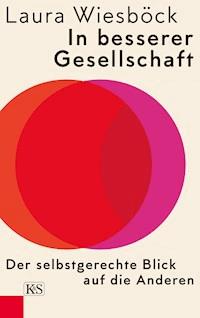Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Trauma, triggern, toxisch: Laura Wiesböck über die inflationäre Verwendung psychologischer Begriffe in Sozialen Netzwerken und über den Social-Media-Trend »Mental Health« Lebenskrisen, emotionale Verletzungen und Phasen der Ineffizienz sind seit jeher Teil des Menschseins. Doch im digitalen Zeitalter zeigt sich eine immer größere Entschlossenheit, derartige Zustände krankhaft zu deuten. Social-Media-Plattformen sind voll mit psychiatrischen Diagnosen. Begriffe wie »Trauma«, »triggern« und »toxisch« werden inflationär verwendet. Eigen- und Fremddiagnosen gehen leicht von den Lippen. Wo aber liegt die Grenze zwischen Enttabuisierung und Verherrlichung? Präzise analysiert die Soziologin Laura Wiesböck die Ursachen und Folgen des Trends um »Mental Health«. Ein zeitgemäßes Buch und ein Plädoyer für das Aushalten emotionaler Ambivalenzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Lebenskrisen, emotionale Verletzungen und Phasen der Ineffizienz sind seit jeher Teil des Menschseins. Doch im digitalen Zeitalter zeigt sich eine immer größere Entschlossenheit, derartige Zustände krankhaft zu deuten. Social-Media-Plattformen sind voll mit psychiatrischen Diagnosen. Begriffe wie »Trauma«, »triggern« und »toxisch« werden inflationär verwendet. Eigen- und Fremddiagnosen gehen leicht von den Lippen. Wo aber liegt die Grenze zwischen Enttabuisierung und Verherrlichung? Präzise analysiert die Soziologin Laura Wiesböck die Ursachen und Folgen des Trends um »Mental Health«. Ein zeitgemäßes Buch und ein Plädoyer für das Aushalten emotionaler Ambivalenzen.
Laura Wiesböck
Digitale Diagnosen
Psychische Gesundheit als Social-Media-Trend
Paul Zsolnay Verlag
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Laura Wiesböck
Impressum
Inhalt
Einleitung
Online-Diagnosen zwischen Enttabuisierung, Glamourisierung und Kommerzialisierung
»Sad Girl Culture« und Depressionsromantik
ADHS als Deutungsangebot für ineffizientes Verhalten
Die Vermarktung von psychischen Krankheiten
Die Inflation von psychologischen Begriffen
»Toxisch« als endgültiges Urteil und Ausschlussgrund
»Trauma« und die Anerkennung von Verletzungen
»Triggern« und die Verschiebung der Grenze des Zumutbaren
Erfahrungsexpertise und die fachliche Autorität von Betroffenen
Influencer:innen und die Gefahr der Nachahmung
das Kultivieren eines »krankhaften Blicks«
Illness Appropriation: Pathologisierung als Entlastungsstrategie
Die psychiatrische Einordnung von patriarchaler Männlichkeit
Psychisch kranke Täter
Social Media als Katalysator für schnelle Urteile
Mental Health und Selfcare als Wohlstandsphänomen
Frauen zwischen Konsum und Schönheitsarbeit
Der Aufstieg neoliberaler Spiritualität
»Healing« als fortlaufendes Wachstumsversprechen
Die heilende Kraft von Glaube, Hoffnung und Anpassung
Plädoyer für zwischenmenschliche Ambivalenz und Trost
Gesundheit als Konsumgut und Verhaltenserwartung
Social-Media-Plattformen als Geschäftsmodell
Das Prinzip der Eindeutigkeit als Gefahr für die Demokratie
Gegen die Rationalisierung von Menschlichkeit
Danksagung
Anmerkungen
Einleitung
Online-Diagnosen zwischen Enttabuisierung, Glamourisierung und Kommerzialisierung
Die Inflation von psychologischen Begriffen
Erfahrungsexpertise und die fachliche Autorität von Betroffenen
Illness Appropriation: Pathologisierung als Entlastungsstrategie
Mental Health und Selfcare als Wohlstandsphänomen
»Healing« als fortlaufendes Wachstumsversprechen
Plädoyer für zwischenmenschliche Ambivalenz und Trost
Einleitung
Im Jahr 2013 sorgte das vor der Veröffentlichung stehende fünfte Handbuch für psychiatrische Störungen (DSM), herausgegeben von der Amerikanischen Psychiatrie-Vereinigung, für Diskussionen. Ein zentraler Kritikpunkt war, dass Trauer zukünftig bereits nach zwei Wochen als depressive Episode klassifiziert werden sollte. Einige Jahre später teilte eine Influencerin aus den USA in einer Instagram-Story mit, dass sie ihre beiden Kinder gerade vor den Fernseher gesetzt habe. Dies sei etwas, was sie normalerweise nicht tue, aber sie stand kurz davor, auszurasten (»to snap«), weshalb sie sich nun Zeit für eine Meditation nehmen würde, denn ihre »Mental Health« gehe vor.
Beide Ereignisse lassen Fragen aufkommen. Was sagt es über eine Gesellschaft aus, wenn der Schmerz über den Verlust einer nahestehenden Person als Krankheit klassifiziert wird? Ist Traurigkeit mittlerweile zu einem Symptom geworden, dem es lösungsorientiert zu begegnen gilt? Welche Funktion erfüllt die Schematisierung und Pathologisierung von leidvollen Erfahrungen? Und was hat Gereiztheit mit psychischer Gesundheit (»Mental Health«) zu tun? Ist ein dünnes Nervenkostüm nicht ein nachvollziehbarer Zustand für Mütter, die unter dauerhaftem Schlafmangel, fordernden Betreuungspflichten, mangelnder Unterstützung und hohen gesellschaftlichen Erwartungen leiden? Oder können Menschen sich mittlerweile nur mehr eine legitime Auszeit erlauben, wenn sie auf ihre Gesundheit verweisen?
Zehn Jahre später ist die Globalisierung des US-amerikanischen Gesundheitsansatzes und die Überwertigkeit des Gesundheitsdenkens (»Healthism«) auch im europäischen Kontext angekommen. War der Begriff »psychische Gesundheit« vor nicht allzu langer Zeit noch überwiegend medizinischem Personal vorbehalten, so hat sich die Situation inzwischen drastisch verändert. Die Wahrnehmung von seelischen Erkrankungen ist gesamtgesellschaftlich gestiegen. Social-Media-Plattformen sind voll von Inhalten zu psychiatrischen Diagnosen — und das nicht erst seit der COVID-19-Pandemie. Darin zeigt sich ein historisches Kontinuum: Was von wem als pathologischer Zustand verstanden wird, unterliegt laufenden Aushandlungsprozessen. Definitionen von »krank« und »gesund« sind keine objektiven Parameter. Sie sind sozial konstruiert, gesellschaftlich vermittelt, unterliegen spezifischen »Moden« und sind abhängig von unterschiedlichen Interessen und vorherrschenden Werten.
Die verstärkte Sichtbarkeit von psychischen Erkrankungen wirft die Frage auf, inwieweit es nicht nur zu einer Bewusstmachung, sondern auch zu einer Popularisierung von psychiatrischen Diagnosen kommt und »normales« menschliches Leid oder Funktionsbeeinträchtigungen zunehmend als krankhaft eingestuft werden. Denn es besteht das Risiko, dass mit den gegenwärtigen diskursiven Entwicklungen auch Zustimmung für psychiatrische Deutungsstrategien erzeugt wird: ob ein gewisses Grundgefühl von Melancholie und Weltschmerz als Depression wahrgenommen wird, Schüchternheit oder Introversion als Sozialphobie gelabelt werden, Trauma als Synonym für unangenehme Erfahrungen verwendet wird oder man als hypersensibel gilt, wenn man vom Leid anderer berührt ist.
Zwar macht die Erkenntnis, dass psychiatrische Diagnosen auch soziale Konstruktionen und keine biologische »Störung« sein können, den Zustand für diejenigen, die unter Belastungen leiden, nicht weniger schwerwiegend oder real. Und auch wenn bestimmte seelische Notlagen — wie Lebenskrisen, Phasen der Orientierungslosigkeit, emotionale Verletzungen und persönliche Tiefpunkte — seit jeher Teil des »normalen« menschlichen Lebens sind, bedeutet das nicht, dass diese nicht schmerzvoll sind oder keine Unterstützung brauchen. Aus soziologischer Sicht drängt sich allerdings die Frage auf, warum hinderliche Gefühlslagen und Handlungsweisen im öffentlichen Bewusstsein gegenwärtig primär in pathologisierter Form anerkannt und ausgelebt werden und welche gesellschaftlichen Umstände und Akteur:innen dafür förderlich sind, dass Fragen zur emotionalen Ausgeglichenheit und Funktionalität immer mehr zu Fragen von Gesundheit oder Krankheit werden.
Sieht man sich bisherige Analysen über die gesellschaftliche Popularisierung von psychiatrischen Diagnosen an, wird vielfach der Standpunkt vertreten, dass ökonomische Interessen der Gesundheitsindustrie (»Pharma«) als treibende Kraft dahinterstünden. Andere Stimmen betonen, unsere gegenwärtige Kultur sei auf Schmerzvermeidung und damit Daueranästhesierung ausgelegt.1 Auf Social-Media-Plattformen finden insbesondere Ansätze einer psychosozialen Systemkritik Anklang, nach denen der Kapitalismus krank mache.2 Bisher wenig wurde der Fokus darauf gelegt, dass es in utilitaristischen Gesellschaften außerhalb des krankhaften Settings eigentlich kaum Räume gibt, in denen dysfunktionale Verhaltensweisen und menschliche Gefühle von Verletzlichkeit legitimerweise ausgelebt werden können — im Gegensatz zu christlichen Kulturen etwa, in denen es Orte für Leid gibt und dieses sinnbesetzt verwertet werden kann. Und das, obwohl das Selbst immer stärker im Fokus steht und so fragil und verletzungssensibel ist wie kaum zuvor.
In gläubigen Gesellschaften haben Menschen oft eine höhere Leidensfähigkeit, da sie an eine tiefere Wahrheit glauben, die über das unmittelbare Wohlbefinden hinausgeht (»Jenseits«). Moderne Ansprüche der Produktivität, Effizienz, Eigenverantwortung und Lustorientierung lassen hingegen wenig Platz für Dysfunktionalität, Phasen der Orientierungslosigkeit oder das Zulassen und Ausleben von emotionalem Schmerz. Traurigkeit wird dann weniger als »normale« menschliche Reaktion auf bestimmte Ereignisse gedeutet, etwa auf eine globale Pandemie, den Verlust einer geliebten Person oder diskriminierende Erfahrungen, sondern als »Störung«, die behandlungsbedürftig ist. Hinzu kommen radikale Individualisierungsprozesse, die die Idee befördern, dass das subjektive Wohlbefinden Ergebnis von eigenen Entscheidungen und Handlungen ist. Die Verschiebung von Zuständen des Unwohlseins in den medizinischen Bereich erlaubt dann zu leiden, das Leid nach außen zu tragen und sich von einer persönlichen Verantwortung zu entlasten: Man ist kein unzufriedener Mensch, sondern ein:e Patient:in, der:die im eigenen Unbehagen von sich und anderen ernst genommen werden muss.
Unzureichend Beachtung hat nicht nur gefunden, dass moderne Zwänge zur Popularisierung von psychiatrischen Diagnosen beitragen können, sondern auch neue Akteur:innen. Dazu zählen Mental-Health-Influencer:innen auf Social-Media-Plattformen. Jene kommerziell ausgerichteten Vermarkter:innen befördern ein Verständnis von psychischer Gesundheit als Ausgeglichenheit und bewegen sich zwischen der Enttabuisierung, Glamourisierung, Kommerzialisierung und Aneignung von psychischen Erkrankungen.
Diese Aspekte aufzugreifen und damit die bisherige Debatte über gesellschaftliche Pathologisierungsprozesse zu erweitern, steht im Zentrum des Buchs. Dabei wird das Motto »Hard on systems, soft on people« verfolgt. Ausgewählte Beispiele von Content Creators dienen rein der Veranschaulichung. Es geht nicht um das Bewerten einzelner Aussagen oder Praktiken von User:innen auf Social Media, sondern darum, was deren Popularität über gesellschaftliche Zustände offenbart. Ebenso wichtig hervorzuheben ist, dass es »Social Media« als einheitliches Modell so nicht gibt. TikTok, Instagram und YouTube sind Plattformen, die zwar alle auf Video-Inhalte setzen, jedoch unterschiedlichen Logiken folgen im Hinblick auf Content-Formate und Länge, Algorithmus-Struktur, Möglichkeiten für Interaktivität oder Monetarisierungsmodelle. Allen gemein ist jedoch, dass sie Orte der »vermeintlichen Realitätsvermittlung«3 sind, und in diesem Sinne wird der Begriff auch übergeordnet verwendet. Ziel ist es, besser zu verstehen, wie und warum Menschen online mit der Kategorie psychischer Erkrankungen interagieren, um ihrem Selbstverständnis Bedeutung zu verleihen und Gemeinschaften zu bilden. Damit rückt die Publikation einen Diagnose-Enthusiasmus in den Mittelpunkt und analysiert die gegenwärtige gesellschaftliche Entschlossenheit, hinderliche oder unangenehme Gefühlslagen, Handlungsweisen, Erfahrungen oder auch Personen krankhaft zu deuten.
Online-Diagnosen zwischen Enttabuisierung, Glamourisierung und Kommerzialisierung
In gegenwärtigen Online-Kulturen gibt es eine große Bereitschaft, sich mit psychiatrischen Diagnosen zu identifizieren und diese öffentlich zu zeigen. Die vordergründig propagierte Absicht hinter dem Sichtbarmachen von schmerzhaften Tabus ist, ein breiteres Verständnis für und Empathie mit Erkrankten zu fördern. Damit finden wichtige Entstigmatisierungsprozesse statt, die bewirken können, dass sich Betroffene eher Hilfe suchen oder sich in ihrem Leid nicht sozial isoliert fühlen, sondern als Teil einer »virtuellen Community« . Personen mit schweren psychischen Erkrankungen werden dadurch ermutigt, Hoffnung zu schöpfen, sich gegenseitig zu unterstützen und persönliche Erfahrungen und Strategien zur Bewältigung von täglichen Herausforderungen des Lebens auszutauschen.1 Eine Studie unter jungen Erwachsenen zeigt, dass Menschen mit psychischen Belastungen eher dazu neigen, Freundschaften in sozialen Medien zu schließen und sich virtuell mit Gleichgesinnten zu vernetzen.2 Online lernen sie von anderen Betroffenen über die Möglichkeiten und Wege der Inanspruchnahme von psychosozialer Hilfe.3 Soziale Medien haben also ein pädagogisches Potenzial, indem sie eine Plattform bieten, auf der psychische Krankheiten offen angesprochen und mit aktivistischen Bewegungen verknüpft werden können.4
Bei all den Vorzügen der neueren Onlinediskurse über »Mental Health« stellt sich allerdings auch die Frage: Wo liegt die Grenze zwischen Bewusstmachung und Verherrlichung? Und inwieweit wird im Namen der Enttabuisierung vielleicht sogar zusätzlicher Druck auf Betroffene ausgeübt? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist grundlegend für ein differenziertes Verständnis darüber, welche Auswirkungen der Debatte auf das Wohlergehen von Erkrankten, Nichterkrankten und der Gesellschaft als Ganzes zu erwarten sind.
Als Beispiel kann der Themenbereich »Depression« herangezogen werden. Depressive Symptome werden allgemein mit einer Störung neuronaler Systeme wie dem Emotions- und Belohnungssystem in Verbindung gebracht und machen sich unterschiedlich bemerkbar: von Antriebslosigkeit und der Unmöglichkeit von Alltagsbewältigung bis hin zu Hochfunktionalität bei innerer Leere. Selbst wenn das Hauptanliegen von Content Creators darin besteht, diesen psychischen Belastungszustand zu entstigmatisieren, kann das bei Betroffenen zu verstärkten Schamgefühlen führen, etwa wenn sich die eigene Depression nicht wie das bildschirmtaugliche »beautiful suffering« von Influencer:innen darstellt, sondern durch eine Vernachlässigung grundlegender Körperhygiene. Denn ob man will oder nicht: Der Konsum von Social-Media-Inhalten löst bei den meisten Menschen soziale Vergleichsprozesse aus. Das eigene Bedürfnis nach Rückzug, die Angst vor Bewertung, der Mangel an Kraft, sich um die eigenen Grundbedürfnisse zu kümmern, oder auch das vorherrschende Gefühl von emotionaler Taubheit stehen den ästhetischen Aneignungen von Depression auf Social Media gegenüber, die auf Bestätigung und Reichweite abzielen. In der Logik von sozialen Medien geht es schließlich nicht vorrangig um Ehrlichkeit, sondern um Likes, Follower:innen und Popularität.
Inszenierungen von Gefühlsintensität und der Schönheit im Schmerz, zum Beispiel wenn sich junge, attraktive Frauen mit Schwarz-Weiß-Filter beim Weinen filmen, können demnach als »performative Authentizität«5 verstanden werden, die der Logik der Aufmerksamkeitsökonomie entsprechen. Überzeichnet ausdrucksstarke Darstellungen tragen das Potenzial, die eigene Reichweite zu vergrößern, die wiederum den Marktwert bestimmt. Das fünf Sekunden kurze Video der weinenden TikTokerin Ryelee Steiling mit dem Titel »depression is a tricky thing«, das Views im zweistelligen Millionenbereich aufweist, zeigt dies musterhaft.6 Es mag befremdend wirken, dass jemand in einem derart hilflosen emotionalen Moment die Geistesgegenwart besitzt, zum Smartphone zu greifen, um sich zu filmen, das Video nachträglich zu bearbeiten und mit trauriger Musik zu hinterlegen, um es schließlich online zu stellen und Reaktionen abzuwarten. Selfies von weinenden Menschen stehen jedoch exemplarisch für allgemeine soziokulturelle und technologische Entwicklungen im menschlichen Verhalten. Denn die Art und Weise, wie Personen ihre Privatsphäre wahrnehmen und darstellen, hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Soziale Medien, die einen großen Teil des kommunikativen Austauschs ausmachen, tragen dazu bei, dass Menschen verstärkt Aspekte ihres persönlichen und intimen Lebens öffentlich teilen. Über die Gefahren dieser »Ideologie der Intimität« hat der US-amerikanische Soziologe Richard Sennett bereits Mitte der 1970er Jahre geschrieben, als noch lange keine Rede vom Internet in der gegenwärtigen Form war.
Unabhängig davon, ob man derartige Praktiken eher als selbstbewusste Offenheit oder »kollektive Infantilisierung«7 bewerten möchte, fällt eines auf: Online leidvolle Emotionen darzustellen ist für Jugendliche nichts Neues, denkt man etwa an die Emo-Kultur der späten 2000er. Heute finden derartige Gefühlsbekundungen jedoch zunehmend in pathologisierten Kategorien Ausdruck. Das trifft besonders auf Teenager:innen zu, die Diagnosen in visuell ansprechende Erzählungen verpacken. Inszenierungen von Traurigkeit als medizinisches Symptom sind damit zu einer normalisierten und auch ästhetisierten Erscheinung in Social-Media-Feeds geworden, die zu einer unbeabsichtigten Verharmlosung schwerer Krankheiten führen können. Das gilt vor allem für Betroffene, die kein Potenzial darin sehen, eine Krankheit visuell »schön« zu stilisieren, die sie hoffnungslos, wertlos, unverstanden und einsam macht, die sie dazu bringt, Beziehungen und Hobbys zu verlieren, und die mitunter auch suizidale Gedanken auslöst.
Die Fülle der Informationen und ästhetisierten Bilder im Bereich psychischer Krankheiten ist verbunden mit dem Trend, dass sich immer mehr Nutzer:innen selbst eine Diagnose stellen, ohne medizinisches Fachpersonal zu konsultieren.8 Auf TikTok hat das Hashtag #selfdiagnosis über 22 Millionen Views.9 Die Popularisierung von Online-Selbstdiagnosen ist ursprünglich im US-amerikanischen Kontext entstanden, begünstigt durch einen mangelhaften Zugang zu (qualitativ hochwertiger) Gesundheitsversorgung. Das ist kaum vergleichbar mit wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen in Europa, doch auch hier ist es mitunter ein langwieriger und teurer Prozess, den eigenen Krankheitsstatus offiziell feststellen zu lassen. Wenn eine psychiatrische Versorgung unzugänglich oder unerschwinglich ist, können Selbstdiagnosen das einzige Mittel zum Verständnis von persönlichen Problemen und zur Suche nach Lösungen werden. Diagnosen auf der Grundlage von ungeprüften Informationen, Online-Tests oder eigenen Recherchen zu stellen, ist allerdings nicht valide und kann sogar ein potenzielles »Genesungshindernis« darstellen, etwa wenn Symptome anderen Ursachen zuzuordnen sind und diese ununtersucht bleiben. Zudem entsprechen die auf den Plattformen verbreiteten Informationen der allgemeinen Logik von digitalen sozialen Netzwerken: dem Herstellen von Eindeutigkeit.
Aus klinischer Sicht kann das facettenreiche Spektrum von Krankheitsbildern in komprimiert aufbereiteten Instagram-Slides oder kurzen TikTok-Videos kaum ausreichend erfasst werden, nicht zuletzt da sich dieselbe »Störung« bei einem Kind, Jugendlichen und Erwachsenen sehr unterschiedlich äußern kann. Mit anderen Worten: Die gleiche Liste von Symptomen gilt nicht für jede Altersgruppe. Um psychische Krankheitszustände einzuschätzen, müssen außerdem nicht nur Anzeichen berücksichtigt werden, sondern auch subjektive Leidenszustände, Einschränkungen der sozialen Teilhabe oder das Schlaf- und Essverhalten.10 Und schließlich verfügen Influencer:innen im Bereich psychischer Gesundheit häufig über keine professionelle Ausbildung und formale medizinische Fachkenntnis. Das führt zur Verbreitung von falschen oder einseitigen Informationen, etwa dass Ohrwürmer ein Zeichen für ADHS seien, wie in einem viral gegangenen TikTok-Video mit mehr als vier Millionen Views behauptet wurde.11 Eine aktuelle psychiatrische Studie zeigt hierzu: Unter den hundert beliebtesten Videos über ADHS auf TikTok sind mehr als die Hälfte irreführend (»misleading«), die Mehrheit davon stammt von Personen ohne formalen medizinischen Abschluss.12
Nicht zuletzt befördert die selbstdiagnostische Online-Kultur psychische Krankheiten zu einem identitätsstiftenden Lebensgefühl mit Zugehörigkeitseffekt. Das zeigt sich unter anderem darin, dass viele Teenager:innen psychiatrische Diagnosen in der Kurzbiographie ihres Social-Media-Profils anführen. Jene Identifikation ist wiederum verknüpft mit einer erhofften Aussicht auf digitale Aufmerksamkeit und weiterführend deren potenzieller ökonomischen Verwertbarkeit. Der Krankheitsstatus wird so zu einer neuen Art, auf Social Media dazuzugehören — oder sogar erfolgreich zu sein. Besonders auf Jugendliche übt das Eindruck aus, da sie sich ohnehin in einem schwierigen Transformationsprozess befinden. In kaum einer anderen Lebensphase verändern sich die neuronalen Strukturen so sehr wie in der Pubertät. In diesen Entwicklungsjahren finden grundlegende psychische und emotionale Veränderungen statt. Intensive und fragile Empfindungslagen, Reizbarkeit, starke Stimmungsschwankungen, Zweifel, eine grundsätzliche Verunsicherung und innere Zerrissenheit sind gängige Erscheinungen. Wachsende intellektuelle Fähigkeiten führen dazu, gesellschaftliche Strukturen stärker zu hinterfragen, was ein andauerndes Gefühl von Weltschmerz hervorbringen kann. Der Körper verändert sich, es werden zunehmend Vergleiche zu anderen gezogen und die eigene »Normalität« infrage gestellt. Schamgefühle nehmen einen großen Platz ein. Der Abnabelungsprozess von den Eltern geht mit der Frage einher, wo man selbst dazugehört oder auch dazugehören möchte und dazugehören kann. Dieser hormonell und sozial bedingte Wachstumsprozess ist außerordentlich anstrengend und verstörend.
Sich in dieser Phase eine psychische Krankheit zuzuschreiben, kann verlockende Erleichterungen mit sich bringen, gerade weil Social Media für viele Jugendliche, die mit dem Internet aufgewachsen sind, ein existenzieller Ort der Zugehörigkeit und Identitätsbildung ist. Darüber hinaus ist es naheliegend, dass Teenager:innen auch »normale« belastende Gefühlslagen als Krankheit interpretieren, wenn diese online überwiegend in pathologisierten Kategorien sichtbar sind. Dementsprechend besteht ein Risiko der Vermengung von klinischen und menschlichen Leidenszuständen wie auch die Gefahr einer Überidentifikation damit (»Ich habe keine Diagnose, ich bin die Diagnose«), die dazu einladen kann, in jenem Leidenszustand — oder sogar Patient:innenzustand — zu verharren.
»Sad Girl Culture« und Depressionsromantik
Das Verhalten und das Selbstverständnis von jungen Frauen sind kulturell geprägt und von dominanten gesellschaftlichen Diskursen beeinflusst. Das betrifft auch den Druck, sich in eindimensionale, leicht konsumierbare Kategorien einzuordnen: Frauen, die ihr Leben im Griff haben (»That Girl«), Frauen, die schlagfertig und rebellisch sind (»Bad Girl«), Frauen, die sich auf Kosten anderer Frauen bei Männern anbiedern (»Pick me Girl«), Frauen, die den Sommer ihres Lebens verbringen (»Hot Girl Summer«) oder auch Frauen, die ihre Traurigkeit ästhetisch ansprechend inszenieren (»Sad Girl«). Auf der Blogging-Plattform Tumblr wurde letztere Figur ursprünglich popularisiert.
Die Google-Suchanfragen nach »Sad Girls« erreichten 2014 und 2015 einen Höhepunkt. 2022 wurde der Trend auf TikTok aufgegriffen und weitergeführt, wo das Hashtag #sadgirl knapp zwanzig Milliarden Views13 aufweist und unter anderem der Trend »Crying Make-up« durch weinende Selfies von dem Model Bella Hadid popularisiert wurde.
Während »Sad Girls« der 2010er Jahre eher dazu neigten, sich als viktorianische Frau zu stilisieren — als zerbrechliches Mädchen, das sich zu Hause einschließt, fast schon wie eine Hommage an das schwindsüchtige Frauenideal des 19. Jahrhunderts —, beanspruchen »Sad Girls« der 2020er zunehmend auch den öffentlichen Raum. Gleich geblieben ist jedoch die Romantisierung von jungen, hübschen, leidenden Frauen, die schon lange davor popkulturell verbreitet war.
Ein klassisches Beispiel ist der vor 25 Jahren erschienene US-amerikanische Spielfilm The Virgin Suicides, in dem fünf schöne, depressive Schwestern Suizid begehen. Der Plot wird aus der Sicht einer Gruppe von Männern erzählt, die auf die Zeit zurückblicken, als sie noch Jungen und von der Schönheit und den psychischen Krankheiten der Schwestern fasziniert waren. Sie beobachten sie durch ihre Fenster, fetischisieren ihre Depressionen und finden andere Mädchen in der Schule nicht so anziehend und geheimnisvoll wie sie.
Laut der britischen Psychologin Sarah Derveeuw befördert die geheimnisvolle Darstellung der Schwestern die Vorstellung, Depressionen seien tiefgründig und verführerisch, was dazu führen kann, dass junge Frauen das Krankheitsbild als »Trend« übernehmen.14 Dieses Image und die Fetischisierung des »Beautiful Damaged Girl«, das stets von überdurchschnittlich attraktiven Schauspielerinnen gespielt wird, zeigt sich immer wieder — in älteren Filmen wie Girl Interrupted und Prozac Nation oder aktuelleren Serien wie Skins, 13 Reasons Why oder Euphoria. In all diesen Werken werden psychische Gesundheitsprobleme romantisiert und erotisiert, sie lassen die Hauptdarstellerinnen cool und anziehend erscheinen. Dabei wird eine Verbindung zwischen Schönheit und Leid hergestellt, die sich auch in der »Sad Girl Culture« im virtuellen Raum widerspiegelt und im Kontext der geschlechtsspezifischen Kultur von Traurigkeit und psychischer Krankheit zu verstehen ist.15 Psychische Instabilität ist kulturhistorisch weiblich konnotiert, von Neurasthenie über Hysterie, Schizophrenie bis hin zu Nervenfieber. Neuartig an der »Sad Girl Culture« ist, dass junge Frauen nicht »von oben« diagnostiziert werden, sondern sich freiwillig damit identifizieren und inszenieren. Das kann vielfältig interpretiert werden, von der Reproduktion traditioneller Pathologisierungsmuster bis hin zu einem emanzipatorischen Akt.
Aus feministischer Perspektive kann die bedeutende Rolle von geschlechtsspezifischen Emotionsnormen in patriarchalen Gesellschaftsordnungen nicht genug hervorgehoben werden. Denn einer der Eckpfeiler des tiefenpsychologischen Denkens ist die Freud’sche Idee, dass hinter Depressionen unterdrückte Wut steckt — und Frauen wird schon früh beigebracht, diese nicht auszuleben.16 Wütende Frauen lösen eine tiefe kulturelle Angst aus, da Wut eine treibende Emotion für politischen Protest ist, zum Beispiel gegen eine Gesellschaft, in der »weibliche« Leistungen, Erfahrungen, Wahrnehmungen und Bedürfnisse strukturell abgewertet werden.17 In anderen Worten: Für patriarchale Interessen sind depressive Frauen dienlicher als wütende. In dieser Leseart werden Depressionen zu einem legitimen Weg der passiven Auslebung aktiver Wut, was als systemische Kontrolle des widerständischen Potenzials von Frauen verstanden werden kann.
Die US-amerikanische Künstlerin Audrey Wollen vertritt eine andere Position. In ihrer »Sad Girl Theory« beschreibt sie die nach außen getragene Traurigkeit als Antwort auf das neoliberale feministische Ideal, das Frauen als Macherinnen ihres eigenen Erfolgs ansieht, der darin besteht, sich selbst zu lieben und wirtschaftlich erfolgreich zu sein.18 »Sad Girl Culture« ist für sie eine bewusste Geste der Befreiung, eine leisere und weniger maskuline Form des Widerstands und ein Weg, die Kontrolle über weibliche Körper, Identitäten und Leben zurückzuerlangen. Zugespitzt ausgedrückt: Es ist unwahrscheinlich, dass ein »Sad Girl« eine gute Hausfrau ist. Wollen erklärt, dass Selbsthass, Kummer und Leiden »Szenen des Protests« seien und nicht als Neurose, Narzissmus oder Verwahrlosung eingestuft werden sollten.19 Traurigkeit und Depression seien historisch bei Frauen unsichtbar gehalten worden, da es ihre Aufgabe war, für andere da zu sein und emotionale Belastungen mit sich selbst auszumachen. Auch deshalb ist ihrer Ansicht nach der Anspruch, andere zu Zeug:innen des eigenen Leids zu machen, ein widerständischer. Audrey Wollen selbst führt in ihren Interviews wiederholt »Tragic Queens« an, die eine Faszination und Vorbildwirkung auf junge Frauen ausüben. Dazu zählt sie Judy Garland, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Edie Sedgwick, aber auch Lana del Rey (genannt »Sad Girl Superstar«), Brittany Murphy, Hannah Wilke oder Elena Ferrante. Bemerkenswert ist, dass all diese Frauen — sowie die Protagonistinnen aus den genannten Film- und Serienbeispielen und jene, die im Internet die »Sad Girl Culture« dominieren — ein gemeinsames Merkmal haben: Sie sind weiß.
Der dominierende visuelle Fokus für die Darstellung von Depression liegt also auf dem weißen privilegierten Frauenkörper. Diese depressive Karikatur zeigt sich durchgängig und trägt zu der destruktiven Vorstellung bei, dass man auf bestimmte Weise aussehen muss, um leiden zu dürfen. Die Journalistin Alice Hines beschreibt das typische »Sad Girl« sehr eindrücklich als junge Frau aus einem wohlhabenden westlichen Land, die genug Zeit hat, um diese online zu verbringen, und schön aussieht, wenn sie leidet.20 Wenn performative Traurigkeit auf Social Media und in der allgemeinen kulturellen Erzählung von visuell sehr eng gefassten — und damit ausgrenzenden — Repräsentationen und Schönheitsidealen getragen wird, kann es dazu führen, dass junge Frauen, die nicht in diese Kategorie passen, sich noch mehr entfremdet fühlen oder das Gefühl bekommen, nicht auf die »richtige« und »coole« Art traurig sein zu können. Statt als widerständischer Akt kann die »Sad Girl Culture« in dieser Lesart auch als vermeintlicher Anspruch auf eine leidende Rolle betrachtet werden und als Beförderung der Vorstellung, dass weiße Frauen fragil sind und Schutz brauchen. Das ist eng verknüpft mit der kulturhistorischen Konnotation von Blässe mit zarter Schönheit und Verletzlichkeit.
Die Vorstellung von Weiblichkeit und die Annahme einer vulnerablen Zerbrechlichkeit, Empfindsamkeit und Schutzwürdigkeit wird nichtweißen Frauen gesellschaftlich nicht zugestanden.21