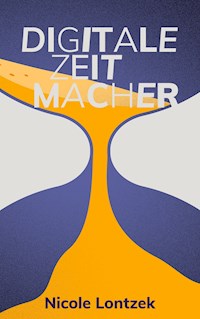
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Digitale Zeitmacher ist ein positiver Blick auf die technologischen Möglichkeiten unserer Zeit und wie diese uns helfen können wertvolle Lebenszeit für die Dinge zu nutzen, die uns wirklich wichtig sind. Wo steht Deutschland aktuell in Sachen Innovation und technologischer Fortschritt? Und was ist Zeit eigentlich? Digitale Zeitmacher geht diesen Grundsatzfragen auf die Spur und rüttelt wach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Anmerkung der Autorin
Vorwort
Kapitel 1: Die digitale Lage der Nation
Kapitel 2: Staubsaugerroboter
Kapitel 3: Die Zeit aus physikalischer Sicht
Kapitel 4: Die Zeit aus philosophischer Sicht
Kapitel 5: Die Vorreiter der Digitalisierung – was wir vonanderen lernen können
Kapitel 6: Was Skandinavien besser macht
Kapitel 7: Die neue Weltmacht China
Kapitel 8: KI in der Rechtsprechung
Kapitel 9: Dem Leben mehr Tage geben
Kapitel 10: Transhumanismus
Kapitel 11: KI in der Kunst
Kapitel 12: KI in der Elektronikentwicklung
Kapitel 13: Wie Innovation entsteht
Kapitel 14: Die volkswirtschaftliche Bedeutung der digitalen Wirtschaft
Kapitel 15: Die Treiber des Fortschritts
Kapitel 16: Vertrauen in Technologie als Grundpfeiler
Kapitel 17: Transparenz als Basis
Kapitel 18: Kontrollmechanismen
Kapitel 19: Zeit haben – eine Utopie
Kapitel 20: Aufstieg suchterzeugender Technologien
Kapitel 21: Was wir jetzt gewinnen
Literatur und Quellen
Über die Autorin
Widmung
Ich widme dieses Buch all jenen lieben Personen, die mich in meinem Leben begleiten und durch inspirierende Gespräche bereichern, und meinem Partner, der mich mit seiner Sicht auf die Dinge und die Welt immer wieder herausfordert und beflügelt. Im Besonderen widme ich dieses Buch meiner kleinen Schwester.
Anmerkung der Autorin
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und des Textflusses wird auf die Verwendung von Gender-* oder Gender-„I“ verzichtet, sofern sich die Bezeichnung nicht aus dem Kontext heraus ergibt. Vielmehr umfasst jede Nutzung der männlichen Form auch die weibliche Form, sollte sich dieser Umstand aus dem Gesamtkontext ergeben.
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser, wie schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, sich diesem Buch zu widmen. Ich hoffe, Sie sitzen oder liegen irgendwo ganz entspannt, vielleicht bei einer köstlichen heißen Tasse Tee, und haben einmal so richtig viel Zeit für sich.
Sie können sich sicher noch an die ersten Gedanken erinnern, die Sie hatten, als es um Ihre berufliche Laufbahn ging. An die vielen Träume, die Sie hatten, die vielen Ideen, die so aufregend erschienen, und die Möglichkeiten, die nahezu endlos waren.
Als ich vierzehn Jahre alt war, führte mein Vater ein ebensolches Gespräch mit mir, in dem es um meine berufliche Orientierung ging. Damals meinte er zu mir, ich solle Rechtsanwältin oder Ärztin werden. Er tat das mit dem Gedanken, den viele Eltern für ihre Kinder hegen: Sie sollten es später mal besser haben als sie selbst. Rechtsanwalt und Arzt galten als Berufe der mittleren bis oberen Mittelschicht. Die Verdienstmöglichkeiten der beiden Berufsgruppen schienen meinem Vater demnach angemessen für seine Tochter.
Ich war schon immer etwas eigensinnig und stur – zum Leidwesen aller, die bereits in den zweifelhaften Genuss kommen durften, nicht einer Meinung mit mir zu sein. So war es wenig verwunderlich, dass ich mit vierzehn Jahren, mitten in der Pubertät, nicht derselben Ansicht mit den Zukunftsplänen meiner Eltern war. Allerdings musste ich meinem Vater in einer Sache Recht geben: Etwas Solides wollte ich auch machen. Später entschied ich mich deshalb für ein duales Studium zur Bankkauffrau an der Dualen Hochschule Ravensburg und der Sparkasse München. Etwas Beständigeres fiel mir als Berufswahl nicht ein.
Mit meinem Studium begann ich im Jahr 2008 – dem Jahr, in dem die weltweite Bankenkrise über die Wirtschaft hereinbrach. So hatte ich mir „solide“ nicht vorgestellt, mein Vater auch nicht. Etwas über ein Jahr später ließ ich mich exmatrikulieren. Die Welt der Banken war nichts für mich, obwohl ich eine der Besten in meinem Ausbildungsjahrgang war. Diese Entscheidung lag weniger an der Krise als an der Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, mit einer Bankausbildung in einer Sackgasse zu landen.
Der ausschlaggebende Moment für diesen Schritt war ein Gespräch mit meiner damaligen Ausbildungsleiterin, die zu mir sagte: „Nicole, du bist eine der Besten dieses Jahrgangs. Du wirst es noch weit bringen und sicher bald eine eigene Filiale leiten.“ Was sich für andere Menschen als Lob anhört, war mir ein Dorn im Auge. Die Vorstellung, irgendwo im Münchner Umland eine halbleere Sparkassenfiliale zu leiten, und das für den Rest meines Lebens, missfiel mir zutiefst. Zugegebenermaßen habe ich zu diesem Zeitpunkt auch keinen Gedanken daran verschwendet, darüber nachzudenken, dass sich Karrieren ja entwickeln können und es nicht bei einer Position in einer Bankfiliale bleiben muss. Der Backfisch in mir war für solche Überlegungen zu unreif. So entschied ich mich dann für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Tourismus. Weniger solide und prestigeträchtig, aber durch die Vorstellung geprägt, dass es nicht falsch sein kann, etwas zu studieren, das mit dem Reisen zu tun hat.
Generell habe ich in meinem frühen beruflichen Leben viel ausprobiert und war sprunghaft: Ich war schnell von Themen genervt und sie langweilten mich, sobald sie ihren Reiz verloren. Es musste immer etwas Neues her, von dem ich lernen konnte und das mich beflügelte. Während des Studiums fand ich dann etwas, was mich so faszinierte, dass ich es unbedingt erlernen wollte und – viel wichtiger – auch dabeibleiben wollte: Die Welt der digitalen Analysen hatte mich in ihren Bann gezogen. Ich war fasziniert, mit welcher Präzision man Kundendaten auswerten konnte und welche Handlungsempfehlungen man daraus folgern konnte. Damals waren die Datensätze, die über Nutzer im Netz gesammelt wurden, nicht annähernd so groß wie heute und Big Data war niemandem ein Begriff. Und dennoch, die Möglichkeiten personalisierter Werbung, prädiktive Analysen und semantische Auswertungen waren in meinen Augen so mächtige Instrumente, dass ich diesen Berufsweg unbedingt weiterverfolgen wollte. Zu beeindruckt war ich von den Möglichkeiten, die sich boten. Die Mittel zur Datenauswertung sind heute – zehn Jahre später – weiter massiv gestiegen und die auswertbaren Trackingdaten beängstigend genau.
Bei der Überlegung damals zusammen mit meinem Vater, welchen Berufsweg ich einmal einschlagen sollte, kam mein heutiger Beruf gar nicht auf: Es gab ihn damals einfach noch nicht. Die Möglichkeiten zur Datenanalyse, die wir heute haben, sind daher für Menschen wie mich das reine Paradies.
Als ein weiterer Aspekt neben den vielen Daten, mit denen man menschliches Verhalten nahezu transparent werden lassen kann, fesselt mich die rasante Geschwindigkeit, mit der sich Tools weiterentwickeln und neue Innovationen auf den Markt gebracht werden. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht etwas Neues lernen kann und ein schlauer Mensch ein Produkt verbessert, ein neues Feature entwickelt oder den Algorithmus komplett auf den Kopf stellt, weil sich so ganz neue Trackingmethoden ergeben. Aber auch jenseits von Tracking und Analysen für das digitale Marketing erleben wir erdrutschartige Veränderungen. Algorithmen berechnen unsere Bonität bei der jeweiligen Hausbank, die digitale Gesundheitsakte in Schweden ist mittels einer Registerkonsolidierung für jede beteiligte Behörde zugänglich und Beethovens 10. Sinfonie, die nur in Skizzen vorlag und nun von einem Algorithmus vollendet wurde, soll im Herbst 2021 uraufgeführt werden. Die digitale Welt steht niemals still. Sie unterliegt einem ständigen Wandel und nimmt gerade nochmal so richtig an Fahrt auf.
Kapitel 1
Die digitale Lage der Nation
Es ist 16.27 Uhr an einem Samstagnachmittag, als ich auf die Uhr an der gegenüberliegenden Wand sehe. Die Wanduhr ist neu. Ich habe sie letzte Woche bei einer Einkaufsrunde in der Münchner Innenstadt gekauft. Es ist keine besonders aufwendig gearbeitete Uhr. Sie ist einfach und schlicht gehalten, und trotzdem bin ich fasziniert von ihr. Sie zeigt mir meine freie Zeiteinteilung an. Sie hilft mir, meinen Tag in Abschnitte zu gliedern und zu strukturieren. Sie funktioniert nach dem Lebensentwurf, den wir uns als Menschen selbst gegeben haben.
Wir organisieren unseren gesamten Alltag nach dem Konzept der Zeiteinteilung. Wir unterteilen ihn in morgens und abends, nach Stundeneinheiten, Minuten und Sekunden. Unser vollständiges soziales Leben basiert auf dieser sozialen Absprache, die uns hilft, den Alltag zu sortieren. Dabei gibt es die unterschiedlichen Charaktere unter uns, die jeder kennt: Den einen ist Pünktlichkeit heilig und für die anderen stellt sie zwar eine Tugend dar, allerdings keine allzu erstrebenswerte. Wiederum andere sehen in einem Zeitpunkt eher einen schwebenden Zeitraum. Wie Pünktlichkeit wahrgenommen wird, ist in jedem Land verschieden. Wir Deutschen gehören im internationalen Ansehen zu den penibleren Völkern, wenn es darum geht, zur rechten Zeit, sprich zum vereinbarten Zeitpunkt zu einer Verabredung zu erscheinen. Den pünktlichen Einstieg in die Digitalisierung scheinen wir jedoch verschlafen zu haben. Hier trotten wir als Nation gemächlich hinterher und lassen anderen den Vortritt.
Wirft man einen Blick auf die Pünktlichkeit von Fluggesellschaften, hat Japan die Nase weit vorn. Ebenso lassen die japanischen Schnellzüge die leidgeplagte Deutsche Bahn weit hinter sich. Pünktlichkeit und Geschwindigkeit sind beides Ableitungen aus unserem Verständnis für Zeit. Dabei ist gerade die Geschwindigkeit etwas, was uns antreibt, wenn wir neue Produkte, Services oder Technologien auf den Markt bringen. Es geht darum, bei mindestens gleichbleibender oder steigender Qualität immer ein wenig schneller zu werden. Der eigene Anspruch, den wir an uns stellen, wird gespeist von dem Drang, die Welt um uns herum so effizient, komfortabel und so profitabel wie möglich zu gestalten.
Oft verlieren wir uns jedoch in der Geschwindigkeit des Alltags, das Arbeitspensum nimmt überhand und wir ertappen uns dabei, Opfer unserer eigenen fehlgeleiteten Zeiteinteilung und unserer mangelhaften Selbsteinschätzung zu sein. Wie oft haben wir schon neue Tools zur Zusammenarbeit, zur Kommunikation und zur Automatisierung von Prozessen in Unternehmen eingeführt, um effizienter und produktiver zu arbeiten, und die freigewordene Zeit sofort mit anderen Aufgaben gefüllt? Nach dem Leistungsprinzip ist ein freier Terminkalender ein regelrechtes Unding und wird von den Kollegen nicht immer mit Wohlwollen betrachtet. Das wissen wir zu verhindern. Und so packen wir uns den Kalender entsprechend voll, denn es gibt dauernd was zu tun. Wer nicht busy ist, ist demnach faul. Allein schon für das eigene plagende Gewissen funktionieren vollgepackte Terminkalender hervorragend, sind es doch die Outlook-synchronisierten To-do-Listen unserer Zeit. Und wem das nicht genügt, der bedient sich bei Todoist, Notes, Trello, Asana und Co … Für jeden Vielbeschäftigten unseres Landes gibt es die passende Applikation.
Dieses Verhalten ist einerseits verständlich: Wir alle wollen unseren Teil zum gesellschaftlichen Leben beitragen. Auf der anderen Seite verhalten wir uns paradox: Waren diese kleinen Helferlein, die uns dabei unterstützen sollten, unser Leben besser zu organisieren, nicht dafür gedacht, unserem Alltag mehr Zeit zu lassen anstatt weniger? Sind die digitalen Innovationen, die Abläufe schneller, präziser und in vielfacher Menge abbilden können, nicht erfunden worden, um uns das Leben zu erleichtern? Natürlich sind sie das – und dennoch tun wir uns schwer, wenn es um Digitalisierung geht. Auf der einen Seite sind wir überwältigt von dem Angebot, das man uns bereitstellt, auf der anderen Seite fehlt eine klare, richtungsweisende Strategie in den Unternehmen, wie digitalisiert werden soll.
Aktuell hinken wir den anderen Staaten gemütlich hinterher, weil wir uns als Nation irgendwie den Fuß verknackst haben. Und dennoch geht es mit kleinen Schritten vorwärts. Jeder, der kann, digitalisiert. Neidvoll blicken wir auf das Silicon Valley oder nach Shenzhen, die einiges besser zu machen scheinen – während uns bereits beim Hinken die Puste ausgeht. Im Oktober 2020 teilte Daimler mit, es habe das Rennen um das autonome Fahren verloren und lasse den Kaliforniern den Vortritt. Eine Nachricht, die für ein großes mediales Echo sorgte. Der einstige Klassenprimus gibt sich geschlagen, wenn es um zukunftsweisende Entwicklungen geht.
Und wie sieht es bei den anderen deutschen Autobauern aus? Auch BMW, VW und Co. liefern bis dato kein autonom fahrendes Auto. Zwar wird getestet und probiert, aber bisher hat keiner der Traditionskonzerne den Dreh raus. Was läuft nur schief? Menschen pendeln im Schnitt rund siebzehn Kilometer auf dem Weg zur Arbeit und sind den Tag über zwei Stunden unterwegs. In den Ballungsräumen brauchen Berufspendler oft noch länger, um ans Ziel zu gelangen. Das ist wertvolle Lebenszeit, die wir im Auto verbringen, ohne dabei produktiv zu sein. Einen Großteil dieser Zeit verbringen wir im Stau, die temperamentvollen Zeitgenossen von uns fluchend hinter dem Lenkrad.
Dabei gibt es zahlreiche Ideen und Konzepte, wie die Zukunft des Autofahrens aussehen kann. Das Ziel der Forscher ist es, die durch autonome Fahrzeuge freigewordene Zeit so sinnvoll und so interessant wie möglich zu gestalten. Hierzu gibt es vielfältige Szenarien, wie man den Autofahrern der Zukunft den Transport von A nach B erleichtern kann: vom Concierge-Service über den mobilen Schönheitssalon bis hin zu Restaurants oder mobilen Apotheken. Von einem vollausgestatteten Entertainmentsystem schwärmen die einen, von einem umwandelbaren Schlafwagen im mobilen Hotel die anderen. Um ein umfassendes Entertainment anbieten zu können, würden die Fensterscheiben der Fahrzeuge zu großflächigen Bildschirmen umfunktioniert, die uns dann die neuesten Blockbuster, unsere Lieblings-Netflix-Serie oder die aktuellen Trendspiele wiedergeben. Im Auto der Zukunft ist alles per Touch-Screen bedienbar, und die personalisierte Mediathek synchronisiert sich automatisch mit der hauseigenen Cloud, sobald der Fahrgast eingestiegen ist und die Datenfreigabe erteilt hat.
Ein Forschungsteam in Kanada stellte kürzlich digitale Multiplayer-Spiele vor, die speziell für Fahrer von selbstfahrenden Autos entwickelt wurden. Von unterwegs aus mit den Freunden die neuesten Kreationen spielen – von Activision Blizzard oder Epic Games – wird in Zukunft genauso zum Alltag gehören, wie die Gewissheit, dass die Tageschau in der ARD täglich um 20 Uhr ausgestrahlt wird. Auch vollfunktionsfähige Meetingräume erträumen sich die Visionäre: Die Termine des Tages bequem auf dem Weg zum nächsten Kundentermin abarbeiten und dabei neue Geschäftspotenziale erschließen.
Das Unternehmen Intel schuf hierfür den Begriff Passenger Economy. Dieser bezeichnet den zu erwartenden Umsatz, den die Unternehmen mit dem zukünftigen Entertainmentangebot erzielen. In seinem Report summiert Intel für den Zeitraum von 2034 bis 2045 über 234 Milliarden US-Dollar an eingesparten Kosten im Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr aufgrund der massiv reduzierten Anzahl von Unfällen. Das freigesetzte Kapital derjenigen Bürger, die kein eigenes Auto mehr besitzen werden, beläuft sich auf rund 900 Milliarden US-Dollar. Und dieses frisch verfügbare Kapital kann dann in neue Services investiert werden und ebnet den Weg für Mobility-as-a-Service-Produkte (MaaS). Dieser Markt wird mit über 3,7 Billionen US-Dollar beziffert und umfasst die gesamte Produktpalette an Mobilitätsangeboten, auf die wir zukünftig zurückgreifen können. Der Markt für Applikationen und Serviceanwendungen rund um das autonome Fahren folgt mit einem geschätzten Volumen von rund 200 Milliarden US-Dollar. (Intel Global Public Transport Report 2020)
Der Schritt zum autonomen Fahren ist der größte technische Fortschritt in der menschlichen Mobilität seit dem Umstieg von Pferden auf das Automobil. Zugegeben: Flugtaxis wären noch spannender gewesen – aber auch die brauchen noch ein wenig Zeit in der Entwicklung. Daher fokussieren wir uns auf das Automobil.
Da die Notwendigkeit entfällt, selbst hinter dem Steuer sitzen zu müssen, werden schlagartig hunderte Stunden Lebenszeit frei. Wie wir diese Zeit nutzen, bleibt uns überlassen. Ob wir uns an dem überbordenden Angebot von digitalem Entertainment bedienen wollen oder doch lieber die Zeit dafür nutzen wollen, ein physisches Buch offline zu lesen, ist dann eine Frage der persönlichen Präferenzen und ist so individuell wie wir Menschen selbst. Es wird eine gewaltige Verschiebung geben in der Art, wie wir Medien konsumieren werden und wofür wir unsere Zeit nutzen. Wir Marketingexperten würden sagen, dass das Autofahren von morgen ein völlig neues, kundenzentriertes Nutzererlebnis sein wird.
Nur eines ist klar: Die Innovationen dafür kommen nicht aus Deutschland. Denn autonomes Fahren stand nicht auf dem Lehrplan der deutschen Autobauer. Daher weiß niemand so recht, wie uns das selbstfahrende Auto gelingen soll. Es gibt zu viele Probleme: Daten werden nicht exakt genug übertragen, die Reaktionszeiten sind zu langsam. Die gewinnbringende Verknüpfung der Autobauer mit der Plattformökonomie fällt den Entwicklern in den hiesigen Forschungszentren schwer. Die Entwicklungskosten sind exorbitant hoch und im internationalen Vergleich weit über dem Niveau anderer Player. Dabei hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Juli 2021 ein Gesetz beschlossen, das das autonome Fahren unter bestimmten Vorgaben landesweit ermöglicht, und in Deutschland somit als erstem Land der Welt autonomes Fahren gesetzlich verankert. Als Erstes sollen Busse autonom fahren dürfen und so den öffentlichen Nahverkehr sicherer machen.
Und wie sieht es in den deutschen Behörden mit der Digitalisierung aus? Wenig überraschend fällt auch hier die Bilanz eher mau aus. Laut einer Studie von kobaltblau Management Consulting aus dem Jahr 2020 verfügen neun von zehn Behörden in Deutschland über keine Digitalstrategie. Dabei empfinden die befragten Führungskräfte Digitalisierung als Chefsache. Ungeschickt dabei ist, dass solche Positionen in den Behörden aber nur selten existieren und auch nicht geschaffen werden.
Auch digitale Behördengänge erfüllen nicht die Standards, die ein Nutzer von kommerziellen Online-Anwendungen gewöhnt ist. Der Maßstab ist die intuitive Bedienbarkeit von Apps auf dem Smartphone. Hier müssen Nutzer vor der Nutzung keine Bedienungsanleitung durchlesen und die Apps liefern bereits bei der ersten Anwendung einen Mehrwert. Wenn ich meine Anträge im Erscheinungsbild eines veralteten Formulars zwar online ausfüllen kann, das Dokument dann aber erst ausdrucken und persönlich zur Behörde bringen muss, dann ist das am Nutzer vorbei digitalisiert und die zunächst gewonnene Zeit verpufft im Stau auf dem Weg zur Behörde.
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat erließ daher das Onlinezugangsgesetz (OZG). Es soll sicherstellen, dass insgesamt sechshundert Verwaltungsleistungen bis 2022 auch digital verfügbar sind. Hierfür wurden zwei Digitalisierungsprogramme aufgesetzt: Das erste Programm wird vom Bund verantwortet, und alle Leistungen mit Regelungs- und Vollzugskompetenz, die themenfeldübergreifend beim Bund liegen, werden digitalisiert. Die Leistungen, die in der Verantwortung der Bundesländer und Kommunen liegen, werden mithilfe des zweiten Programms digital verfügbar gemacht. Es trägt den sprechenden Namen „Digitalisierungsprogramm Föderal“. Bleibt nur zu hoffen, dass sich das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat kein Beispiel am neuen Berliner Flughafen nimmt. Sonst könnten so manche von uns vielleicht erst ihren Rentenantrag digital einreichen.
Eine nicht minder große Aufgabe als die nutzerorientierte Entwicklung von digitalen Prozessen ist das Thema Datenschutz. Die Deutschen lieben ihre Datensouveränität und die 2018 eingeführte Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union trägt zusätzlich zu einem restriktiveren Datenschutz bei. Dabei muss die Politik dem Wunsch der Bevölkerung, Herr über die eigenen Daten zu sein, nachkommen. Der Nutzer muss die Verwendung seiner Daten selbst in der Hand haben.
Besonders wichtig ist hierbei der Aspekt der Transparenz: Wer weiß, wie seine Daten verwendet werden, ist eher bereit, der Nutzung durch die Behörden zuzustimmen. Auch bei der Konzeptionierung digitaler Angebote muss der Datenschutz von Anfang an berücksichtigt werden. So entstehen hinterher keine unüberwindbaren Hürden. So sucht man weiterhin vergebens nach gelungenen digitalen Lösungen bei der Beantragung wichtiger Dokumente.
Die Pandemie hat uns viel gelehrt – unter anderem, dass wir hierzulande für die digitale Schulbildung nicht gewappnet sind. Digitale Lehrpläne sind nicht altersgemäß auf die Kinder abgestimmt, Lehrkräfte brauchen selbst Nachhilfe, wenn es um die Verwendung von Webkonferenz-Programmen geht, und für viele ist Digitalisierung immer noch eine abstrakte Zukunftsidee. Die Lernplattformen, die dazu dienen sollen, den Schülern das Lernen im Homeoffice zu erleichtern und eigenständig so viel Stoff zu erlernen wie möglich, stürzen ab oder sind anderweitig fehlerhaft programmiert. Deutschland gilt als Nachzügler. Das hat sich auch nach über einem Jahr Pandemie nicht geändert. Die Schulen sind für digitalen Unterricht nicht ausgestattet, Server brechen unter der Datenlast zusammen.
Aber auch mit der Bereitstellung von Hardware allein ist es nicht getan. Digitale Schulbildung benötigt ein umfassendes Transformationskonzept – darauf ist das Land jedoch noch nicht vorbereitet. Und selbst wenn ein ausgearbeitetes Schulkonzept vorhanden ist und die Server stabil laufen, reicht in manchen Gegenden des Landes die Internetverbindung nicht aus, um am hybriden Unterricht teilnehmen zu können.
Ein weiteres prominentes Beispiel für misslungene Digitalisierung ist die Corona-Warn-App. Dabei hätte alles so gut funktionieren können … Zu Beginn der Pandemie in Deutschland tat sich ein Konsortium aus Forschern und Entwicklern zusammen, um innerhalb kürzester Zeit eine App auf den Weg zu bringen, die die Eindämmung des Virus unterstützen sollte. Die Teams arbeiteten Tag und Nacht an diesem digitalen Helfer, dessen erste Version schlussendlich am deutschen Datenschutz gescheitert ist. Die zweite Version, die von der Telekom und SAP mit großer Verzögerung auf den Markt gekommen ist, kostete das Land Unsummen und kam trotzdem nicht fehlerfrei. Obwohl die Akzeptanz der App mit millionenfachen Downloads hoch ist, bleiben Fehler nicht aus.
Mit dem digitalen Impfpass kommt der nächste breit ausgerollte Versuch, der Pandemie Herr zu werden. Der Impfpass soll dazu dienen, allen Corona-Geimpften den Impfnachweis zu erleichtern und möglichst unkompliziert und unbürokratisch eine einheitliche Lösung zu schaffen. Wie erfolgreich dieser Versuch ist, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Ein zentralisiertes System sieht jedenfalls anders aus, denn schon jetzt ist klar: Der digitale Impfpass soll in verschiedenen Apps funktionieren, denn jeder bevorzugt eine andere App und man möchte den unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden.
Kapitel 2
Staubsaugerroboter
In seinem Buch Silicon Germany beschreibt der Journalist Christoph Keese seine Erlebnisse mit einem unbändigen Mähroboter. Der Roboter aus dem Hause Bosch wird als autonomes Haushaltsgerät angepriesen, das seinem Besitzer die Gartenarbeit erleichtern soll. Einfach einzurichten und funktional soll der Roboter einem zur Hand gehen und einen top gemähten Rasen hinterlassen. Das einzige Problem in dieser Utopie ist, dass bei diesem Gerät so gar nichts von allein, geschweige denn problemlos funktioniert: Das Abmessen der Gartenbegrenzung erweist sich als schweißtreibende und frustrierende Fronarbeit. Das Kartografieren will auch nicht so recht funktionieren und eine verständliche Bedienungsanleitung sucht man vergebens.
Was Christoph Keese in seinem Buch so humorvoll umreißt, stellt plakativ das Trauerspiel zur Schau, mit dem wir es in Deutschland zu tun haben: Wir sind in Sachen Digitalisierung ermattet. Ambitioniert, aber noch nicht so richtig aus der Deckung gekommen. Als sich Herr Keese auf Ursachenforschung begab, nahm er sogar den Weg nach England auf sich, um mit einem der damaligen Hauptverantwortlichen in Sachen Mähroboter zu sprechen und Antworten für den defizitären Entwicklungsstand des schwäbischen Konzerns zu finden. Das war im Jahr 2016.
Heute, fünf Jahre später, stehe ich vor meinem Staubsaugerroboter aus dem Haus Rowenta und wundere mich, denn die Qualität der Staubsaugerroboter hat sich nur wenig verbessert. Eigentlich hatte ich in fünf Jahren Entwicklungszeit mehr erwartet. Aber kurz zum Hintergrund: Das Unternehmen, das einst den Namen Weintraud & Comp. trug, wurde 1884 in Offenbach am Main gegründet. Damals stellte es Gürtelschnallen und Beschläge für die ortsansässige Lederindustrie her. 1909 wurde die Firma in Weintraud & Co. GmbH umbenannt und der Markenname „Rowenta“ entstand unter Berücksichtigung des Namens seines Firmengründers Robert Weintraud. Rowentas Produkthistorie begann mit Bügeleisen, Toastern, Kaffeemaschinen und Wasserkochern. Seit dem Jahr 1988 gehört die Marke Rowenta dem französischen Mutterkonzern Groupe SEB. Auf der Website von Rowenta liest sich die Historie optimistisch, zukunftsorientiert und innovativ. Allerdings endet dieser Optimismus in der firmeneigenen Timeline im Jahr 2014. Seither scheint nicht mehr viel Neues passiert zu sein. Jedenfalls wurde die Timeline bis heute nicht aktualisiert, und irgendwie passt das auch zu meinem Erlebnis. Denn der Staubsaugerroboter war definitiv nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Er erkannte weder Ecken und Kanten noch Objekte, wie Stuhlbeine oder andere Möbel und rempelte entsprechend immer wieder dagegen. Und seiner Aufgabe, das Reinigen der Böden kam der Staubsaugerroboter nur mangelhaft hinterher. Letztlich war ich besser bedient doch wieder den altbewährten Handstaubsauger zu verwenden. Der Mutterkonzern Groupe SEB schreibt über seine Tochtergesellschaft:
“A German specialist in steam and heat since 1909, Rowenta creates respectful solutions for home and personal care for the most demanding customers. Our elegant products strike an ideal balance between technology and comfort in use. Rowenta vacuum cleaners, steam generators and hairdryers boast exceptional performance and silence.”
Da hätte ich doch mal lieber früher einen Blick auf die Website geworfen. Von innovativ steht hier nichts, das muss man dem Konzern zugutehalten. Sie sind in ihrer Selbsteinschätzung immerhin ehrlich.
Surft man auf die Produktübersichtsseite der Rowenta-Saugroboter, erfährt man, dass das Unternehmen aktuell drei Modelle auf dem Markt vertreibt. Neben den Produktfeatures, die im Einzelnen erläutert werden, wirbt Rowenta mit einem Aspekt, der mich bei meiner Suche nach Innovation und der Frage, wie die sinnvolle Auseinandersetzung mit unserer Zeit aussehen kann, aufhorchen ließ. Hier malt Rowenta ein behagliches Bild mit der Überschrift: „Zeit für die schönen Dinge des Lebens“. Der nachfolgende Text lässt Gutes erhoffen:
„Einfach die Seele baumeln lassen und den Roboter die Arbeit machen lassen. Besitzen Sie so einen Staubsauger Roboter, dann haben Sie Zeit für die anderen, wichtigen Dinge im Leben. Der Saugroboter fährt allein durch Ihre Wohnung bzw. Ihr Haus und putzt strukturiert ihren Boden. Nun müssen Sie sich nur noch ums Fensterputzen und Möbelputzen sorgen.“
Zumindest in seinem Werbeversprechen trifft Rowenta den Ton der Zeit. Immer mehr Menschen wünschen sich, wieder Zeit für Dinge zu haben, die ihnen wichtig sind, und Technologie soll hier eine Schlüsselfunktion einnehmen.
Die Tatsache, dass ich einmal einen Staubsaugerroboter kaufen würde, hätte ich vor ein paar Jahren für unmöglich gehalten. Ebenso wie ich nicht gedacht hätte, einmal die Dienste einer Haushaltshilfe in Anspruch zu nehmen. Aber mit mehr Verantwortung im Beruf und den vielen Hobbys, die ich pflege, bleibt nicht mehr viel Zeit für ein ordentliches Zuhause. Und wer es, so wie ich, trotzdem gerne sauber hat, der greift gerne mal auf Hilfe zurück. Früher empfand ich diese Einstellung als dekadent – jeder kann doch wohl selbst dafür sorgen, seinen Haushalt in den Griff zu bekommen – und lehnte jedwede Art der Haushaltshilfe ab. Nachdem ich mich nach einigem Hin und Her dann aber dafür entschied, gewöhnte ich mich schnell an die neue Normalität. Umso härter traf es mich, als ich nach etwas mehr als einem Jahr erfuhr, dass meine Putzfrau in Rente gehen wolle und ich nun wieder allein mit den anfallenden Tätigkeiten konfrontiert war. Der Technologie unserer Zeit war ich jedoch schon immer sehr zugetan, und daher beschloss ich nach kurzer Abstimmung mit meinem Partner, dass ein Staubsaugerroboter das Mittel der Wahl ist.
So stehe ich also vor unserem Neuerwerb, dem ich unvermittelt den altertümlich anmutenden Namen „Garcon“ gab. Garcon sollte von nun an unser Leben erleichtern und vor allem die Böden staubfrei halten. Der Verkäufer, der beteuerte, er hätte das gleiche Modell ebenso zu Hause und sei hellauf begeistert, war derselbe, der auch das implizierte Kartografieren des Gerätes beschwor sowie Sauberkeit mit nur einem Knopfdruck versprach.
Leider gestaltet sich die ganze Geschichte nicht so einfach. Als ich Garcon einrichte, sehe ich, dass ich zur Benutzung des Gerätes erstmal eine App laden muss. So weit, so gut. Nach Einrichtung der App möchte ich den Staubsauger seine Magie vollführen lassen und den Boden abscannen lassen. Fehlanzeige. Diese Funktion existiert in dem über fünfhundert Euro teuren Gerät nicht. Da habe ich wohl das falsche Modell gekauft. Aber, so denke ich, vielleicht ist das Gerät mittlerweile einfach noch intelligenter und benötigt diese Einstellung gar nicht mehr, sondern schafft das quasi auf dem Weg des Reinigens implizit. Nachdem ich einige Mal versucht habe, mittels diverser Knöpfe Garcon davon zu überzeugen, dass die Wohnung nun gereinigt werden müsse, bewegt sich das Gerät erstaunlich leise über das Parkett. Ich bin begeistert – zumindest so lange, bis der Roboter das erste Mal mit lautem Krachen gegen eine Wand donnert. Oje, denke ich. Vermutlich muss er sich erst in die neue Umgebung einlesen.
Kurz darauf ertönt wieder ein lautes Krachen, ein weiteres und ein weiteres Mal. Der Roboter findet sich einfach nicht in unserer Wohnung zurecht. Ich stelle ihn in die Mitte eines nahezu leeren Raumes und versuche mein Glück da. Kreuz und quer düst das Gerät nun über den Boden – nur leider am Staub vorbei. Ich ertappe mich dabei, wie ich dem Gerät nachlaufe, um sicherzustellen, dass es auch wirklich den Staub entfernt. Hin und wieder muss ich den Roboter anheben, weil er es nicht über Unebenheiten schafft oder weil er wieder gegen eine Wand gefahren ist. Nach zwanzig Minuten verkündet mir das Gerät, es sei erschöpft und muss an die Ladestation. Erschöpft, ja das bin ich auch, denke ich und folge dem Gerät zurück zur Station, an der es sich final vergebens versucht richtig anzudocken. Der einzige Unterschied zwischen dem Staubsaugen mit einem herkömmlichen Staubsauger und dem Roboter ist der fehlende Griff, an dem man sich bei der Old-School-Variante wenigstens noch festhalten konnte. So hatte ich mir das nicht vorgestellt mit dem modernen Wunderwerk der Technik, das mir das Leben erleichtern sollte. Fünf Jahre nachdem Christoph Keese in seinem Buch über die Digitalisierung Bilanz gezogen hatte, sind wir in Sachen Roboter kein Stück weitergekommen. Irgendwie ernüchternd. Dabei sollen genau diese kleinen Helfer unseren Alltag erleichtern und es uns ermöglichen, mehr Zeit für andere Dinge zu haben.
Anders sieht die Sache bei amerikanischen oder chinesischen Produkten aus: Die Firma Irobot etwa liefert High-End-Geräte in Sachen technischer Haushaltshilfen, und roborock ist Marktführer im chinesischen Staubsaugerrobotermarkt.
Nach einigen leidvollen Anläufen habe ich resigniert und mich schweren Herzens von „Garcon“ getrennt und ihn in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Zu Hause saugt und wischt nun die chinesische Entwicklung von roborock, und das äußerst zuverlässig und präzise. Ein Hinweisschild auf dem Saugroboter macht beim Auspacken darauf aufmerksam, dass die „zu Reinigungszwecken gemachten Bildaufnahmen innerhalb der Wohnfläche“ alsbald wieder gelöscht werden. Zynische Stimmen würden jetzt behaupten, dass dies natürlich nicht der Fall ist und wir mithilfe unserer kleinen Haushaltshelfer von chinesischen Konzernen unter dem Deckmantel der Saugroboter ausspioniert werden. Jeder Saugroboter erstellt detaillierte Karten der Wohnflächen und weiß somit mehr über Sie als der Postbote. Nun, wie dem auch sei. Er saugt und wischt und macht somit genau das, was ich von ihm will. Es gibt Dinge, die sind einem manchmal völlig egal.
Aber weg von Haushaltsaufgaben hin zur Nahrungsaufnahme. Denn nicht viel besser sieht es aus, wenn wir vom heimischen Sofa aus unsere Pizza bestellen wollen. Durch die Pandemie hat sich unser Bestellverhalten massiv verändert und der gemächliche Wechsel vom stationären Handel zu E- Commerce-Angeboten beschleunigte sich rasant. Amazons Geschäft verdreifachte sich im dritten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahreswert, was der Aktie einen neuen Rekordwert bescherte. Die Einfachheit und die Zuverlässigkeit, die Amazons Service bietet, lässt den Kundenstamm weiterwachsen und die Geschäftszahlen in hellem Glanz erstrahlen.
Was Amazon kann, können Lieferdienste leider noch lange nicht: einen Rundum-Service bieten, der alle Schritte der Customer Journey berücksichtigt. Bei der Lieferando-App beispielsweise bestelle ich bequem meine Pizza bei meinem Lieblingsitaliener und bezahle online mit der Kreditkarte. Die Transaktion ist binnen kurzer Zeit abgeschlossen und ich kann mich auf mein Essen freuen – nur um im nächsten Schritt gefragt zu werden, wie viel Trinkgeld ich dem Fahrer geben möchte, nachdem meine Bestellung bereits abgeschlossen ist. So fordert mich die App im nächsten Schritt auf, meine Kreditkartendaten erneut einzugeben, damit ich dem Fahrer das verdiente Trinkgeld übermitteln kann. Das ist unbequem und daher eine schlechte Kundenerfahrung. Jetzt lässt sich argumentieren, dass die Bezahlvorgänge voneinander getrennt werden müssen, weil sie separat abgerechnet werden. Das interessiert den Kunden allerdings nicht. Das, was er möchte, ist eine nahtlose und einfache Nutzererfahrung und eine warme Pizza.
Fairerweise muss man festhalten, dass weder das Unternehmen Rowenta noch Lieferando deutsche Unternehmen sind. Rowenta liegt, wie erwähnt seit einigen Jahren in französischer Hand und vom deutschen Ursprung ist nicht mehr viel übriggeblieben. Der Lieferdienst Lieferando wurde zwar 2009 in Berlin gegründet, im Jahr 2014 jedoch an die niederländische Muttergesellschaft Takeaway.com, die ihren Sitz in Amsterdam hat, verkauft.
Dennoch zeigen diese zwei Beispiele, wie es um unser digitales Fortkommen im Land aktuell bestellt ist. Denn etwas Vergleichbares „made in Germany“ lässt sich leider nicht finden. Wir verwenden täglich Bestell-Apps und die Entwicklung von IoT-Systemen (Internet of Things) wird weitergehen. Nur dürfen wir dabei den eigentlichen Nutzen der Erfindungen nicht außer Acht lassen. Es geht schließlich darum, den Konsumenten Zeit zu sparen, und nicht, ihnen vermeintlich Zeit zu sparen, um sie dann am Ende wieder draufzurechnen. Diese Services sollen dafür entwickelt werden, uns das Leben zu erleichtern, damit wir uns anderen Aufgaben widmen können und uns Zeit sparen können. Allein wenn man bedenkt, wie viel Lebenszeit ein normaler Mensch damit verbringt, Staub zu saugen, andere mühselige Aufgaben im Haushalt zu erledigen oder einzukaufen! Diese verwendete Zeit bekommen wir nie wieder zurück – außer, wir schaffen es, uns als Cyborgs mehr Lebenszeit hinzuzuaddieren und der Physik in Sachen Zeit ein Schnippchen zu schlagen. Aber dazu mehr in den folgenden Kapiteln.
Ach du liebe Zeit!
Ich habe keine Zeit. Nie. Ich muss immer etwas erledigen und ein Termin jagt den nächsten. – Kommt Ihnen das bekannt vor? Womit verbringen Sie Ihre Zeit?
Mein Tag ist meistens vollgepackt mit allen möglichen Terminen. Neben meinem Job habe ich mit „eduloni“ 2020 eine gemeinnützige Firma gegründet, die sich dem Mentoring von Jugendlichen aus sozial schwächeren Umfeldern beschäftigt. Außerdem studiere ich nochmal, nehme Klavierunterricht, besuche einen Kurs in Elektronikentwicklung – und mir würde noch jede Menge einfallen, was ich aufzählen könnte. Ein Buch schreiben zum Beispiel. Aber worauf ich hinauswill, ist, dass es vermutlich sehr vielen Menschen genauso geht wie mir: Wir sind alle immer schwer beschäftigt oder zumindest busy. Und die meisten von uns haben sich das genauso ausgesucht.
Als ich in New York lebte, wies mich ein guter Freund einmal darauf hin, dass ich immer sagte, ich müsse xyz erledigen. Also: Ich habe keine Zeit, weil ich noch zum Supermarkt oder zu einem Termin in die Bank muss etc. Er machte mir klar, dass ich das nicht müsse, sondern mich bewusst dafür entscheiden würde, genau diese Dinge zu tun, und er forderte von mir, mich von nun an auch so auszudrücken. Zunächst fand ich diese Forderung ein wenig überzogen und ärgerte mich wegen seiner offensiven Art. Aber bei näherem Nachdenken wurde mir klar, dass er Recht damit hatte, wenn er sagte, ich solle keinen Grund vorschieben, wenn ich Dinge priorisiere. Denn es sind bewusste Entscheidungen, wie wir unsere Zeit einteilen und womit wir sie verbringen.
Von nun an seinem Rat folgend, entscheide ich mich nun bewusst, keine Zeit für bestimmte Dinge zu haben, und lebe weiterhin mit meinem vollen Terminplaner. Nur eben bewusster.
Haben Sie schon einmal die Benachrichtigungsfunktion Ihrer E-Mails abgeschaltet und nur noch in Ihren E-Mail-Client gesehen, wenn Sie wirklich Zeit und Muße dazu hatten? Probieren Sie es aus. Es ist ein überragendes Gefühl, wieder ein Stückchen Macht über die eigene Zeit zurückzuerobern. Aber das nur am Rande.
Weniger oft setzen wir uns aber gezielt mit dem Konzept von Zeit auseinander, denn was bedeutet es, Zeit zu haben? In dieser Zeit nichts zu tun oder in dieser Zeit bewusst etwas zu tun – und ist nichts tun wirklich möglich? Auch wenn ich mich entschließe, in einer bestimmten Zeit nichts zu tun, dann tue ich ja genau das: nichts.
Aber wir schweifen ab. Nähern wir uns einmal dem Wesen der Zeit. Dafür müssen wir herausfinden, was Zeit eigentlich ist. Im folgenden Kapitel machen wir einen Exkurs in zwei faszinierende Disziplinen: Unsere erste Station ist ein Ausflug in die Welt der Physik. Ganz rational und pragmatisch lässt sich die Zeit in Formeln packen und berechnen. Wir statten uns also mit den Grundlagen der Physik zum Thema Zeit aus, bevor wir in die zweite, nicht minder spannende Disziplin eintauchen. Jeder Pragmatismus dieser Welt tut gut daran, einen Gegenspieler zu haben oder – vielleicht etwas treffender – eine Ergänzung, um das Bild über das Wesen der Zeit zu komplettieren. Daher werden wir uns im Anschluss daran die philosophischen Ansätze der Zeit vor Augen führen. Für diesen Abschnitt des Buches lohnt es sich, wenn Sie sich Zeit nehmen und Ihre Gedanken schweifen lassen.
Das folgende Kapitel des Buches bereitet Sie, liebe Leser und Leserinnen, auf die folgenden Kapitel vor und lenkt, so hoffe ich, Ihren Blick auf das Wesentliche. Generell ist es empfehlenswert, immer mal wieder innezuhalten und das Gelesene mit dem eigenen Zeitverständnis und Zeitempfinden abzugleichen.
Kapitel 3
Die Zeit aus physikalischer Sicht
Was ist Zeit? Diese Frage mag auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen. Zeit ist für die meisten Menschen die Maßeinheit, die wir verwenden, um unserem Leben eine gewisse Struktur zu geben.
In der Physik zählt die Zeit zu den grundlegenden Größen: Zeit beschreibt eine Abfolge von Ereignissen und hat eine eindeutige und unumkehrbare Richtung. Sie läuft stetig und unaufhaltsam in eine Richtung ab: von der Vergangenheit, die wir erforschen können, in die Zukunft, die offen ist, von der Geburt zum Tod. Die Zeit definiert ein Vorher und ein Nachher. Wir teilen sie in Einheiten, die man genau messen kann: Stunden, Minuten, Sekunden.
Legte man früher fest, dass 24 Stunden, also ein Tag, einer Umdrehung der Erde um sich selbst entsprechen, bestimmt man Zeit heute viel exakter: Eine Sekunde entspricht 9.192.632.770 Perioden der Strahlung des Überganges zwischen den beiden Hyperfeinstruktur-Niveaus des Grundzustandes von Atomen des Elements Cäsium-133. Zeit wird als physikalische Größe definiert, deren allgemeines Formelzeichen „t“ lautet.
Seit dem Urknall ist die Zeit eine wichtige Größe für das Verständnis unserer Welt. Doch obwohl sie als einzigartiger Maßstab erscheint, ist sie seit Einsteins Relativitätstheorie „nur“ ein quasi gleichberechtigter Teil unseres physikalischen Modells zur Beschreibung des Universums. Nach Einsteins Theorie bildet die Zeit zusammen mit dem Raum eine vierdimensionale Raumzeit, in der die Zeit eine von vier gleichberechtigten Dimensionen ist. Wir betrachten dabei meistens nur eine der Größen und fokussieren uns entweder auf die Zeit oder den Raum. Es fällt uns schwer, den gewohnten Unterschied in der Wahrnehmung zwischen Raum und Zeit abzulegen und beides als Teil eines Ganzen zu verstehen.
Das Zusammenspiel von Raum und Zeit können wir anhand eines einfachen Beispiels erkennbar machen: Wenn Sie sich mit Ihrem Partner in der Stadt zum Essen verabreden möchten, dann bringt es Ihnen nichts, wenn Sie ihm nur mitteilen, wann Sie sich treffen wollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zufällig am selben Ort zur richtigen Zeit aufeinandertreffen, ist gering. Teilen Sie ihm hingegen Ort und Zeit mit, dann erfüllen Sie die Bedingungen für die Raumzeit, und dem gemeinsamen Essen steht nichts mehr im Weg. Die spezielle Relativitätstheorie formuliert das Verhalten von Raum und Zeit aus der Perspektive von Beobachtern, die sich relativ zueinander bewegen. Aufbauend darauf führt die allgemeine Relativitätstheorie die Gravitation auf eine Krümmung von Zeit und Raum zurück, die unterem anderem durch die beteiligten Massen verursacht wird. Raum- und Zeitangaben sind in der Relativitätstheorie keine allgemein geltenden Ordnungsstrukturen.
Eine zusätzlich irritierende Eigenschaft der Zeit wird ebenfalls mit der Relativitätstheorie beschrieben: Die Zeit läuft nicht an allen Orten gleich schnell. Je schneller sich ein System, zum Beispiel ein fliegender Satellit bewegt, umso langsamer vergeht dort die Zeit. Dieser Effekt lässt sich bereits in einem Flugzeug messen: Kommt man nach einem Rundflug wieder zu einer gleichzeitig messenden stationären Uhr zurück, wird man feststellen, dass die stationäre Uhr schon eine minimal spätere Zeit anzeigt; die Zeit im Flieger vergeht also langsamer. Das nächste Mal, wenn jemand zu Ihnen sagt, dass die Zeit wie im Flug vergehe, werden Sie skeptisch.
Alles ist relativ. Das gilt auch dann, wenn sich zwei voneinander unabhängige Objekte aufeinander zubewegen. Die Frage, wer von beiden die Situation präziser beschreibt, ist prinzipiell nicht zu beantworten und demnach sinnlos. In einfachen Worten ausgedrückt bedeutet das etwa: Ein Messwert gilt als absolut, wenn er für sich selbst steht, wie zum Beispiel: „Es hat achtzehn Grad Celsius.“ Ein Messwert gilt als relativ, wenn er mit einem anderen verglichen wird: „Es ist heute fünfzehn Grad wärmer als im Vorjahr zur selben Jahreszeit.“
Der Begriff der Gegenwart lässt sich dabei nur in einem einzigen Punkt definieren, während andere Punkte der Raumzeit, die weder in der Vergangenheit noch der Zukunft dieses Punktes liegen, als „raumartig getrennt“ von diesen Punkten bezeichnet werden. Während man sich raumartig problemlos voneinander getrennt vorwärts und rückwärts bewegen kann, kann man sich in der Zeit nicht vorwärts oder rückwärts bewegen. Die Zeit kennt eben nur eine Richtung.
Ist das unsere menschliche Grenze? Ich möchte näher auf die physikalische Definition von Zeit eingehen und erfahren, wie weit der Stand der Forschung ist. Allzu präsent im Kopf ist mir die Filmreihe Zurück in die Zukunft aus meiner Jugend. Etwas, was man sich erdenken kann, muss vielleicht doch nicht so weit weg von der Realität sein. Daher möchte ich den Physiker Prof. Dr. Thomas Filk, der am Physikalischen Institut der Universität in Freiburg Physik lehrt, fragen, wie es sich mit unserem physikalischen Verständnis von Zeit genau verhält, und rufe ihn an. Herr Filk ist ein intelligenter Mensch, der höflich genug ist, einen seinen Wissensvorsprung über die Physik nicht spüren zu lassen. Neben seiner Arbeit am Institut für Physik ist er seit vielen Jahren Mitglied der Parmenides Stiftung in Pullach bei München. Die Stiftung widmet sich der Forschung und der Lehre darüber, wie Menschen mit Komplexität umgehen und innovative Methoden und Tools nutzen, um das menschliche Gehirn bei der Bewältigung dieser Aufgabe zu unterstützen.
Die tiefe Stimme von Herrn Filk wirkt gleich beruhigend, und als er zu erzählen beginnt, räumt er gleich mit einer Fehlannahme auf:





























