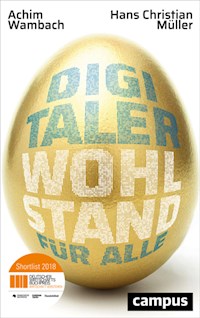
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Achim Wambach: Update für die Soziale Marktwirtschaft Daten statt Preise, Monopole statt Wettbewerb, Sharing statt Eigentum, Crowdworking statt Sozialpartnerschaft: Die Digitale Revolution stellt die Art und Weise des Wirtschaftens auf den Kopf. Die alten Leitplanken, mit denen die Soziale Marktwirtschaft die wohlstandsmehrenden Kräfte schützte, passen heute nicht mehr. Sie brauchen ein Update. Die Ökonomen Achim Wambach, Präsident des ZEW in Mannheim, und Hans Christian Müller, Redakteur beim Handelsblatt, zeigen, dass auch die Internetwirtschaft zum Wohle aller arbeiten kann, wenn man die nötigen Grenzen setzt. Wenn Wettbewerbs- und Sozialpolitik umdenken und ihr Instrumentarium schärfen, kann es auch morgen produktiven Wettbewerb und auskömmliche Arbeit für alle geben. Wambach ist überzeugt: Die Politik muss umschalten und die großen Internetkonzerne regulieren. Nominiert für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2018!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Achim WambachHans Christian Müller
DIGITALER WOHLSTAND FÜR ALLE
Ein Update der Sozialen Marktwirtschaft ist möglich
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Daten statt Preise, Monopole statt Wettbewerb, Sharing statt Eigentum, Crowdworking statt Sozialpartnerschaft: Die Digitale Revolution stellt die Art und Weise des Wirtschaftens auf den Kopf. Die alten Leitplanken, mit denen die Soziale Marktwirtschaft die wohlstandsmehrenden Kräfte schützte, passen heute nicht mehr. Sie brauchen ein Update.
Die Ökonomen Achim Wambach, Präsident des ZEW in Mannheim, und Hans Christian Müller, Redakteur beim Handelsblatt, zeigen, dass auch die Internetwirtschaft zum Wohle aller arbeiten kann, wenn man die nötigen Grenzen setzt. Wenn Wettbewerbs- und Sozialpolitik umdenken und ihr Instrumentarium schärfen, kann es auch morgen produktiven Wettbewerb und auskömmliche Arbeit für alle geben.
Wambach ist überzeugt: Die Politik muss umschalten und die großen Internetkonzerne regulieren.
Vita
Achim Wambach ist Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und Vorsitzender der Monopolkommission. Laut FAZ-Ökonomenranking gehört er zu den einflussreichsten Ökonomen in Deutschland. Die Monopolkommission hat in ihren Gutachten regelmäßig auf die Defizite in der Wettbewerbspolitik im digitalen Zeitalter aufmerksam gemacht.
Hans Christian Müller hat an der Kölner Journalistenschule gelernt, Volkswirtschaftslehre in Köln studiert und in Düsseldorf im Fach Wettbewerbsökonomie promoviert. Er arbeitet als Datenjournalist beim Handelsblatt.
Inhalt
Vorwort
1. Ludwig Erhards Politik passt nicht mehr, seine Ideen schon
Die Digitalisierung verändert – fast – alles
Auf den Märkten von heute gelten andere Regeln als früher
Die Soziale Marktwirtschaft muss neu aufgestellt werden
2. Die Großen Fünf der Internetwirtschaft und der Abschied vom Wettbewerb
Die enorme Machtfülle der Netzgiganten
Monopole entstehen im Internet schneller
Wenn wohlstandsmehrende Kräfte den destruktiven weichen
Die Wettbewerbshüter müssen den Konkurrenzkampf beleben
3. Gute Daten, schlechte Daten – die Herausforderungen der Datenökonomie
Im Netz gibt es vieles umsonst – aber nur gegen Informationen
Daten sind zum entscheidenden Produktionsmittel geworden
Mehr Daten bedeuten oft mehr Monopole
Ohne Vertrauen in den Datenschutz wird der Wandel kein Erfolg
Daten, auf die wir besser verzichten sollten
4. Von Robotern, Clickworkern und der drohenden Spaltung des Arbeitsmarktes
Die unnötige Angst vor dem Ende der Arbeit
Gewinner und Verlierer auf dem Arbeitsmarkt
Dem Strukturwandel die Härten nehmen
Eine neue Bildungsoffensive muss her
5. Wenn neue Geschäftsmodelle alte Märkte aufmischen
Teilen ist das neue Besitzen
Branchen im digitalen Umbruch
Ein passender Anlass, um Märkte anders zu regulieren
Ohne gute Infrastruktur kein digitaler Erfolg
6. Warum Wohlstand für alle auch in der Internetepoche möglich ist
Wenn Erhard auf Zuckerberg träfe
Wie es weitergehen könnte
Danksagung
Literaturempfehlungen
Register
Vorwort
Kann das funktionieren, wenn ein Wissenschaftler und ein Journalist zusammenarbeiten – und gemeinsam ein Buch schreiben? Immerhin unterscheidet sich die grundsätzliche Herangehensweise fundamental. Die große Angst eines Forschers ist es, unpräzise zu arbeiten und Einschätzungen ohne wissenschaftliche Fundierung abzugeben. Bevor er sich zu einem Thema äußert, liest er am liebsten die gesamte Forschungsliteratur durch und stellt vielleicht schnell noch ein paar eigene Berechnungen an. Seine Zielgruppe sind die Fachkollegen. Ihr Respekt ist das, was zählt. Ein Journalist dagegen lebt mit der ständigen Angst, er könnte seine Leser langweilen. Das Mittel der Wahl sind klare, schlichte Thesen, locker in der Sprache. Aussagen müssen sich gut zu Ende argumentieren lassen, doch sie brauchen kein Zwar und Aber, sondern Eindeutigkeit. Ein Journalist möchte möglichst viele Leser erreichen und niemanden beim Lesen vergraulen.
Wir haben bei diesem Buch versucht, das Beste beider Ansätze zu verbinden. Wissenschaft muss verständlich sein, sonst hat sie keine Wirkung. Journalismus muss redlich und fundiert sein, sonst hat er die falsche Wirkung. Unser Ziel war es, verständlich zu schreiben und untermauerte Thesen zu entwickeln. Dabei wollten wir nicht nur analysieren und bewerten, sondern auch klare Handlungsempfehlungen geben.
Ob uns all das gut gelungen ist, müssen andere beurteilen. Wir hoffen es.
Achim Wambach, Hans Christian Müller,
im Sommer 2018
1. Ludwig Erhards Politik passt nicht mehr, seine Ideen schon
Die Digitalisierung verändert – fast – alles
Können Sie sich noch erinnern, welche Handy-App während der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland am meisten benutzt wurde? Nein? Kein Wunder, denn die ersten Apps für den Massenmarkt kamen erst 2007 auf den Markt, mit den ersten iPhones von Apple. Bei der WM gab es zwar schon Handys mit mobilem Internet, aber praktisch noch keine Apps. Kein WhatsApp, kein Amazon Prime, kein Car2go.
In allerkürzester Zeit haben Apps das Leben verändert – das der Menschen und das der Wirtschaft. Heute sind sie nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag. Anders als zur Jahrtausendwende, als man nur online war, wenn man vor dem PC oder Laptop saß, ist man es heute im Zeitalter der Smartphones ständig. Denken Sie einmal darüber nach: Wie gut ertragen Sie noch eine Zeit im Funkloch? Nicht mehr allzu gut, oder? Es könnte ja jemand eine Nachricht geschrieben haben, es könnte ja etwas passiert sein in der Welt!
Die Apps auf unseren Smartphones sind nur ein Beispiel dafür, mit welcher Wucht die Digitalisierung alles verändert. Es ist eine Revolution. In der Vergangenheit betrafen technologische Umbrüche wie etwa die Einführung der Dampfmaschine oder des Elektromotors nur einzelne Bereiche der Wirtschaft. Heute dagegen erleben wir eine allumfassende Revolution.
Es gibt praktisch keinen Lebensbereich, der nicht vom Wandel erfasst wird, kaum Arbeitsplätze, die noch ohne Unterstützung von Computern auskommen. In modernen Häusern lassen sich Haushaltsgeräte und Heizkörper schon aus der Ferne steuern. Die Industrie kann ihre Maschinen weltweit miteinander verbinden und aufeinander abgestimmt arbeiten lassen. Der Handel wandert immer mehr ins Internet ab, Bestellungen sind in Sekundenschnelle möglich und werden manchmal noch am selben Tag ausgeliefert. Moderne Algorithmen protokollieren vieles von dem, was die Menschen tun – im Netz, aber auch anderswo –, werten es aus und nutzen die Daten dann für Werbung und neue Produkte. Autos können bald alleine fahren. Kleine Armbänder überwachen die Gesundheit und Vitalfunktionen der Menschen im Alltag. Die Blockchain-Technologie steht in den Startlöchern – und könnte dafür sorgen, dass es bald keine offiziellen Instanzen mehr geben muss, die Verträge beglaubigen oder Zahlungen abwickeln.
Längst hat der Übergang zu einer neuen Generation von intelligenten Maschinen und Computern begonnen. Ihnen wird nicht mehr einprogrammiert, was sie in dieser oder jener Situation tun sollen, sondern sie werden darauf getrimmt, selber zu lernen. Aus der Betrachtung von Ergebnissen ziehen sie eigene Schlüsse – und handeln dann danach. Systeme mit künstlicher Intelligenz können Sprache verstehen lernen und Gesichter erkennen, Lippen lesen, Texte übersetzen, eigene journalistische oder sogar juristische Texte formulieren, Spam-Mails aus unserem Posteingang fischen und in gigantischen Kolonnen von medizinischen Werten Hinweise auf Krankheiten erkennen. Und noch vieles mehr.
Grundlage der meisten neuen Technologien sind Daten. Immer größere Mengen davon werden erhoben und gespeichert, immer besser werden sie geordnet und ausgewertet. Das bringt ganz neue Erkenntnisse für die Wissenschaft und ganz neue Produkte für die Wirtschaft. Über die technologischen Neuerungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, wurde schon viel geschrieben. Auch über einzelne Aspekte, wie etwa die Rolle der Daten und die Probleme des Datenschutzes. Doch was bedeutet die Digitalisierung für die einzelnen Märkte? Für die einzelnen Branchen und für das gesamte Wirtschafts- und Wohlstandsmodell, also die Soziale Marktwirtschaft? Hier klaffte bislang eine Lücke – die wir mit diesem Buch schließen wollen.
Die Digitalisierung besitzt ein riesiges Potenzial, unseren Wohlstand weiter zu mehren. Sie schafft neue Produkte, bessere Produkte, und sie kann unser Leben einfacher machen. Doch ob diese möglichen Wohlstandsgewinne auch tatsächlich gehoben werden können, das ist noch offen. Denn dafür braucht es ein Wirtschaftsmodell, das mit seinen Mechanismen und mit seiner Marktordnung die nötigen Voraussetzungen schafft. Und das dafür sorgt, dass die Vorteile auch allen zugutekommen und nicht nur einigen wenigen. Kurz gesagt: Der marktwirtschaftliche Unterbau muss zur neuen Technologie passen.
Kann der Wettbewerb auch im digitalen Zeitalter die entscheidende Kraft sein, durch die Innovationen entstehen, Anstrengungen belohnt werden und letztlich alle eine Chance bekommen? Kann verhindert werden, dass die Computerisierung den Arbeitsmarkt spaltet in Gewinner und Verlierer – in jene, die von den Veränderungen profitieren, weil sie über knapp gewordene Qualifikationen verfügen, und jene, deren Fähigkeiten von der modernen Wirtschaft nicht mehr in dem Maße gebraucht werden? Kann der Wandel, der viele Branchen erfasst hat, so gelenkt werden, dass er nicht blindwütig bestehende Strukturen zerstört? Kann die Nutzung der Daten so geregelt werden, dass die Potenziale zur Geltung kommen, gleichzeitig aber die Sicherheit gewährleistet ist und negative Auswirkungen auf die Gesellschaft vermieden werden?
Aus heutiger Sicht müssen wir sagen: All das könnte misslingen. Auf den Märkten für neue Internetdienstleistungen breiten sich Monopole aus, der Arbeitsmarkt zeigt Tendenzen einer Polarisierung, und die Datennutzung wirkt allzu anarchisch. Es besteht also die Gefahr, dass das, was die Soziale Marktwirtschaft ausgezeichnet und zum Ideal einer guten Wirtschaftsordnung gemacht hat, nicht in die neue Zeit herübergerettet wird. Das aber würde das Vertrauen in dieses Wirtschaftsmodell schädigen. Schon jetzt haben viele Menschen zu zweifeln begonnen: Nicht nur die Globalisierung, auch die Digitalisierung löst massive Sorgen aus. Sorgen, die ein Grund dafür sind, warum Parteien und Kandidaten mit der Verbreitung von Ängsten und vermeintlich leichten Antworten darauf plötzlich so viele Anhänger gewinnen können.
Aber es ist ebenfalls möglich – und aus unserer Sicht auch wahrscheinlich –, dass wir die Herausforderungen der Digitalisierung meistern werden. Das gelingt, wenn die Regeln der Märkte angepasst werden an die neue Zeit. Wenn die destruktiven Kräfte des technologischen Wandels gebremst werden – und gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass sich die wohlstandsmehrenden gut entfalten können. Dann kann neues Vertrauen entstehen.
Womit wir bei Ludwig Erhard wären: Der erste Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland – der dieses Amt während der gesamten Kanzlerschaft Konrad Adenauers innehatte und später auch kurz selber Bundeskanzler war – hatte damals gemeinsam mit anderen das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft aus der Taufe gehoben. Demnach soll der Staat auf der einen Seite, wo immer möglich, darauf verzichten, in die Wirtschaft einzugreifen – etwa indem er festlegt, wer was zu welchen Preisen und in welchen Mengen herstellt und anbietet. Erhard vertraute darauf, dass freie Märkte am besten in der Lage sind, die Dynamik zu erzeugen, die die Wirtschaft vorantreibt. Auf der anderen Seite wusste er aber auch, wie viel Unsinn eine Marktwirtschaft anrichten kann, wenn sie ungeordnet bleibt. Leitplanken mussten also her, die die Marktkräfte in die richtige Bahn lenken.
Dazu zählte Erhard vor allem die Wettbewerbspolitik: Sie verhindert – oder besser gesagt sie soll verhindern –, dass Unternehmen Kartelle bilden, um gemeinsam die Kunden auszunehmen. Und dass mächtige Unternehmen ihre Vormachtstellung ausnutzen, weil sie nicht fürchten müssen, dass ihnen das Geschäft wegbricht, wenn sie die Bedingungen verschärfen oder die Preise erhöhen. Zur Ordnungspolitik sind aber auch weitere Felder zu zählen: die Sozialpolitik, die Bildungspolitik und das, was man am besten unter den Begriff Strukturanpassungspolitik fassen kann.
Diese Grundidee ist auch heute noch richtig. Nur die einzelnen Maßnahmen, die dafür nötig sind, die sind heute anders, weil auch die Märkte heute anders sind. Sie folgen anderen Mechanismen und anderen Moden – und es wirken ganz andere Kräfteverhältnisse. Die Ordnungspolitik, wie sie Ludwig Erhard skizziert hat – sie braucht also ein Update. Genau darum geht es uns hier. Der Grundtenor des Buches ist dabei positiv und optimistisch. Wir sind überzeugt: Die Digitalisierung ist eine große Chance!
Es stimmt, die makroökonomischen Daten lassen bisher noch keinen nennenswerten, flächendeckenden Schubeffekt erkennen, der auf diese neue technologische Welle zurückzuführen wäre. Die Produktivität – also die Wertschöpfung pro geleistete Arbeitsstunde – entwickelt sich zurzeit nur flach in der westlichen Welt. Hätte man nicht erwarten können, dass es gerade hier eine zusätzliche Dynamik gibt, wenn sich eine neue Technologie etabliert, die die Prozesse der Wirtschaft beschleunigt?
Ja und nein. Einerseits werden viele positive Effekte der Digitalisierung von der Statistik nur schlecht erfasst: Schließlich gibt es zahlreiche neue Produkte mittlerweile kostenlos. Fotos zu machen, kostet heute nichts mehr, Telefonieren praktisch auch nichts mehr. Das ist zweifellos ein Zuwachs an Wohlstand. Doch wenn Statistiker die Wirtschaftsleistung aufaddieren, zählen sie eben nur, was produziert und verkauft wurde. Zum anderen stehen wir noch ganz am Anfang dieser technologischen Welle. In vielen Branchen wurde erst ein kleiner Teil dessen umgesetzt, was möglich ist.
Sicherlich fehlt der neuen Zeit aber auch noch die passende Ordnungspolitik, die die Kräfte richtig kanalisiert. Wir liefern in diesem Buch Vorschläge, wie das gelingen kann. Dabei werden wir ins Detail gehen und viele einzelne Märkte betrachten. Das mag wie Stückwerk wirken, doch dieser Vorwurf würde zu kurz greifen. Die Digitalisierung ist eine Revolution. Die Wirtschaftsordnung braucht eher eine Reform. Die Grundidee Ludwig Erhards ist immer noch die richtige. Die Soziale Marktwirtschaft ist noch immer das passende Ideal einer wirtschaftlichen Ordnung. Nur der Inhalt muss angepasst werden. Zusammengenommen kann aus den einzelnen Ideen vielleicht eine Blaupause entstehen für das Update, das nötig ist.
Wohlstand für alle nannte Erhard sein maßgebliches Werk vor mehr als 60 Jahren. Und die Soziale Marktwirtschaft hat geliefert. Heute geht es uns um ein Vielfaches besser als damals. Der monatliche Bruttolohn eines durchschnittlichen deutschen Arbeitnehmers ist heute zweieinhalbmal höher als 1960 – die Teuerung der Verbraucherpreise ist dabei bereits herausgerechnet.
Gab man damals im Schnitt 38 Prozent seines Einkommens für Lebensmittel aus, so sind es mittlerweile nur noch 14 Prozent. Heutzutage muss ein durchschnittlicher Arbeitnehmer 10 Minuten arbeiten, um sich ein Brot kaufen zu können. 1960 waren es noch 19 Minuten. Für ein Paket Kaffee reichen heute 20 Minuten – statt 3,5 Stunden damals. Und um sich eine Waschmaschine zu verdienen, genügen 23 Stunden Arbeit – zehnmal weniger als 1960.
Auch wenn natürlich nicht immer alles glatt lief, hat uns die Soziale Marktwirtschaft doch sehr gut bis hierhin gebracht. Jetzt aber liegt die Aufgabe darin, diese wohlstandsmehrende Wirtschaftsform auf das Internetzeitalter zu übertragen. Wir möchten Erhards Ideen für die neue Zeit adaptieren. Darum geht es: um digitalen Wohlstand für alle.
Auf den Märkten von heute gelten andere Regeln als früher
Als Ludwig Erhard 1957 mit Wohlstand für alle sein maßgebliches Werk zur Sozialen Marktwirtschaft veröffentlichte, da funktionierte das Leben noch etwas anders als heute.
Wer neue Kleidung brauchte, ging zum Damen- oder Herrenausstatter. Was dieser an Ware dahatte, das war das, aus dem man auswählte. Was gerade nicht da war, war gerade nicht da. Das hatte man zu akzeptieren. Und wer wissen wollte, ob ein Kleidungsstück woanders billiger zu haben war, der musste gleich mehrere Läden abklappern.
Wer jemandem etwas mitteilen wollte, der konnte ihn anrufen oder ihn einfach besuchen. Beides setzte voraus, dass der andere gerade zu Hause war. Telefon besaß noch lange nicht jeder, die Apparate waren damals noch schwarz oder beige-grau, später auch grün oder orange, aber natürlich immer mit Schnur. War der Gesuchte gerade unterwegs, so musste man ihn dort abpassen, wo man ihn vermutete. Oder man schrieb einen Brief und schickte ihn mit der Post. Wer mehreren Leuten dasselbe mitteilen wollte, der musste alle einzeln treffen. Oder allen denselben Brief schicken. Oder eine Telefonkette organisieren.
Wer jemandem ein paar Fotos zeigen wollte, der musste sie ihm mitbringen oder per Post schicken. Das dauerte dann mindestens ein bis zwei Tage – zusätzlich zu denen, die die Entwicklung der Fotos in Anspruch genommen hatte. Wer eine Zugfahrkarte brauchte, der ging zum Bahnhof und stellte sich in die Schlange am Schalter. Brauchte man zusätzlich noch eine Auskunft über eine Verbindung, dann blätterte der Bahnbeamte am Schalter in seinem Kursbuch herum und schrieb einem eine auf den Zettel.
Wer Informationen brauchte – über einen Fluss vielleicht oder über ein Land –, der schaute in sein Lexikon. Oder er ging in eine Bibliothek und schaute dort in eines. Wer eine Route für eine Autofahrt brauchte, schlug eine Landkarte auf und versuchte, dort den kürzesten Weg zu ergründen. Ein Lineal konnte dabei sehr hilfreich sein. Wer wissen wollte, ob das Restaurant am Marktplatz etwas taugte, der musste sich bei Freunden und Bekannten umhören. Oder es einfach ausprobieren.
Wer wissen wollte, wie das Wetter am nächsten Tag wird, der schaute in die Zeitung. Oder einfach in den Himmel. Wer ein bestimmtes Lied hören wollte, musste sich die entsprechende Platte im Laden kaufen. Oder darauf hoffen, dass es irgendwann zufällig einmal gespielt würde in einem der regionalen Radiosender, die man zu Hause empfangen konnte.
Nehmen Sie ruhig einmal Ihr Smartphone zur Hand, schauen Sie Ihre Apps durch und überlegen Sie sich, wie viel Aufwand man früher hätte betreiben müssen, um diese oder jene Leistung zu bekommen. Vieles, was heute nur ein paar Klicks kostet, hätte einen halben Tag gedauert. Mindestens.
Und vieles hätte es überhaupt nicht gegeben, zumindest nicht als Massenmarktprodukt. Dass jemand einem Fremden im Tausch gegen ein paar Mark seine Privatwohnung überlässt zum Beispiel – so wie es heute bei Airbnb gemacht wird. Oder dass jemand einem Fremden sein Auto leiht, so wie heute bei Drivy und anderen Anbietern. Oder dass man als Privatmensch Dinge versteigert. Oder Urlaubserfahrungen niederschreibt und in ein Verzeichnis aufnehmen lässt. Texte von einer Maschine übersetzen lässt. Den eigenen Herzschlag überwachen lässt. Spiele spielt mit Spielpartnern, die auf der anderen Seite der Welt sitzen.
Von unserer Warte des frühen 21. Jahrhunderts aus betrachtet erscheint die Wirtschafts- und Konsumwelt der Erhard-Zeit ungeheuer träge und gemächlich. Doch das war sie nicht. Die 1950er und frühen 1960er Jahre waren geprägt von einer großen wirtschaftlichen Dynamik. Deutschland stieg wieder zum Industrieland auf, der Massenautobau begann, der Massentourismus ebenso. Die alten Industrien – Kohle und Stahl vor allem – bekamen zwar erste Probleme, kurz nachdem sie sich von den Kriegsschäden erholt hatten. Aber neue Sektoren kamen hinzu, wie etwa die Kunststoffindustrie. Die Konsumgüterhersteller wussten, wie man den Menschen neue Dinge schmackhaft macht, der Handel wusste, wie man sie zu den Menschen bringt. Das Wirtschaftswachstum war immens, Arbeitslosigkeit gab es praktisch keine mehr.
So piefig, autoritär und geschichtsvergessen die Politik in gesellschaftlicher Hinsicht sein mochte, so wagemutig war sie in wirtschaftlicher. Natürlich ist es nie die Wirtschaftspolitik alleine, die eine Ökonomie zum Boomen bringt, sondern immer in erster Linie die Innovationsfähigkeit der Unternehmen und der Aufstiegsdrang der Menschen. Aber dennoch kann die Politik helfen, indem sie Gutes anschiebt und Schlechtes verhindert.
Begünstigt wurde der wirtschaftliche Aufstieg der Nachkriegsjahre durch eine stringente Wirtschaftspolitik, die klaren Prinzipien folgte. Anders, als es heute oft der Fall ist, hatten die Vordenker damals eine klar formulierte ökonomische Strategie, die sie umsetzen wollten. Wobei »klar formuliert« bei Ludwig Erhard relativ ist: Wohlstand für alle ist ein über weite Strecken schwer verdauliches Buch geblieben. Auch wenn Wirtschaftsjournalisten es gerne behaupten: Man muss es nicht unbedingt gelesen haben.
Gemeinsam mit dem Ökonomen Alfred Müller-Armack, der erst die Grundsatzabteilung des Wirtschaftsministeriums leitete und später Staatssekretär wurde, entwarf Erhard die Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft. Ein Konzept, das immer zweierlei war: Einerseits die nüchterne Beschreibung einer Wirtschaftspolitik. Andererseits ein emotional aufgeladener Begriff – ein Versprechen, dass es jeder zu Wohlstand bringen kann, dass aber auch jeder aufgefangen wird, wenn er fällt.
Die Wirtschaftspolitik der Sozialen Marktwirtschaft folgte auf der einen Seite dem Prinzip, dass die Marktkräfte so lange möglichst frei wirken sollen, wie sie positiv wirken, also wohlstandsmehrend sind. Dazu gehörte, dass der Staat erst einmal niemandem reinredete im Wirtschaftsalltag. Gleichzeitig verlangte er Eigenverantwortung von den Wirtschaftsakteuren. Wer etwas tat, der haftete auch für etwaige Schäden. Hinzu kam das Bemühen um eine möglichst große Verlässlichkeit der Politik: Alle Akteure sollten im Vorhinein abschätzen können, wie der Staat wohl handeln würde.
Damit setzte sich die Wirtschaftspolitik von dem ab, was es in den Jahrzehnten zuvor gegeben hatte, als staatliche Preispolitik und aktive Industriepolitik üblich waren. Und man setzte sich auch durch gegen all jene Kräfte in den Volksparteien, die nach dem Crash der frühen 1930er Jahre und der Terrorherrschaft der Nationalsozialisten eine mehr oder minder ausgeprägte Planwirtschaft befürworteten. Erhard und seine Mitstreiter setzten lieber auf die Marktkräfte. Freier und intensiver Wettbewerb sollte das Versprechen einlösen, das Marktwirtschaften laut ökonomischer Theorie eben geben: Dass es – zumindest meistens – allen nützt, wenn alle eigennützig handeln.
Doch die Soziale Marktwirtschaft war immer ein Mittelweg zwischen den ökonomischen Extremen. Denn genauso wie man sich von der Planwirtschaft absetzte, setzte man sich auch vom Laissez-faire-Liberalismus ab – also einer weitgehend unregulierten Wirtschaft, wie sie in Großbritannien zur Zeit der Industrialisierung vorherrschte. Die Schöpfer der Sozialen Marktwirtschaft wussten, dass auf freien Märkten eben nicht nur gute Kräfte wirken, sondern auch destruktive. Kräfte, die nur der Staat bändigen kann – mit klaren Regeln. Erhard und seine Mitstreiter waren der Meinung, dass Märkte eine Ordnung brauchen, um Verwerfungen zu verhindern – Leitplanken sozusagen.
Deshalb schufen sie Korrekturmechanismen: Dazu gehörte auf der einen Seite eine ambitionierte Sozialpolitik. Man setzte auf staatliche Umverteilungspolitik, auf gut ausgestattete Sozialversicherungen und auf kollektive Lohnabschlüsse. So wurde 1957 die heutige gesetzliche Rentenversicherung geschaffen, die die Altersbezüge an die Lohnentwicklung koppelte – und diese im Vergleich zu den frühen Nachkriegsjahren stark anhob. Für die Lohnpolitik etablierte sich der Begriff Sozialpartnerschaft: Das Ringen um die künftigen Einkommen der Arbeitnehmer wurde institutionalisiert, um ungeordnete Arbeitskämpfe zu vermeiden. Im Wissen darum, dass man voneinander abhängig war, war das Zusammenwirken von Arbeitgebern und Gewerkschaften eher eine Kooperation als eine Konfrontation. All das führte dazu, dass das neue Wirtschaftsmodell zum Nachnamen »Marktwirtschaft« noch den Vornamen »sozial« bekam.
Allerdings stand Erhard selbst diesen sozialpolitischen Ansätzen ungleich kritischer gegenüber als Müller-Armack, der einen deutlich pragmatischeren Weg verfolgte. In Wohlstand für alle kommen die Gewerkschaften jedenfalls nicht wirklich gut weg. Erhard vertrat eher eine Ansicht, die in den 1980er Jahren als Trickle-down-Theorie bekannt wurde – nämlich, dass schon von selber genug für alle »heruntertropfen« würde von dem Wohlstand, den eine freie Marktordnung schafft. Müller-Armack dagegen war der Meinung, dass man den Ertrag schon etwas aktiver umverteilen müsse, damit alle etwas davon haben. Vereinfachend lässt sich sagen: Müller-Armack wollte eine Ordnung für die Märkte und eine aktive Sozialpolitik, Erhard hätte die Ordnung gereicht.
Auf der anderen Seite sah Erhards Konzept eine harte und strikte Wettbewerbspolitik vor, die Monopole und Kartelle bekämpfen und so für einen möglichst stabilen und fairen Wettbewerb sorgen sollte. Dass er die Arbeitgeber hier nicht immer auf seiner Seite hatte, war Erhard nur zu gut bewusst. Wer mit seinem Unternehmen Erfolg haben will, für den sind strenge Wettbewerbshüter ja vor allem lästig – zumindest, wenn man gerne Wettbewerber aufkaufen oder Absprachen mit ihnen treffen will, um die eigene Position zu stärken. Dieser Interessenkonflikt zwischen Wirtschaftsakteuren und Wirtschaftsministern ist systemimmanent: Erstere sorgen sich um den betriebswirtschaftlichen Erfolg, letztere um den volkswirtschaftlichen.
Der Gedanke, dass Wettbewerb und Konkurrenzkampf etwas Gutes sind – gut vor allem für eine Ökonomie als Ganzes –, ist vielen bis heute fremd. Warum nur sollen sich alle immerzu ihre Kunden abspenstig machen und sich gegenseitig bei den Preisen unterbieten? Warum können nicht alle im Einklang miteinander produzieren und verkaufen? Und bringt es nicht mehr Wohlstand, wenn man aufeinander Rücksicht nimmt?
Wie sehr die Volkswirtschaft den Wettbewerb braucht, lässt sich am besten am Beispiel von Monopol und Kartell erläutern: Da Monopolisten keine Konkurrenz fürchten müssen, haben sie wenig Anreize, an der Qualität ihrer Produkte zu arbeiten. Es kommt ja keiner, der etwas Besseres auf den Markt bringt und ihnen die Kunden wegnimmt. Gleichzeitig können die Monopolisten einen hohen Preis verlangen, da ihr Produkt oder ihre Dienstleistung quasi alternativlos ist. Die Folge: Die Qualität ist niedriger, der Preis höher und die verkaufte Menge kleiner als bei funktionierendem Wettbewerb. Den Schaden haben die Kunden: Entweder, weil sie sich das gewünschte Produkt nicht kaufen können – oder weil sie zu viel dafür zahlen.
Ein wettbewerbsfreier Markt führt also nicht zum optimalen Marktergebnis: Die Preise sind zu hoch, die Innovationskraft lahmt, die Qualität ist zu niedrig, die Produktion auch und somit ebenso die Nachfrage nach Arbeitskraft. Das schwächt eine Volkswirtschaft insgesamt.
Das Gleiche gilt bei Kartellen: Wenn Konkurrenten vereinbaren, sich keine Konkurrenz mehr zu machen, wenn sie also nicht mehr versuchen, sich gegenseitig durch bessere Qualität oder niedrigere Preise Kunden abzuluchsen, dann agieren sie quasi wie ein großer Monopolist. Zusammen streichen sie jene üppigen Margen ein, die ein Monopolist erzielen würde – und teilen sie untereinander auf. Für die Firmen ist das lukrativ. Für die Kunden aber – und damit für die Ökonomie – ist das schlecht. Das Schöne am freien Wettbewerb – dass nämlich niemand weiß, wer wann eine Preisoffensive startet oder ein neues Produkt auf den Markt bringt –, das fehlt auf Märkten, die von Kartellen beherrscht werden.
Erhard und seine Mitstreiter hatten es damals nicht leicht, ihre harte Anti-Kartell-Politik mit dem Ziel eines möglichst vollständigen und möglichst freien Wettbewerbs durchzusetzen. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), das die Wettbewerbspolitik Deutschlands begründet, war vor seiner Einführung äußerst umstritten. In den Jahrzehnten zuvor hatte man in Kartellen sogar noch etwas Gutes gesehen: Im Kaiserreich galt Deutschland als Land der Kartelle, auch in der Weimarer Republik waren sie noch legal. Die Nationalsozialisten führten 1933 gar ein Zwangskartellgesetz ein, um die Wirtschaft besser dirigieren zu können.
In Wohlstand für alle beschreibt Erhard ausführlich, wie zäh sein Kampf für ein Anti-Kartell-Gesetz war. Am Ende setzte er sich durch, das GWB gilt heute als Grundgesetz der Sozialen Marktwirtschaft. Seit nunmehr sechs Jahrzehnten wachen die Wettbewerbshüter im Bundeskartellamt darüber, dass der Konkurrenzkampf auf den Märkten nicht erlahmt. In Brüssel gibt es darüber hinaus die Generalkommission Wettbewerb der EU-Kommission – sozusagen das Kartellamt Europas –, das die großen internationalen Fälle bearbeitet.
Die Wettbewerbshüter haben im Wesentlichen drei Tätigkeitsbereiche. Da ist zum einen die Fusionskontrolle: Wenn sich zwei Unternehmen zusammenschließen wollen oder eines das andere aufkaufen will, dann prüfen die Behörden, ob dadurch der Wettbewerb eingeschränkt würde oder nicht – also ob die verbleibenden Konkurrenten nach der Fusion noch in der Lage wären, dem neuen Großkonzern Paroli zu bieten. Wenn sich das andeutet, wird die Fusion erlaubt. Wenn nicht, wird sie verboten.
Die beiden anderen Tätigkeitsfelder sind die Missbrauchsaufsicht und die Fahndung nach Kartellen. Wenn das Kartellamt aufdeckt, dass sich auf einem Markt zwei oder mehr Konkurrenten illegalerweise abgesprochen haben – etwa wer welche Region bedient, wer welche Preise verlangt oder wer welche Produktneuheiten einführt –, dann kann es eine Strafe verhängen und Geschäftspraktiken verbieten. Ebenso wenn es zu dem Schluss kommt, dass ein mächtiges Unternehmen seine Macht missbraucht hat.
Denn genau darum geht es bei der Missbrauchsaufsicht: Dass ein Unternehmen Monopolist ist – oder auch der maßgebliche Akteur in einem Oligopol aus wenigen starken Konkurrenten –, ist alleine noch kein Grund für die Wettbewerbshüter, tätig zu werden. Wenn ein Unternehmen durch Innovationen und gute Produkte eine dominante Stellung im Markt erlangt hat, dann werden sie nichts dagegen tun. Doch wer Marktmacht hat, hat auch eine besondere Verantwortung – die Verantwortung, fair zu bleiben und diese Macht nicht zu missbrauchen. Denn wer mächtig ist, der kann möglicherweise Bedingungen durchsetzen, die er sich in einem Markt mit starkem Wettbewerb und vielen kleinen Akteuren nicht erlauben könnte, weil die Kunden oder Geschäftspartner dann einfach zu einem anderen Anbieter wechseln würden.
Man kann sagen, dass die Aufgaben und Befugnisse der Kartellbehörden seit Erhards Zeiten ziemlich eindeutig definiert und umrissen waren. Natürlich gab es hin und wieder Diskussionen, ob eine Entscheidung der Wettbewerbshüter richtig oder falsch war. Viele Entscheidungen wurden auch vor Gericht angefochten, weil die betroffenen Unternehmen sie nicht akzeptieren wollten. Das meiste aber war unstrittig. Die Vorgehensweise der Ermittler war klar, das Instrumentarium auch. Inhaltlich ging es darum, den Wettbewerb zu schützen und dadurch zu hohe Preise für die Kunden zu verhindern. Manchmal ging es aber auch um zu niedrige Preise – etwa, wenn ein Marktführer seine Waren für eine gewisse Zeit für weniger verkaufte, als er selbst dafür bezahlt hatte, um Wettbewerber aus dem Markt zu drängen.
Die Digitalisierung nun stellt die Wettbewerbshüter vor ganz neue Herausforderungen. Denn nicht nur die Technik wandelt sich, sondern auch die zentralen Mechanismen der Wirtschaft. Die Geschäftsmodelle sind neu, die Märkte funktionieren anders und ihre Grenzen verschwimmen, dazu kommt eine hohe Dynamik der Veränderung. Die Frage, wann eine Fusion den Wettbewerb schwächt oder wann ein Missbrauch von Macht vorliegt, ist deshalb oft anders zu beantworten als zu Erhards Zeiten. Viele Vorgehensweisen von Unternehmen, an die man früher überhaupt nicht gedacht hätte – etwa, dass man einen Konkurrenten nur deshalb aufkauft, weil man an seine Datensätze kommen will –, haben heute das Zeug dazu, dem Wettbewerb und damit dem Wohlstand zu schaden.
Doch es geht hier nicht nur um die Arbeit der Wettbewerbsbehörden, sondern grundsätzlich um die Ordnung der Märkte – also um die Leitplanken, die man als Staat den Märkten setzt, damit die wohlstandsmehrenden Kräfte zur Geltung kommen. Die Antworten aus Erhards Zeiten passen nicht mehr. Das digitale Zeitalter verlangt nach anderen, neuen Antworten.
Wer der Ordnungspolitik ein Update verpassen möchte, der muss zunächst einmal verstehen, wie die moderne Wirtschaft funktioniert – und wie sie sich von dem unterscheidet, was man früher einmal gelernt hat über die Marktwirtschaft. Wir stellen hier zunächst vier Prinzipien vor, die die digitale Ökonomie charakterisieren, weil sie so anders sind.
Jedem dieser Prinzipien ist später ein ganzes Kapitel gewidmet, in dem dann jeweils versucht wird, eine Idee für eine moderne Ordnungspolitik zu entwickeln. Grundsätzlich ist Erhards Vorgehen, die Kräfte des Marktes dort zu korrigieren, wo sie nicht zum Wohle aller arbeiten, sie aber ansonsten in Ruhe wirken zu lassen, noch immer richtig. Doch der damalige Wirtschaftsminister beschrieb eine nicht-digitale Wirtschaft. Das reicht für die heutige Wirtschaft nicht aus.
#1: Monopole statt Wettbewerb
In vielen Branchen, in denen es in den Anfangsjahren des Internetzeitalters noch zahlreiche Anbieter und viel Wettbewerb gab, gibt es heute praktisch nur noch einen starken Monopolisten. Gerade die großen Internetkonzerne – wie Google, Apple, Amazon, Microsoft und Facebook – sind Riesen mit enormer Marktmacht, teils in kürzester Zeit zu unglaublicher Größe aufgestiegen, die ihre Kerngeschäfte quasi alleine dominieren. Ihr Vorgehen mutet oft äußerst aggressiv an: Mit Zukäufen erfolgreicher Start-ups haben die Unternehmen ihre Position der Stärke weiter gefestigt und neue Konkurrenz verhindert. Ihre prozentuale steuerliche Belastung ist meist deutlich geringer als bei kleineren Unternehmen, weil sie es bestens verstehen, unterschiedliche internationale Regularien optimal zu nutzen.
Dass Unternehmen schnell zu mächtigen Riesen werden, ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal der digitalen Märkte. Doch hier passiert es viel schneller – weil die Marktkräfte es fördern. Viele digitale Produkte sind umso attraktiver, je mehr Menschen sie nutzen – man denke nur an soziale Netzwerke, Büro-Software oder Suchmaschinen. Wenn alle Freunde oder Geschäftspartner ein bestimmtes Produkt verwenden, dann ist es einem praktisch nicht mehr möglich, zu einem anderen Angebot zu wechseln – man ist also gefangen. Dieses Phänomen führt schnell zu einer Konzentration von Märkten.
Verantwortlich dafür ist aber auch das Verschwimmen der Marktgrenzen: Wer mit einem Produkt Erfolg hatte, dem fällt es in der Digitalwirtschaft besonders leicht, in einem benachbarten Markt Erfolg zu haben. Denn die Kundendaten, die man bereits gesammelt hat, helfen auch hier weiter.
#2: Daten statt Preise
Den Preisen kommt in der Marktwirtschaft normalerweise eine zentrale Rolle zu – vor allem in einer relativ freien Marktwirtschaft, wie sie Ludwig Erhard skizziert hat. Sie sorgen dafür, dass Transaktionen zustande kommen, und helfen dabei, den Wohlstand zu verteilen: Der Käufer bekommt ein Gut, der Verkäufer das Geld. Zum Zuge kommen dabei aber nur jene Käufer, die bereit sind, viel für das Gut zu zahlen, die also wirklich daran interessiert sind – und nur jene Verkäufer, deren Kosten niedrig genug sind. Beim Feilschen über Preise werden Werte definiert, ständig aufs Neue. Auch das ist wichtig für eine Volkswirtschaft, schließlich weiß man dadurch recht gut, welche Vorstellungen die Kunden und Unternehmen haben. Als Gegenbeispiel denke man an die Planwirtschaft der DDR: Hier wurden Preise und Mengen oft zentral verordnet – ohne dass man wusste, wie groß Nachfrage und Zahlungsbereitschaft wirklich waren.
In der digitalen Wirtschaft nun gibt es vieles umsonst – oder besser gesagt für null Euro: Ein Postfach von Google Mail kostet nichts, ein Facebook-Konto auch nicht, vieles andere ebenfalls nicht. Der Preismechanismus fehlt hier also. Dennoch ist all das natürlich nicht wirklich umsonst, denn es kommt trotzdem ein Tauschgeschäft zustande. Im Tausch gegen das Produkt geben die Kunden Informationen über sich preis, die wiederum für Werbetreibende interessant sind. Und so ergibt sich eine ökonomische Dreiecksbeziehung: Der Anbieter bekommt sein Geld von dem, der Werbung schaltet, und gibt sein Produkt deshalb kostenlos an den Kunden. Der wiederum bietet im Gegenzug seine Aufmerksamkeit an für die passgenaue Reklame, die ihm angezeigt wird. Diese sogenannten zweiseitigen Märkte geben dem Anbieter viel Macht, da er in der Mitte steht.
Die Daten sind heute das entscheidende Produktionsmittel. So wie die Industrie mit Rohstoffen Produkte herstellt, so tut es die Digitalwirtschaft mit Daten. Diese haben besondere ökonomische Merkmale: Ihr Wert steigt häufig mit wachsender Menge überproportional an. Verschiedene Datensätze zu verbinden, eröffnet dann ganz neue Möglichkeiten. Meist gilt daher: Wer die Daten hat, hat die Macht. Das aber kann negative Folgen haben – für den Wettbewerb, aber auch für den Datenschutz.
#3: Clickworkertum statt Sozialpartnerschaft
Wir leben heute im Zeitalter des Individuums. Für den Arbeitsmarkt trifft das im Besonderen zu: Während die Industrie – die ja zu Erhards Zeiten noch der primäre Arbeitgeber war – von standardisierten Arbeitsplätzen geprägt war, so ist das in der digitalen Dienstleistungsgesellschaft anders. Hier ist oft jeder Job unterschiedlich. Kollektive Lohnverhandlungen im Sinne der Sozialpartnerschaft von Arbeitnehmern und Arbeitgebern verlieren an Bedeutung, heute müssen die Menschen stärker für sich selbst verhandeln. Damit kommen auch die Gesetze des Marktes stärker zur Geltung: Wer über Fähigkeiten verfügt, die knapp sind, wird zum Gewinner. Wer diese nicht hat, kann schnell verlieren.
Sinnbild dessen ist der Clickworker, der auf eigene Rechnung Kleinstaufträge am Computer erledigt, dafür wenig bekommt und schlecht abgesichert ist. Zwar ist dieses Arbeitsmodell ein seltenes Extrem und wird es vermutlich auch bleiben. Dennoch: Die Gefahr, dass sich die Arbeitswelt polarisiert, ist da.
Verstärkt wird der Wandel des Arbeitsmarktes durch die Computerisierung: Intelligente Maschinen, Computer und Roboter übernehmen immer mehr Tätigkeiten, die bisher von Menschen erledigt wurden. Das wird zwar nicht dazu führen, dass die Zahl der Jobs sinkt – einfach, weil an anderer Stelle neue entstehen werden. Dennoch erhöht es den Druck auf die Arbeitnehmer: Sie müssen sich schneller als bisher mit neuen Technologien vertraut machen. Gleichzeitig werden die Anforderungen im Alltag größer: Wenn Maschinen Routinejobs übernehmen, bleibt den Menschen schließlich mehr Zeit für komplexere Aufgaben.
#4: Sharing statt Eigentum





























