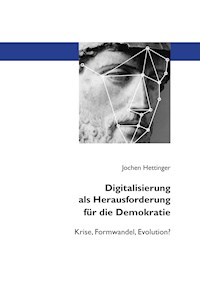
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Digitalisierung erfasst Alltag, Gesellschaft und Politik. Auch die Demokratie wandelt sich unter den Bedingungen der Digitalisierung. Grundprinzipien demokratischer Herrschaft wie "Volkssouveränität", "demokratische Öffentlichkeit" und "politische Partizipation" müssen neu gedacht werden. Anhand eines differenziert ausgearbeiteten Modells der Demokratie diskutiert der Autor die Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Dabei geht es zum einen darum, die Digitalisierung demokratisch zu gestalten und zum anderen, die Demokratie im digitalen Kontext weiterzuentwickeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Digitalisierung als Herausforderung für die Demokratie
Jochen Hettinger
Digitalisierung als Herausforderung für die Demokratie
Verlag tredition
Heidelberg 2022
© 2022 Dr. Jochen Hettinger
Umschlagmotiv: Perikles (490 - 429 v. Chr), © akg-images, eigene Bearbeitung.
ISBN Softcover: 978-3-347-71260-7
ISBN E-Book: 978-3-347-71264-5
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Für alle im Netz.
Inhalt
1. Einleitung
2. Digitalisierung als gesellschaftlicher Meta-Prozess
2.1 Was ist Digitalisierung?
2.2 Technische Grundlagen
2.3 Entwicklung der Digitalisierung
2.4 Kennzahlen zur Digitalisierung
2.5 Digitalisierung als gesellschaftlicher Metaprozess
2.6 Zusammenfassung
3. Demokratie und Digitalisierung
3.1 Was ist Demokratie?
3.2 Das Volk als Souverän–unter den Bedingungen der Digitalisierung
3.2.1 Die Delegation der Macht durch das Volk
3.2.2 Übertragung der Macht auf Verfassungsorgane
3.2.3 Ausübung der Staatsgewalt durch Verfassungsorgane
3.2.4 Staatlichkeit als Voraussetzung für Volkssouveränität
3.2.5 Der mündige Bürger als Subjekt der Volkssouveränität
3.2.6 Digitale Souveränität als Herausforderung und Lösungsweg
3.2.7 Zusammenfassung und Diskussion
3.2.8 Exkurs: Digitalisierung im Wahlkampf
3.3 Digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit
3.3.1 Öffentlichkeit in der Demokratie
3.3.2 Digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit
3.3.3 Zusammenfassung: Funktionsverlust der Öffentlichkeit?
3.4 Politische Partizipation und Digitalisierung
3.4.1 Politische Partizipation in der Demokratie
3.4.2 Digitale Partizipation
3.4.3 Zusammenfassung
3.5 Demokratische Legitimität und Digitalisierung
3.5.1 Legitimität und Legitimation in der Demokratie
3.5.2 Legitimität und Digitalisierung
3.5.3 Zusammenfassung
3.6 Grundrechte, Grundwerte, Ethik und Digitalisierung
3.6.1 Demokratische Grundrechte im Zeitalter der Digitalisierung
3.6.2 Demokratische Grundwerte und Digitalisierung
3.6.3 Ethische Fragen der Digitalisierung in Bezug auf die Demokratie
3.6.4 Zusammenfassung
3.7 Gewaltenteilung und Digitalisierung
3.7.1 Gewaltenteilung als Grundprinzip der Demokratie
3.7.2 Veränderung der Gewaltenteilung im Kontext der Digitalisierung
3.7.3 Gewaltenteilung und Digitalisierung der Verwaltung
3.7.4 Zusammenfassung
3.8 Digitale Transformation der Parteien?
3.8.1 Kommunikation der Parteien nach außen
3.8.2 Innerparteiliche Kommunikation und Organisation
3.8.3 Positionierung der Parteien zur Digitalisierung
3.8.4 Strukturprobleme der Parteien
3.8.5 Zusammenfassung
4. Rahmungen und Perspektiven: Krise, Technikfolgen und zweite Moderne
4.1 Digitalisierung als Krise der Demokratie?
4.2 Technikfolgen: Welche Folgen hat die Digitalisierung für die Demokratie
4.3 Digitalisierung und Demokratie in der zweiten Moderne
5. Zusammenfassung und Diskussion
5.1 Das Konzept der „Digitalisierung“
5.2 Herausforderungen der Digitalisierung für die Demokratie
5.2.1 Ebene 1: Herausforderungen in den einzelnen Demokratiedimensionen
5.2.2 Ebene 2: Herausforderungen durch Interaktionen zwischen den Demokratie-Dimensionen
5.2.3 Ebene 3: Digitalisierung und Demokratie im (politischen) Kontext
5.3 Rahmungen und Perspektiven
5.4 Schlussbemerkungen
6. Ausblick: Vernunft, Digitalisierung und Demokratie
6.1 Was ist „Vernunft“?
6.2 Vernünftig denken und handeln
6.3 Formen von Rationalität: Die „Einheit der Vernunft in der Vielfalt ihrer Stimmen“
6.4 Kritik an der Vernunft
6.5 Kommunikative Vernunft und Diskursethik
6.6 Vernunft und Demokratie
6.7 Diskursive Vernunft, Digitalisierung und Demokratie
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Der Prozess der Digitalisierung stellt die Demokratie vor große Herausforderungen. Die einen sprechen von einer „Krise“ oder gar vom „Ende der Demokratie“, die anderen betonen die Chancen der neuen digitalen Technologien für die Demokratie. Wurden das Internet und die sozialen Netzwerke noch vor wenigen Jahren als „Befreiungstechnologie“ begrüßt, so meldeten sich bald kritische Stimmen, die von einer ernsten Bedrohung für die freiheitliche Demokratie oder gar vom „Totalitarismus der Digitalisierung“1 sprachen. Der Hoffnung auf die Verwirklichung demokratischer Prinzipien wie Teilhabe, Mitgestaltung und Selbstregierung durch die Digitalisierung steht die Angst gegenüber, dass die Digitalisierung zur Zerstörung der Demokratie durch Populismus, Extremismus und die Beschädigung des öffentlichen Diskurses beitragen könnte.
Weitere Fragen drängen sich auf: Können freie Wahlen durch digitale Wahlkämpfe manipuliert werden? Welche Macht haben die großen Tech-Konzerne und internationalen Digitalplattformen? Entstehen durch die Digitalisierung rechtsfreie Räume? Wie „digital“ muss ein demokratischer Staat heute sein? Was leistet die Digitalisierung für die politische Mitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger? Entwickelt sich die Öffentlichkeit im Prozess der Digitalisierung zu einem offenen, pluralistischen Forum für alle oder zerfällt sie in unverbundene Teilöffentlichkeiten? Was wird aus dem mündigen Bürger in unüberschaubaren digitalen Informationswelten? Gelten die Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaft auch für digitale Umgebungen? Welche Rollen spielen Werte wie „Privatheit“ und „Freiheit“ in der Digitalisierung? Führt künstliche Intelligenz zu größeren Freiräumen für unser Handeln oder zu mehr Überwachung, Steuerung und Fremdbestimmung? Fördert Digitalisierung die politische Teilhabe und Mitgestaltung oder privilegiert sie die Privilegierten? Ist Digitalisierung mit einem Verlust staatlicher Souveränität verbunden, weil sie technologische Abhängigkeiten und Angriffsflächen (Spionage, Sabotage) ausweitet? Oder ist Souveränität heute nur auf der Grundlage weitgehender Digitalisierung staatlicher Institutionen und Prozesse denkbar? Führt die Digitalisierung dazu, dass die politischen Parteien aufgrund alternativer Beteiligungsangebote weiter an Bedeutung und Mitgliedern verlieren oder beschleunigt sie ihre Transformation zu offenen, mitgliederorientierten Plattformparteien?
Das Buch versucht Antworten auf diese Fragen zu finden. Das zweite Kapitel „Digitalisierung als gesellschaftlicher Metaprozess“ bietet einen einführenden Überblick über die technischen Grundlagen, die Entwicklung und wesentliche „Kennzahlen“ der Digitalisierung und nimmt die Digitalisierung als umfassenden gesellschaftlichen Veränderungsprozess („Metaprozess“) in den Fokus.
Das dritte Kapitel untersucht das Verhältnis von Demokratie und Digitalisierung in sieben grundlegenden Dimensionen der Demokratie. Im Abschnitt 3.1 „Volkssouveränität“ geht es um die Frage, welche Bedrohungen sich durch die Digitalisierung für die Staatlichkeit und die Souveränität von Demokratien ergeben. Die Beeinflussung demokratischer Wahlen und Abstimmungen durch digitale Methoden ist Thema eines Exkurses in Abschnitt 3.1. Dabei geht es um Präsidentschaftswahlen in den USA in den Jahren 2012, 2016 und 2020, die Brexit-Abstimmung in Großbritannien im Jahr 2016 und die Bundestagswahlen 2017 und 2021. Der „digitale Strukturwandel der Öffentlichkeit“ ist Thema des Abschnitts 3.2. In zahlreichen Einzelanalysen wird untersucht, inwieweit die neue digitale bzw. hybride Öffentlichkeit die Funktionen einer demokratischen Öffentlichkeit noch erfüllen kann. Der Abschnitt 3.3 „Partizipation“ geht der Frage nach, ob und inwieweit die Digitalisierung die politische Partizipation nachhaltig unterstützt oder ob sie eher zu einer digitalen Spaltung beiträgt. Demokratische Legitimität und Legitimation – Thema von Abschnitt 3.4 „Legitimität“ – stellen sich in einer stark digitalisierten Gesellschaft anders dar als in einer analogen. Die entsprechenden Veränderungen werden auf den Untersuchungsebenen „Legitimität der Demokratie als Herrschaftsform“, „Legitimität demokratischen Regierens“ und „Legitimität von Institutionen und Politikern“ vorgestellt. Abschnitt 3.5 des dritten Kapitels „Grundrechte, Grundwerte und Ethik“ analysiert die Bedeutung der Digitalisierung für die Grundrechte und -werte der Demokratie (wie Menschenwürde, Privatheit und Freiheit) und ihre ethische Begründung. Wesentliche Themen und grundlegende Konzepte einer digitalen Ethik, die auch für die Demokratie relevant sind, werden ebenfalls diskutiert. Der sechste Abschnitt (3.6 „Gewaltenteilung“) beschäftigt sich mit dem demokratischen Prinzip der Gewaltenteilung unter zwei Fragestellungen: Führt die Digitalisierung zu einem Übergewicht der Exekutive und verschiebt so die Achsenverteilung der Gewaltenteilung? Und umgekehrt: Wie wirkt sich die horizontale und vertikale Gewaltenteilung der Demokratie in Deutschland auf die Digitalisierung des Staates, insbesondere der Verwaltung aus? Dahinter steht die Frage, unter welchen Bedingungen ein digitaler Staat ein demokratischer Staat ist. Im siebten Abschnitt (3.7 „Parteien“) geht es schließlich um die politischen Parteien, die im Prozess der Digitalisierung neue Möglichkeiten der Außendarstellung, der Organisation und der Mitgliederbeteiligung hinzugewinnen, gleichzeitig jedoch in Konkurrenz zu anderen, oft digitalen Möglichkeiten des politischen Engagements geraten.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit unterschiedlichen Perspektiven auf den Prozess der Digitalisierung und seine Bedeutung für die Demokratie. Im ersten Abschnitt des vierten Kapitels (4.1 „Krisen“) geht es um die Frage, inwieweit die Digitalisierung als Krise der Demokratie zu betrachten ist und welche Krisentheorien dabei relevant sind. Der zweite Abschnitt (4.2 „Technikfolgen“) nimmt die Perspektive der Technikfolgenabschätzung ein und diskutiert die Frage von Ursache-Wirkungszusammenhängen im Verhältnis zwischen Digitalisierung und Demokratie. Der dritte Abschnitt (4.3 „Zweite Moderne“) skizziert die Theorie der zweiten Moderne von Ulrich Beck als eine mögliche „Rahmentheorie“ für den Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Demokratie.
Das fünfte Kapitel beleuchtet die grundlegenden Herausforderungen der Demokratie durch die Digitalisierung und stellt sie in einen Zusammenhang mit den „Leistungsgrenzen der Demokratie“ und den aktuellen politischen Herausforderungen zum Beispiel durch die Corona-Pandemie, den Klimawandel und den Krieg in der Ukraine. Das 6. Kapitel „Ausblick: Vernunft, Digitalisierung und Demokratie“ ist der Versuch, das Konzept einer diskursiven Vernunft nachzuzeichnen, das als eine Grundlage für die „Digitalisierungspolitik“ dienen kann.
„Demokratie zu verteidigen, heißt sie lebendig zu halten“ schreibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Vorwort zu dem von ihm herausgegebenen Buch „Zur Zukunft der Demokratie“2. Und er fährt fort: „Die Demokratie ist ein offenes Projekt, ihr Anspruch und ihre Hoffnung ist auf die conditio humana jedes Menschen gerichtet, auf das Bedürfnis nach Freiheit und das Recht darauf“. Dieses Buch versteht die Digitalisierung als Teil dieses Projekts und gleichzeitig als Impuls für die Fortentwicklung der Demokratie.
1 Jakob Augstein im Vorwort zu dem von ihm herausgegebenen Buch „Reclaim Autonomy“ (Augstein 2017a, S. 9).
2 Steinmeier (2022), S. 14, folgendes Zitat S. 23 f.
2. Digitalisierung als gesellschaftlicher Meta-Prozess
Digitale Technologien sind ein allgegenwärtiger Bestandteil unseres Alltags und unserer Lebenswelt. Sie prägen Abläufe und Handlungen, verändern Institutionen und soziale Beziehungen, ermöglichen Kooperation und Kommunikation, schaffen neue Produkte und Dienstleistungen und bieten Räume für künstlerische Kreativität und spielerischen Zeitvertreib. Dieses Kapitel erläutert den Begriff der Digitalisierung, beschreibt die zugrunde liegenden Technologien, skizziert die Entwicklung der Digitalisierung und gibt einen Überblick über Bereiche, in denen die Digitalisierung eine besondere Rolle spielt. Anhand einiger Kennzahlen wird die Verbreitung digitaler Technologien in der heutigen Gesellschaft veranschaulicht. Abschließend wird die Digitalisierung als „gesellschaftlicher Metaprozess“ beschrieben, der alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringt und beeinflusst.
2.1 Was ist Digitalisierung?
Der Begriff „Digitalisierung“ im engeren Sinne bezeichnet die Umwandlung von analogen Informationen in digitale: Eine Farbe, ein Ton, ein Buchstabe des Alphabets werden durch eine Folge von digitalen Signalen beschrieben. Diese Signale können gespeichert, bearbeitet und ausgegeben werden, etwa bei der Anzeige eines elektronischen Dokuments am Bildschirm. In der Informatik findet sich zum Beispiel die folgende Definition: Digitalisierung ist die „Umwandlung beliebiger (kontinuierlicher) Signale (Sprache, Musik, Video usw.) in diskrete Signale, die meist durch eine Folge von Binärzeichen (Bits) dargestellt werden. In der Regel erfolgt in gleichen Zeitabständen eine Quantisierung der (analogen) Signalamplitude“.3 Damit ist allerdings nur der Prozess der Transformation von analogen in digitale Informationen beschrieben. In einem weiteren Sinne meint Digitalisierung die Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche mit digitalen Technologien und Prozessen. Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Medien, das alltägliche Leben – überall spielen digitale Technologien und Verfahren eine herausragende Rolle. Dies rechtfertigt es, von der Digitalisierung als „gesellschaftlichem Metaprozess“ zu sprechen, der in seiner Bedeutung mit den gesellschaftlichen Metaprozessen der Individualisierung, Mediatisierung und Globalisierung vergleichbar ist (vgl. Abschnitt 2.5 „Digitalisierung als gesellschaftlicher Metaprozess“).
2.2 Technische Grundlagen
Der grundlegende Prozess der Digitalisierung ist die Codierung von Informationen. Auch die Buchstaben der Schrift codieren Informationen, sie fixieren gesprochene Laute. Insofern könnte man die Digitalisierung als eine Medientechnologie bezeichnen. Das Besondere an ihr ist allerdings die Abstraktheit, Universalität, Portabilität und Veränderbarkeit ihrer Informationsträger: Der Buchstaben „A“ beispielsweise wird im sogenannten ASCII-Zeichensatz durch die dezimale Zahl 65 und durch die Bitfolge 01000001 repräsentiert. Mit diesem Verfahren lassen sich alle wahrnehmbaren Eigenschaften digitalisieren, die sich auf Gegenstände und Vorgänge beziehen (Formen, Farben, Umriss, Gewicht, Klang und so weiter) wie zum Beispiel die visuellen und auditiven Informationen einer Filmszene oder Strukturmerkmale eines menschlichen Gesichts. Auch Formen, die es in der Wirklichkeit nicht gibt, lassen sich digital erzeugen und darstellen, etwa als simulierte dreidimensionale Objekte in „Virtual-Reality“-Anwendungen.
Die Informationen werden nach bestimmten Regeln in elektrische Zustände übersetzt. Diese lassen sich sehr einfach übertragen, verändern und ausgeben. Dies erfolgt mit Hilfe elektronischer Geräte, im wesentlichen mit Hilfe von Mikroprozessoren in Computern. Gespeichert werden die Informationen auf Datenträgern wie Festplatten, Solid-State-Disks (SSDs, Speicherung der Information in Halbleiterbausteinen) und optischen Speichermedien. Die Verarbeitung der digitalen Informationen wird durch Programme gesteuert, die mit Hilfe von Programmiersprachen geschrieben werden. Dabei kommen Algorithmen zum Einsatz, die Lösungswege für informatisch darstellbare Aufgaben beschreiben. Auch eine App auf einem Smartphone ist ein Computerprogramm, das in einer Programmiersprache geschrieben ist. Die Steuerung der digitalen Geräte erfolgt über Interfaces (Schnittstellen wie Maus, Tastatur, Mikrofon, Kamera und Sensoren), die Ausgabe über Geräte wie Bildschirm, Lautsprecher, VR-Brillen und mit Hilfe von „Aktoren“ wie etwa Roboterarmen oder Maschinen. Die informationsverarbeitenden Geräte sind in der Regel in lokalen Netzwerken oder durch das Internet miteinander vernetzt, wobei verschiedene Übertragungstechnologien, Protokolle und Standards zum Einsatz kommen. Das Internet verbindet nicht nur Computer(-netze), sondern – als „Internet of Things“ (IoT) – auch „Dinge“ wie zum Beispiel Haushaltsgeräte, Maschinenteile oder Steuerungsanlagen. Die Technologie des Cloud-Computing bietet die Möglichkeit, Computer und digitale Infrastrukturen in das Internet auszulagern und entsprechende Dienstleistungen aus der „Cloud“ in Anspruch zu nehmen.
Die Entwicklung immer leistungsfähigerer Geräte, die weltumspannende Vernetzung durch das Internet und die Entwicklung neuer Programmiersprachen ist die Grundlage für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz wie komplexe Datenanalysen (Big Data Analytics), Muster- und Gesichtserkennung, maschinelles Sehen, Sprachverarbeitung, Empfehlungsdienste und verhaltensbasierte Vorhersagen (zum Beispiel bei Videostreamingdiensten oder sozialen Netzwerken). Wichtige Einsatzgebiete sind auch die medizinische Forschung und Diagnostik und die individualisierte Content-Erstellung durch Medienanbieter.
In der industriellen Fertigung spielen Roboter eine große Rolle, etwa im Maschinenbau oder in der Autoindustrie. Humanoide, autonome und bewegliche Roboter verfügen über „intelligente“ Fähigkeiten: Sie können z. B. ein Instrument spielen oder ein Selbstportrait malen.4
Die Verfahren der virtuellen und virtuell unterstützten Realität (Virtual-Reality, VR, und Augmented-Reality, AR) schaffen digitale Räume, die Informationen sehr realitätsnah darstellen. Mit Hilfe von VR-Geräten kann man mit einer computergenerierten Umwelt interagieren und zum Beispiel an einem computergenerierten Modell über große Distanzen hinweg zusammenarbeiten. Virtual-Reality verstärkt den Wirklichkeitseindruck etwa bei Computerspielen.
Mit Hilfe von 3D-Druckern lassen sich unter anderem Gegenstände des täglichen Bedarfs, Maschinenbauteile, Bauelemente von Häusern, Körperteile wie Zähne oder Knochenimplantate, Ersatzteile und Kleinserien sowie Prototypen herstellen.
Damit sind nur einige technologische Erscheinungsweisen der Digitalisierung genannt. Eine umfassende Darstellung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.5
2.3 Entwicklung der Digitalisierung
Die elektronische Datenverarbeitung begann mit der Entwicklung des ersten programmierbaren digitalen Rechners durch Konrad Zuse im Jahr 1941 in Berlin. Die Z3 genannte Maschine mit einem Arbeitsspeicher von 200 Byte konnte arithmetische Berechnungen ausführen und ließ sich über Lochkarten und eine Tastatur steuern. Die Firma IBM entwickelte in den sechziger Jahren einen Großrechner („Mainframe“, System 360), der mit Hilfe von Lochkartenlesern und später dann Terminals bedient wurde und die Ergebnisse seiner Berechnungen auf zentralen Druckern ausgab. Der „Personal Computer“ von IBM (1981) bot einen funktionsfähigen Rechner in einem kompakten Gehäuse und machte die Nutzung zu Hause, in Büros und anderen Arbeitsstätten möglich. Diese Einzelrechner wurden später in lokalen Netzwerken miteinander verbunden. Im Jahr 1974 wurde der Begriff „Internet“ eingeführt, seit dem Jahr 1990 steht das Internet für die Nutzung außerhalb von Universitäten und dem US-amerikanischem Militär zur Verfügung. Das Internet verbindet die lokalen Netzwerke zu einem Netz von Netzen mit Hilfe eindeutiger Standards und Protokolle. Die Entwicklung der „Hypertext-Markup-Language“ (HTML, 1990 am CERN von Tim Barners Lee) und von Programmen, die diese Sprache interpretieren und Inhalte entsprechend am Bildschirm darstellen können (Browser) führte zu einer rasanten Zunahme der Nutzung des Internets.
Roboter wurden bereits seit den sechziger Jahren in der Industrie eingesetzt, der erste mobile autonome Roboter wurde im Jahr 1968 am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt.6 Aktuell verschmelzen die Entwicklungen der Robotik mit denen der KI, um noch leistungsfähigere, flexibel einsetzbare Roboter zu entwickeln.7
Im Jahr 1996 führte der US-amerikanische Sozialwissenschaftler Howard Rheingold den Begriff „Social Web“ ein. Neben sozialen Plattformen zur Interaktion über das Internet gehören dazu Anwendungen wie Blogs und Wikis. Die ersten digitalen sozialen Netzwerke wie LinkedIn, Myspace, XING und Facebook entstanden in den Jahren 2003 und 2004 in den USA. Tim O’Reilly verwendete im Jahr 2005 den Begriff „Web 2.0“ und beschrieb damit das Internet als Arbeits- und Kommunikationsplattform, die von den Nutzern mit eigenen Inhalten gefüllt werden kann und als Grundlage für die Schaffung neuer Produkte und Inhalte dient.
Im Jahr 2001 prägte die Consulting-Firma Gartner den Begriff „Big Data“ als Bezeichnung von „Daten, die in großer Vielfalt, in großen Mengen und mit hoher Geschwindigkeit anfallen“8 und die man mit herkömmlichen Verfahren der Datenverarbeitung nicht bewältigen konnte. Darunter fallen die Daten aus der Nutzung sozialer Netzwerke und Daten, die von Maschinen und Objekten generiert werden. Für die Auswertung großer Datenmengen werden heute zunehmend Verfahren der künstlichen Intelligenz eingesetzt, um Muster und Zusammenhänge in den Daten zu erkennen.
Bereits im Jahr 1956 entstanden im Rahmen der sogenannten Dartmouth-Konferenz am Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, erste Ideen und Konzepte der künstlichen Intelligenz. Themen waren unter anderem neuronale Netzwerke, Selbstverbesserung, Problemlösung und Kreativität. Aufgrund der zu geringen Rechenleistung der damals verfügbaren Computer und des Mangels an digitalen Daten konnten diese Ideen zunächst nicht umgesetzt werden. Wichtige Meilensteine der Entwicklung der künstlichen Intelligenz waren Expertensysteme für bestimmte Fachgebiete (etwa in der Medizin), Programme, die gesprochene Sprache verarbeiten können (vgl. der Sprachassistent Siri von Apple, 2011 vorgestellt) und Anwendungen, die Spiele wie Schach oder Go beherrschen. Neuronale Netzwerke, die die Struktur der Nervenzellen im Gehirn nachbilden, werden etwa seit 2009 für das maschinelle Lernen eingesetzt, u. a. zur Mustererkennung (Google-Brain) und Gesichtserkennung.9 Entsprechende KI-Verfahren ermöglichen auch die Erzeugung realistisch wirkender Fotografien, Videos und Audioaufzeichnungen („Deep-Fakes“, ab 2017). Auch für das autonome Fahren sind diese Technologien relevant.
Einen ungeahnten Schub erfuhr die Digitalisierung durch die Vorstellung des ersten „Smartphones“ durch Apple-Gründer Steve Jobs im Jahr 2007. Mobile Geräte wie das Smartphone und das Tablet verbreiterten die Anwendungsmöglichkeiten digitaler und internetbasierter Angebote enorm.
Im Jahr 2009 wurde die Kryptowährung Bitcoin entwickelt, die auf kryptografischen Verfahren beruht und deren Einheiten in weltweit verteilten Datenbanken (Blockchain) verwaltet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass diese Einheiten jederzeit einem Besitzer eindeutig zugeordnet werden können.10 Im allgemeinen Geldverkehr konnte sich diese Währung bislang nicht durchsetzen, das Verfahren der eindeutigen Identifizierung durch Blockchains kann aber auch in anderen Zusammenhängen genutzt werden (etwa bei der Nachverfolgung von Produkten vom Hersteller bis zum Verbraucher).
Der Begriff „Virtual Reality“ wurde im Jahr 1987 durch Jaron Lanier geprägt, ab ca. 2012 kamen die ersten mobilen VR-Brillen auf den Markt. Ebenfalls ab dem Jahr 2012 wurden erste Softwareprodukte entwickelt, die über das Internet nutzbar waren und nicht mehr lokal auf dem Rechner oder dem Server installiert werden mussten. Dies war der Beginn des „Cloud-Computing“, das die Nutzung von Hardware, Software und Infrastruktur über das Internet ermöglicht.
Im „Internet of Things“ werden zum Beispiel Maschinen durch eine eindeutige Internetadresse identifiziert, so dass sie mit anderen Dingen (Maschinen, Computern) kommunizieren können. Eine praktische Anwendung ist der „digitale Zwilling“ etwa zur Überwachung von Flugzeugtriebwerken oder Energieanlagen. Das „Internet of Everything“ erweitert diese Integration der physischen Welt auf beliebige unbelebte und belebte Objekte.
Die aktuellen Entwicklungen sind kaum noch zu überschauen: künstliche Intelligenz, Robotik, Echtzeitanalyse und vorausschauende Analyse von Daten, Geschäftsprozessautomatisierung, Hyperautomatisierung in der industriellen Fertigung, smarte Arbeitswelt, autonomes Fahren und flächendeckende Vernetzung mit dem Mobilfunkstandard 5G sind einige der Begriffe, die häufig genannt werden. Als mögliche Alternative zu mittlerweile weitgehend zentralisierten Internet-Diensten wird an der Entwicklung eines „alternativen“ Internets bzw. World Wide Web gearbeitet (Web3), das unter anderem auf der Blockchaintechnologie aufbauen soll.11
2.4 Kennzahlen zur Digitalisierung
Die Verbreitung digitaler Technologien wird im Folgenden durch einige „Kennzahlen“ verdeutlicht. Auch wenn es dabei im Wesentlichen um technische Aspekte geht, wird damit die Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche im Rahmen der Digitalisierung deutlich. Die Angaben zeigen darüber hinaus, dass die Digitalisierung als gesellschaftlicher Metaprozess nicht etwas Abstraktes ist, sondern sich in messbaren Größen niederschlägt – auch wenn er mit diesen nicht identisch ist.12
– Internetzugang haben im Jahr 2020 sechsundneunzig Prozent der deutschen Haushalte.13 Mehr als 75 Prozent der Haushalte in Deutschland verfügen über einen Internet-Anschluss mit mindestens 50 Mbit/s (93,5 Prozent aller Haushalte in Städten, im ländlichen Raum sind es dagegen nur 50,5 Prozent).14 In 96 % der Fläche der Bundesrepublik Deutschland ist der Mobilfunkstandard LTE (4G) nutzbar, bei 5G sind es 7,6 %. Ein Glasfaseranschluss ist für fünfzehn Prozent der Haushalte verfügbar.15
– Fast alle Haushalte in Deutschland verfügen über einen Computer (PC, Laptop, Tablet), 16 in 97,6 Prozent der Haushalte gibt es (2021) ein Handy oder ein Smartphone.17 Smartphones sind bereits bei Jugendlichen außerordentlich verbreitet (zwischen 95 und 99 %18 2019 je nach Altersgruppe).
– In Deutschland nutzen im Jahr 2021 67 Millionen Menschen das Internet (94% der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren). Fast dreieinhalb Stunden (224 Minuten) verbringen Menschen in Deutschland im Durchschnitt täglich im Internet, davon entfallen 136 Minuten auf die Nutzung des „medialen Internets“ (z. B. Videostreaming). 19
– Der Datenverkehr im Internet in Deutschland steigt kontinuierlich an. Von 3,4 Mrd. Gigabyte im Jahr 2010 auf 72 Mrd. Gigabyte im Jahr 2020.20 Zu Beginn der Corona-Krise im März 2020 nahm der durchschnittliche Datenverkehr beim Internetknoten DE-CIX in Frankfurt innerhalb weniger Tage um 15 bis 30 Prozent zu.21 Der durch Videokonferenzen verursachte Datenverkehr stieg innerhalb einer Woche um 50 Prozent, beim Online-Gaming lag die Zunahme bei 25 Prozent.22
– Die Zahl der .de-Domains betrug am 1.Oktober 2020 rund 16,56 Millionen - 23 gegenüber 4 Mio. registrierten .de-Domains im Jahr 2000 und 12,5 Mio. im Jahr 2010.24
– Fast die Hälfte der größeren Unternehmen (250 Beschäftigte und mehr) sind „stark digitalisiert“, bei mittleren sind es 37 Prozent und bei kleinen Unternehmen 22 Prozent. Stak digitalisiert bedeutet dabei, dass komplette Prozesse als Datenmodell abgebildet und zur Steuerung verwendet werden. Insgesamt hat die Digitalisierung der Unternehmen zwischen 2020 und 2021 zugenommen. 25 Knapp ein Viertel der Unternehmen erzielen ihren Umsatz hauptsächlich mit digitalen Produkten und Dienstleistungen. Dieser Umsatzanteil ist bei Informations- und Kommunikationsanbieter sowie „wissensintensiven Dienstleistern“ am höchsten, am geringsten im Gesundheitssektor und im Fahrzeugbau. 26 Etwa die Hälfte (48%) der Unternehmen in Deutschland nutzten im Jahr 2019 soziale Medien für ihre Geschäftsaktivitäten.27
– „Kollege Roboter“ ist in den Unternehmen in Deutschland (verarbeitendes Gewerbe) noch keineswegs allgegenwärtig: auf 10.000 Beschäftigte kommen im Jahr 2019 346 Industrieroboter. Mit insgesamt 221.500 Robotern verfügen diese Unternehmen in Deutschland nicht einmal über die Hälfte der Roboter wie in Südkorea, aber mehr als in den USA. 28 Im europäischen Vergleich nimmt Deutschland allerdings den ersten Platz ein.29
– Für digitale Technologien und Dienste wird viel elektrische Energie benötigt: Im Zeitraum von 2010 bis 2017 ist der Energieverbrauch von Rechenzentren in Deutschland um 25 % auf 13,2 Milliarden Kilowattstunden (kWh) angestiegen. Allerdings kann Digitalisierung auch zu Energieeinsparungen führen, sowohl in Rechenzentren selbst als auch in Bereichen, in denen Energie verbraucht wird. Die Energiebilanz der Digitalisierung ist umstritten, unter anderem weil vergleichbare Messdaten fehlen. Besonders energieintensiv ist die Erzeugung von Bitcoins: zwischen 30 bis 75 Milliarden kWh sind dafür erforderlich (zum Vergleich: der Energieverbrauch in Dänemark im Jahr 2016 betrug 30 Mrd. kWh) 30
– Während der Online-Handel seine Umsätze im Jahr 2021 um rund 19,2 Prozent auf 86,7 Milliarden Euro steigern konnte, gingen die Umsätze im stationären Einzelhandel um 0,7 Prozent zurück. In den Branchen Mode und Elektroartikel liegt der Umsatzanteil des Onlinehandels bei ca. 40 Prozent. Große Zuwächse erreichten die Online-Marktplätze. Insgesamt betrug der Umsatz im Online-Handel im Jahr 2919 58,3 Mrd. Euro, im stationären Einzelhandel 477 Mr. Euro. 31
– Informationstechnische Kompetenzen spielen heute in Deutschland in fast allen Berufen eine Rolle. Grundkompetenzen im digitalen Bereich gehörten bereits im Jahr 2018 bei 79 % der Stellenanzeigen zum Anforderungsprofil.32 In einer Studie aus dem Jahr 2018 stellt die Agentur McKinsey fest, dass der Anteil von Tätigkeiten am Arbeitsplatz, die digitale Kompetenzen voraussetzen, von 9 Prozent im Jahr 2002 auf 11% im Jahr 2016 und voraussichtlich 16 % im Jahr 2030 zunehmen werden. Bezogen auf die Arbeitszeit soll im Zeitraum von 2016 bis 2030 die Zunahme 55 Prozent betragen. 33 Fast alle Berufstätige (94 %) nutzen mittlerweile das Internet beruflich.34
– Man schätzt, dass rund die Hälfte aller Arbeitsplätze in der EU von Automatisierung betroffen sein werden. Die Automatisierungswahrscheinlichkeit ist bei 18 % der Arbeitsplätze hoch, bei weiteren 32 Prozent sind erhebliche Veränderungen zu erwarten.35 Das Automatisierungspotenzial (also „die technische Möglichkeit, eine bislang durch den Menschen ausgeführte Tätigkeit computergestützt automatisieren zu können“) wird für Deutschland auf 12 Prozent aller Arbeitsplätze geschätzt, in anderen Volkswirtschaften sind es zum Teil weniger (USA: 9%, 6 % in Südkorea).36
– Buchhändler machen mittlerweile 24,1 Prozent ihres Umsatzes über das Internet (2020).37 Zeitungen gehen immer mehr dazu über, ihre Inhalte auch über das Internet anzubieten. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V. berichtet, dass 56 Zeitungen „Paid-Content-Modelle“ eingerichtet haben, dreißig Prozent mehr als im Jahr zuvor. Besonders wichtig für die Nachfrage nach diesen Angeboten seien „Leitartikel und Kommentare zu regionalen und lokalen Themen“ sowie „exklusive und regionale Geschichten“.38 Medienunternehmen wie Springer oder Burda erzielen „mehr als die Hälfte ihrer Umsätze mit digitalen Geschäftsmodellen“39.
– Dem entspricht ein verändertes Informationsverhalten der Nutzer: Im Jahr 2016 informierten sich drei Viertel (76 Prozent) der Internetnutzer in Deutschland im Internet über aktuelle Ereignisse. Dabei spielen Online-Angebote von Fernsehsendern (54 Prozent) und Printmedien (52 Prozent) eine wichtige Rolle.40 Die Reichweite der digitalen Zeitungsangebote in Deutschland beträgt rund 70 Prozent der Bevölkerung (Zeitraum: September bis November 2021). Bei den jüngeren Altersgruppen liegt sie höher (rund 82 Prozent bei den 30- bis 49-Jährigen), in der Gruppe ab 50 Jahren liegt sie bei rund 61 Prozent.41 Über die Onlineangebote Facebook und Google gelangen 80 Prozent der Internetnutzer an Nachrichteninhalte.42
– Die Bedeutung des Internets für die Meinungsbildung ist nach Berechnungen der Landesmedienanstalten von 13 % im Jahr 2009 auf 26 % im Jahr 2017 gestiegen.43 Damit kommt das Internet auf den zweiten Platz nach dem Fernsehen und vor Radio, Tageszeitung und Zeitschriften. Diese Ausgabe bezieht sich allerdings nur auf redaktionelle Angebote im Internet wie zum Beispiel Verlagsangebote oder Nachrichtenseiten von t-online.de oder web. de.
– Sechsunddreißig Prozent der Menschen in Deutschland nutzen Onlinecommunities wie Facebook oder Instagram mindestens einmal wöchentlich.44 Mehr als die Hälfte der Jugendlichen nutzt Instagram täglich. Weltweit nehmen im vierten Quartal 2020 etwa 2,8 Milliarden Menschen die Angebote des Konzerns Facebook in Anspruch (Facebook, WhatsApp und Instagram).45 Der Messengerdienst Whatsapp verzeichnete im Jahr 2019 58 Mio. tägliche Nutzer in Deutschland. 46 Siebzig Prozent der Deutschen ab 14 Jahren nutzten ihn täglich.47
– Insbesondere in Großstädten verwenden die Bürger das Internet häufig für die Kommunikation mit Behörden (42 Prozent in Brandenburg und 60 Prozent in Hamburg und Berlin). Meist handelt es sich dabei um die digitale Übermittlung von Formularen (in Schleswig-Holstein haben dies 34 % der Bevölkerung wahrgenommen, in Bayern 50 Prozent), vollständig digital werden nur 25 Prozent der Verwaltungsdienstleistungen in Kommunen angeboten (Daten von 2021). 48
– Die Digitalisierung im Gesundheitswesen („Digital Health“) nimmt an Bedeutung stark zu: Im Jahr 2025 wird ein Umsatz von 1 Billion Euro in diesem Bereich erwartet (weltweit), davon 239 Mrd. Euro in der EU und 59 Mrd. Euro in Deutschland.49 Mobile Gesundheits-Apps und KI-Anwendungen spielen dabei eine große Rolle, der Umsatz durch künstliche Intelligenz im Rahmen von Gesundheits-IT-Anwendungen soll sich weltweit von 4,9 Mrd. US-Dollar auf 45,2 Mrd. US-Dollar erhöhen.50
– Die deutsche Wirtschaft investiert große Summen in Forschungsprojekte zur Digitalisierung: Im Jahr 2018 betrugen diese Forschungsausgaben 60 Mrd. Euro, eine Steigerung um 9 % zum Vorjahr.51 Fünf Milliarden Euro investiert die Bundesregierung in die Entwicklung der künstlichen Intelligenz („Strategie Künstliche Intelligenz“).52
Diese Zusammenstellung macht deutlich, wie weitgehend digitale Technologien in alle Lebensbereiche der Gesellschaft eingedrungen sind und wie sehr sie diese prägen. Sie zeigt aber auch, dass digitale und nicht-digitale Bereiche eng miteinander verwoben sind. Digitalisierung bedeutet eben nicht, dass „alles nun virtuell“ ist. Sehr deutlich wird dies zum Beispiel bei einem Blick auf die modernen Logistik-Ketten und Distributionsmechanismen in der Wirtschaft: Die Digitalisierung hat hier zu radikalen Veränderungen geführt, dennoch handelt es sich bei der Distribution von Waren immer noch weitgehend um physische Prozesse (die Soziologin Sabine Pfeiffer spricht in diesem Sinne von der „Digitalisierung als Distributivkraft“).53
2.5 Digitalisierung als gesellschaftlicher Metaprozess
Das technische Verfahren der Digitalisierung ist die Grundlage für die Digitalisierung als gesellschaftlichen Metaprozess, der alle Bereiche der gesellschaftlichen Wirklichkeit erfasst. Der Kommunikationswissenschaftler Friedrich Krotz verwendet den Begriff „Metaprozess“ in Bezug auf die Mediatisierung und vergleicht diese mit Prozessen der Globalisierung, Individualisierung und Ökonomisierung. 54 Digitalisierung wird als „Megatrend“ beschrieben, als „industrielle Revolution“, als weltweites Epochenphänomen und umfassender Prozess der Transformation. In ihrer Bedeutung wird sie wird mit der Erfindung des Buchdrucks verglichen.55 Digitalisierung ist durch disruptive, also grundlegende und unvorhersehbare Veränderungen gekennzeichnet.
Der Grund für diese universelle Verbreitung der Digitalisierung liegt in den oben bereits angesprochenen Eigenschaften des „Digitalen“, die sie von anderen Technologien abheben und ihre herausragende Bedeutung erklären:56
– Digitale Technologien verarbeiten Informationen, nicht Dinge. In diesem Sinn sind sie abstrakt, denn sie sehen von realen gegenständlichen Eigenschaften ab, sie sind unkörperlich, d. h. nicht an einen bestimmten materiellen Träger gebunden, und universell, also für die vielfältigsten Zwecke nutzbar.
– Weil digitale Informationen nicht fest an einen materiellen Träger gebunden sind, lassen sie sich schnell und einfach übertragen, speichern und bearbeiten.
– Digitale Technologien repräsentieren Merkmale und Eigenschaften durch Zeichen (Codes), die von Maschinen verarbeitet werden können. Dabei sind sie weder an eine sensorische Modalität (Sehen, Hören) noch an ein vorgegebenes Zeichensystem (wie etwa das Alphabet) gebunden.
– Bei digitalen Technologien lassen sich Input, Throughput (Verarbeitung) und Output voneinander trennen, separat optimieren und fast grenzenlos kombinieren. Einzelne Funktionen lassen sich in Module auslagern, die getrennt vom Gesamtgerät arbeiten (etwa als KI-Chips in Smartphones zur Sprachverarbeitung).
– Digitale Technologien können als informationsverarbeitende Systeme kognitive Leistungen simulieren (wie etwa die Erkennung von Mustern), was in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen genutzt wird (z. B. Roboter, industrielle Fertigung, autonomes Fahren und Gesichtserkennung).
Während der Begriff „Digitalisierung“ die Prozessperspektive aktualisiert, könnte man auch fragen, was das Ergebnis dieses Prozesses ist. Dafür wird der Begriff „Digitalität“ vorgeschlagen, der eine bestimmte Eigenschaft des Digitalen bezeichnet. Die Welt, in der wir leben, ist aktuell von einer weitgehenden Vermischung analoger und digitaler Elemente gekennzeichnet. Es ist keine digitale, sondern eher eine „hybride Welt“. So hat die Digitalisierung beispielsweise den Vorgang der menschlichen Kommunikation verändert, in dem nun analoge und digitale Elemente eine Rolle spielen. Die Digitalität der technisch vermittelten Kommunikation ist unter anderem, dass sie unabhängig von Ort und Zeit stattfinden und fast unbegrenzt viele Teilnehmer einbeziehen kann, jederzeit reproduzierbar ist und multimedial oder virtuell unterstützt ablaufen kann. Diese Eigenschaften machen die Digitalität der Kommunikation aus.57 Die Veröffentlichung dienstlicher oder privater E-Mails gegen den Willen der Betroffenen oder die virale Verbreitung digitaler Mitteilungen sind Beispiele dafür, wie durchgreifend diese digitale Qualität die Kommunikation und ihre Wirkungen verändern kann.
Die Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche durch digitale Technologien und die damit verbundenen Veränderungsprozesse konstituieren eine hybride, digital geprägt Welt, wofür unter anderem die Begriffe „deep mediatization“ und „onlife“ geprägt wurden.58 Der Kulturwissenschaftler Felix Stadler spricht von einer „Kultur der Digitalität“, die auf den spezifischen Eigenschaften des Digitalen beruht und durch Referenzialität (Bezugnahme), Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität gekennzeichnet ist.59 Auch der Bereich des Politischen lässt sich nicht unabhängig von der Digitalisierung als Metaprozess diskutieren, sondern muss immer bereits in seiner „digitalen Konstellation“60 verstanden werden. Dies gilt beispielsweise für die Themen Repräsentation, Partizipation, Öffentlichkeit und Machtausübung (vgl. dazu ausführlich Kapitel 3).
Eine weitere Bedeutungsebene des Begriffs „Digitalisierung“ erschließt der Soziologe Armin Nassehi, wenn er fragt, für welches Problem die Digitalisierung die Lösung ist. Dieses Problem sieht er in der Komplexität und Regelmäßigkeit der modernen Gesellschaft: „Die moderne Gesellschaft [stößt] vor allem mit ihrer digitalen Form der Selbstbeobachtung auf jene Regelmäßigkeiten …, auf jenen Eigensinn und jene Widerständigkeit, die gesellschaftliche Verhältnisse ausmachen.“ 61 Durch die „Verdoppelung der Welt in Datenform“ zum Beispiel mit dem Aufkommen der Sozialstatistik im 18. Jahrhundert wird nach Nassehi die moderne Gesellschaft überhaupt erst sichtbar und beschreibbar. Bei aller Verschiedenheit der sozialen Phänomene offenbart diese Art der Betrachtung nach Nassehi durchgehende „Muster“, die in vormodernen Gesellschaften beispielsweise durch äußerliche Kennzeichen (Kleidung, Rang- und Funktionszeichen) kenntlich gemacht wurden. Das bedeutet, „dass die Digitalisierung unmittelbar verwandt ist mit der gesellschaftlichen Struktur“.62
Dieser soziologische Ansatz zur Aufklärung des Begriffs der „Digitalisierung“ ist im vorliegenden Zusammenhang deshalb relevant, weil er den Blick auf die Bedeutung der vorausliegenden Strukturen und Bedingungen lenkt, die für den Prozess der Digitalisierung von Bedeutung sind. Die Digitalisierung ist demnach – so könnte man den Gedanken Nassehis fortführen – nicht nur die Lösung für das Problem der Selbstentdeckung und Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft, sondern auch für viele jeweils konkrete Probleme und Anforderungen. Die Digitalisierung kann sich nur deshalb so universell und durchdringend ausbreiten, weil sie Lösungen für bereits existierende oder sich herausbildende Bedarfe, Anforderungen und Probleme bietet. Das Smartphone ist in diesem Sinne ein Werkzeug für die Kommunikation, Information, Alltagsbewältigung, Teilhabe und Selbstdarstellung. Allerdings „löst“ es nicht nur Probleme, es schafft auch neue, zum Beispiel die zunehmende Abhängigkeit von diesem digitalen Werkzeug.
2.6 Zusammenfassung
Das Kapitel gibt einen Überblick über die technischen Grundlagen der Digitalisierung, über die Entwicklung der entsprechenden Technologien und über wesentliche „Kennzahlen“ zum Einsatz digitaler Verfahren in den unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Der Begriff „Digitalisierung“ im engeren Sinne bezeichnet den Vorgang der Umwandlung analoger in digitale Informationen, zum Beispiel bei der Aufzeichnung von auditiven Signalen oder von Messwerten. Diese können durch Computer (Mikroprozessoren) verarbeitet, übertragen, vervielfältigt, ausgegeben und gespeichert werden. Die Verarbeitung der Daten wird durch Programme gesteuert. Computer lassen sich zu lokalen Netzwerken und mit dem Internet (dem „Netzwerk der Netzwerke“) verbinden. Anwendungen in der Cloud (im Internet) ermöglichen die Datenverarbeitung im Internet weitgehend unabhängig vom Endgerät. Die Verfahren der „künstlichen Intelligenz“ sind die Grundlage für komplexe Datenanalysen, Sprachverarbeitung und maschinelles Sehen. Roboter verfügen zunehmend über derartige „intelligente“ Fähigkeiten. Weitere Technologien sind „virtuelle Realität“ und der dreidimensionale Druck (3D-Druck).
Die Entwicklung der Digitalisierung führte von Großrechnersystemen über Einzelplatzrechner („Personal Computer“) hin zu immer kleineren, mobilen Geräten (Tablets und Smartphones). Entscheidende Bedeutung für die Entwicklung der Digitalisierung hatten das Internet und die internetbasierten Anwendungen wie zum Beispiel die „Hypertext-Markup-Language“ (HTML), das World Wide Web und die sozialen Netzwerke. Wichtige Meilensteine der Entwicklung waren die Technologien zur Datenanalyse (unter Einsatz neuronaler Netzwerke), die Blockchaintechnologie (auf der Kryptowährungen wie Bitcoin beruhen) und Cloud-Anwendungen. Aktuell geht es unter anderem um das Internet der Dinge (IoT), neuronale Netzwerke, autonomes Fahren und die Vernetzung mit dem Mobilfunkstandard 5G (um nur einige Beispiele zu nennen).
Der Abschnitt 2.4 „Kennzahlen der Digitalisierung“ mach die weitgehende Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche durch die Digitalisierung deutlich, zeigt aber auch, dass Digitalisierung noch nicht überall flächendeckend zum Einsatz kommt (etwa bei kleineren Unternehmen, bei Behörden und im Gesundheitswesen). Besonders deutlich wird die Bedeutung der Digitalisierung für die Bereiche Information, Kommunikation und Medien.
Die weitgehend Durchdringung aller Lebensbereiche durch die Digitalisierung rechtfertigt es, von der Digitalisierung als „gesellschaftlichem Metaprozess“ zu sprechen, der ebenso grundlegende Veränderungen bewirkt wie die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert. Ermöglicht wird dies durch die Eigenschaften des „Digitalen“: Informationen werden von ihrem materiellen Träger weitgehend gelöst, digital gespeichert und übertragen und lassen sich in die unterschiedlichsten Zeichen und Codes übersetzen. Dazu kommt, dass digitale Technologien weitestgehend modularisierbar sind, sowohl was die Hardware also auch was die Software angeht. Dies ermöglicht es, immer leistungsfähigere Geräte und Anwendungen zu entwickeln. Während der Begriff „Digitalisierung“ die Prozessperspektive bezeichnet, lässt sich das Ergebnis als „Digitalität“ beschreiben. Zwischenmenschliche Kommunikation mit Hilfe digitaler Technologien beispielsweise bekommt die Eigenschaft der „Digitalität“, die sie von einer rein analogen Kommunikation („face-to-face“) unterscheidet. In diesem Sinn kann man von einer „Kultur der Digitalität“ (Stalder) sprechen. Eine weitere Perspektive tut sich auf, wenn man die Digitalisierung als technische Abbildung gesellschaftlicher Muster begreift, als eine Methode zur „Verdoppelung der Welt in Datenform“ (Nassehi).
3 VDI-Lexikon Informatik und Kommunikationstechnik, herausgegeben von Manfred Broy und Otto Spaniol (1999), S. 196. „Quantisierung“ bedeutet, dass die Signalstärke zu allen erfassten Zeitpunkten gemessen wird.
4 So etwa der humanoide Roboter Sophia, dessen Selbstportrait bei einer Auktion den Preis von 688.888 Dollar erzielte. https://www.heise.de/news/Roboter-Selbstportraet-fuer-fast-700-000-US-Dollar-versteigert-6000322.html. HINWEIS: alle URLs in diesem Buch wurden am 3.11.2022 überprüft.
5 Exemplarisch sei an dieser Stelle auf einige weiterführende Informationen zu wesentlichen technologischen Grundlagen und Entwicklungen der Digitalisierung verwiesen: Kurose/ Ross (2014) Computernetzwerke (Internetstrukturen, -protokolle und -dienste), Paas/ Hecker (2020) Künstliche Intelligenz (Wissensbasierte KI und neuronale Netzwerke), Russel/ Klassen (2018) Mining the social web (Daten-Gewinnung und Analyse aus sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook und Instagram), Farwick/ Schmidt/ Trojer (2020) „Cloud-Computing“ (grundlegende Übersicht), D’Onofrio/ Meier (2021) Big Data Analytics (Grundlagen in Teil I, Wissen aus Daten generieren) und Meinel/ Gayvoronskaya (2020) Blockchain. Hype oder Innovation (kryptografische Grundlagen, Anwendungen, Einsatzbereiche).
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Robotik#Geschichte.
7 Vgl. https://www.vdi-wissensforum.de/news/robotik-und-kuenstliche-intelligenz/#.
8 https://www.oracle.com/de/big-data/what-is-big-data/.
9 https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_k%C3%BCnstlichen_Intelligenz#Maschinelles_Lernen_und_neuronale_Netze.
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Bitcoin.
11 https://www.heise.de/hintergrund/Entwicklung-des-Web3-eine-Bestandsaufnahme-6537074.html.
12 Die Angaben beziehen sich auf die Bunderepublik Deutschland. Meist liegen nur Daten für einzelne Zeitpunkte vor, seltener Zeitreihen, die eine chronologische Entwicklung widerspiegeln könnten. Informativ sind u. a. die folgenden Quellen: Deutschlandindex der Digitalisierung: https://www.oeffentliche-it.de/digitalindex; bidt-SZ-Digitalbarometer: https://www.bidt.digital/wp-content/uploads/2022/01/ Analysen-Studien-bidt-SZ-Digitalbarometer.pdf; Breitbandatlas: https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html; ARD-ZDF-Onlinestudie: https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/; Bitkom-ifo-Digitalindex: https://www.bitkom.org/Marktdaten; JIM-Studie des medienpädagogischen Forschungsverbundes: https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2020/.
13 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153257/umfrage/haushalte-mit-internetzugang-in-deutschland-seit-2002/.
14 Der „Deutschlandindex der Digitalisierung“ weist dazu die Zahlen für die einzelnen Bundesländer aus (2021): https://www.oeffentliche-it.de/documents/10181/14412/Deutschland-Index+der+Digitalisierung+2021.
15 https://netzda-mig.de/breitbandatlas/interaktive-karte (Bezugsjahr 2021).
16 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160925/umfrage/ausstattungsgradmit-personal-computer-in-deutschen-haushalten/ (Bezugsjahr 2020: 91,9 %).
17 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/198642/umfrage/anteil-der-haushalte-in-deutschland-mit-einem-mobiltelefon-seit-2000/.
18 https://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2020/pdf-dateien-2020/kapitel-h-2020.pdf, S. 238 (Bezugsjahr 2018).
19 https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2021/Beisch_Koch.pdf.
20 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3565/umfrage/datenvolumen-desbreitband-internetverkehrs-in-deutschland-seit-dem-jahr-2001/.
21 https://www.verivox.de/internet/nachrichten/internet-verkraftet-anstieg-desdatenverkehrs-in-der-pandemie-1117761/.
22 https://www.internetworld.de/marketing-praxis/video/corona-krise-50-prozentvideokonferenzen-2516227.html.
23 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/39530/umfrage/entwicklung-derdomainzahl-mit-endung-de/#professional.
24 https://www.denic.de/wissen/statistiken/monatsauswertung-de/.
25 https://www.de.digital/DIGITAL/Navigation/DE/Lagebild/lagebild.html.
26 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/monitoringreport-wirtschaft-digital-2018-langfassung.pdf%3F blob%3DpublicationFile%26v%3D4, S. 30f (2018).
27 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2020/ PD20_35_p002.html.
28 https://de.statista.com/infografik/13676/roboterdichte-in-der-fertigungsindustrie/.
29 https://www.kollegeroboter.de/industrie/die-7-wichtigsten-zahlen-zur-robotik-736.html.
30 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/schwerpunktstudie-digitalisierung-energieeffizienz.pdf? blob=publicationFile&v=12, S. 12f.
31 https://einzelhandel.de/index.php?option=com_attachments&task=download&id=10572.
32 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2020/august/digitalisierung-durchdringt-die-gesamte-arbeitswelt.
33 https://www.mckinsey.com.br/de/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20 middle%20east/deutschland/news/presse/2018/2018-05-24/studienreport_mgi_ skill%20shift_automation%20and%20future%20of%20the%20workforce_may%20 2018.pdf, S. 7 und ii.
34 https://www.bidt.digital/wp-content/uploads/2022/01/Analysen-Studien-bidt-SZ-Digitalbarometer.pdf, S. 48.
35 https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Digitalisierung-der-Arbeitswelt/digitalisierungder-arbeitswelt.html.
36 https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2020/heft/13/beitrag/digitalisierung-und-die-zukunft-der-arbeit.html. Zu den untersuchten Fähigkeiten gehören IT-Expertise, Programmier- und Analysekenntnisse sowie wissenschaftliche Forschungs- und technische Designfähigkeit. Andere Untersuchungen kommen zu einem weit höheren Prozentsatz an Arbeitsplätzen (30-60%), die vollständig rationalisiert werden können (vgl. Oswald/ Borucki 2020, S. 116).
37 https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/wirtschaftszahlen/ branchenumsatz-und-branchenentwicklung/.
38 https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/journalismus-im-netz-diegunst-des-geldverdienens/20929548.html und https://www.presseportal.de/ pm/6936/2568293.
39 https://high-potential.com/karriereplanung/skills/zukunft-der-medienbranche/.
40 Das hat eine repräsentative Befragung unter 1.042 Internutzern im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben: https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/ import/Bitkom-Charts-PK-Digitalisierung-der-Medien-22-06-2016-final.pdf.
41 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/274883/umfrage/reichweite-der-digitalen-zeitungsangebote-in-deutschland/.
42 https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/journalismus-im-netz-diegunst-des-geldverdienens/20929548.html (Analysetool Parse.ly).
43 https://www.kek-online.de/fileadmin/user_upload/KEK/Publikationen/Gutachten/ Meinungsmacht_im_Internet_ALM51_web_2018.pdf, S. 66. In der Gewichtungsstudie werden die tägliche Reichweite („Nutzung gestern“) im Bereich der informativen Nutzung sowie das wichtigste Informationsmedium für die Einzelmedien Fernsehen (erstes Halbjahr 2017: 31 % – 34 %), Radio (26 % – 11 %), Internet (21 % – 29 %), Tageszeitung (18 % – 21 %) sowie Zeitschriften (inkl. Nachrichtenmagazine und Wochenzeitungen) (6 % – 2 %) erfasst. Der daraus gemittelte Wert ergibt das „potenzielle Gewicht für die Meinungsbildung“.
44 https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2020/0920_Beisch_Schaefer.pdf.
45 https://de.statista.com/themen/138/facebook/#dossierKeyfigures.
46 https://www.messengerpeople.com/de/weltweite-nutzer-statistik-fuer-whatsappwechat-und-andere-messenger/#Deutschland.
47 https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/ardzdf-onlinestudie/pressemitteilung/.
48 https://www.oeffentliche-it.de/documents/10181/14412/Deutschland-Index+der+Digitalisierung+2021, S. 28 und S. 33.
49 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1178751/umfrage/umsatz-auf-demmarkt-fuer-digital-health-weltweit/#professional.
50 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/971348/umfrage/umsatz-durch-kuenstliche-intelligenz-im-gesundheitswesen/.
51 https://digital-magazin.de/digitale-forschung-studie/.
52 https://www.bmbf.de/de/kuenstliche-intelligenz-5965.html.
53 Vgl. Pfeiffer (2021), S. 189.
54 Krotz (2015), S. 440. Vgl. auch Thimm (2018), S. 162, und Roth-Ebner u. a. (2018), S. 13 ff. Mediatisierung und Digitalisierung hängen eng zusammen, worauf in Kapitel 3 an konkreten Beispielen (z. B. „Öffentlichkeit“) noch eingegangen wird.
55 Der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan spricht vom „Ende der Gutenberggalaxis“ (1962 The Gutenberg Galaxy).
56 Zur Begrifflichkeit: Das „Digitale“ bezeichnet die digitalen Systeme und Umgebungen, mit dem im Folgenden verwendeten Begriff „Digitalität“ werden die kennzeichnenden Eigenschaften dieser Systeme und ihrer Anwendung bezeichnet.
57 So verändert sich beispielsweise die Interaktion zwischen Menschen in Situationen, die durch digitale Medien geprägt sind („synthetische Situationen“, vgl. Reichmann 2018, S. 87 f. und S. 91 ff.).
58 Thiel (2020), S. 333.
59 Stalder (2017), zitiert nach Thiel (2017), S. 204f. Ähnlich die Bestimmung des Begriffs „digitale Kultur“ bei Boehme-Neßler (2018), S. 3.
60 Thiel (2020), S. 332.
61 Nassehi (2019), S. 28.
62 Nassehi (2019), S. 18.
3. Demokratie und Digitalisierung
Die Digitalisierung ist eine technologische Revolution, die sich auf alle Bereiche von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft sowie das private Leben auswirkt. Die These dieses Buches ist, dass sich auch die Demokratie als Form politischer Herrschaft unter den Bedingungen der Digitalisierung verändert. Diese Veränderungen sind „Herausforderungen“ für die Demokratie, weil sie grundlegende, strukturelle Merkmale der Demokratie betreffen. Die folgenden Abschnitte analysieren diese Veränderungen im Detail. Grundlage ist eine Konzeption bzw. ein Modell von Demokratie, das sieben Dimensionen unterscheidet: Volkssouveränität, Öffentlichkeit, Partizipation, Legitimität, Grundrechte und Grundwerte, Gewaltenteilung und Parteien (vgl. Abschnitt 3.1 „Was ist Demokratie“). Das vierte Kapitel „Rahmungen“ diskutiert die Frage, inwieweit diese Veränderungen als „Krise“, Erosion“ oder als „Formwandel“ der Demokratie zu deuten sind, es fragt nach dem Verhältnis von technologischen Entwicklungen und politischen Institutionen („Technikfolgeabschätzung“) und entwirft einen Verständnisrahmen für die untersuchten Prozesse, der sich an dem (soziologischen) Ansatz der zweiten Moderne (und seinem Begriff der „Nebenfolgen“) von Ulrich Beck orientiert.
3.1 Was ist Demokratie?
Um die Frage untersuchen zu können, wie sich Digitalisierung und Demokratie zueinander verhalten, wird in diesem Abschnitt zuerst die Herrschaftsform „Demokratie“ genauer beschrieben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der repräsentativen bzw. parlamentarischen Demokratie, wie sie insbesondere in westlichen Staaten verbreitet ist. Bezugspunkt ist dabei im Wesentlichen die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland. Obwohl die Demokratie heute in vielen Staaten eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint, so ist die Frage „Was ist Demokratie?“ dennoch berechtigt. Nur vor dem Hintergrund einer differenzierenden Beschreibung der Herrschaftsform „Demokratie“ lässt sich beurteilen, welche Auswirkungen die Digitalisierung hat, wie sich die Demokratie gegebenenfalls verändert und welche Entwicklungen ihren grundlegenden Prinzipien widersprechen. Das vorliegende Kapitel gibt eine sehr kurzgefasste Übersicht über verschiedene Definitionen der Demokratie, ihre geschichtliche Entwicklung und unterschiedliche Demokratietheorien. Dabei werden auch verschiedene empirische Ansätze beispielsweise zur Messung der Demokratiequalität in verschiedenen Ländern erläutert. Schließlich wird das in diesem Buch zugrunde gelegte Konzept der sieben „Dimensionen“ der Demokratie vorgestellt.
Definition der Demokratie als Herrschaftsform
Demokratie ist eine Herrschaftsform, bei der das Volk der Souverän ist, also über sich selbst herrscht. Das griechische Wort „demos“ bedeutet „Volk“ (im Sinne von „Bürgern“) und das Verb „kratein“ bedeutet „herrschen“. Das Begriffsverständnis von „Demokratie“ in der Politikwissenschaft ist allerdings vielfältig und abhängig von der theoretischen Orientierung der jeweiligen Autoren.63 Die Vielfalt an Definitionen hängt auch damit zusammen, dass Demokratie nicht nur ein deskriptiver, sondern auch ein normativer Begriff 64 ist und dass es unterschiedliche Modelle und Formen der Demokratie gibt: direkte, parlamentarische und präsidentielle Demokratie.65 Sehr bekannt ist die Definition der Demokratie durch Abraham Lincoln in seiner Gettysburg-Rede von 1863 als „Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk“ („government of the people, by the people, for the people“).66 Eine aktuelle, ausführlichere Definition lautet:
„Die Demokratie ist eine Staatsverfassung, in der die Herrschaft bzw. die Machtausübung auf der Grundlage politischer Freiheit und Gleichheit sowie weitreichender politischer Beteiligungsrechte erwachsener Staatsbürger erfolgt. Im Idealfall geschieht dies in offenen, die Opposition gleichberechtigt einschließenden Vorgängen der Willensbildung und Entscheidungsfindung. Und geherrscht wird mit dem Anspruch, im Interesse der Gesamtheit oder zumindest der Mehrheit der Stimmberechtigten zu regieren. Dabei stehen die Herrschaft und die Machtausübung unter dem Damoklesschwert der Abwahl der Regierenden durch den Demos, den stimmberechtigten Teil des Volkes. Die Waffen des Demos gegen die Regierenden sind das Wahlrecht und die Chance, die Volksvertreter oder die Regierungschefs in allgemeinen, freien und fairen Wahlen zu wählen oder abzuwählen.“67
Das „Kleine Lexikon der Politik“68 nennt die folgenden Kennzeichen der Demokratie:
– Volkssouveränität und Gleichheit,
– Geltung bürgerlicher Grundrechte,
– Demokratische Partizipationsrechte (Wahlrecht, Öffentlichkeit, Opposition),
– Responsivität der Regierenden.
Als weitere Kennzeichen der Demokratie werden häufig angeführt: Parlamentarismus, Mehrparteiensystem, Mehrheitsregel, Minderheitenschutz, organisierte Interessenvielfalt und geregelte Konfliktaustragung, Meinungsfreiheit, sozialstaatliche Mindestgarantieren sowie Unverletzlichkeit und Freizügigkeit der Person (Menschenwürde, Grundrechte).69 Eine allgemein akzeptierte Begriffsbestimmung von Demokratie allerdings gibt es nicht: „Kurz gesagt ist heute umstrittener denn je, was Demokratie bedeutet, voraussetzt oder verlangt“.70
Entwicklung der Demokratie
„Erfunden“ wurde die Demokratie von den Griechen im sechsten und fünften Jahrhundert vor Christus. Kleisthenes (570 - 507) und Perikles (490 429) werden als die Väter der attischen Demokratie bezeichnet. Die Demokratie Athens war eine direkte Demokratie mit Institutionen wie der Volksversammlung (ekklesia), dem Rat der Fünfhundert (boule) und den Volksgerichten (dikasterien).71 An der Volksversammlung konnten alle männlichen Bürger Athens teilnehmen, Frauen, Sklaven und Fremdarbeiter („Metöken“) hatten keinen Zugang. Die ekklesia tagte etwa vierzigmal im Jahr auf einem Marktplatz im Athener Stadtgebiet, später auf einem Hügel. Beschlussfähig war sie ab einer Teilnehmerzahl von 6.000 Personen.72 Berufspolitiker gab es damals nicht, ebenso wenig eine Trennung in die gesetzbegebende, ausführende und rechtsprechende Gewalt. Die Bürger trafen die Entscheidungen in allen politischen Fragen selbst.
Mit der Machtübernahme durch den mazedonischen König Philipp II. gegen Ende des vierten Jahrhunderts v. Chr. verlor die Demokratie in Athen als Herrschaftsform ihren prägenden Einfluss. Erst im sechzehnten Jahrhundert finden sich wieder erste Ansätze demokratischen Denkens. Machiavelli stellte in seinen „Discorsi“ der Monarchie die Republik als Selbstregierung der Bürgerinnen und Bürger gegenüber. Die „vordemokratische Staatstheorie“ (Hobbes, Locke) entwickelte das Konzept des Staates, die Idee des „Souveräns“ (Machthabers) und die Theorie des Staatsvertrages. Rousseau und Montesquieu diskutierten in ihren Schriften grundlegende Ideen zur Selbstregierung des Volkes wie den Gesellschaftsvertrag und die Gewaltenteilung. Die Aufklärung formulierte grundlegende Wertvorstellungen wie die Freiheit des Individuums und die Idee des Nationalstaates. In der französischen Revolution 1789-1799, der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 1789 und der Verfassung von 1791 fanden diese Ideen konkrete, geschichtliche Gestalt. In diese Zeit fällt auch die Verabschiedung der US-amerikanischen Verfassung (1776), in deren Folge in den USA eine Form der repräsentativen Demokratie entstand.
In Deutschland wurde die parlamentarische Demokratie als Regierungsform nach dem ersten Weltkrieg mit der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung am 31.7.1919 eingeführt. Mit der Verkündung des Grundgesetzes am 23.5.1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland zu einem demokratischen, sozialen Bundesstaat (Art. 20 GG). Seit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik am 3.10.1989 gilt das Grundgesetz als Verfassung für das gesamte deutsche Staatsgebiet.
Insbesondere in der „westlichen Welt“ ist die Herrschaftsform der Demokratie stark verbreitet. Im Jahr 2020 stuft der Demokratieindex der englischen Zeitschrift „The Economist“ insgesamt 75 Länder als „vollständige“ oder „nichtvollständige“ Demokratien (49,4 % der Weltbevölkerung) ein, ihnen standen 93 Länder als Nicht-Demokratien (hybride und autoritäre Systeme; insgesamt 50% der Weltbevölkerung) gegenüber.73 Sowohl der Freedom-House-Index74 als auch der Transformationsindex der Bertelsmann-Stiftung75 stellen allerdings einen deutlichen Rückgang in der Zahl demokratisch regierter Länder fest, auch die Qualität demokratischen Regierens habe - unter anderem im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie – deutlich abgenommen.76
Normative und empirische Demokratietheorie
Das grundlegende Verständnis von dem, was eine Demokratie ausmacht, lässt sich in verschiedenen „Demokratiemodellen“ beschreiben. Die Entwicklung dieser Modelle ist Aufgabe der „Demokratietheorie“, die sich mit den normativen Anforderungen an die Demokratie (wie zum Beispiel die Gewährleistung von Freiheits- und Grundrechten für die Bürger) und mit ihrer empirischen Beschreibung und Analyse beschäftigt. Grundlegend sind hier zum Beispiel die liberal-pluralistische, die republikanische und die deliberative Demokratietheorie.77 Dem englischen Philosophen John Stuart Mill (1806-1873) als Vertreter der liberalen Demokratietheorie geht es in seinen Schriften um die „Verteidigung der Freiheit der Bürger“, „um die erzieherische Funktion politischer Beteiligung am Willensbildungsprozess und an Wahlen“ sowie um „die Sorge um die Kompetenz der politischen Führung und die Effizienz der Regierungsmaschinerie“.78Kennzeichnend für die liberal-pluralistische Demokratietheorie im 20. Jahrhundert ist „die Betonung individueller Autonomie, repräsentativer Demokratie sowie rechtlicher Sicherungen als integraler Bestandteil der Demokratie“.79
Auch „radikale Demokratietheorien“ wie zum Beispiel das „agonistische Demokratiemodell“ von Chantal Mouffe, das von unaufhebbaren Interessenwiedersprüchen und dem „lebhaften Zusammenstoß demokratischer politischer Positionen“ ausgeht, sind hier zu nennen.80 Demokratiemodelle lassen sich danach unterscheiden, ob sie nur relativ geringe normative Anforderungen stellen („thin-democracy“) wie die Orientierung am Begriff der individuellen („negativen“) Freiheit, der Begrenzung staatlicher Macht, Gleichheit der Bürger und allgemeines Wahlrecht, oder ob sie weitere Anforderungen an die demokratische Herrschaftsform formulieren wie etwa „positive Freiheit“, Partizipation der Bürger und eine gemeinwohlorientierte Politik („strong-democracy“).81
Themen der empirischen Demokratieforschung sind zum Beispiel die Überprüfung einer „rationalen“ Theorie der Demokratie, die von der individuellen Nutzenmaximierung der Bürgerinnen und Bürger ausgeht, sowie die Klärung der Frage, welche Regierungssysteme als demokratisch zu bezeichnen sind und welche nicht. Um diese Frage beantworten zu können, wurden unterschiedliche Klassifikations- und Messsysteme entwickelt.82 Diese sollen es ermöglichen, demokratische von undemokratischen Staaten zu unterscheiden und bestimmte Eigenschaften von demokratischen Systemen zu bestimmen.
Sehr bekannt ist der „Freedom-House-Index“, der die Verwirklichung von politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten misst. Für den Bereich „politische Rechte“ gibt es in der aktuellen Version dieses Verfahrens83 zehn Indikatoren, die in drei Unterkategorien gegliedert sind: „Wahlvorgang“, „politischer Pluralismus und Partizipation“ und „Funktionieren der Regierung“. Ein Indikator aus dem Bereich „Wahlvorgang“ lautet beispielsweise: „Wurde das aktuelle Regierungsoberhaupt beziehungsweise die führende nationale Autorität durch freie und gerechte Wahlen gewählt?“ Zu jedem Indikator werden Fragen vorgegeben wie zum Beispiel „Konnten die Wähler für ihre Kandidaten oder ihre Partei ihre Stimme abgeben, ohne unangemessenen Druck oder Einschüchterung?“ Auf der Grundlage dieser Fragen bewerten Experten jeden der vorgegebenen Indikatoren und vergeben eine entsprechende Punktezahl. Für den Bereich „politische Rechte“ sind maximal 40 Punkte möglich, im Bereich „civil rights“ können Staaten bis zu 60 Punkte erreichen. Aus der Kombination dieser Punktezahlen wird dann die Einstufung des jeweiligen Staates als „frei“, „teilweise frei“ und „nicht frei“ abgeleitet. Auf der Grundlage der erhobenen Daten lässt sich bestimmen, welche Staaten als „Wahl-Demokratien“ („electoral democracies“) gelten können. Dazu sind bestimmte Mindesteinstufungen in der Unterkategorie „Wahlvorgang“ und den Bereichen „politische Rechte“ sowie „zivile Freiheiten“ erforderlich.
Der „Transformationsindex“ der Bertelsmann-Stiftung enthält ebenfalls Kriterien, die es erlauben, zwischen „Demokratien“ und „Autokratien“ zu unterscheiden.84 Dabei werden sieben Indikatoren berücksichtigt:
1. Freie und faire Wahlen
2. Effektive Regierungsgewalt
3. Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit
4. Presse- und Meinungsfreiheit
5. Gewaltenteilung
6. Bürgerrechte
7. Staatliches Gewaltmonopol, Verwaltungsstrukturen
Für jedes dieser Kriterien wird ein „Schwellenwert“ definiert. Nur wenn dieser erreicht oder überschritten wird, wird der betreffende Staat als „Demokratie“ eingestuft. Voraussetzung für diese empirischen Verfahren ist jeweils ein idealtypisches „Modell von Demokratie“, das in unterschiedliche Dimensionen aufgegliedert wird. Da es aber kein allgemein anerkanntes Modell von Demokratie gibt, unterscheiden sich die Klassifikationssysteme und Messverfahren hinsichtlich der Konzeption von Demokratie, die sie jeweils zugrunde legen. Daher kann es vorkommen, dass einzelne Indikatoren von Demokratie anders gewichtet oder ggf. auch überhaupt nicht berücksichtigt werden. Dementsprechend sind die Ergebnisse nur bedingt vergleichbar und müssen jeweils auf dem Hintergrund der jeweiligen Methodologie interpretiert werden.
Sieben Dimensionen der Demokratie
Die Grundlage für die folgenden Ausführungen ist die Unterscheidung von sieben „Dimensionen“ der Demokratie, die für diese Herrschaftsform kennzeichnend sind. Sie bilden den Rahmen dafür, die Herausforderungen der Digitalisierung für die Demokratie aufzuzeigen. Der Begriff „Dimension“ soll deutlich machen, dass es um grundlegende und wesentliche Aspekte der Demokratie geht und nicht um einzelne Merkmale oder „Indikatoren“ im Sinne empirischer Messverfahren. Diese Dimensionen können unterschiedliche Ausprägungen haben (unterschiedliche Wahlsysteme, präsidentielle oder parlamentarische Demokratie, verschiedene Formen der Gewaltenteilung), auch ihre historische Entwicklung ist durchaus nicht einheitlich und stellen eine Auswahl wesentlicher Aspekte des demokratischen Herrschaftsmodells dar. Alle im Folgenden genannten Dimensionen haben einen Bezug zu normativen Demokratietheorien: Fragen der Souveränität und Staatlichkeit sowie der grundlegenden Rechte und Werte beispielsweise spielen in allen Demokratietheorien eine wichtige Rolle.
Dabei geht es um die folgenden Dimensionen der Demokratie:
1. Volkssouveränität
2. Demokratische Öffentlichkeit
3. Partizipation
4. Legitimität und Legitimation
5. Grundrechte, Grundwerte und ethische Grundlagen
6. Gewaltenteilung
7. Parteien
Diese Dimensionen stehen in einem engen Zusammenhang zueinander. In einer ersten Annäherung könnte man dies so formulieren: (1) Das Volk herrscht über sich selbst, ist also selbst der Souverän. Dazu wählt es seine Vertreter in freien, gleichen und geheimen Wahlen, die die Regierung des demokratischen Staates bilden. (2) Fragen, die die Allgemeinheit betreffen, werden öffentlich diskutiert und zu öffentlichen Meinungen verdichtet, die die Entscheidungen der Regierungen beeinflussen. (3) Das Volk partizipiert an der Ausübung politischer Herrschaft durch Wahlen, durch die Beteiligung an der demokratischen Öffentlichkeit und durch Einflussnahme auf politische Entscheidungen. (4) Diese Form, Herrschaft demokratisch zu organisieren, ist immer wieder neu auf Rechtfertigung angewiesen. Sie erhält ihre „Legitimität“ („Anerkennungswürdigkeit“) zum einem durch ihre Übereinstimmung mit grundlegenden Ideen, zum anderen aber auch in ihren jeweils konkreten Formen und Handlungen und ihrer Fähigkeit, Probleme zu lösen. (5) Die Demokratie als Herrschaftsform beruht auf grundlegenden Werten, die als Grundrechte formuliert sind und durch ethische Argumentation gerechtfertigt und begründet werden. (6) Zur Begrenzung staatlicher Macht wird die Staatsgewalt geteilt und arbeitsteilig organisiert. (7) Die Parteien haben die Aufgabe, an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken.
Diese Dimensionen der Demokratie bilden in ihrem Zusammenhang das Modell von Demokratie, das in diesem Buch für die Untersuchung der Herausforderungen der Demokratie durch die Digitalisierung herangezogen wird. Die einzelnen Dimensionen werden zu Beginn der einzelnen Unterkapitel genauer beschrieben, im Anschluss daran werden die Veränderung im Zusammenhang mit der Digitalisierung analysiert.
3.2 Das Volk als Souverän – unter den Bedingungen der Digitalisierung
In der Demokratie hat das Volk die Macht. Es ist der der Souverän und herrscht allein und unumschränkt. In diesem Abschnitt geht es um die Frage, inwieweit die Digitalisierung eine Herausforderung für den Grundsatz der Volkssouveränität darstellt, ob sie diesen beeinträchtigt oder gefährdet oder eher stärkt und unterstützt. Denkbar wäre auch, dass es zu einem Formwandel der Volkssouveränität kommt.
Das Prinzip der Volkssouveränität lässt sich in einzelne, miteinander verbundene Teilaspekte untergliedern: (1) Zuerst geht es um die Delegation der Macht durch das Volk an die Staatsorgane durch freie, gleiche und geheime Wahlen. Das Thema „Digitalisierung im Wahlkampf“ spielt dabei eine besondere Rolle und wird in einem Exkurs am Ende dieses Kapitels behandelt. Darauf folgt (2) die Übertragung der Macht auf Verfassungsorgane und die Legitimationskette dieser Übertragung. (3) Zur Legitimität der Ausübung der Staatsgewalt durch Verfassungsorgane gehört auch die Fähigkeit dieser Instanzen, ihre Macht wirksam auszuüben. Weitere Voraussetzungen für Souveränität sind die Staatlichkeit (4) sowie der mündige Bürger als „Subjekt“ der Volkssouveränität (5). Für alle diese Teilaspekte soll untersucht werden, welche Auswirkungen die Digitalisierung jeweils hat. Das im Anschluss daran vorgestellte Konzept der „digitalen Souveränität“ fasst diese Herausforderungen zusammen und zeigt Handlungsmöglichkeiten zu ihrer Bewältigung auf.
3.2.1 Die Delegation der Macht durch das Volk
In Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland heißt es: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ Das Grundgesetz bestimmt also die Wahl als die Art der Machtausübung des Volkes (Abstimmungen sind nur vorgesehen für die Neugliederung des Bundesgebietes oder bei Beschluss einer neuen Verfassung). Das Volk delegiert seine Macht an die gewählten Repräsentanten, auf Ebene des Bundes ist das der Bundestag.85Freie, geheime, gleiche und regelmäßige Wahlen sind daher das zentrale Element der Demokratie und für die Legitimität dieser Herrschaftsform von ausschlaggebender Bedeutung. Gerät dieser Kernbestand des demokratischen Herrschaftssystems durch die Digitalisierung in Gefahr?
Zwar können die Wahlergebnisse in Staaten, in denen „analog“ (also durch Präsenz- oder Briefwahl) gewählt wird, nicht mit Hilfe digitaler Werkzeuge manipuliert werden. Aber es gibt Anhaltspunkte dafür, dass versucht wurde, im Wahlkampf mit Hilfe des Internets und insbesondere der sozialen Netzwerke auf das Wahlergebnis Einfluss zu nehmen und die Legitimität demokratischer Wahlen in Frage zu stellen. Mit relativ geringem technischen und personellen Aufwand lassen sich öffentlichkeitswirksame Kampagnen aus einem Land in einem anderen starten, die erhebliche Auswirkungen auf die demokratischen Prozesse in dem angegriffenen Land haben können. Ein Bericht des Geheimdienstausschusses des US-Senats86 belegt entsprechende Aktionen für die Präsidentschaftswahl in den USA im Jahr 2016, u. a. bei der Veröffentlichung von E-Mails der demokratischen Bewerberin Hillary Clinton. Auch der Bericht des Sonderermittlers Robert Mueller im Jahr 2019 kommt zu dem Schluss, dass Russland sich aktiv in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt habe, unter anderem durch eine Facebook-Kampagne der „Internet Research Agency“ in St. Petersburg, die durch den eng mit Wladimir Putin verbundenen Oligarchen Yevgeniy Prigozhin finanziert worden sei.87 Die sozialen Netzwerke wurden dabei von erfundenen Accounts aus mit Falschnachrichten, personalisierten Anzeigen und Verschwörungstheorien „geflutet“, wobei auch sogenannte „Bots“ (Programme, die wie ein menschlicher Nutzer agieren) zum Einsatz kamen. Individualisierte Botschaften, deren Herkunft nicht erkennbar war („Dark Ads“) wurden in Facebook gezielt an bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgespielt, unter anderem mit dem Ziel, diese vom Wählen abzuhalten. Es wird vermutet, dass Russland auch die Brexit-Abstimmung in Großbritannien im Jahr 2016 durch Aktionen in den sozialen Medien beeinflusst hat. Eindeutige Beweise dafür wurden bislang allerdings nicht veröffentlicht.88 Der Exkurs „Digitalisierung im Wahlkampf“ am Ende dieses Kapitels geht ausführlich auf die Bedeutung der Digitalisierung für Wahlkämpfe ein.
Die Nutzung digitaler Technologien für den Wahlvorgang selbst ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 3.3.2009 zur Verwendung von Wahlcomputern bei der Bundestagswahl 2005 mit hohen Anforderungen verbunden. Demnach müssen die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses öffentlich und ohne besondere Sachkenntnis überprüfbar sein. Der Wahlakt selbst dagegen muss geheim, das heißt für Dritte nicht einsehbar sein. Zudem erfordern die Wahlrechtsgrundsätze nach Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, dass „die Wahlberechtigung … nachgewiesen wird und die Stimmabgabe pro Wähler nur ein einziges Mal vorgenommen werden kann. Zum anderen muss die Stimme unumkehrbar von den personenbezogenen Daten des Wählers getrennt werden, um die geheime Wahl sicherzustellen.“ 89 Auch müsse das System gegen Manipulationen abgesichert sein. Bei Bundestags- oder Landtagswahlen soll „E-Voting“ daher vorerst nicht zum Einsatz kommen.90
Politische Macht in der Demokratie ist durch den Akt der Wahl der Regierenden durch das Volk legitimiert. Die Frage, ob die Digitalisierung dazu beiträgt, dass – neben dem Volk – ein „zweiter Souverän“ im demokratischen Staat Macht ausübt, ist nicht einfach zu beantworten. Von einem „zweiten Souverän“ spricht man zum Beispiel im Zusammenhang mit der Macht der internationalen Finanzmärkte.91 Diese Finanzmärkte sind ohne digitale Technologien (insbesondere das Internet und spezielle Software für Finanzdienstleistungen: „Fintech“) nicht denkbar. Die Soziologin Saskia Sassen stellt dazu fest: „Die Digitalisierung hat bei der Transformation der Hochfinanz in eine sehr mächtige und nicht leicht zu regulierende Branche eine wesentliche Rolle gespielt“.92 Allerdings lässt sich die Macht der Finanzmärkte nicht allein auf die Digitalisierung zurückführen.
Auch demokratiekritische Ansätze wie die Theorie der „Postdemokratie“93 gehen davon aus, dass der wirkliche Souverän im demokratischen Staat nicht das Volk, sondern die wirtschaftlichen und politischen Eliten sind. Der Kulturwissenschaftler Felix Stalder bezeichnet „als ‚postdemokratisch‘ … all jene Entwicklungen …, die zwar die Beteiligungsmöglichkeiten bewahren oder gar neue schaffen, zugleich aber Entscheidungskapazitäten auf Ebenen stärken, auf denen Mitbestimmung ausgeschlossen ist“.94 Als Modell für diese Tendenz betrachtet Stalder die „Kluft zwischen der Nutzeroberfläche und den Prozessen, die auf der Rückseite, den Servern in den Datenzentren, angesiedelt sind“, wodurch der „Einfluss privilegierter Eliten“ verstärkt werde.95 Mit Hilfe der dort gewonnen Daten könne das Verhalten von Nutzern vorhergesagt und in gewissem Umfang auch gesteuert werden. Stalder weist hier auf die Facebook-Experimente zum Wählen-Gehen und zur „Gefühlsansteckung“96 hin. Der Autor führt seine Überlegungen weiter mit dem Hinweis, dass soziale Netzwerke die Macht haben, die Umgebung für die Entscheidungen der Nutzer zu manipulieren und dabei in ihren eigenen Entscheidungen völlig intransparent bleiben. Die Folge sei eine „Normalisierung des Postdemokratischen“ durch die „Postdemokratie der sozialen Massenmedien“ und schließlich die „Postdemokratisierung der Politik“.97
3.2.2 Übertragung der Macht auf Verfassungsorgane
Durch demokratische Wahlen überträgt das Volk die Macht an Abgeordnete etwa des deutschen Bundestages (Legislative). Dies begründet eine ununterbrochene Legitimationskette, die alle staatliche Macht auf die vom Volk übertragene Macht zurückführt – und zwar in jedem Bereich und auf jeder Ebene staatlichen Handelns.98 Von dieser Input-Legitimation durch demokratische Wahlen ist die Legitimation staatlichen Handelns durch Partizipation der Bürger zu unterscheiden, auf die in Abschnitt 3.3 „Partizipation“ ausführlich eingegangen wird. Die Abgeordneten in den Parlamenten (Bund, Land und Kommunen) als „Träger“ des Volkswillens haben ein freies Mandat, sie sind nur ihrem Gewissen verantwortlich.99 Ein Fraktionszwang existiert nicht, wohl aber die Einschränkung durch Fraktionsdisziplin.
Die Übertragung der Macht auf Verfassungsorgane setzt voraus, dass diese ihr Mandat unabhängig von äußeren Einflüssen wahrnehmen können (das gilt auch für die Übertragung auf weitere, nachgeordnete Institutionen). Durch die sozialen Netzwerke und digitalen Medien ergeben sich allerdings Möglichkeiten einer Einwirkung von außen, die Abgeordnete in der Ausübung ihres Mandats beeinflussen können, zum Beispiel durch beleidigende Posts in sozialen Netzwerken wie im Fall der Grünen-Abgeordneten Renate Künast. Durch Internetportale wie abgeordnetenwatch.de soll das Handeln von Abgeordneten transparenter gemacht werden, was grundsätzlich aber auch die Möglichkeit des Missbrauchs eröffnet.100 Der Jurist Florian Kuhlmann weist darauf hin, dass „gewisse Arcana in der einzelnen natürlichen Person Voraussetzung für einen offenen politischen und offenen parlamentarischen Prozess sind“.101 Das bedeutet, dass die Privatsphäre von Abgeordneten und Politikern eine Voraussetzung dafür ist, dass sie ihre Aufgaben wahrnehmen können. Die Strategie des „Doxing“, also des Veröffentlichens personenbezogener Informationen im Internet mit dem Ziel, Personen sichtbar und angreifbar zu machen, hebt diesen Schutzbereich tendenziell auf. Beispiele sind die Veröffentlichung der Privatadresse des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow im November 2020 durch Mitglieder der Querdenker-Bewegung102 und die Aktionen gegen den Abgeordneten des Bundestages (und jetzigen Gesundheitsminister) Karl Lauterbach.103 Besonders gravierend sind sog. Feindes- und Todeslisten, auf denen auch die Namen von Abgeordneten des Bundestages zu finden sind. Denkbar ist, dass die starke Zunahme von Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger insbesondere im kommunalen Bereich von rund 1.250 Fällen im Jahr 2018 auf knapp 1.700 Fälle 2019 auch mit den genannten Vorgängen in digitalen Netzwerken zu tun hat.





























