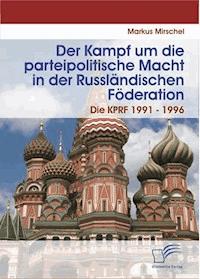Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch erzählt die Geschichte der DDR anhand ihrer sich wandelnden repressiven Mechanismen. Von der Staatsgründung im Jahr 1949 bis zu ihrem für viele Zeitzeugen überraschenden Zusammenbruch 1989/90 durchlief die DDR stetig Neuorientierungen sowie von oben nach unten weitergereichte Reglementierungen. Im Spannungsfeld zwischen Herrschaftsdurchsetzung, -etablierung und -sicherung bewies die DDR dabei eine erstaunliche Langlebigkeit. Aus Quellen gearbeitet erzählen Dr. Markus Mirschel und Samuel Kunze von persönlichen Schicksalen, normativen Vorgaben durch die Staats- und Parteiführung sowie von Anpassungsprozessen innerhalb der Sicherheitsorgane der DDR während der 40-jährigen Geschichte der zweiten Diktatur auf deutschem Boden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Mirschel und Samuel Kunze
Diktatur im Wandel
Eine Geschichte der DDR in Quellen
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder GmbH
Umschlagmotiv: Demonstration gegen das SED-Regime anlässlich des 40. Jubiläums der DDR in Ost-Berlin. Stasi-Mitarbeiter filmen und fotografieren die vom Alexanderplatz zum Palast der Republik ziehende Demonstration aus einer Wohnung heraus - © Jacques Torregano / akg-images
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft SRL, Timișoara
ISBN Print: 978-3-451-39579-6
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-83191-1
ISBN E-Book (PDF): 978-3-451-83193-5
Inhalt
Einleitung
Zu den Quellen
Prolog – Der sowjetische Terror kommt nach Deutschland: Die SBZ 1945–1946
1 Kollektivierung und Justizterror – Die Frühphase der Repression auf dem Land
1.1 Thematische Einführung
1.1.1 Die Diktatur nimmt Gestalt an
1.1.2 Der Repressionsapparat formiert sich
1.1.3 Die Umgestaltung der Landwirtschaft beginnt
1.2 Die Erzählung in Quellen
1.2.1 Die Kollektivierung beginnt – Die Gründung der ersten Genossenschaften
1.2.2 Der „Gegner“ rückt in den Fokus – „Großbauern“ als Haupthindernis der Kollektivierung
1.2.3 Der Repressionsapparat wird diszipliniert – Der Justizterror und seine Folgen
1.2.4 Die Unzufriedenheit bricht sich Bahn – Der 17. Juni auf dem Land
1.3 Repression als Mittel des radikalen Gesellschaftsumbaus
2 Erziehung zur Konformität – Die Disziplinierung der unangepassten Jugend
2.1 Thematische Einführung
2.1.1 Die Diktatur stabilisiert sich
2.1.2 Der Repressionsapparat etabliert sich
2.1.3 Die Jugend und die SED
2.2 Die Erzählung in Quellen
2.2.1 Gegen „Gammler“ und „Rowdys“ – Das Ende der Kompromissbereitschaft
2.2.2 Schikane und Massenüberwachung – Versuche der Unterdrückung der unangepassten Jugendkultur
2.2.3 Disziplinierung durch Arbeit – Die SED-Erziehungsdiktatur in der Praxis
2.2.4 „Viva Dubcek“ – Der „Prager Frühling“ und die DDR-Jugend
2.3 Repression als Mittel der Jugendpolitik
3 Verhinderte Träume: Bewegung in einem erstarrten Land
3.1 Thematische Einführung
3.1.1 Die Diktatur in neuen Gewändern
3.1.2 Repression im Wandel
3.1.3 Fokus Ausreise
3.2 Die Erzählung in Quellen – Dimensionen der Ausreise
3.2.1 Das auslösende Moment – Man wird nicht als Antragsteller geboren
3.2.2 Das erzieherische Moment – Vorstufen der Repression
3.2.3 Das verbindende Moment – Emanzipation und Solidarität
3.2.4 Das kalkulierende Moment – Übersiedlung als Ventil
3.2.5 Das drohende Moment – Übersiedlung um jeden Preis
3.3 Schneller, differenzierter, konsequenter – Gedanken zu einem vielschichtigen Phänomen
4 Durch Emanzipation zum Wandel – Opposition als Initiative im Spätsozialismus
4.1 Thematische Einführung
4.1.1 Krisenerscheinungen „ohne Krise“
4.1.2 Der Pakt mit Gott – Zur Wirkung kirchlicher Freiräume
4.1.3 Das „Allmachtsministerium“ und seine Unterordnung
4.2 Die Erzählung in Quellen
4.2.1 Vom Paradoxon der Annäherung – Kirche im Sozialismus
4.2.2 Druck von unten – Die Macht der Unterschriften
4.2.3 Die Arbeit gegen den „Feind“ – Das MfS in Aktion
4.2.4 Ein ideologischer Kreuzzug – Die Parteitreue des MfS
4.2.5 Misstrauen und Angst als Ressourcen des MfS
4.2.6 Das Werkzeug des MfS – Schlüsselfigur „Inoffizieller Mitarbeiter“
4.3 Ein Blick in die finale Krise
Epilog: Der Niedergang der Machthaber – Von der Einheitspartei zum Runden Tisch 1989/90
Fazit
Danksagung
Anhang
Anmerkungen
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
In den frühen 1950er Jahren wurden vom SED-Regime definierte „Feinde des Sozialismus“ nach inszenierten Schauprozessen noch zu drakonischen Strafen verurteilt und teils in sowjetische Lager nach Sibirien verbracht. Nur wenige Jahre später ging es für die vermeintlichen Delinquenten zur „Bewährung in der Produktion“. In der Lausitz förderten sie unter schwierigsten Bedingungen Braunkohle für die Energieversorgung der Republik und im thüringischen Unterwellenborn arbeiteten sie im Dreischichtsystem in der Stahlproduktion am „Aufbau des Sozialismus“. Wo die Deutsche Volkspolizei (VP) und das nach sowjetischem Vorbild am 8. Februar 1950 gegründete Ministerium für Staatssicherheit (MfS) anfangs verbreitet zu körperlicher und sichtbarer Gewalt griffen, entwickelten sie in den folgenden Jahrzehnten ein differenziertes Instrumentarium an verdeckt repressiven Mitteln und Methoden des Vorgehens gegen den „Klassenfeind“. In unterschiedlicher Art und Weise wurden so die repressiven Mittel zur Durchsetzung der SED-Politik eingesetzt. Sie verweisen (wie zu zeigen sein wird) auf die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Durch Willkür oder systematisch gesteuerte (Des-)Informationen, durch die offene Kontrolle oder die verdeckte Beobachtung aller Lebensbereiche sorgte die Geheimpolizei im Auftrag der Staatspartei für Beklommenheit und Unsicherheit in Bezug auf ihre nächsten Schritte. Die bewusst herbeigeführte Unkalkulierbarkeit nachfolgender repressiver Maßnahmen sowie das Unwissen der Betroffenen gegenüber den von der Geheimpolizei eingesetzten Mitteln bildeten dabei wirkmächtige Ressourcen der staatlichen Repression. Vorbeugend sollte ein „Einwirken konterrevolutionärer Kräfte“ aus dem Ausland verhindert und das Aufkommen und die Äußerung kritischer Gedanken in der DDR unterbunden werden. Nonkonforme Menschen sollten so in die Konformität gepresst werden, wurden in die innere Immigration gezwungen oder versuchten, ihre Heimat zu verlassen.
Zur Entwicklung der Repressionsgeschichte gehört aber auch, dass die betroffenen DDR-Bürger zunehmend Erfahrungen im Umgang mit staatlichen und geheimdienstlichen Behörden sammelten. In Prag oder Budapest traf man sich mit der Verwandtschaft oder geflüchteten Freunden aus der Bundesrepublik. Kritische Geister fanden unter dem Dach der Kirche oder in der Anonymität der Kleingärten Freiräume zur Diskussion. Oppositionelle, die auf den Beobachtungslisten des MfS standen, entwickelten Strategien, der Observation durch Finten oder Ablenkungen zu entgehen. Eine Repressionsgeschichte ist stets auch eine Geschichte des Widerstandes bzw. der Opposition.
Vor dem Hintergrund gegenwärtiger Entwicklungen erscheint dieser Umstand ermutigend. Politische Repression ist auch im 21. Jahrhundert kein Auslaufmodell; kommt sie zur Anwendung, dann stützt sie sich auf Methoden der Vergangenheit und erweitert die Mittel um die aktuellen Möglichkeiten. In der Konsequenz einer politischen und gesellschaftlichen Transformation nach 1991 sind es paradoxerweise gerade auch die Staaten des ehemaligen „Ostblocks“, in welchen der Wert der einst erstrittenen Freiheit erneut infrage gestellt wird – und im Falle der Russischen Föderation zugunsten der Repression und eines geführten Angriffskrieges beantwortet wurde. Doch verweist die historische Erfahrung darauf, dass liberale Impulse zur Veränderung weiterhin stärker aus der Zivilgesellschaft selbst erwachsen, als von Regierungen initiiert werden.
Diese Entwicklungen bringen die Geschichte, die in diesem Buch erzählt wird, auf den Punkt: Die Abhandlung beleuchtet die Entstehung, die Entfaltung und den sich wandelnden Charakter des Repressionsregimes in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der DDR zwischen 1945 und 1989. Als eine „Erzählung in Quellen“ verfolgt es einen zeitlich und thematisch übergreifenden Ansatz und bildet die Repressionslandschaft im SED-Staat und die Erfahrungen ihrer Bürger in verschiedenen Facetten paradigmatisch ab. Das Buch stellt keine wissenschaftliche Untersuchung im engeren Sinne dar, sondern zielt auf eine grundlegende Wissensvermittlung sowie auf eine Förderung des Verständnisses zeitgenössischer Zusammenhänge ab. Im Zentrum stehen Fragen danach, wie sich die staatlichen Zwangs-, Straf- und Disziplinierungsmaßnahmen über die Jahre in ihren Zielen und Ausprägungen veränderten und wie sie von den Betroffenen wahrgenommen und eingeordnet wurden. Welche das Regime stabilisierende Kontinuitäten sicherten das Fortbestehen der DDR über Jahrzehnte hinweg ab? Welche Prioritäten setzten die Machthaber etwa bei der Durchsetzung ihrer Ziele, die anfänglich noch stark durch die Vorgaben aus Moskau geprägt waren? Wer waren die entscheidenden Protagonisten und welche Institutionen oder Entwicklungen waren grundlegend in der Vorgabe und der Durchsetzung repressiver Strategien? Welche Möglichkeiten wiederum standen den Repressierten zur Verfügung, ihren Unmut kundzutun und somit ihren individuellen Vorstellungen Raum zu geben?
Eine Geschichte der Repression kann nicht ohne die Erfahrungen und Bemühungen der Betroffenen geschrieben werden. Tausende gerieten in den jeweiligen Phasen der SED-Herrschaftsausübung in den Fokus der Geheimpolizei und Justiz. Politische Aktivisten der frühen Jahre, Ausreisewillige, Zeugen Jehovas oder Punks lehnten mit ihren Lebensentwürfen die gesellschaftliche Umgestaltung unter Federführung der SED sowie den Alltag in der DDR teils kategorisch ab. Andere, wie der Dissident Robert Havemann, forderten verhältnismäßig früh eine umfassende Reform der DDR, ohne das sozialistische Modell abschaffen zu wollen. Die Ausgrenzung aus der Mehrheitsgesellschaft war der Preis, den diese Menschen für ihre Individualität sowie ihr dissidentisches Engagement zahlten. Unabhängiges und nonkonformes Verhalten gegenüber einem zentralistisch durchgesetzten und stark von ideologischen Dogmen geprägten Herrschaftsstil des SED-Regimes – sei es als persönliche Verweigerung, als politischer Dissens oder in Form zunehmender Oppositionstätigkeit eines Teils der ostdeutschen Gesellschaft – ist somit ebenso ein prägendes Merkmal der DDR-Geschichte wie die Absicherung des „sozialistischen Weges“ durch den Einsatz repressiver Mittel.
In diesem Buch soll darüber hinaus aufgezeigt werden, wie die von den Herrschenden ins Werk gesetzte Politik an der verweigerten Unterordnung einzelner Menschen scheiterte. Besonders die letzten beiden Jahrzehnte waren durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Modernisierungsdefizite vonseiten der Partei- und Staatsorgane geprägt. Diese beförderten subkulturelle Milieus, die von den DDR-Bürgern als Rückzugsorte, aber auch als Orte des Austausches genutzt werden konnten. Somit lautet eine der in diesem Buch verhandelten Thesen, dass sich die Lebenspraxis der Menschen und ihre Erfahrung mit der Anwendung repressiver Mittel zur Herrschaftsdurchsetzung, -etablierung und -sicherung zu einem erlernten Umgang damit weiterentwickelten. Aber woraus speiste sich das Wissen der Bürger um die Repressionsmechanismen des Regimes? Wie vermochten es Gegner und Kritiker des SED-Staates, eine Routine der Vorsicht zu entwickeln, und wo waren ihnen Grenzen gesetzt?
Ferner soll verdeutlicht werden, dass auch die Mittel der Diktatur in der DDR aufgrund wirtschaftlicher Faktoren, ihrer Lage als „Frontstaat“ im Kalten Krieg, der historisch bedingt starken Position der Kirche (besonders der evangelischen) sowie des autonomen Engagements Einzelner oder kleiner Gruppen zunehmend limitiert waren.
Eine Repressionsgeschichte der DDR mit Fokus auf zentrale Ereignisse zu erzählen, birgt die Gefahr, das Geschehene alleinig anhand einiger Zäsuren einzuordnen. Erzählungen dieser Art können nur unvollständig sein: Wo der Moment dominiert, drohen die oft langen Vor- und Folgegeschichten aus dem Blick zu geraten. So wichtig „(symbolträchtige) Schlüsseldaten“1 auch gerade für die Erinnerungskultur sind, reduzieren sie doch Geschichte in ihrer Komplexität. Ereignisse wie der Aufstand vom 17. Juni 1953, der Mauerbau 1961 oder der 9. November 1989 finden hier zwar ihren Platz, werden aber zu Bestandteilen einer übergreifenden Darstellung. Entlang von vier zentralen Themenfeldern wird die politische Verfolgung im SED-Regime eingeordnet. Die Voraussetzungen und Grundgedanken zu sogenannten Zersetzungsmaßnahmen – wie sie prägend in der MfS-Richtlinie 1/76 von 1976 als Werkzeug der Geheimpolizei umfassend dargelegt wurden – hatten ihren Ursprung schon in den 1960er Jahren. Die geheimpolizeilich abgeleitete „Notwendigkeit“, auf Zersetzung als Methode zurückzugreifen, basierte wiederum auf dem Wunsch nach internationaler Anerkennung der DDR-Staatlichkeit, einem die Phasen und Zäsuren übergreifenden Anliegen des SED-Regimes. Die Entwicklungen sind demnach nicht separat zu betrachten – vielmehr laufen sie ineinander und bedingen sich gegenseitig. So ist es das Ziel dieses Buches, nach Ursachen und Konsequenzen von politischen Entscheidungen zu fragen. Im Fokus steht die Repression als Werkzeug zur Errichtung, Konsolidierung und Stabilisierung des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden.
Der sich verändernde Herrschaftsstil der DDR-Machthaber bildet hierbei einen roten Faden und bindet das Erzählte in einen chronologischen und thematischen Rahmen ein. Dem stark willkürlich sowie gewaltsamen Auftreten der Staats- und Parteiorgane zum Zweck des Umbaus der Gesellschaft in den 1950er Jahren folgte ein euphorischer Stil des Anpackens. Auch wenn die 1960er Jahre durch einen Zickzackkurs auf der Suche nach der richtigen Dosierung der Repression geprägt waren, schritt ein Großteil der Gesellschaft im Eifer der Reformen und im Glauben an die sozialistische Utopie voran. Mit dem Machtwechsel von Walter Ulbricht zu Erich Honecker Anfang der 1970er Jahre galt es, das Erreichte abzusichern und die Bevölkerung mit den Versprechungen der „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ an das Sozialismusmodell der DDR zu binden. Die Erhöhung des Lebensstandards und der sozialen Leistungen stellte ein staatliches Angebot als Gegenleistung für die Akzeptanz der Diktatur und den gesellschaftlichen Frieden im Land dar. Die 1980er Jahren wurden daraufhin zu einer Phase, in der die Mittel der Repression die Herrschaft des Regimes zu konservieren hatten. Eine der Diktatur gegenüber stille Mehrheit bedeutete zwar nicht notwendigerweise die Akzeptanz der Verhältnisse, jedoch hatten sich viele Menschen mit dem Status quo arrangiert. Zu dieser Zeit bestand die Hauptaufgabe der Sicherheitsorgane unter anderem darin, die erstarkende Opposition zu zerschlagen und ihre Mitglieder mundtot zu machen.
So fragen die vier Hauptkapitel nach den Spezifika der repressiven Praxis und setzen sie in Relation zur jeweiligen innen- sowie außenpolitischen Verfasstheit der DDR. Welchen Einfluss hatten demnach auch Entwicklungen im sogenannten Ostblock sowohl auf die Partei- und Staatsführung als auch auf die Herausbildung staatskritischer Gedanken in der DDR?
Wie prägend der sowjetische Einfluss war, verdeutlichen die ersten Jahre der SBZ ebenso wie die Frühphase der Repression nach der Gründung der DDR im Jahr 1949. Am Beispiel der Kollektivierung der Landwirtschaft wird im ersten Kapitel veranschaulicht, dass die Repression nicht nur geheimpolizeilich organisiert werden musste, sondern auch auf der Ebene der politischen Justiz. Infolge der Verkündung des „Aufbaus des Sozialismus“ im Juli 1952 entfalteten sich im Rahmen der Kollektivierung umfassende Verfolgungsmaßnahmen gegen die ländliche Elite (die sogenannten Großbauern).
Das „Kahlschlagplenum“ von 1965 beendete eine kurze Phase der Liberalisierung im Umgang mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen und zog eine Periode zunehmender Überwachung, Kriminalisierung und Verfolgung unangepasster Jugendlicher nach sich. Unter dem Titel „Erziehung zur Konformität“ geht das zweite Kapitel auf das breite Spektrum staatlicher Disziplinierungsversuche sowie die Auswirkungen dieser „Erziehungsdiktatur“ ein. Die Proteste um die Niederschlagung des „Prager Frühlings“ in der ČSSR bildeten hierbei einen Kulminationspunkt.
Das Augenmerk des dritten Kapitels liegt auf den staatlichen Strategien zur Einhegung von Ausreisewilligen und der infolge der KSZE-Schlussakte von 1975 verstärkt einsetzenden Dynamik, die vom MfS zunehmend als Problem wahrgenommen wurde. Die DDR-Sicherheitsorgane durchliefen hierbei einen Lernprozess, der sowohl in normierten Vorgehensweisen gegen die Antragsteller als auch in der „Erprobung“ angepasster Repressionsmethoden wie der Ausbürgerung und der „Zersetzung“ mündete.
Die 1980er Jahre waren durch starke Impulse der Veränderungen im Lager der sozialistischen Staaten geprägt und gleichzeitig von einer herrschaftswahrenden Wagenburgmentalität des SED-Regimes gekennzeichnet. Das letzte Kapitel skizziert die im ost- und mitteleuropäischen Vergleich verspätet einsetzende Transformation der DDR-Protestbewegung in eine zivilgesellschaftliche Opposition. Die Motive ihrer Protagonisten kommen ebenso zur Sprache wie jene Strategien des MfS, die als „politische Untergrundtätigkeit“ (PUT) bezeichnete Opposition zu zerschlagen. Der Epilog umreißt das für viele unerwartete Ende der SED-Repressionslandschaft und zeichnet den Weg der Opposition an den „Zentralen Runden Tisch“ nach. Viele der in der DDR verbliebenen Aktivisten verloren sich im Strudel der Ereignisse und gerieten nicht selten unter die Räder der Friedlichen Revolution.
Die Grundlage für die Beschäftigung mit dem Unterdrückungsregime in der DDR bildet ein weites Verständnis des Begriffes der politischen Repression. Darunter werden alle staatlichen Maßnahmen gegen Individuen oder Gruppen verstanden, die die von der SED gesetzten Normen und Regeln infrage stellten, sich ihnen zu widersetzen suchten oder einen individuellen Weg durch das stark normierte (real-)sozialistische Leben anstrebten. Aufgrund des umfassenden Kontroll- und Gestaltungsanspruches der SED wurden Verfolgungs-, Disziplinierungs- und Zwangsmaßnahmen in nahezu allen Gesellschaftsbereichen in sehr unterschiedlichen Formen sichtbar. Die Bereitschaft der SED-Herrschaft zur Repression und ihre Praktiken richteten sich hierbei an den jeweiligen Phasen der Entwicklung der DDR aus. Die Geschichte der Repression war demnach evolutionär. Die Staatssicherheit sah sich vom Zeitpunkt ihrer Gründung bis zu ihrer Umstrukturierung in der späten DDR stetig mit Herausforderungen konfrontiert. Sie musste sich etwa eingestehen, dass die Verbreitung staatskritischer Positionen nur kontrolliert, aber nie vollständig unterbunden werden konnte. Im Jahr 1989 ging das MfS von circa 2500 oppositionell aktiven Bürgern in der DDR aus; nur 60 von ihnen wurden als „harter Kern“ definiert.2 Die Geheimpolizei schätzte die Opposition in der späten DDR demnach als zahlenmäßig gering ein. An der Gesamtbevölkerung gemessen war sie es auch. Es ist ein historisches Merkmal nahezu jeder Opposition, das unter anderem auch für die Sowjetunion galt. Doch wenn die späte UdSSR im Nachhinein als ein Koloss auf tönernen Füßen beschrieben wird, dann stand die im Verhältnis kleine DDR bis zum Herbst 1989 auf erstaunlich festem Fundament.
Die Anwendung von Repression war ein durchgängiger Bestandteil im Gefüge des SED-Regimes. Dieses Modell basierte – wie bei allen „Volksdemokratien“ des Ostblocks – auf der monolithischen Einheit aus herrschendem Partei- und Staatsapparat sowie dem Anspruch einer vollständigen „Durchherrschung“ der Gesellschaft. Aus der Sicht des MfS galt die Macht der Staatspartei und ihrer Exponenten durchgängig als bedroht: In jeder Dekade des Bestehens der DDR kamen Widerstände aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft, darunter von Landwirten, Christen, Studenten und Arbeitern. Der jeweilige Dissens richtete sich unter anderem gegen die von oben durchgesetzte Kollektivierung der Landwirtschaft, die Militarisierung der Gesellschaft oder gegen die Einschränkung individueller Freiheiten. Die Gegnerschaft wandelte sich von einer fundamentalen Ablehnung der radikalen Umgestaltung des Staates zu Kritik aus dem System heraus. Was lässt sich aus diesen Entwicklungen zum Anspruch der „Durchherrschung“, was zur Wirksamkeit der ostdeutschen Geheimpolizei, Justiz und Parteiarbeit ableiten? Wo bildeten sich Freiräume heraus, aus denen ein systemkritisches Denken in die Mehrheitsgesellschaft hineinwirken konnte? Auch wenn die DDR ein Staat mit einer oppositionellen Minderheit war, begründete doch die stille Ablehnung des DDR-Sozialismus durch Teile der Gesellschaft ihre finale Krise mit. Diesen Sachverhalten und Fragen versucht sich „Diktatur im Wandel. Eine Geschichte der DDR in Quellen“ anzunähern.
Zu den Quellen
Das Format einer „Erzählung in Quellen“ als eine Mischung aus kontextueller Darstellung sprechenden Dokumenten und interpretierender Einordnung, rückt ausgewählte Zeitzeugnisse aus der DDR-Geschichte in den Mittelpunkt. Authentisches und prägnantes Quellenmaterial zur Repressionsgeschichte der zweiten deutschen Diktatur wird so historisch verortet und auch für Nachgeborene zugänglich gemacht. Das Quellenmaterial variiert hierbei von vollständigen Dokumenten bis hin zu aussagekräftigen Auszügen, zum Beispiel aus normativen Dienstanweisungen und Analysen oder dissidentischen Positionspapieren und Erinnerungen. Diese Darstellungsform bietet die Möglichkeit, das Innere gesellschaftlicher Teilräume zu beleuchten: Wie verfasste etwa das MfS interne Dokumente, welcher Wortwahl und Sprache bediente sich das Ministerium? Wer hatte an wen zu berichten oder welche argumentative Strategie verfolgten dissidentische Kreise in ihren oft illegalen Veröffentlichungen? Einige Dokumente dienten der geheimpolizeilichen beziehungsweise dissidentischen Selbstvergewisserung und lassen demnach Rückschlüsse zur jeweiligen Weltsicht und Selbstverortung der Beteiligten zu. Diese Anmerkungen schmälern nicht den Wert der Quelle, erweitern ihn sogar um eine Interpretationsebene: jene des Selbstverständnisses der Akteure.
Die Abhandlung kann einerseits als Einstieg in die Geschichte der DDR dienen, wie sie andererseits auch als vertiefende Darstellung die Verflechtung von Staat und Gesellschaft beleuchtet. Darüber hinaus eröffnen die Quellen einen Blick in den „Maschinenraum“ der jeweiligen Sicherheitsorgane sowie involvierten Ministerien. Auf diese Weise veranschaulichen sie, wie politische Unterdrückung in der DDR gedacht, angepasst und, wenn nötig, „optimiert“ wurde. Als notwendiges Korrektiv werden die normativen Überlieferungen durch die Wahrnehmungen der Betroffenen ergänzt. So finden Briefe, Erinnerungen sowie Interviews von Zeitzeugen, Opfern der Repression oder Protagonisten der oppositionellen Szene ihren Widerhall in der Darstellung.
Das Buch stützt sich auf bereits veröffentlichte und noch unveröffentlichte Materialien. Darüber hinaus wird der ostdeutschen Geografie Rechnung getragen – neben Quellen aus den politischen wie gesellschaftlichen Zentren des SED-Regimes, der Hauptstadt der DDR oder der Bezirksstadt Leipzig werden auch Dokumente aus den ländlichen Regionen und politischen Landschaften der Peripherie herangezogen.
Von zentraler Bedeutung für das Verständnis von Repressionspraktiken in der DDR sind hierbei die Bestände des Stasi-Unterlagen-Archivs in Berlin und seinen regionalen Standorten, die heute Teil des Bundesarchives (BArch) sind. Durchgesehen wurden hier neben Richtlinien, Dienstanweisungen, Schulungsakten oder internen Analysen auch die Berichte der Zentralen Informations- und Auswertungsgruppe (ZAIG) des MfS sowie einzelne Untersuchungsvorgänge bzw. Personal- und Fallakten. Auch wichtige MfS-Bezirksverwaltungen wie jene der Bezirke Potsdam, Frankfurt/Oder und Magdeburg finden sich mit ihren regionalen Eigenheiten und Themen in den Quellen wieder.
Um die politischen Aushandlungsprozesse und die Aufgabenverteilungen zwischen den unterschiedlichen Instanzen und ihre Umsetzung vor Ort nachvollziehen zu können, wurden Quellen aus dem Bundesarchiv und im Besonderen der ihr zugeordneten Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR in Augenschein genommen. Eine vertiefende Berücksichtigung fanden die Bestände des Ministeriums des Innern der DDR (MdI) – durch seine Verantwortung für die Deutsche Volkspolizei oder etwa die Verwaltung in den Kommunen war das Ministerium integraler Bestandteil des repressiven Systems in der DDR. Wie die politische Kommunikation zwischen den SED-Bezirks- und Kreisleitungen und der Berliner Machtzentrale aussah, ist in den Landesarchiven von Brandenburg und Sachsen-Anhalt überliefert. Dennoch konnte für das Buch nur eine begrenzte Zahl an Dokumenten ausgewählt und verwendet werden. Dabei wurde ein möglichst repräsentativer und die Erzählung unterstützender Querschnitt ausgewählt.
Im Hinblick auf die Zeitzeugen und Opfer der Repression sind die Bestände des Archivs der DDR-Opposition unter dem Dach der Robert-Havemann-Gesellschaft maßgeblich gewesen. Quellen zur Interpretation zeitgenössischer Ereignisse und ihrer Wahrnehmung, sogenannte Ego-Dokumente, beleuchten die andere Seite geheimdienstlicher Aktivitäten: ihre Rezeption. Herrschende und Beherrschte agierten hierbei nicht im ereignisleeren Raum, sie reagierten auf internationale Ereignisse, innenpolitische Weichenstellungen oder ideologische Dogmen. Beide Seiten richteten ihr Handeln an den erlebten Erfahrungen aus und standen in einem Aktions- und Reaktionsverhältnis zueinander. Erst das Zusammenspiel von Ego-Dokumenten der Betroffenen einerseits und normativ ausgerichteten wie auch analytischen Dokumenten des staatlichen Berichtswesens oder der geheimpolizeilichen Arbeit andererseits macht jene Beeinflussungen sichtbar, die durch repressive Mechanismen bedingt waren.
Der Authentizität der Quellen wird dadurch Rechnung getragen, dass Änderungshinweise, Streichungen, aber auch der formale Aufbau der Überlieferung in der Abhandlung weitestgehend beibehalten wird. Handschriftlich vermerkte Hinweise der SED-Führungsriege bleiben dabei ebenso erkennbar wie nachweisbare Randnotizen innerhalb von Aufrufen, Grundsatzpapieren oder Appellen der oppositionellen Szene in der DDR. Orthografische und grammatikalische Fehler nehmen besonders in den Dokumenten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) über die Jahre hinweg ab. Dies spricht unter anderem für die zunehmende Professionalisierung des Apparates, die über höhere Bildungsabschlüsse bei den Mitarbeitern angestrebt wurde. Fehler, so sie von geringer Qualität waren, wurden stillschweigend korrigiert. Eingriffe in das Zitat wurden durch eckige Klammern kenntlich gemacht.
Aus Gründen des Datenschutzes mussten vereinzelt Personennamen anonymisiert werden. In den meisten Fällen handelt es sich um unbekannte Personen, die in anderen Zusammenhängen nicht wiederauftauchen. Die Quellenaussage wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Prolog – Der sowjetische Terror kommt nach Deutschland: Die SBZ 1945–1946
Es war der 2. Januar 1946 im mecklenburgischen Ludwigslust. Erika Riemann war mit der Probe für einen Theaterauftritt beschäftigt, als zwei Männer in sowjetischer Uniform in die Garderobe des Theaters traten und sie zum Mitkommen aufforderten. Für die 15-Jährige war es nicht das erste Mal, dass sie mit Angehörigen der sowjetischen Besatzungsmacht zu tun hatte. Wenige Monate zuvor war sie schon einmal vorgeladen worden, um zu erklären, warum sie eine Abbildung Josef Stalins mit Lippenstift bemalt hatte. Damals war sie auf nachgiebige Mitarbeiter der sowjetischen Geheimpolizei getroffen, die ihrer Erklärung, wonach der Führer der Sowjetunion auf dem Bild so traurig ausgesehen und sie dessen Bart deshalb mit einer Schleife versehen habe, Glauben schenkten und sie mit einer Verwarnung davonkommen ließen. Dieses Mal war alles anders. Anstatt einer kurzen Aussprache zur Klärung des vermeintlichen Missverständnisses ihrer erneuten Vorladung wurde Riemann in Haft genommen und in die Kellerräume der von der sowjetischen Geheimpolizei besetzten Villa gesperrt.1 Wenige Stunden später begannen die nächtlichen Verhöre, die sie in ihrer Autobiografie in eindrücklichen Worten beschreibt:
„Artistka, Artistka, aufwachen.“ Eine freundliche Stimme reißt mich aus meinen wirren Träumen. Die Prozedur des Abends läuft in umgekehrter Reihenfolge ab. Der sanfte Posten reicht mich an den groben weiter. Die Übergabe findet an der Grenze zwischen Ober- und Unterwelt statt. Man trennt die Welten hier streng voneinander. In den Wochen, die ich hier verbringen muss, werde ich nie einen Wärter aus den Katakomben über der Erde treffen. Andererseits bin ich in meinem Kellerkabuff vor meinen Peinigern sicher. Die Einzige, die die unsichtbare Demarkationslinie überschreiten darf, scheine ich zu sein, so wie in der Sagenwelt nur die Toten den Styx passieren können.
Wieder werde ich über erleuchtete Flure gezerrt.
In dem Büro sitzen dieselben Personen wie bei dem ersten Verhör. Sie haben sogar dieselben Plätze inne. Es scheint, als wäre ich gar nicht fort gewesen.
Die folgenden Verhöre zerfließen zu einer einzigen alptraumhaften Erinnerung. Der Ablauf ist immer der gleiche. Nachts werde ich geweckt. Kurz darauf nehme ich auf dem Hocker Platz. Meistens wird meine Anwesenheit zunächst ignoriert. Meine Peiniger tafeln und plaudern. Der stete Strom russischer Worte wird hin und wieder von aufbrandendem Gelächter unterbrochen. Die eisige Stimme der Dolmetscherin nimmt einen kehligen Klang an, je weiter die Nacht voranschreitet.
Irgendwann kommt unweigerlich jede Nacht der Zeitpunkt, an dem ich auf meinem Hocker nicht mehr gerade sitzen kann. Sobald ich auch nur ein wenig in mich zusammensinke, trifft mich der Gewehrkolben des Postens schmerzhaft im Rücken. Erst diese Bewegung scheint die vergnügte Runde auf mich aufmerksam zu machen. Dann prasseln plötzlich Fragen auf mich ein. „Wie alt bist du? Warst du im BDM [Bund Deutscher Mädel, eine NS-Organisation, Anm. d. Verf.]? Welche Sabotageakte habt ihr geplant? Seit wann arbeitest du in der Gruppe Werwolf [eine von der NS-Führung Ende 1944 ins Leben gerufene Untergrundorganisation, Anm. d. Verf.] mit? Wie heißen deine Verbindungsleute?“
Bei den ersten Verhören gebe ich mir noch Mühe, die Fragen zu verstehen und gewissenhaft darauf zu antworten. Später bringe ich lediglich ein „Ja“, ein „Nein“ oder „Weiß nicht“ heraus. Es scheint ohnehin egal zu sein, was ich sage. Es gelingt mir nie, zufriedenstellende Auskünfte zu geben. In einigen Nächten gebe ich alles zu, ja, Werwolf, ja, BDM, nein, Namen kenne ich nicht.
An besseren Tagen streite ich alles ab: „Ich weiß überhaupt nicht, was Werwolf ist. Ich kenne niemanden, und mit Sabotage habe ich auch nichts zu tun.“
Ein Punkt, auf dem sie beharrlich herumreiten, bleibt mein Alter. „1928, da bist du geboren. Du bist siebzehn Jahre alt.“ In besonders müden Nächten entgleitet mir sogar mein Geburtsdatum. So oft, beinahe gebetsmühlenartig, habe ich nun gehört, ich sei 1928 geboren, dass ich es selbst fast glaube. Am meisten fürchte ich die Nächte, in denen ich von Anfang an im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehe. Auch solche werden immer wieder eingestreut. Dass ich vorher nie weiß, was mich erwartet, ist vielleicht das Schlimmste daran.
Diese speziellen Verhöre beginnen in völliger Stille. Ich bemühe mich um kerzengeraden Sitz, während einer der Offiziere beständig meinen Hocker umkreist. Ab und zu bleibt er stehen und zielt. Meist trifft er den Napf neben der Tür, nur selten spuckt er daneben. Ich habe Mühe, meinen Ekel zu verbergen, aber jede Regung zieht einen Knuff oder eine Ohrfeige nach sich. Sonst wird die Stille nur unterbrochen, wenn die Dolmetscherin „Der Major wartet“ sagt.
Man liest mir meine Geständnisse vergangener Nächte vor. Es wird mit Papieren gewedelt. Ich soll unterschreiben. Manchmal bin ich kurz davor. Ich bin so müde. Für eine ungestörte Nacht würde ich beinahe alles tun. Aber jedes Mal, wenn ich das Bündel mit den russischen Schriftzeichen in der Hand halte, taucht aus irgendwelchen Tiefen meine alte Widerspenstigkeit auf. „Ich werde hier gar nichts unterschreiben. Und schon gar nicht dieses russische Geschreibsel, das ich nicht lesen kann. Da könnt ihr lange warten.“ Einer mit besonders vielen Sternen klopft seine Pfeife auf meiner Stirn aus. Glühende Asche regnet auf meinen Schoß herab, frisst sich durch die Kleidung. Unwillkürlich hebe ich die Hand, versuche die Glut wegzufegen. „Sitz still!“ Ein harter Schlag ins Gesicht unterstreicht den Befehl.
Dann wieder Versprechungen. „Unterschreib einfach, dann hast du deine Ruhe. Wir lassen dich nach Hause gehen. Heute Nacht unterschreiben, morgen bist du zu Hause.“ Aber was sie auch tun, ich unterschreibe nicht. Meine Unbeugsamkeit hat wenig mit Heldentum zu tun. Es ist die Unwirklichkeit der ganzen Situation, aus der sich mein Widerstand speist. „Das geht vorbei, Erika. Das können sie nicht ernst meinen. Eine Fünfzehnjährige kann man auch nicht nach Sibirien schicken. Wenn ich das zu Hause erzähle, glaubt mir das keiner. Bald bin ich wieder zu Hause, und dann ist alles wieder gut.“ Das Ganze kommt mir vor wie ein Abenteuer. Es ist ein scheußliches Abenteuer, aber ich fühle mich zu keinem Zeitpunkt wirklich bedroht. Die Wirklichkeit wird einsetzen, wenn ich das Buch zuklappe. Ich werde in meinem Bett aufwachen und lachen.2
Was sich für Riemann wie ein Alptraum anfühlte, setzte sich auch in den kommenden Wochen fort. Unterbrochen wurde der sich wiederholende Rhythmus, bestehend aus Befragungen, Misshandlungen und Erniedrigungen, erst, als die 15-Jährige einige Zeit später vor ein Sowjetisches Militärtribunal (SMT) treten musste, das ihren Fall verhandelte:
Die Verhandlung beginnt. Ich bin zwar die Hauptperson, aber von dem, was hier vorgeht, bekomme ich wenig mit. Es wird nur Russisch gesprochen, und so bin ich meinen Beobachtungen überlassen. Angesichts der ernsten, fast schon feindseligen Mienen am Richtertisch hat es mein Optimismus schwer. Immer wieder blättert man raschelnd in meiner Akte. Die ist mittlerweile zu beachtlichem Umfang angewachsen. Was da wohl drinstehen mag, frage ich mich nun doch besorgt. Einige meiner Geständnisse tauchen jetzt brennend wieder an der Oberfläche auf. „Na, dann bin ich eben Werwolf“, ist ein solcher Satz. Während vor mir mein Schicksal verhandelt wird, überfällt mich bittere Reue. Schließlich klammere ich mich an der Tatsache fest, dass ich ja nichts unterschrieben habe.
Dann kommt Bewegung in das Geschehen. Ich habe die beiden Posten hinter mir keine Sekunde lang vergessen. Auf einen Wink hin packen sie mich an den Schultern. „Aufstehen!“ Es ist das erste Wort der Dolmetscherin.
Der Schreiber zieht das Papier aus der Schreibmaschine. In feierlichem Ton verliest er, was dort geschrieben steht. Ich begreife noch immer nichts, aber diese wenigen Zeilen werden mir anschließend übersetzt.
„Das Tribunal hat Sie verurteilt zu zehn Jahren Zwangsarbeit in Sibirien.“
Ob der Bedeutung ihrer Worte macht die Dolmetscherin eine Pause. „Gründe für das Urteil sind Beleidigung der Roten Armee und Werwolftätigkeit.“ Wieder kurze Stille, bevor sie fragt: „Haben Sie das verstanden?“
So ein Affentheater, ist mein erster Gedanke.
Auch der zweite Gedanke stellt sich leider als Irrtum heraus.
„Zehn Monate, dann muss ich ja bald entlassen werden. Ich sitze doch bestimmt schon über ein halbes Jahr hier.“
Die Frau zeigt keine Gefühlsregung, als sie mich korrigiert.
„Zehn Jahre, Sie sind zu zehn Jahren verurteilt.“
Diese Auskunft beweist mir, wie absurd die ganze Veranstaltung ist. Lächerlich, völlig lächerlich der Zirkus hier. Wie immer soll ich dann unterschreiben. Da sind sie eigen. Und wie sonst auch besteht das Geschriebene ausschließlich aus russischen Hieroglyphen.
„Das mache ich nicht. Ich weiß nicht, was da steht, und ich unterschreibe das nicht.“ Jetzt werden sie richtig wütend. Einer der Richter schreit mir mit donnernder Stimme etwas entgegen, auch aus den aufgerissenen Mündern der anderen ergießen sich russische Beschimpfungen über mich. Die Posten hinter mir treten unruhig von einem Bein aufs andere. Ich kämpfe nun doch mit meiner Angst. Der Krach nimmt bedrohliche Ausmaße an.
Irgendwann tritt Stille ein. Alle Blicke sind erwartungsvoll auf mich gerichtet. Ich schüttle nur den Kopf, die Lippen fest zusammengepresst. Es wird kurz beraten. Dann kritzelt die Dolmetscherin einen kleinen Zettel, den mir der Posten vor die Nase hält. Zehn Jahre Sibirien, steht dort auf Deutsch. Ich halte einen Stift in der Hand, ein Schubs mit dem Gewehrkolben in den Rücken unterstreicht die Aufforderung:
„Unterschreiben!“
Ich setze meine Unterschrift unter den Zettel.
Die Tinte kann noch nicht trocken sein, da trifft mich schon wieder der Gewehrkolben. „Ruki nasad!“ – Hände auf den Rücken. Zum ersten Mal höre ich dieses Kommando. Unter Stößen und Puffen bugsiert man mich zur Kellertreppe. Dort werde ich in Empfang genommen, aber heute ist man alles andere als sanft und freundlich. Der Griff ist grob und das Schweigen eisig.
Stille. Es bricht eine beinahe unerträgliche Stille über mich herein. Die Außenwelt hat mich offenbar gelöscht aus ihrem Ablauf. Es finden keine Verhöre mehr statt, niemand will irgendetwas von mir.
Zweimal am Tag stellt einer der Posten die übliche Wassersuppe in meine Zelle. Wortlos. Zelischka und Artistka scheinen gestorben zu sein, und auch ich beginne mich zu fühlen, als sei ich bereits tot.
Unheimlicher noch als das Schweigen außen ist die Tatsache, dass in meinem Inneren die gleiche Grabesruhe herrscht. Keine Angst, keine Hoffnung, keine Wut, da ist nichts. Mein Verstand umkreist dieses Urteil viele Male, kann aber den Sinn nicht entschlüsseln. Zehn Jahre Zwangsarbeit in Sibirien, das ist einfach nicht real. Genauso gut hätte man mich dazu verurteilen können, auf dem Mond Zwiebeln zu ernten.
Um zu fühlen, dass ich überhaupt noch am Leben bin, nehme ich endlose Wanderungen durch meinen kleinen Verschlag auf. Fünf Schritte hin, fünf Schritte zurück. Gedichte fallen mir ein. Ich sage eines nach dem anderen auf, froh, wenigstens meine eigene Stimme zu hören.3
Mit dem Schuldspruch durch das Militärtribunal begann für Erika Riemann eine leidvolle Odyssee, die sie durch mehrere Lager und Gefängnisse auf deutschem Boden führte und nach mehr als sieben Jahren erst am 18. Januar 1954 mit ihrer Freilassung endete.4 Um ihr Schicksal einordnen zu können, ist ein Blick auf die Situation in dem sowjetisch besetzten Teil Deutschlands in den Jahren 1945 bis 1946 notwendig.
Mit der bedingungslosen Kapitulation des Oberkommandos der Wehrmacht war der Zweite Weltkrieg in Europa im Mai 1945 zu Ende gegangen und die Armeen der alliierten Siegermächte USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich hatten das ehemalige Deutsche Reich besetzt und in vier je von einer der Besatzungsmächte verwalteten Zonen aufgeteilt. Während der Alltag der Zivilbevölkerung in den ersten Monaten vor allem von der Suche nach Nahrung und Unterschlupf sowie der Unsicherheit über den Verbleib ihrer Angehörigen bestimmt war, begannen die Alliierten mit der Neuordnung des Landes. Auf der Potsdamer Konferenz im Juli und August 1945 einigten sich die „großen Drei“ – der sowjetische Diktator Josef Stalin, US-Präsident Harry S. Truman und der britische Premierminister Winston Churchill5 – anknüpfend an vorherige Vereinbarungen darauf, Deutschland zu entmilitarisieren, die Bevölkerung zu entnazifizieren und die Kriegsverbrecher zu bestrafen sowie das Erziehungssystem, die Justiz, die Verwaltung und das öffentliche Leben entsprechend demokratischer Grundsätze umzugestalten. Darüber hinaus bekräftigten die Siegermächte ihre Absicht, alle wichtigen und das ganze Land betreffenden Angelegenheiten gemeinsam zu entscheiden, ließen die Frage nach der konkreten Ausgestaltung eines zukünftigen deutschen Staates aber offen. Verantwortlich für die Umsetzung der in Potsdam vereinbarten Ziele waren Militärregierungen, die von den Armeeführungen der jeweiligen Besatzungsmacht eingesetzt worden waren. Für die Sowjetische Besatzungszone (SBZ), die sich über Mecklenburg und Vorpommern, die mitteldeutschen Länder Sachsen und Thüringen, die Provinz Sachsen-Anhalt und einen Großteil der Provinz Brandenburg erstreckte, war die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) zuständig.6
Das Leben unter der sowjetischen Besatzungsmacht war für die Zivilbevölkerung von Beginn an von Rechtlosigkeit, Willkür und großer Unsicherheit geprägt. Verantwortlich dafür waren die sowjetischen Sicherheitsorgane, die neben der regulären Armee nach Deutschland gekommen waren. Unter der Führung der Geheimpolizei NKWD7 hatten sie den Befehl erhalten, alle „verdächtigen und feindlichen Elemente“ zu verhaften und die sowjetische Besatzungsherrschaft auf diese Weise abzusichern. Unter diese Definition fielen nicht nur Angehörige von NS-Organisationen wie der Wehrmacht, der Gestapo oder der Hitler-Jugend (HJ) sowie „aktive“ Mitglieder der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) und das Leitungspersonal von Verwaltungen und Zeitungen, sondern alle potenziellen Gegner der sowjetischen Besatzungsherrschaft wie vermeintliche „Werwölfe“, „Saboteure“ und ausländische „Spione“. Um diese Personengruppen aufzuspüren, führte das NKWD nach Kriegsende groß angelegte Razzien durch und durchkämmte dabei systematisch Ortschaften, Wälder, Bahnhöfe, Häfen, Gaststätten und Hotels. Bei einer der größten Suchaktionen wurden in den ersten beiden Augustwochen 1945 fast 65 000 Personen aufgegriffen, von denen über 3000 verhaftet wurden. Darüber hinaus ging die sowjetische Geheimpolizei, wie im Fall von Erika Riemann, zielgerichtet gegen einzelne Personen vor, über die Hinweise auf „feindliche Aktivitäten“ eingegangen waren. Die Informationen der sowjetischen Sicherheitsorgane stützten sich dabei nicht nur auf ein wachsendes Netz von Spitzeln, das im Februar 1946 bereits mehr als 3000 Personen umfasste, sondern auch auf Denunziationen aus der Bevölkerung. Diese erfolgten häufig freiwillig aus politischer Überzeugung, Missgunst und Neid bzw. dem Bestreben, sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen. In vielen Fällen gingen die Anzeigen aber auch auf die Unterdrucksetzung und Folter von bereits Inhaftierten durch das NKWD zurück.8
Zeitgenössische Abbildung der alliierten Besatzungszonen.
Für die Betroffenen begann mit ihrer Inhaftierung häufig ein langer und qualvoller Leidensweg, der sie zunächst in eines der vielen sowjetischen Untersuchungsgefängnisse führte. Diese in der Bevölkerung entsprechend der früheren Bezeichnung der sowjetischen Geheimpolizei „GPU-Keller“9 genannten Haftorte wurden nicht nur in ehemaligen Gefängnissen, sondern auch in anderen öffentlichen Gebäuden sowie Privathäusern eingerichtet. Die Inhaftierten sahen sich hier meist katastrophalen Bedingungen ausgesetzt, wobei sie neben einer unzureichenden Versorgung mit Lebensmitteln auch unter mangelnder Hygiene und Überfüllung der Zellen zu leiden hatten. Darüber hinaus wurden sie, wie von Erika Riemann beschrieben, stundenlangen Verhören unterzogen, die in der Regel nachts stattfanden und von Einschüchterungen, körperlichen Misshandlungen und seelischer Folter geprägt waren. Während die Schuld der Inhaftierten dabei schon durch die Tatsache ihrer Verhaftung als erwiesen galt, zielten die Vernehmungen darauf ab, Details über die „feindliche Aktivität“ der Verhafteten sowie die Namen weiterer „Täter“ und Informationen über die Organisationen wie den Werwolf aus den Gefangenen herauszupressen. Für einen Teil der Inhaftierten zogen sich die Vernehmungen über mehrere Monate hin, wohingegen andere nur ein oder einige wenige Male befragt wurden. Zu einem Ende kam die Tortur der Verhöre für die Betroffenen in der Regel erst, wenn sie die in Russisch verfassten Vernehmungsprotokolle unterschrieben hatten, selbst wenn sie deren Inhalt häufig nicht verstanden.10
Der Großteil der Verhafteten – bis zum Oktober 1946 ca. 63 000 – wurde nach dem Abschluss der Vernehmungen ohne Gerichtsverfahren und Urteil in eines der sogenannten Speziallager verlegt. Dabei handelte es sich um ein System von insgesamt zehn großen Haftorten, die von der sowjetischen Besatzungsmacht zwischen April 1945 und Mai 1946 auf dem Areal ehemaliger Gefängnisse bzw. NS-Konzentrationslager eingerichtet worden waren. Der weitaus kleinere Teil der Untersuchungshäftlinge – 1945 etwa 800 und 1946 etwa 4300 Personen – wurde vor eines der Sowjetischen Militärtribunale gestellt und dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne die Möglichkeit, sich zu verteidigen, im Schnellverfahren abgeurteilt. Die ausgesprochenen Urteile lauteten dabei in der Regel auf 10, 15 oder 25 Jahre Lagerhaft und in mehreren Hundert Fällen auf Todesstrafe. Nachdem die sowjetische Führung anfangs geplant hatte, die durch die Militärtribunale Verurteilten als Arbeitskräfte in die Sowjetunion zu deportieren, wurden sie zur Verbüßung ihrer Strafe ab 1946 ebenfalls in die Speziallager verlegt.11
Die Speziallager wurden somit zum zentralen Bestandteil und zum Symbol des sowjetischen Repressionsregimes in der SBZ und verwiesen auf dessen Grundcharakter. Zum einen verdeutlichen sie den doppelten Zweck der sowjetischen Strafmaßnahmen. Richteten diese sich im ersten Jahr der sowjetischen Besatzung in erster Linie gegen Angehörige verschiedenster nationalsozialistischer Organisationen, darunter sowohl einfache Mitglieder als auch tatsächlich belastete NS-Kriegsverbrecher, wurden ab 1946 zunehmend Personen, die als politische Gegner der sowjetischen Herrschaft wahrgenommen wurden, inhaftiert. Zum anderen wird an den Speziallagern auch die extreme Rücksichtslosigkeit der sowjetischen Führung im Umgang mit ihren Gegnern deutlich. So starben in den Jahren 1945 und 1946 Zehntausende von Inhaftierten vor allem infolge unzureichender Versorgung mit Lebensmitteln, katastrophalen hygienischen Bedingungen und Krankheiten.12
Parallel zur Verfolgung „aktiver“ Nazis und potenzieller Gegner durch die sowjetischen Sicherheitsorgane trieb die SMAD die Neuordnung der SBZ voran. Deren Handeln war dabei immer an die übergeordneten strategischen Ziele Stalins gebunden. Dessen Priorität lag zunächst auf dem Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Sowjetunion, der durch umfassende Demontagen deutscher Industriebetriebe und die Ableistung von Entschädigungszahlungen aus Deutschland möglich gemacht werden sollte. In der Hoffnung, Reparationen nicht nur aus der eigenen Besatzungszone, sondern auch aus den anderen Teilen Deutschlands zu erhalten, versuchte der sowjetische Diktator nach Kriegsende zunächst, die Zusammenarbeit mit den Westalliierten aufrechtzuerhalten. Daher ging er auch vorsichtig im Hinblick auf sein zweites strategisches Ziel vor: die Erweiterung seines Machtbereiches und wohl auch die Schaffung eines wiedervereinigten Deutschlands unter sowjetischem Einfluss.13 So sollte der – auch infolge der massiven Repressionen gegen die Bevölkerung entstehende – Anschein, die sowjetische Führung wolle auf deutschem Boden ein Regime stalinistischer Prägung errichten, vermieden werden.14
Vor diesem Hintergrund leiteten die SMAD und ihre regionalen Vertretungen auf Länderebene (SMA) sowie die örtlichen Militärkommandanturen bereits ab Juni 1945 umfassende Strukturreformen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur ein. Diese sollten unter dem Stichwort der „antifaschistisch-demokratischen Umwälzung“ den Eindruck erwecken, es gehe der sowjetischen Führung um die Errichtung einer Demokratie. Gleichzeitig wurden aber auch die Grundlagen dafür geschaffen, zu einem späteren Zeitpunkt ein kommunistisches Regime installieren zu können. Deutlich wurde diese doppelte Absicht beim Aufbau des neuen politischen Systems in der SBZ. Bereits am 10. Juni 1945 und damit noch vor den Westalliierten erlaubte die SMAD die Bildung von demokratischen Parteien, Gewerkschaften und gesellschaftlichen Massenorganisationen15 und ermöglichte auf diese Weise die (Wieder-)Gründung von vier politischen Parteien: der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), der Liberaldemokratischen Partei (LDP), der SPD und der CDU. Mit diesem Schritt wurde einerseits ein pluralistisches Parteiensystem geschaffen, das theoretisch einen demokratischen Wettbewerb ermöglicht hätte. Gleichzeitig wirkte die sowjetische Besatzungsmacht aber von Beginn an darauf hin, die ihr ideologisch nahestehende KPD als politische Führungsmacht aufzubauen. Dazu waren bereits vor Kriegsende drei Gruppen von emigrierten deutschen Kommunisten, die man in der Sowjetunion geschult und mit detaillierten Anweisungen ausgestattet hatte, in die SBZ zurückgebracht worden. Nach der Gründung der KPD übertrug die SMAD diesen Exil-Kommunisten – unter ihnen auch Walter Ulbricht – Schlüsselpositionen in der neu aufgebauten Verwaltung und bevorteilte die KPD darüber hinaus in materieller Hinsicht gegenüber den anderen Parteien, beispielsweise bei der Zuteilung von Papier für Wahlkampfmaterialien und Zeitungen. Ungeachtet dieser massiven Unterstützung gelang es der KPD bis zum Herbst 1945 nicht, sich die Zustimmung der Bevölkerungsmehrheit und die damit verbundene Führungsposition in der SBZ zu sichern.16
Aus diesem Grund änderte die KPD-Führung in Absprache mit der Besatzungsmacht im September 1945 ihr Vorgehen und strebte nun eine zuvor abgelehnte Vereinigung mit der SPD an, die Ende 1945 zur mitgliederstärksten Partei aufgestiegen war und zunehmend selbstbewusst auftrat. Viele Sozialdemokraten lehnten eine Verschmelzung mit der als „Russenpartei“ geltenden KPD ab, sodass der Zusammenschluss der Parteien zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) im April 1946 letztlich nur möglich wurde, weil die sowjetische Besatzungsmacht die Vereinigungsgegner systematisch einschüchterte, ihnen Redeverbote erteilte und sie in vielen Fällen verhaftete. Die Zwangsvereinigung der SPD mit der KPD war eine wichtige Zäsur für die weitere Entwicklung der SBZ. Zwar wurden zentrale Ämter in der neuen Partei paritätisch mit ehemaligen SPD- und KPD-Funktionären besetzt und die SED-Führung bekannte sich zunächst noch nicht offen zum Ziel der Errichtung eines stalinistischen Herrschaftssystems nach sowjetischer Prägung. Gleichwohl markierte die erzwungene Gründung der SED das Ende des Parteienpluralismus und verdeutlichte den unbedingten Willen der deutschen Kommunisten, sich mit allen Mitteln die politische Vorherrschaft in der SBZ zu sichern – ein Anspruch, den die SED-Führung im Jahresverlauf 1946 ungeachtet der Proteste der anderen Parteien zunehmend offensiv formulierte und der alle Gesellschaftsbereiche umfassen sollte.17
1 Kollektivierung und Justizterror – Die Frühphase der Repression auf dem Land
1.1 Thematische Einführung
1.1.1 Die Diktatur nimmt Gestalt an
Der sich abzeichnende Kalte Krieg veränderte die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) grundlegend. War Stalin nach Kriegsende wohl zunächst bestrebt gewesen, ein geeintes Deutschland unter sowjetischem Einfluss zu schaffen, führten die zunehmenden Spannungen zwischen der Sowjetunion und den USA seit Anfang 1947 zu einem allmählichen Kurswechsel. Die sowjetische Führung intensivierte ihre Bemühungen, die SBZ in den eigenen Herrschaftsbereich einzugliedern, und leitete die Sowjetisierung Ostdeutschlands ein. Im Zuge dessen begann die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) ab 1948 nicht nur mit dem Aufbau einer zentral gesteuerten Planwirtschaft, sondern auch mit der Anpassung der politischen Strukturen an das Herrschaftsmodell des Stalinismus.1 Unter diesen Vorzeichen legte die Führung der SED ihre öffentliche Zurückhaltung ab und strebte nun offensiv die Weiterentwicklung zu einer dem sowjetischen Muster entsprechenden „Partei neuen Typs“ an. Dazu wurden die noch in der SED verbliebenen ehemaligen SPD-Funktionäre aus den bis dahin paritätisch besetzten Führungspositionen verdrängt, die Kritiker der Parteiführung ausgeschlossen und auf diesem Wege die Dominanz der kommunistischen Kräfte untermauert. Dieser Prozess der Neujustierung war bis Januar 1949 abgeschlossen und bildete eine wichtige Vorrausetzung für die Schaffung einer stalinistischen Diktatur nach sowjetischem Vorbild.2
Seit 1948 drängte die SED-Spitze um Walter Ulbricht bei der sowjetischen Führung verstärkt auf die Gründung eines eigenständigen ostdeutschen Staates. Auf dieses Ansinnen reagierte Stalin aus strategischen Gründen jedoch weiterhin zurückhaltend, da er die Hoffnung auf die Schaffung eines Gesamtdeutschlands unter seinem Einfluss noch nicht aufgegeben hatte. Anstatt offen auf die Errichtung eines sozialistischen Staates hinzuarbeiten, mahnte er die SED-Führung zur Vorsicht und forderte die Verschleierung ihrer wahren Absichten vor der Öffentlichkeit. Diese abwartende Haltung gab der sowjetische Diktator erst im Mai 1949 auf, nachdem die Gründung der Bundesrepublik Deutschland verkündet worden war und sich die deutsche Teilung damit endgültig manifestiert hatte.3
Die Vorbereitungen für die Schaffung eines ostdeutschen Staates wurden nun intensiviert und noch im Mai der Deutsche Volkskongress als Vorstufe einer verfassunggebenden Versammlung gewählt. Davon ausgehend erfolgte am 7. Oktober 1949 die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik mit ihrer Hauptstadt Ostberlin. Dabei wurde mit der Konstituierung des Parlaments als dem formal höchsten Organ nach außen hin der Schein einer parlamentarischen Demokratie gewahrt. Tatsächlich spielten die demokratischen Institutionen aber keine entscheidende Rolle, da alle zentralen politischen Entscheidungen von der Führung der SED in Absprache mit der sowjetischen Besatzungsmacht getroffen wurden. Zwar waren mit der CDU, LDP sowie der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands (DBD) und der National-Demokratischen Partei Deutschlands (NDPD), die beide 1948 neu gegründet worden waren, offiziell weitere Parteien im Parlament vertreten. Allerdings konnten diese Blockparteien nicht unabhängig von der SED agieren und dienten lediglich der Vortäuschung demokratischer Verhältnisse. Um den Führungsanspruch der SED in der politischen Praxis zur Geltung zu bringen, wurde im Zuge der Staatsgründung eine Doppelstruktur aus staatlichen Stellen und Parteistellen geschaffen. Dabei gaben die Führungsgremien der SED – das Zentralkomitee (ZK), das Politbüro und das Sekretariat des ZK – nicht nur die Leitlinien der Politik vor, sondern ließen sich alle wichtigen Entscheidungen der Regierung, des Parlaments oder einzelner Minister vor ihrer Ausführung vorlegen und segneten diese ab.4
Die Gründung der DDR beendete formal die sowjetische Besatzung in Deutschland. Dementsprechend übertrug die SMAD ihre administrativen Funktionen am 10. Oktober an die DDR-Regierung und wurde in die Sowjetischen Kontrollkommission (SKK) umgewandelt. Auch wenn das Personal dieses Kontroll- und Beratungsorgans in den Folgejahren schrittweise reduziert wurde, blieb der maßgebliche sowjetische Einfluss auf zentrale Fragen von Politik, Wirtschaft, innerer Sicherheit, Justiz und Verwaltung erhalten.5
Die Herrschaft der SED war von Beginn an durch eine Mischung aus sozialistischer Ideologie und pragmatischen Überlegungen geprägt. Ausgehend von der Idee des Klassenkampfes zwischen den „werktätigen“ Teilen der Bevölkerung auf der einen und den kapitalistischen „Ausbeutern“ auf der anderen Seite bestand das langfristige Ziel in der Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft nach sowjetischem Vorbild, deren Überlegenheit gegenüber dem westlichen, kapitalistischen System sich zwangsläufig aus der Geschichte ableite. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte die Herrschaft der Arbeiter und der SED als ihrem Repräsentanten gefestigt, die Eigentumsverhältnisse neu geordnet und das Denken der Bevölkerung durch eine sozialistische Erziehung langfristig verändert werden. Die Anwendung von Gewalt gegen die Gegner dieser Ideen wurde dabei ausdrücklich als legitimes und notwendiges Mittel der Herrschaftsausübung angesehen. Seit Beginn ihrer Existenz war die Verwirklichung der kommunistischen Utopie für die Politik der SED handlungsleitend. Jedoch war der Parteiführung klar, dass die dafür notwendigen Schritte nicht kurzfristig und ohne Kompromisse vollständig umgesetzt werden konnten, ohne die eigene Macht zu gefährden. Vor diesem Hintergrund war die Herrschaft der SED in den folgenden Jahrzehnten häufig von Widersprüchen geprägt und gestaltete sich als eine Abfolge von Phasen unnachgiebiger ideologischer Politik und Zeiten zumindest begrenzter Kompromissbereitschaft und Zurückhaltung.6
Nach der Gründung der DDR war die SED-Spitze unter der Führung von Walter Ulbricht zunächst bestrebt, ihre Macht weiter auszubauen. Dazu wurden einerseits abweichende Meinungen innerhalb der eigenen Partei bekämpft und infolge einer Mitgliederüberprüfung im Jahr 1950 mehr als 150 000 als politisch unzuverlässig eingestufte Mitglieder ausgeschlossen. Andererseits gelang es der SED-Führung, ihren Einfluss auf die bis dahin zumindest teilweise unabhängig agierenden Blockparteien CDU und LDP auszuweiten und ihre Vormachtstellung im neu etablierten politischen System durch die Anpassung der Wahlregularien abzusichern.7 Begleitet wurde die schrittweise Ausweitung der SED-Herrschaft von einer Militarisierung von Staat und Gesellschaft, die unter anderem in der Gründung der Kasernierten Volkspolizei als Vorform einer regulären Armee ihren Ausdruck fand, sowie von einer Wirtschaftspolitik, die in erster Linie auf die Stärkung der Schwerindustrie abzielte. All diese Maßnahmen dienten dem Aufbau eines sozialistischen Staates nach sowjetischem Vorbild, auch wenn sich die SED-Führung zunächst nicht öffentlich zu diesem Ziel bekannte.8
Das änderte sich erst im Frühjahr 1952. Im März hatte Stalin sich in einer diplomatischen Note an die Westalliierten gewendet und die Schaffung eines neutralen Gesamtdeutschlands in Aussicht gestellt. Die einstigen Bündnispartner der Sowjetunion sahen diesen Vorstoß jedoch lediglich als den Versuch an, die geplante Einbindung der BRD in das westliche Verteidigungsbündnis zu verhindern, und lehnten ab.9 Als Konsequenz daraus entsprach der sowjetische Diktator dem Wunsch der SED, die sozialistische Umgestaltung der DDR zu intensivieren, ohne dabei auf die öffentliche Meinung Rücksicht nehmen zu müssen. Auf der II. SED-Parteikonferenz im Juli 1952 kündigte der mittlerweile zum Generalsekretär gewählte Walter Ulbricht daher den „Aufbau des Sozialismus“ und die „Verschärfung des Klassenkampfes“ an. Damit einher ging nicht nur die Abriegelung der innerdeutschen Grenze und die Gründung der Nationalen Volksarmee (NVA), sondern auch eine territoriale Neuordnung des Landes, bei der die Länderstruktur durch Bezirke ersetzt und dadurch die letzten Reste regionaler Selbstverwaltung beseitigt wurden. Darüber hinaus forcierte die SED-Führung den Umbau der Wirtschaft nach sowjetischem Vorbild, richtete die Schul- und Kulturpolitik streng an der sozialistischen Ideologie aus und versuchte, den Einfluss der christlichen Kirchen zurückzudrängen.10
1.1.2 Der Repressionsapparat formiert sich
Begleitet worden war der schrittweise Aufbau der SED-Herrschaft von Beginn an durch den umfassenden Einsatz von Repressionen. Richteten sich die Verhaftungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit vor allem gegen NS-Belastete, gerieten ab 1946 verstärkt all jene Personen ins Visier, die als Gegner der SED-Führung wahrgenommen wurden. Das umfasste zum einen Abweichler innerhalb der SED sowie die Mitglieder der bürgerlichen Parteien CDU, SPD und LDP. Zum anderen waren aber auch SED-kritische Intellektuelle betroffen sowie Handwerker, Unternehmer und Bauern, denen Verstöße gegen das im Rahmen der Einführung der Planwirtschaft verschärfte Wirtschaftsrecht vorgeworfen wurde.11 Geplant und ausgeführt wurden die Verfolgungsmaßnahmen weiterhin zu einem Großteil von den sowjetischen Sicherheitsdiensten und den Sowjetischen Militärtribunalen (SMT), die noch bis 1955 tätig waren und bis dahin insgesamt fast 40 000 Deutsche verurteilten.12
Gleichzeitig wurden nach und nach die Voraussetzungen dafür geschaffen, die politische Strafjustiz an die DDR-Organe zu übertragen. Ein erster Schritt dazu war die Auflösung der drei noch existierenden sowjetischen Speziallager im Frühjahr 1950. Etwa die Hälfte der 30 000 verbliebenen Insassen wurde freigelassen. Ungefähr 10 500 der von den SMT verurteilten Häftlinge wurden in deutsche Strafvollzugseinrichtungen überstellt und weitere 3300 Personen in den Waldheimer Prozessen in Schnellverfahren ohne Verteidigung, Beweisaufnahme oder Zeugenvernehmungen verurteilt und in den meisten Fällen ebenfalls in deutschen Gefängnissen inhaftiert. In 33 Fällen wurden überdies Todesstrafen ausgesprochen.13
Als weiterer wichtiger Baustein für das Repressionssystem wurde der Aufbau einer der SED treu ergebenen Justiz angesehen. Im Rahmen der Entnazifizierung waren nach Kriegsende mehr als drei Viertel aller Richter und Staatsanwälte aus dem Dienst entlassen worden. Sie wurden in großer Zahl durch politisch zuverlässige, also der KPD bzw. SED nahestehende Laien ersetzt, die in Schnellkursen auf ihre jeweilige Funktion als sogenannte Volksrichter vorbereitet wurden. Ab 1948 leitete die SED die Zentralisierung, Politisierung und Sowjetisierung der Justiz ein. Dazu wurden zum einen die Organisationsstrukturen und das Strafprozessrecht in Teilen an das sowjetische Vorbild angepasst und zum anderen das verbliebene nichtsozialistische Personal durch SED-Mitglieder ersetzt. Diese Neuordnung war bis 1952 weitgehend abgeschlossen und resultierte in einem Justizwesen, das für den „verschärften Klassenkampf“ vorbereitet war.14
Einen ähnlichen Transformationsprozess durchlief die Polizei. Nach ihrer Neuorganisation im Jahr 1945 war sie unter Anleitung der SMAD zunächst ausschließlich für Ordnungsaufgaben zuständig. Gleichzeitig wurde sie jedoch von Beginn an in die Repressionspolitik der Besatzungsbehörden eingebunden und war als Hilfsorgan der sowjetischen Geheimdienste vor allem ab dem Ende der 1940er Jahre an der Verfolgung vermeintlicher oder tatsächlicher Regimegegner beteiligt. Das spiegelte sich auch in der Rekrutierung des Personals wider, die in erster Linie nach politischen Kriterien erfolgte. Während die Leitungspositionen häufig mit ehemaligen Widerstandskämpfern und langjährigen Mitgliedern der KPD besetzt wurden, rekrutierte sich die Mehrzahl der einfachen Polizisten aus überwiegend kaum gebildeten, aber politisch zuverlässigen Arbeitern. In den Jahren nach der Staatsgründung wurde der Polizeiapparat kontinuierlich ausgebaut und umfasste 1952 schon über 60 000 Mitarbeiter. Zwar verfügte die Volkspolizei im Vergleich zu den anderen Sicherheitsorganen und dem Militär über weniger Ressourcen, gleichzeitig war sie aber besonders in den ländlichen Gebieten einer der sichtbarsten Repräsentanten der neuen Staatsmacht.15
Ein letzter grundlegender Schritt bei der Errichtung des Repressionsapparates war die Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) im Februar 1950. Als „Schild und Schwert der Partei“ war das MfS von Beginn an eng an die SED-Führung gebunden und sollte als Geheimdienst äußere Gefahren abwehren und als Geheimpolizei die Gegner im Inneren bekämpfen. Bereits während der Besatzungszeit war mit dem Dezernat 5 der Kriminalpolizei (K5) eine für politische Kriminalität zuständige Abteilung innerhalb der Volkspolizei geschaffen worden, die jedoch ausschließlich als Hilfsorgan für die sowjetischen Sicherheitsdienste agiert hatte. Im Frühjahr 1949 entsprach Stalin dann dem Wunsch der SED-Führung, eine eigenständige deutsche Geheimpolizei zu gründen, und erlaubte im Zuge der Staatsgründung die Einrichtung der „Hauptverwaltung für den Schutz des Volkseigentums“, die wenige Monate später zum Ministerium für Staatssicherheit wurde. Das Führungspersonal der Geheimpolizei umfasste ca. 85 Deutsche,16 die zur ersten Generation der kommunistischen Bewegung gehört hatten und von Gewalterfahrungen in Deutschland und der Sowjetunion geprägt waren. Ähnlich wie bei der Volkspolizei bestand das übrige Personal überwiegend aus sehr jungen Männern, die aus sozial unterprivilegierten Verhältnissen stammten und meist nur über einen sehr niedrigen Bildungsstand verfügten, sich aber durch große Loyalität gegenüber dem neuen Regime auszeichneten. Die fehlende fachliche und allgemeine Qualifikation der MfS-Mitarbeiter führte in der Praxis zu zahlreichen Problemen, die selbst grundlegende Aufgaben der Polizeiarbeit wie das Abfassen von Vernehmungsprotokollen betraf. Infolgedessen konnte das MfS seinem Anspruch und Selbstbild eines elitären und diszipliniert agierenden Sicherheitsdienstes vor allem in den ersten Jahren seiner Existenz kaum gerecht werden und zeichnete sich in seinem Vorgehen weniger durch Geschick und Effizienz bei der Ermittlungsarbeit als durch große Brutalität aus. Während das MfS in den späteren Jahrzehnten der SED-Herrschaft zum dominierenden Akteur in der Repressionslandschaft der DDR wurde, war dies in der Anfangszeit noch nicht absehbar. So konkurrierte die Geheimpolizei in den ersten Jahren nach ihrer Gründung mit der Justiz sowie verschiedenen anderen offen oder verdeckt operierenden Überwachungsorganen um die Kompetenzen bei der politischen Strafverfolgung. Darüber hinaus war der MfS-Apparat sowie das damit verbundene Netz an Informanten anfangs noch vergleichsweise klein. Aus diesem Grund war die Geheimpolizei bis 1953 vor allem in den ländlichen Gebieten kaum präsent und verfügte beispielsweise im einwohnerschwachen Norden der DDR in vielen Kreisen nur über sieben bis acht Mitarbeiter.17
1.1.3 Die Umgestaltung der Landwirtschaft beginnt
Eine der ersten Maßnahmen des Gesellschaftsumbaus in der SBZ und der Ausgangpunkt der Landwirtschaftspolitik war die Bodenreform. Dabei wurden ab Herbst 1945 alle Großgrundbesitzer mit Landbesitz von mehr als 100 Hektar sowie als „aktive Nationalsozialisten“ und „Kriegsverbrecher“ eingestufte Eigentümer entschädigungslos enteignet und das frei werdende Land an landlose Bauern, Landarbeiter und Flüchtlinge bzw. Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten verteilt. Das Ziel dieser Neuordnung der Besitzverhältnisse war die grundlegende Veränderung des Sozial- und Machtgefüges auf dem Land. So sollten die bis dahin einflussreichen Gutsbesitzer entmachtet und die unterprivilegierten Schichten der Landbevölkerung sowie die als „Umsiedler“ bezeichneten Vertriebenen gestärkt und als sogenannte Neubauern dazu befähigt werden, ihren Lebensunterhalt eigenständig zu bestreiten.18
Nach der Bodenreform teilte die SED die Bauern entsprechend der ihnen zur Verfügung stehenden Ackerfläche in drei Gruppen ein. Kleinbauern bearbeiteten bis zu 10 Hektar Land, Mittelbauern verfügten über eine Fläche von 10 bis 20 Hektar und „Großbauern“19 bewirtschafteten eine Fläche bis 100 Hektar. Diese Einteilung war in erster Linie ideologisch begründet und schaffte die Grundlage für den Umgang der SED mit den Landwirten in den folgenden Jahren. Während sich die SED als Interessenvertreter der Klein- und Mittelbauern als den sogenannten werktätigen Bauern verstand, betrachtete sie die „Großbauern“ als eine feindliche soziale Klasse, die die ärmere Landbevölkerung ausbeute und die sozialistischen Ideen ablehne.20
Ungeachtet dieser Freund-Feind-Zuschreibung richtete sich die Landwirtschaftspolitik von SED und SMAD bis 1948 nicht direkt gegen die „Großbauern“. Der Grund für diese Zurückhaltung lag neben der sowjetischen Deutschlandpolitik vor allem in der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Gruppe. So handelte es sich bei ihnen häufig um erfahrene und gut ausgestattete Bauern, die hohe Ernteerträge erzielten und daher überaus wichtig für die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung waren. Dagegen befand sich vor allem unter den Kleinbauern eine große Zahl von Neubauern, die häufig über wenig oder gar keine Erfahrung in der Landwirtschaft verfügten und zudem in vielen Fällen nicht die notwendigen Maschinen besaßen, um die ihnen übertragenen Ackerflächen effizient bewirtschaften zu können. Die SED konzentrierte sich in erster Linie darauf, die Neubauern zu unterstützen und auf diese Weise sowohl deren Existenz zu sichern als auch die landwirtschaftliche Produktion insgesamt anzukurbeln. Zu diesem Zweck wurde die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) gegründet und darüber hinaus Maschinen-Ausleih-Stationen (MAS) eingerichtet, die den Bauern die benötigten Landmaschinen gegen eine Leihgebühr zur Verfügung stellen sollten.21
Auch wenn bei der gezielten Förderung der Klein- und Mittelbauern zunächst wirtschaftliche Motive handlungsleitend waren, verfolgte die SED damit von Beginn an auch politische Ziele. So sollte durch die Stärkung der „werktätigen“ Landwirte der Einfluss der „Großbauern“ schrittweise zurückgedrängt werden. In der Praxis war von einer Veränderung der Machtverhältnisse jedoch in den ersten Jahren nach der Bodenreform wenig zu spüren. Während viele Klein- und Mittelbauern bis 1948 wirtschaftlich schwach blieben und trotz Einrichtung der MAS noch immer davon abhängig waren, Landmaschinen von den „Großbauern“ auszuleihen, erzielten Letztere häufig hohe Gewinne und konnten ihren Einfluss auf die Dorfgemeinschaften aufrechterhalten oder sogar ausbauen – ein aus Sicht der SED unhaltbarer Zustand.22
Hatte die SED bis Mitte 1948 darauf verzichtet, aktive Maßnahmen gegen die „Großbauern“ durchzuführen, änderte sich dies im Zuge der nun eingeleiteten verstärkten Sowjetisierung Ostdeutschlands. Ausgangspunkt der neuen Politik war die 11. Tagung des SED-Vorstandes im Juni 1948, auf der die Parteiführung ihre Rhetorik gegenüber den „Großbauern“ verschärfte. So wurden diese nun auch öffentlich als Ausbeuter der „werktätigen“ Bauern gebrandmarkt und ihre Zurückdrängung aus allen Sphären des dörflichen Lebens zum Ziel erklärt. Zu diesem Zweck sollten lokale Kontrollkommissionen, die im Jahr zuvor zur Bekämpfung des Schwarzmarkthandels gegründet worden waren, den Einfluss der „Großbauern“ in den Dorfgemeinschaften ermitteln und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Darüber hinaus wurde im Folgejahr das Steuerrecht so angepasst, dass die „Großbauern“ pro Hektar Land bis 30 Prozent mehr Steuern zahlen mussten als die Kleinbauern. Während diese Maßnahmen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der betroffenen Landwirte nachhaltig schwächen sollte, wurden gleichzeitig die Anforderungen an diese Gruppe der Bauern sukzessive angehoben. Das entscheidende Mittel dafür war die Erhöhung der Ablieferungsquoten.23
Wie in der Planwirtschaft nach sowjetischem Vorbild üblich, konnten die Bauern nicht frei über die Menge und den Vertrieb der von ihnen produzierten landwirtschaftlichen Produkte entscheiden. Vielmehr wurde ihnen von staatlichen Funktionären entsprechend der Größe ihrer Ackerfläche vorgeschrieben, wie viel pflanzliche und tierische Erzeugnisse sie im jeweiligen Jahr zu einem festen Preis bei staatlichen Stellen abzuliefern hatten. Lediglich die darüber hinaus erwirtschafteten landwirtschaftlichen Erzeugnisse durften als sogenannte freie Spitzen von den Bauern selbst verkauft werden. Wer die vorgegebenen Ablieferungsquoten nicht erfüllte, musste mit harten Strafen rechnen, die von der Beschlagnahmung von landwirtschaftlichen Gütern bis hin zu Gefängnisstrafen reichen konnten. Ab 1949 nutzte die SED diesen Steuerungsmechanismus gezielt, um die „Großbauern“ unter Druck zu setzen, und erhöhte die Quoten bis Anfang 1952 schrittweise um bis zu 44 Prozent. Ab Beginn der 1950er Jahre konnten immer mehr der betroffenen Bauern diesem Druck nicht mehr standhalten und sahen sich gezwungen, ihre Bauernhöfe aufzugeben. So entschieden sich von den Landwirten mit einer Ackerfläche von mindestens 20 Hektar bis Ende 1951 mehr als 3300 dazu, ihre Bauernhöfe zu verlassen und zu einem großen Teil in die Bundesrepublik zu flüchten, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. 24
Während die SED die Gruppe der Großbauern wie geplant schwächen konnte, blieben zwei zentrale Probleme der Landwirtschaftspolitik ungelöst. Zum einen gelang es vielen Neubauern trotz staatlicher Unterstützung nicht, das ihnen übertragene Land gewinnbringend zu bewirtschaften. Das führte dazu, dass viele Landwirte dieser Gruppe ebenfalls ihre Höfe aufgaben und in der Folge immer größere landwirtschaftliche Nutzflächen brachlagen. Zum anderen war die SED trotz ihres Engagements für die Klein- und Mittelbauern nicht in der Lage, diese Gruppe von der eigenen Politik zu überzeugen und an sich zu binden. Indem man sich auf die Seite der vermeintlich unterdrückten und ausgebeuteten „werktätigen“ Bauern stellte, hatte die Partei gehofft, diesen Teil der Landbevölkerung vom Sozialismus zu überzeugen und sie gleichzeitig gegen die „Großbauern“ als den vermeintlichen „Klassenfeind“ aufzuhetzen. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass der Zusammenhalt in vielen dörflichen Gemeinschaften stärker war als die ideologischen Grundannahmen der SED. So kam es statt des von der Partei erwarteten „Klassenkampfes von unten“ insbesondere ab 1951 an verschiedenen Orten zu Solidaritätsbekundungen der Dorfbevölkerung mit den von Repressionen bedrohten „Großbauern“.25
Bis Anfang 1952 war die Landwirtschaftspolitik der SED also nur teilweise von Erfolg gekrönt. Zwar gelang es auf der einen Seite, die Ernteerträge zu stabilisieren und den Gesamtumfang der landwirtschaftlichen Produktion in vielen Bereichen wieder auf das Vorkriegsniveau zu heben. Auf der anderen Seite stand die SED 1952 aber sowohl vor dem Problem, das durch die zunehmende Landflucht frei werdende Ackerland in den landwirtschaftlichen Produktionsprozess zu integrieren, als auch vor der Herausforderung, das eigene Klientel in seine Politik einzubinden und auf diese Weise die eigene Herrschaft auf dem Land zu sichern.26