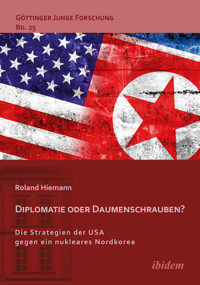
45,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Göttinger Junge Forschung
- Sprache: Deutsch
Seit nunmehr drei Jahrzehnten schwelt die Atomkrise mit Nordkorea – und ein Ende scheint nicht in Sicht. Die USA haben in diesem weltpolitischen Konfl ikt stets eine Schlüsselrolle gespielt. Zwischen Diplomatie und Daumenschrauben hat Washington wenig erfolgreich versucht, den renitenten Machthabern ihr begehrtes Atomwaff enpotenzial abspenstig zu machen. In seiner Analyse der Außenpolitik der USA zeichnet Roland Hiemann den Atomkonfl ikt von seinen Anfängen bis zum Ende der Präsidentschaft George W. Bushs detailliert nach. Dabei geht er dem ideologischen Streit über den richtigen Umgang mit Pjöngjang auf den Grund und erörtert den Einfl uss individueller Entscheidungsträger auf die Nichtverbreitungsstrategien gegen ein nukleares Nordkorea.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1122
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Vorwort:Einigkeit in der Verschiedenheit
Robert Lorenz / Matthias Micus
Zuletzt ist Bewegung in die Außenpolitik der USA gekommen. Länder, die eben noch der Gruppe der Schurkenstaaten zugerechnet wurden, werden in Washington plötzlich mit anderen Augen gesehen, die Beziehungen zu ihnen auf eine neue Grundlage gestellt. So wurde Kuba von der Liste der Terrorstaaten gestrichen – und mit der vermeintlichen Inkarnation des Bösen, dem vielfach sogenannten „Mullah-Regime“ Iran, traf eine internationale Delegation unter Führung der USA eine Rahmenvereinbarung in Atomfragen.
Um Atomfragen, genauer: die Nichtverbreitung von Kernwaffen und die Verhinderung einer Nuklearisierung geht es auch in der amerikanischen Politik gegenüber Nordkorea. Mit welchen diplomatischen Mitteln bestreiten die USA den Kampf für die Nonproliferation atomarer Waffen am Beispiel Pjöngjangs? Aus welchen außenpolitischen Denktraditionen leiten die Präsidenten seit George Bush sen. ihre Strategie in der Nordkoreapolitik ab, in welchem administrativen Umfeld agieren sie, wie groß sind die Handlungsspielräume, wer sind die präsidentiellen Berater, wer die Gegenspieler – und inwiefern erschwert oder begünstigt die Konstellation außenpolitikrelevanter Regelungen, Akteure und Institutionen die Umsetzung der Politikpräferenzen des amtierenden Entscheidungsträgers im Oval Office? Das sind die Fragen, die sich Roland Hiemann in seiner hier vorliegenden Dissertation stellt.
Dabei interessiert ihn zunächst die Rolle, die der jeweilige Präsident (eine Frau gab es in dem Amt bis dato noch nicht) vermittels seiner Führungs- und Verwaltungsfunktion an der Spitze des Entscheidungs- und Aushandlungsprozesses im „Spiel“ zwischen den übrigen Akteuren in Außenpolitikfragen einnimmt. Der Präsident wählt seine Mitarbeiter aus, weist ihnen spezifische Kompetenzen und Aufgaben zu und nimmt durch die Einsetzung und Auflösung von Gremien auch Einfluss auf die Strukturen der Entscheidungsfindung. Die von Hiemann konstatierte Zentralisierung des Außenpolitikprozesses in sowohl inhaltlicher als auch prozessualer Dimension bildet das Fundament, aufdem der in dieser Arbeit angenommene Nexus zwischen präsidialem Führungsstil, institutionellen Strukturen, gouvernementalen Prozessen und handlungsbezogenen Prozessergebnissen aufbaut. Darüber hinaus richtet sich Hiemanns Erkenntnisinteresse auf den Wandel der Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse, auch innerhalb einer Regierungsperiode, auf einen Bereich mithin, der als Forschungslücke in Arbeiten zur US-Außenpolitik identifiziert wird. Und schließlich soll die Rolle informeller Gremien in der außenpolitischen Entscheidungsfindung ins Blickfeld gerückt, gründlich analysiert und geklärt werden, ob sich eine sukzessive Informalisierung von Aushandlungsprozessen im Verlauf auch einzelner Regierungsperioden feststellen lässt.
Hiemann benennt die beiden Pole, zwischen denen sich die Debatte in der außenpolitischen Kultur und der Administration bewegt: Das diplomatische „Give-and-take“ hier und die fundamentale Bekämpfung des „Bösen“, der „Schurken“ dort. Dazwischen ist ein großes Spannungsfeld, in dem sich unterschiedliche Akteure mit differenten, oft auch wechselnden Weltbildern tummeln. Und dieses Spannungsfeld, dazu die verschiedenartigen Kontexte und politischen Charaktere der jeweils führenden Leader interessieren Hiemann besonders; wodurch er sich notwendigerweise auf eine hohe Komplexität des Gegenstandes und seiner Deskription wie Analyse einzulassen hat. Kurz: Die Realität, die zwischen den konstruierten Dichotomien von Eindämmung und Einbindung liegt, zieht den Blick Hiemanns an. Es geht um Ziele, Motive, Überzeugungen, Handlungsweisen und Instrumente der amerikanischen Strategie gegenüber dem nordkoreanischen Nuklearprogramm.
Methodisch kennzeichnet die Arbeit ein Imperativ offener Zugänge. Hiemann will die bestehenden außenpolitischen Ansätze miteinander verbinden, das Gute hier und das Positive dort versöhnen und zwecks Erkenntnisstärkung zusammenführen. Daher konstruiert er unentwegt Brücken, zwischen dem internationalen System und den gesellschaftlichen Binnenprozessen innerhalb der Staaten, zwischen rationalen Entscheidungsprozeduren und den von Emotionen, gar Irrationalitäten durchwirkten Klimata in Entscheidungsmomenten, zwischen Strukturen und den präsidentiellen Einzelnen.
Diese Herangehensweise ist durchaus zielführend. In aller Deutlichkeit schält der Verfasser heraus, dass trotz aller Regierungs- und Strategiewechsel als elementare, wenngleich rhetorisch oft zurückgehaltene Grundhaltung konstant blieb, dass mit einem totalitären Regime der Sorte Nordkoreas die (nuklearen) Bedrohungen im Kern nicht über Diplomatie, sondern nur durch einen fundamentalen Systemwechsel zu lösen sein würden. Jenseits dieser Basisüberzeugung, welche die Bushs und Clinton vereinte, kamen je nach Situation alle möglichen Varianten außenpolitischen Handelns zum Zuge, oft genug als taktisch-temporäre Reflexe externer Klimaverschiebungen und infolgedessen kaum als Teilaspekte einer in sich konzisen Strategie.
Weshalb hatten sich die Vereinigten Staaten überhaupt so rigide das Ziel gesetzt, ein „entnuklearisiertes“ Nordkorea zu erreichen? Hiemann diskutiert die Motivlage entlang dreier Dimensionen. Zunächst jedoch: Angst vor einem Atomschlag hatten die Amerikaner nicht. Entscheidend war, erstens, die Besorgnis, dass Nordkorea das Potenzial weitergeben könnte, an andere Staaten, insbesondere aber auch an global agierende Terrorgruppen. Zweitens spielte die Befürchtung um die Stabilität in Nordostasien, die Sicherheit der Bündnispartner Japan und Südkorea, eine wesentliche Rolle. Und schließlich hatte man, drittens, bei nachsichtiger Behandlung von Nordkorea mit einer Vorbildwirkung auf andere Länder mit atomaren Ambitionen zu rechnen. Hierin waren sich alle Präsidenten der Vereinigten Staaten, die damit umzugehen hatten, einig. Im Grunde teilten sie auch das strategische Kernziel. Allein in den Instrumenten differierten sie, wobei keiner der hier behandelten amerikanischen Staatschefs auf die Offerte allein einer einzelnen außenpolitischen „Schule“ zurückgriff, sondern sich Handlungsempfehlungen aus den Munitionskammern von Beratern und Experten wahlweise und infolge gegebener Opportunitäten beschaffte (und nach einiger Zeit dorthin wieder zurückstellte).
Und dennoch waren die Differenzen in der operativen Außenpolitik zwischen etwa Clinton und George W. Bush beträchtlich. Die Gründe dafür – im Charakter, in der Biografie, in den Normenpräferenzen und dem Stil – destilliert der Verfasser kenntnisreich-analytisch und einleuchtend-anschaulich heraus.
Letztlich ist Hiemanns Botschaft, dass im oft schwer zu entwirrenden Geflecht außenpolitischer Entscheidungsprozesse die Führungsrolledes Präsidenten und sein Vermögen, die Beratungskapazitäten seiner engsten Mitarbeiter zu nutzen, konstitutiv sind.
Göttinger Junge Forschung
„Göttinger Junge Forschung“, unter diesem Titel firmiert eine Publikationsreihe desInstitutes für Demokratieforschung, das am 1. März 2010 an derGeorg-August-Universität Göttingengegründet worden ist. Göttinger Junge Forschung verfolgt drei Anliegen: Erstens ist sie ein Versuch, jungen Nachwuchswissenschaftlern ein Forum zu geben, auf dem diese sich meinungsfreudig und ausdrucksstark der wissenschaftlichen wie auch außeruniversitären Öffentlichkeit präsentieren können. Damit soll erreicht werden, dass sie sich in einem vergleichsweise frühen Stadium ihrer Laufbahn der Kritik der Forschungsgemeinde stellen und dabei im Mut zu pointierten Formulierungen und Thesen bestärkt werden.
Zweitens liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Sprache. Die Klagen über die mangelndeFähigkeitder Sozialwissenschaften, sich verständlich und originell auszudrücken, sind Legion. So sei der alleinige Fokus auf Forschungsstandards „problematisch“ im Hinblick auf eine „potentiell einhergehende Geringschätzung der Lehr- und der Öffentlichkeitsfunktion der Politikwissenschaft“, durch die „Forschungserkenntnisse der Politikwissenschaft zu einem Arkanwissen werden, das von den Experten in den Nachbarfächern und den Adressaten der Politikberatung, aber kaum mehr vom Publikum der Staatsbürgergesellschaft wahrgenommen wird, geschweige denn verstanden werden kann“.[1]Viel zu häufig schotte sich die Wissenschaft durch „die Kunst des unverständlichen Schreibens“[2]vom Laienpublikum ab.
Mitnichten soll an dieser Stelle behauptet werden, dass die Texte der Reihe den Anspruch auf verständliche und zugleich genussreiche Sprache mit Leichtigkeit erfüllen. Vielmehr soll es an dieser Stelle um das Bewusstsein für Sprache gehen, den Willen, die Forschungsergebnisse auch mit einer angemessenen literarischen Ausdrucksweise zu würdigen und ihre Reichweite – und damit Nützlichkeit – soweit zu erhöhen, wie dies ohne Abstriche für den wissenschaftlichen Gehalt möglich erscheint. Anstatt darunter zu leiden, kann sich die Erkenntniskraft sogar erhöhen, wenn sich die Autoren über die Niederschrift eingehende Gedanken machen, dabei womöglich den einen oder anderen Aspekt noch einmal gründlich reflektieren, die Argumentation glätten, auf abschreckende Wortungetüme, unnötig komplizierte Satzkonstruktionen und langweilige Passagen aufmerksam werden[3]– insgesamt auf einen Wissenschaftsjargon verzichten, wo dies zur Klarheit nicht erforderlich ist. Denn es besteht durchaus die Möglichkeit, einen wissenschaftlichen Text weder zu simplifizieren noch zu verkomplizieren, selbst unter der Berücksichtigung, dass die schwere Verständlichkeit von Wissenschaft aufgrund unvermeidlicher Fachbegriffe vermutlich unausbleiblich ist.[4]
Dies sollte jedoch nicht die Bereitschaft mindern, den Erkenntnistransfer via Sprache zumindest zu versuchen. In der allgemeinverständlichen Expertise sah der österreichische Universalgelehrte Otto Neurath sogar eine unentbehrliche Voraussetzung für die Demokratie, für die Kontrolle von Experten und Politik. Neurath nannte das die „Kooperation zwischen dem Mann von der Straße und dem wissenschaftlichen Experten“[5], aus der sich die Fähigkeit des demokratisch mündigen Bürgers ergebe, sich ein eigenes, wohlinformiertes Urteil über die Geschehnisse der Politik zu bilden. Dass in diesem Bereich ein Defizit der Politikwissenschaft besteht, lässt sich, wie gezeigt, immer häufiger und dringlicher vernehmen. Ein Konsens der Kritiker besteht in dem Plädoyer für eine verstärkte Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in eine interessierte Öffentlichkeit. Hierzu müsse man „Laien dafür interessieren und faszinieren können, was die Wissenschaftler umtreibt und welche Ergebnisse diese Umtriebigkeit hervorbringt“, weshalb „komplexe wissenschaftliche Verfahren und Sachverhalte für Fachfremde und Laien anschaulich und verständlich“ dargestellt werden sollten.[6]
Der Sprache einen ähnlichen Stellenwert für die Qualität einer Studie einzuräumen wie den Forschungsresultaten, mag sich auf den ersten Blick übertrieben anhören. Und wie die amerikanische Historikerin Barbara Tuchman zu berichten weiß, ist dies zumeist „mühselig, langsam, oft schmerzlich und manchmal eine Qual“, denn es „bedeutet ändern, überarbeiten, erweitern, kürzen, umschreiben“.[7]Doch eröffnet dieser Schritt die Chance, über die engen Grenzen des Campus hinaus Aufmerksamkeit für die Arbeit zu erregen und zudem auch die Qualität und Überzeugungskraft der Argumentation zu verbessern. Kurzum: Abwechslungsreiche und farbige Formulierungen, sorgsam gestreute Metaphern und Anekdoten oder raffiniert herbeigeführte Spannungsbögen müssen nicht gleich die Ernsthaftigkeit und den Erkenntniswert einer wissenschaftlichen Studie schmälern, sondern können sich für die Leserschaft wie auch für die Wissenschaft als Gewinn erweisen.
In den Bänden der Göttingen Jungen Forschung versuchen die Autoren deshalb sowohl nachzuweisen, dass sie die Standards und Techniken wissenschaftlichen Arbeitens beherrschen, als auch eine anregende Lektüre zu bieten. Wie gesagt, mag dies nicht auf Anhieb gelingen. Doch Schreiben, davon sind wir überzeugt, lernt man nur durch die Praxis des Schreibens, somit durch frühzeitiges Publizieren. Insofern strebt die Reihe keineswegs perfektionistisch, sondern perspektivisch die Förderung von Schreib- und Vermittlungstalenten noch während der wissenschaftlichen Ausbildungsphase an.
Freilich soll bei alldem keinesfalls der inhaltliche Gehalt der Studien vernachlässigt werden. Es soll hier nicht ausschließlich um die zuletzt von immer mehr Verlagen praktizierte Maxime gehen, demnach Examensarbeiten nahezu unterschiedslos zu schade sind, um in der sprichwörtlichen Schublade des Gutachters zu verstauben. Die Studien der Reihe sollen vielmehr, drittens, bislang unterbelichtete Themenaufgreifen oder bei hinlänglich bekannten Untersuchungsobjekten neue Akzente setzen, sodass sie nicht nur für die Publikationsliste des Autors, sondern auch für die Forschung eine Bereicherung darstellen. Das thematische Spektrum ist dabei weit gesteckt: von Verschiebungen in der Gesellschaftstektonik über Anatomien von Parteien oder Bewegungen bis hin zu politischen Biografien.
Eine Gemeinsamkeit findet sich dann allerdings doch: Die Studien sollen Momenten nachspüren, in denen politisches Führungsvermögen urplötzlich ungeahnte Gestaltungsmacht entfalten kann, in denen politische Akteure Gelegenheiten wittern, die sie vermittels Instinkt und Weitsicht, Chuzpe, Entschlusskraft und Verhandlungsgeschick zu nutzen verstehen, kurz: in denen der Machtwille und die politische Tatkraft einzelner Akteure den Geschichtsfluss umzuleiten und neue Realitäten zu schaffen vermögen. Anhand von Fallbeispielen sollen Möglichkeiten und Grenzen, biografische Hintergründe und Erfolgsindikatoren politischer Führung untersucht werden. Kulturelle Phänomene, wie bspw. die Formierung, Gestalt und Wirkung gesellschaftlicher Generationen, werden daher ebenso Thema sein, wie klassische Organisationsstudien aus dem Bereich der Parteien- und Verbändeforschung.
Was die Methodik anbelangt, so ist die Reihe offen für vielerlei Ansätze. Um das für komplexe Probleme charakteristische Zusammenspiel multipler Faktoren (Person, Institution und Umfeld) zu analysieren und die internen Prozesse eines Systems zu verstehen, darüber hinaus der Unberechenbarkeit menschlichen, zumal politischen Handelns und der Macht des Zufalls gerecht zu werden,[8]erlaubt sie ihren Autoren forschungspragmatische Offenheit. Jedenfalls: Am Ende soll die Göttinger Junge Forschung mit Gewinn und – im Idealfall – auch mit Freude gelesen werden.
1Einleitung
Wie so viele seinerRegierungskollegen konnteJohn Bolton Nordkorea nicht ausstehen.Schon gar nichtdie dortdespotisch herrschendenMachthaber. AusBoltonsSicht war das Land nicht weniger als ein „höllischer Albtraum“. Der Staatssekretär im Außenministerium war ein Hardliner,wie er im Buche steht, der unbequeme Wahrheiten gerade heraus aussprach; Wahrheiten, die viele konservative Republikaner in- und außerhalb der Regierung George W. Bushsteilten. Er „liebte zu raufen“undwar ein gänzlich undiplomatischer Diplomat. Denn Diplomatie mit einemundurchsichtigen und menschenverachtenden Gewaltregime, das die Welt seit Jahren und Jahrzehnten über seine nuklearen Waffen- und Raketenprogramme hinters Licht geführt hatte, war ihm ebenso zuwider wie jene „Beschwichtiger“ in seinem eigenen Ministerium, die in eben dieser Diplomatie die Option des kleinsten Übels sahen,die tatsächlich zu glauben schienen,dem Land seine nuklearen Gelüste abspenstig machenzu können. Bolton dagegen hatte andere Vorstellungen über den richtigen Umgang mit den zwielichtigen Despoten in Pjöngang.
Es war irgendwann im Jahr 2002.Bolton hatte einem Journalisten der New York Times ein Interview in seinem Büro im State Department gewährt. Ein Thema war die amerikanische Nordkoreapolitik. Der Reporter konfrontierte den schnauzbärtigen Außenpolitiker mit derDiskussion überdie widersprüchlichen Signale zwischen Verhandlungsbereitschaft, Druckausübung und Regimesturz, die seine Regierung seit Monaten gen Pjöngjang ausgesendethabe. Bolton sagte zunächst gar nichts, erhob sich dann von seinem Schreibtisch, schritt zu einem Bücherregal und zog ein Buch heraus, das er vor dem Korrespondenten lässig auf den Tisch knallte. Es war das Werk seines langjährigen Kollegen Nicholas Eberstadt vom American Enterprise Institute, einem konservativen Think Tank in Washington, D.C. Der Titel: „The End ofNorth Korea“. Bolton kommentierte nurtrocken: „Das ist unsere Politik!“[9]
Gute zehn Jahre später. Keineswegs ist Nordkorea vom Erdboden der koreanischen Halbinsel verschwunden, die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat sich am Leben gehalten, irgendwie. Oder doch nicht irgendwie? Denn sein Atomwaffenpotenzial vermochte es gerade während der letzten Dekade massiv auszubauen. 2013freute sich dieFührungsclique umKim Jong-un, der den Thron nach dem Tod seines Vaters Kim Jong-il bestiegen hatte,über dennächsten MeilensteinnordkoreanischerRüstungsmanie. Sicherheitsexperten und internationale Medien hatten schon wochenlang über den nächsten bevorstehenden Atomtest Nordkoreas spekuliert, Regierungschefs rund um die Weltwarntendie Führung in Pjöngjang mit scharfen Worten vor diesem Schritt. Doch dann, am 12. Februar, registrierten geologische Messstationen in Südkorea, Russland, sogar in Deutschland, eine Detonation im Nordosten der DVRK.[10]Auch durch dieIdentifizierungvon radioaktiven Gasen wurde sehr bald zur Gewissheit: Atomtechniker hatten auf dem Testgelände in Punggye-ri eine Atombombe der geschätzten Stärke vonvierbissechsKilotonnen TNT gezündet.Daswar die bislang dritte unterirdisch durchgeführte Kernexplosion. Über seine staatliche Propagandaagentur KCNA frohlockte das Regime einen Tag später mit bekannt deftigen Worten gegenüber der wieder einmal verblüfften Außenwelt: Der erfolgreiche Atomtest sei ein „strahlender Sieg“ des Landes auf seinem Weg, die vom Staatsgründer Kim Il-sung eingeleitete koreanische Revolution mit größter militärischer Entschlossenheit zu vollenden. Nun habe man endgültig seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, aus eigenen Kräften und gegen die permanente Malträtierung des „imperialistischen“, von den USA angeführten Auslandes Atomwaffen als ultimative Sicherheitsgarantie herzustellen. „Vergangen sind die niemals wiederkehrenden Tage, als die Feinde die Volksrepublik mit Atomwaffen bedrohten.“[11]
Bei allem propagandistischenGetöse und allernationalistischenÜberhöhung der eigenen Größe, bei aller Ungewissheit über den tatsächlichen technologischen Entwicklungsfortschritt der Raketen- und Kernwaffenprogramme des Landes: Nordkorea isteineAtommacht und wird als solche von der internationalen Expertengemeinschaft – nicht von Regierungen wohlgemerkt – schon längstals eine solche wahrgenommen. Verfügte die DVRK Mitte der 1980er Jahre, damals noch unter Führung des bis heutedortgottverehrten Kim Il-sung, lediglich über einen Forschungsreaktor, den man zwei Jahrzehnte zuvor von der Schutzmacht Sowjetunion erhalten hatte, war Pjöngjang nach Schätzungen der US-Geheimdienste Anfang der 1990er Jahre bereits im Besitz von Plutonium, das für die Herstellung von bis zu zwei Atombomben reichte. Weitere 15 Jahre später war das Arsenal auf geschätztedreiígbisvierzigKilogramm Plutonium angestiegen und das Regime KimJong-ils, der mittlerweile zum „lieben Führer” aufgestiegen war, ließ sich nicht nehmen, mit seinem ersten Atomtest 2006 der Weltöffentlichkeit seinen neuen atomaren Status mit reichlich Aplomb zu demonstrieren.Eine zweite Kernexplosion folgte 2009.
Immer mehr drohtenundas stets gefürchtete und von den meisten Experten für unwahrscheinlich gehaltene Szenario einer Militarisierung des Spaltmaterials, von außen betrachtet, zurbaldigenWirklichkeit zu werden.Herrschte unter politischen Entscheidungsträgern und ihren Sicherheitsberatern in Washington bis vor wenigen Jahren noch weitgehend Konsens darüber, dass die DVRK über keine direkten militärischen Bedrohungspotentiale für die USA und ihreigenesTerritorium verfügte, sorgte 2011 der damalige Verteidigungsminister Robert Gates mit seiner Bemerkung für Aufsehen, dass diese Generaleinschätzung vor dem Hintergrund der voranschreitenden Raketenrüstung schon in naher Zukunft keine Gültigkeit mehr beanspruchen könnte.[12]Die jüngsten nordkoreanischen „Eskalationen“ – wie es im Sprachgebrauch US-amerikanischer und internationaler Medien gerne heißt – im Dezember 2012 (Raketenstart) und Februar 2013 (dritter Atomtest) haben die Einschätzung vieler Beobachter und nuklearwissenschaftlicher Analysten, dass Nordkorea zwar noch längst nicht das technologische Ende seiner Nuklearwaffenentwicklung erreicht habe,[13]sich auf diesem Wege aber auch unter dem jungen Kim wohl kaum aufhalten lassenwerde, zusätzlich untermauert.
Aus Sicht der Vereinigten Staaten ist das Land nördlich des 38. Breitengrades ein zwar unergründliches und unberechenbares Relikt des Kalten Krieges, aufgrund seinernuklearen Evolutionaber umso mehr von größter sicherheitspolitischer Bedeutung. Wäre Nordkorea lediglich ein totalitär regierter Staat, dessen dynastische Führungsclique seine jahrzehntelang not- und hungerleidende Bevölkerung unterdrückt, ihr grundlegende humanitäreRechte undpolitische und wirtschaftliche Freiheiten vorenthält, und der seine unmittelbare Umwelt „lediglich“ mit konventionellen Streitkräften und Bio- und Chemiewaffenarsenalen in Atem hält, würde sich der Problemfall Nordkorea gänzlich anders darstellen. Dann wäre mehr als fraglich, ob die quasi-stalinistische Volksrepublik heutetatsächlichnoch am Leben wäre. In jedem Falle wäre sie wohl in den Augen US-amerikanischer Sicherheitsplaner keine sicherheitspolitische „Bedrohung“ ersten Ranges. Es ist gerade der Nexus von wirtschaftlicher und humanitärer Verarmung und politischer Instabilität einerseits –dieExistenz Nordkoreas als klassischer „failed state“[14]also –, von Atomwaffen in den Händen totalitärer Machthaber andererseits, der für die USA die eigentliche Bedrohungsnatur Nordkoreas kennzeichnet.[15]
Für die USA steht eine Menge auf dem Spiel. Das Ziel ist dabei seit dem Ende des Kalten Krieges stets gleich geblieben: Ein „nukleares Nordkorea“ zu verhindern, dies zählt bis heute zu einem unumstößlichen Imperativ auf der Agenda US-amerikanischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Niemals würde man Atomwaffen innordkoreanischenHänden tolerieren – das war seit jeherdasMantra, das gebetsmühlenartig deklamierte (Lippen-)Bekenntnis, das immer wieder ausgesprochene Verteidigungsgebot bislang jeder US-Regierung. George W. Bush brachte dieses Prinzip wohl mit der größten Direktheit zum Ausdruck:
„We will not tolerate nuclear weapons in North Korea. We will not give into blackmail. We will not settle for anything less than the complete, verifiable, and irreversible elimination of North Korea's nuclear weapons program.“[16]
Wobei: Abgesehen vom Ziel eines „entnuklearisierten“Nordkoreas war man sich in Washington nie einig und gewiss, wie man mit dieser Herausforderung umgehen sollte. Das Atomarsenal auf „präemptive“, also gewaltsame Art dem Erdboden gleichmachen? Den „lieben Führer“ samt seiner hochrangigen Potentaten – ganz nach dem Muster des Iraks 2003 –promptvom Thron stoßen? Das Regime mit Sanktionen, Restriktionen und Interdiktionen von Waffen- und Luxusgütern so weit in die Knie zwingen, bis es kollabiert, wodurch sich das „nukleare Problem“gelöst hätte, vorausgesetzt, esentstündekein politisches Vakuum, in dem ein weit fortgeschrittenes Atomwaffenarsenal in den falschen (oder gar keinen) Händen verheerende Auswirkungen haben würde? Durch Wirtschaftshilfen und diplomatische Anerkennung die Staatsführung – wie Ende 2003 mit Libyen geschehen – von den Vorzügen einer nuklearfreien Zukunft„positiv“überzeugen? Oder doch einfach abwarten, Nordkoreas atomaren Status stillschweigend anerkennen und auf bessere Zeiten und Lösungenhoffen, die da kommen mögen?
Rückblickend zeigen sich in den nunmehrfast dreiJahrzehnten US-amerikanischer Bemühungen um Nordkoreas Denuklearisierung sowohl Kontinuitäten als auch strategische Veränderungen und Umschwünge.Mittlerweileexistierteine ebenso kontinuitätsbehaftete wie wandlungsvolle und dilemmareiche Geschichte amerikanischer Nukleardiplomatie gegenüber einem scheinbar längst gescheiterten Staat, der ganz offenbar sein größtes Heil in der nuklearen Mobilmachung sieht.
In seinem 2012 erschienenen Buch „America and the Rogue States“ findet Thomas Henriksen dafür treffende Worte:
„Four American presidents have been compelled to take notice and to deal with the rust-bucket country that is the last Stalinist state on the planet. It seemed to play Russian roulette with a half-loaded revolver, which unnerved US policy makers. […] Waiting for its predicted political collapse has enabled Washington to make a string of concessions while sticking with a form of containment strategy to keep the peace on the peninsula.“[17]
Dieses Zitat leitet auf die zentrale Fragestellung dieser Arbeit hin: Mit welchen Mitteln und Strategien ist die globale Führungsmacht USA dem offenbar wahrgewordenen Szenario eines „nuklearen Nordkoreas” im Laufe des Atomkonflikts begegnet?
1.1Beobachtungen und Erkenntnisinteresse
Auf den ersten Blick fällt auf: Jede Regierung schien während ihrer Amtszeit zwischen diversen Ansätzen zu oszillieren. Man hat Verhandlungen geführt, bilateral und multilateral. Man ist sogar zu diplomatischen Vereinbarungen gelangt, an die sich beide Seiten – zeitweise jedenfalls – auchdurchausgehalten haben. Washington hat an allen Fronten versucht, den Druck auf das Regime zu erhöhen–diplomatisch, politisch, wirtschaftlich. Sogar einen militärischen Schlag gegen die Atomanlagen in Yongbyon wollte die Regierung Clinton im Frühjahr 1994, während der bislang schärfsten Krisensituation, nicht ausschließen. Immer mit ideologischen, moralischen und politischen Vorbehalten und Zwängen ausgestattet, als überlegene Supermacht miteinem solchen „Schurken“ eigentlich keine Kompromisse, keine Geschäfte eingehen zu dürfen, sah man sich zu verschiedenen Zeiten dann doch immer wieder zur Diplomatie gedrängt, gezwungen,verdammt.
Aber warum eigentlich? Warum hat bislang jeder US-Präsident im Laufe des Atomkonflikts – von George Bush Senior über William Clinton bis zu George W. Bush – zu bestimmten Zeiten offenbar die Notwendigkeit gesehen, mit einem durchweg renitenten und noch dazu totalitären Akteur ins Gespräch zu kommen, zu verhandeln, ihm gewichtige Anreize in Form von Energielieferungen anzubieten, ihm weitreichende politische Zugeständnisse zu machen, damit er seine ohnehin unerlaubten Nuklearaktivitäten einstellen möge?
So etwa Präsident Clinton: In der bis heute heißesten Phase des Atomstreits, im Frühjahr 1994, zog er militärische Maßnahmen in Erwägung (und ließ diese bereits einleiten!), nachdem Pjöngjang die „rote Linie“ überschritten und die Brennstäbe aus seinem Plutoniumreaktor in Yongbyon entladen hatte, um sie wiederaufzubereiten. Auch die internationale Staatengemeinschaft in Gestalt der zuständigen Gremien der Vereinten Nationen suchte das Weiße Haus hinter sich zu vereinen, um durch Sanktionen Druck auf Kim Il-sungs Führung auszuüben. Kein halbes Jahr später einigten sich Washingtons Diplomaten dann aber doch auf eine diplomatische Lösung. Das in den USA höchst umstrittene und stets brüchig erscheinende, mit Nordkorea im Oktober 1994 unterzeichnete Genfer Abkommen–quasi ein Tauschhandel (Einstellung aller Nuklearanlagen und langfristige Entnuklearisierung für (Kern-)Energiehilfen und politische Zugeständnisse) –hatte bis zum Ende der Präsidentschaft Clintons Bestand, faktisch noch zwei Jahre darüber hinaus. Es war damals die wichtigste Referenz, der Angelpunkt in den US-nordkoreanischen Beziehungen.
Während Clinton seinen Kurswechsel also relativ früh unternahm, ließ sich George W. Bush, der aus seiner Verachtung für Kim Jong-il und seinen Staat keinerlei Hehl machte, für eine diplomatische Einigungsechs JahreZeit. Bis dahin schien seine Politik–stark beeinflusst vom in der Nationalen Sicherheitsstrategie 2002 formulierten Anspruch, der Verbreitung von „Weapons of Mass Destruction“ (WMD) durch „rogue states“ mit neuen, präemptiven Mitteln den Kampf anzusagen[18]–vom Mantra der „Überzeugung durch Erzwingung“ (coercion)dominiert zu sein;wobei auch Bush seiner Abneigung gegenüber jeglicher Atomdiplomatie mit Nordkorea keineswegs freien Lauf lassen wollte oder konnte. Der Atomstreit mit Nordkorea war bereits in seine „zweite Krise“ geraten und hatte sich im Folgenden „multilateralisiert“, das heißt seit 2003 ist er nicht mehr nur zwischen den USA und der DVRK ausgetragen worden. Die so genannten „Six Party Talks“ – die Sechsparteiengespräche, an denen Nord- und Südkorea, die USA, Japan, China und Russland beteiligtwaren– vermochten jedoch keine nachhaltigen Erfolge in Gestalt konkreter ZugeständnisseallerSeiten zu verzeichnen.Letztlich entschloss sichGeorge W. Bush zur Jahreswende 2006/07 zu einer Kurskorrektur im Sinne der Aushandlung eines beidseitigen Atomdeals. Zuvor hatte Kim Jong-Il erstmals eine Atombombe testen lassen und damit die vorangeschrittene Nuklearwaffenentwicklung seines Landes demonstriert. Bushs Chefunterhändler Christopher Hill konnte mit den nordkoreanischen Diplomaten umKim Gye-gwanund den anderen Konfliktparteien im Februar 2007 schließlich einen Durchbruch erzielen, dessen gradueller, beidseitiger Tauschcharakter dem des Genfer Abkommens sehr ähnlich schien.[19]
Mit Blick auf die Ziel-Mittel-Kalküle im amerikanischen Sicherheitsdiskurs kommt man nicht umhin zu erkennen, dass die beiden US-Regierungen durch ihre strategischen Kehrtwendungen jeweils innerhalb kürzester Zeit unterschiedliche Philosophien und Lösungsansätze in ihrem Handeln vertraten. Der unter führender Beteiligung Washingtons vereinbarte „Aktionsplan zur Denuklearisierung Nordkoreas“ von 2007 etwa scheint ein fundamental gewandeltes Strategiedenken der Bush-Regierung über die Wege und Möglichkeiten einer nordkoreanischen Abrüstung widerzuspiegeln. Denn während der ersten sechs Jahre schien Bushs Nordkoreapolitik über weite Strecken doch eher dem LeitsatzdesVizepräsidenten Dick Cheney gefolgt zu sein: Man „verhandle nicht mit dem ‚Bösen‘, sondern besiege es“[20].
Die Frage nach Umbrücheninder amerikanischen Nordkoreapolitik hin zu Ansätzen des diplomatischen „Give-and-take“, mithin auch ihre strategischen Widersprüche, erscheint demnach so interessant wie erklärungsbedürftig. Zunächst einmal berührt diese Thematik die Fundamente der außenpolitischen Kultur der USA. Nicht nur unter erzkonservativen Hardlinern ist die Skepsis gegenüber Verhandlungen mit dem „Bösen“, mit „tyrannischen“ Despoten, die nach nicht-konventionellen Waffensystemen trachten, groß. Über Parteigrenzen hinweg ist der Glaube weit verbreitet, dass die Supermacht USA, gerade nach dem Umbruchereignis vom 11. September 2001, jedes Recht habe, zur Wahrung der internationalen Ordnung und Sicherheit autoritäre Staaten, die nicht zuletzt durch das Streben nach Massenvernichtungswaffen gegen die Werte und Normen dieser Ordnung verstoßen, zur Raison zu bringen – und dies mit allen Mitteln, die „auf dem Tisch liegen“ (wobei während der Präsidentschaft Barack Obamas insbesondere aufgrund der Erfahrungen des Irakkriegs die Bereitschaft zu militärischen Einsätzen massiv geschwunden ist). Aber: Mit solchen oft und gern als „Schurken“ markierten Ländern zu verhandeln, ist keineswegs so leicht mit dem moralischen Selbstverständnis, dem neokonservativen Anspruch nach „moralischer Klarheit“ allzumal, aber auch mit dem nationalen Stolz und dem globalen Führungsanspruch der USA inEinklangzubringen. Wohlweislichexistierenmarkante Unterschiede in den außenpolitischen Denktraditionen in den USA, die auch die Balance zwischen Pragmatismus und Idealismus im Umgang mit Schurkenstaaten betreffen. Dennoch: „Talking to villains“ ist für jeden US-Präsidenten ein politisch waghalsiger Akt, der angesichts des immer lauernden Vorwurfs, man betreibe Chamberlain’sche „Beschwichtigung“, eine gute Rechtfertigung braucht. Leslie Gelb freilich ist überzeugt, dass jeder US-Präsident–und setze er sich wie George W. Bush noch so sakrosankte Prinzipien, renitenten autoritären Despoten die ganze Härte einer entschlossenen Weltmacht spüren zu lassen–irgendwann zu der Erkenntnis gelange, dass eine diplomatische Auseinandersetzung mit „Straftätern“ der internationalen Ordnung zumindest vielversprechender sei als die (meist nur militärischen) Alternativen. Auf Cheneys Sentenz, das Böse besiegen zu wollen anstatt mit ihm zu verhandeln, reagierte Gelb deshalb nüchtern:
„Contrary to Cheney’s dictum, chest-thumping congressional resolutions and op-ed pieces, the United States almost always deals with devils at some point or another. There is no alternative if a president wants to test nonmilitary solutions to the nastiest of problems. Forget the inevitable posturing. The real issue is not whether to talk to the bad guys but how –under which conditions, with which mix of pressure and conciliation, and with what degree of expectationthat the bad guys will keep their word. When figuring out how to go about negotiating with devils, the questions get very basic.“[Hervorheb. d. Verf.][21]
Mit Blick auf den Fall Nordkorea liegt insofern nahe zu hinterfragen, warum jede US-Regierung, seitdem der Atomstreit schwelt und auf der sicherheitspolitischen Agenda der USA einen der vorderen Plätze einnimmt, von „Standard“-Strategien[22]der Eindämmung und Abschreckung irgendwann doch abwich und versuchte, über den Weg der Kooperation mit einem doch so unkooperativen Regime zu einer tragfähigen diplomatischen Lösung zu gelangen. Bei der Betrachtung des strategischen Verhaltens der USA im Atomstreit soll daher ein Hauptaugenmerk auf den Einsatz diplomatischer Verhandlungen und „positiver Anreize“ als Instrumente gelegt werden, um Nordkorea von derEinstellung und Aufgabe seiner nuklearen Abschreckung zu überzeugen.
Noch eine weitere, etwas generellere Beobachtung lässt sich hinzufügen, nämlich die nach den Zielen, Motiven und Instrumenten der amerikanischen Nordkoreastrategien. Von der Oberfläche aus betrachtet haben sich diese Strategien stets zwischen zwei Begriffsachsen bewegt: zwischen Eindämmung und Einbindung. In der amerikanischen Debatte ist von „Containment“ und „Engagement“ die Rede, um die Politik der USA gegenüber Nordkorea und anderen„Schurkenstaaten“zu beschreiben. Diese Dichotomie erscheint zwar hilfreich, um etwa grundsätzliche Meinungsdifferenzen und handlungsbezogene Gegenpositionen – etwa zwischen „Falken“ und „Tauben“ – zu verdeutlichen, mithin zu pointieren. Für politische Entscheidungsträger wie Sicherheitsexperten dient das Begriffspaar oft als komplexitätsreduzierende, „standardisierte Referenzenzpunkte“, „almost as shorthand to indicate their positive or negative attitude toward a particular state“[23].Aber häufigwirdEindämmung synonym mit Sanktionen und Einbindung mit Diplomatie vereinfacht verwendet, ohne dabei der Komplexität einer Strategie, ihren zugrundeliegenden Überzeugungen, akteursspezifischen Einschätzungen und Ziel-Mittel-Kalkulationen gerecht zu werden.[24]Wie Alexander George festgestellt hat, können die beiden Begriffe aus analytischer Perspektive daher lediglich als „übergeordnete Strategiekonzepte“ verstanden werden, da sie selbst spezifische Strategien umfassen und verschiedene Instrumente (etwa Sanktionen und diplomatische Verhandlungen) beinhalten können.[25]
Daherstellt sichauch für dieseStudiedie grundsätzliche Frage, welchespezifischenStrategien im Spannungsfeld zwischen Eindämmung und Einbindung im Laufe des Atomkonflikts mit Nordkorea zur Anwendung gekommen sind. Genauer ist zu hinterfragen: Welches Ziel-Mittel-Kalkül lag der Formulierung von Nichtverbreitungsstrategien in ihren jeweiligen zeitlichen Kontexten zugrunde, gerade in Bezug auf den Zusammenhang zwischen dem Ziel der Entnuklearisierung auf der einen und dem sich stets dahinter verbergenden Motiv der Regimetransformation auf der anderen Seite? Denn, wie uns Robert Litwak verständlich gemacht hat, Strategien, die auf das gleiche Ziel (goal) ausgerichtet sind (bspw. die vollständige Entnuklearisierung Nordkoreas),könnenunterschiedlichen handlungsstrategischen Zielvorgaben (objective) zugrunde liegen: Ist das strategische Ziel der amerikanischen Nichtverbreitungspolitik, den politischen und/oder militärischen Statusquo des Gegners zu verändern, das heißt dessen Regime in seiner politischen Stabilität und Handlungsfähigkeit existentiell einzuschränken und zu unterminieren?[26]Oder aber besteht die Ratio der USA darin, lediglich das Verhalten des Gegners zu verändern und zu „mäßigen“, wobei Destabilisierung und Erschütterung der politischen Existenz des Regimes kein unmittelbares Ziel der Nichtverbreitungsstrategie darstellen?[27]
Kaumzuerstaunenvermag, dass angesichts der Isoliertheit und Intransparenz des nordkoreanischen Staates höchst unterschiedliche Antworten in diesem Rätselraten angeboten worden sind, selbst von jahrzehntelangen Nordkoreabeobachtern, Wissenschaftlern und Regionalexperten, ohnehin von Kongressabgeordneten wie von Regierungsvertretern verschiedener parteipolitischer Couleur. Dabei darf man durchaus von unterschiedlichen Denkschulen (siehe Kap.3) sprechen, die jeweils spezifische Nordkoreabilder repräsentieren unddiesemit handlungskonkreten Strategieempfehlungen verknüpfen. Für die Formulierung von Nichtverbreitungsstrategien undderenInstrumenten erscheint maßgebend, in welcher Reichweite das Ziel der Nichtverbreitung und unmittelbaren Bedrohungseingrenzung (Einstellung und Aufgabe der Nuklearrüstung, Unterlassung einer kriegerischen Handlung, Nichtweiterverbreitung etc.) vom Motiv der politischen oder gesellschaftlichen Transformation und „Resozialisierung“ definiert wird, „ranging from the narrow (behavior change) to the expansive (regime change)“[28].Genau hierinbesteht wohl ein elementares Dilemma der US-Politik gegenüber solchen Staaten, diesich den Normen und Regeln der internationalen Gemeinschaft widersetzen und aufgrund dessen alsroguesoderoutlawsbezeichnet worden sind. Wobei offenbar jeder unmittelbare Versuch der USA, diesen Akteuren ihre Massenvernichtungswaffen zu entziehen, zu einem gewissen Grad vom langfristigen Anliegen begleitetworden ist,in den jeweiligen Länderneinen politisch-sozialen Wandel herbeizuführen:
„The dilemma for US policymakers is that the nuclear issues of immediate urgency are embedded in the broader question of long-term societal change in these countries. The imperative of addressing the proliferation threats posed by Iran and North Korea and the long-term American interest in the transformation of their regimes create a policy tension between objectives on different timelines.“[29]
Die Herausforderung bestehealso darin,so Litwak weiter,auf Grundlage der Einschätzung der Proliferationsmotive des Gegners akteursspezifische, „maßgeschneiderte“ Strategien zu entwickeln. Aber was waren diese wesenseigenen Strategien in der Nordkoreapolitik?Für die Suche nach dem spezifischen Gleichgewicht zwischen Eindämmung und Einbindung, zwischen negativer Druckausübung und positiver„Überzeugung“durch Anreize, wie sie die USA im Laufe desAtomkonfliktsgefunden haben, kann sich der oben beschriebene Motivzusammenhang vermutlich als analytisch hilfreich erweisen.
Noch ein weiteres Phänomen derUS-Nordkoreapolitik, insbesondere der von George W. Bush, wirft Fragen auf, die mit den einleitenden Zeilen dieser Arbeit bereits zum Vorschein kommen und die diese Arbeit zu beantworten sucht:DieFragenach den Widersprüchen und konfligierenden Signalen der Bush-Politik, nach der offenbarinnerenUnsicherheit, ob und wie mit Nordkorea eine friedliche Übereinkunft über den Abbau seiner Atomanlagen erzielt werdenkönnte. Mit anderen Worten:mit welcher Strategie man ein entnuklearisiertes Nordkorea erreichen könnte. Darin meinte nicht umsonst manch ein Beobachter eine paralysierte und ineffektive Regierungspolitik zu erkennen.[30]Anscheinend ist mitnichten so, dass Regierungen immer eine in sich kohärente Strategie mit klarem Kosten-Nutzen-Kalkül verfolgen, nach klaren strategischen und taktischen Vorgaben und Prinzipien handeln, mit genauen Forderungen und Erwartungen an sich und andere Akteure. Wasaberwar dafür verantwortlich? War es das Dilemma zwischen der eigenen Präferenz, Kim Jong-il die Daumenschrauben stärker als bisher anzuziehen, einerseits,und dem merklichen Verlangen anderer Staaten in der Region, vor allem Südkoreas und Chinas, andererseits, deren Primat die regionale Stabilität, die politische Annäherung an das isolierte Regime, also: die Einbindung war? Oder schlugen bei derscheinbarenstrategischen Desorientierung doch eher – oder zugleich – jene inneradministrativen Interessendivergenzen zu Buche, die früh ein offenes Geheimnis der Außenpolitik der ersten Bush-Administration waren?Zutage traten diese Konflikte vor allem im Vorfeld des Einmarschs in den Irak, auch in der Afghanistan- und Anti-Terror-Politik, offenbar aber auch in der Nordkoreapolitik:
„Mr. Bush’s administration has been paralyzed by an ideological war, between those who wanted to bring down North Korea and those who thought it was worth one more try to lure the country out of isolation.“[31]
Wenn hier ein Zusammenhang besteht, also zwischen der offiziell ausgegebenen strategischen Ausrichtung und dem regierungsinternen Machtgleichgewicht, so kann der Blick ins Innere der Administrationnicht ausbleiben, ebenso wenig wie die grundsätzlichere Frage nach dem Einfluss individueller Akteure auf die Nordkoreapolitik. Wann, inwiefern und weshalb spiegelte sich der innere Kampf zwischen Boltons Anhängern und seinen diplomatieaffineren Gegnern in der Nordkoreapolitik wider? Letztlich: Was bedingtsolcheKonflikte überhaupt – und welche Rolle spielt dabei der Präsident? Besitzt dieser doch eigentlich nicht nur die richtungsweisende Entscheidungskompetenz in der US-Außenpolitik(chief decision maker), sondern auch die des Verwaltungschefs(chief administrator), der das interne „Spielfeld“,auf dem diese bürokratischen Grabenkämpfe ausgetragen werden,nach seiner Façon bestellt.[32]
1.2Fragestellungen
Zusammengetragen lassen sich folgende fünf aufeinanderaufbauendeFragekomplexe formulieren, die dieseStudiezu beantworten sucht:
a.Welche Interessen verfolgen die USA in Verbindung mit dem Ziel einer vollständigen Entnuklearisierung Nordkoreas? Warum erschien jedem Präsident unumgänglich, ein „nukleares Nordkorea“ niemals zu akzeptieren?
b.Welche Strategien im Spannungsfeld zwischen diplomatischer Einbindung, wirtschaftlicher und militärischer Eindämmung und Regimewechsel haben die USA im Atomkonflikt mit Nordkorea eingesetzt, um die Gefahren durch die nuklear- und raketentechnologische Entwicklung des Landes aufzuhalten bzw. im Sinne des ZielseinerEntnuklearisierung zu beenden?
c.Welche maßgeblichen Motive und Ideen prägten das strategische Handeln in diesem Spannungsfeld zwischen Diplomatie und einer Politik des Zwangs – insbesondere mit Blick auf die äußere Beeinflussung des Regimeverhaltens einerseits und auf den Regimekollaps andererseits?
d.Warum und unter welchen Bedingungen haben sich die USA gelegentlich auf diplomatische Lösungsansätze der Atomkrise eingelassen?
e.Wie verlief der Entscheidungsprozess in der Nordkoreapolitik? Welchen Einfluss nahmen dabei einzelne, mitunter konkurrierende Fraktionen mit unterschiedlichen Präferenzen? Und welche Rolle spielte dabei der Präsident in seiner außenpolitischen Führungsposition?
Die Arbeitversuchtmithineinen Beitrag zu leisten, Einblicke in die normativen Fundamente und Widersprüche des außenpolitischen Handelns während der vergangenen drei Jahrzehnte zu gewinnen. Diese Einblicke sind forschungsrelevant, weil die zu behandelnde Episode bislang eine im Verhältnis zu anderen sicherheitspolitischen Herausforderungen (Irak, Afghanistan etc.), gerade in der deutschsprachigen Politikwissenschaft, geringe Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Monographische Untersuchungen zur Nordkoreapolitik liegen in sehr überschaubarem Ausmaß vor.[33]Die einschlägige Literatur umfasst zum großen Teil Aufsätze in Fachzeitschriften und Sammelbänden mit Berücksichtigung spezifischer Aspekte der Politik. Die überwältigende Mehrzahl dieser Studien muss indes als Strategieanalysen kategorisiert werden, die in normativer oder präskriptiver Weise die (fehlgeleitete) Politik der Bush-Regierung bewerten und mitunter evaluieren.[34]Zu erwähnen sind außerdem eine Reihe von Sammelbänden und Monographien, die sich zwar nicht explizit, aber im weiteren Sinne mit der Bush-Politik beschäftigen; entweder im Kontext des Atomkonflikts und seiner regionalen Perspektiven und Dimensionen, der Bedrohung durch „Weapons of Mass Destruction“ und „Rogue States“[35]oder der Geschichte der US-koreanischen Beziehungen.[36]Die amerikanischeNordkoreapolitik als solchehingegenistbisherselten Gegenstand von (deutschsprachigen) Außenpolitikanalysen im klassischen Sinne geworden.[37]
1.3Theoretische Vorüberlegungen
Die Leitfrage dieser Arbeit nach Zeit und Kontextspezifik der US-Strategien im Atomkonflikt mit Nordkorea führt auf einer Makroebene zu einer weiteren: Was konditioniert überhaupt das Verhalten von Staaten in der internationalen Politik bzw. in einem bestimmten Problemfall der Außen- und Sicherheitspolitik? Vorweg sollte dabei klargestellt werden: Diese Arbeit ist – in ihrem erkenntnisgeleiteten Kern – nicht von dem Anspruch geleitet, dieBeziehungenundInteraktionsstrukturenzwischen den USA und Nordkorea, so sehr sie vermutlich eine herausragende Rolle bei der Betrachtung einnehmen werden, zu analysieren, auch nicht die Bedeutung des vielseitig-komplexen Macht- und Interessengefüges in Nordostasien, inwelchemdie USA als globale und regionale Führungsmacht agiert und eingebunden ist. Das Hauptaugenmerk sollvielmehraufdieBetrachtung des außenpolitischen Handelns der US-Regierunggerichtet werden,mit dem SchwerpunktderdiplomatischenAuseinandersetzung mit der DVRK. Daherwill sich die Arbeitgrundsätzlich auch nicht in die Disziplin der Internationalen Beziehungen (IB) einordnen, sondern als Außenpolitikanalyse verstanden wissen. Denn IB-Theorien erweisen sich tatsächlich als wenig fruchtbar bei der Suche nach Antworten auf diehieraufgeworfenen Leitfragen.
1.3.1Theoriezugänge der Internationalen Beziehungen
Mehr als abwegigwäre wohl, IB-Theorien a priori allesamt Erklärungskraft für die Untersuchung von Außenpolitik eines Staates, deramerikanischen Nordkoreapolitik allzumal, abzusprechen. Im Gegenteil:Es darf davon ausgegangen werden, dass das außenpolitische Verhalten eines jeden Staates in bestimmtem und gewiss unterschiedlichem Maße von externen Ereignissen und Impulsen, Entwicklungen oder Macht- und Kooperationsstrukturen geprägt, beeinflusst oder gar bestimmt wird. Das gilt nicht zuletzt auch für den Wandel von Außenpolitik, ist dieser doch in den meisten Fällen mit Umbrüchen in der internationalen Arena verbunden, mit ausbrechenden Krisen, „Schock“-Ereignissen oder dem Verhaltenswandel eines oder mehrerer Staaten.[38]Auf dieser systemischen Ebene deuten etwa rationalistische Theorieansätze (ob neorealistischer[39]oder neoinstitutionalistischer[40]Tradition)auf die absolute bzw. relative Machtverteilung im von Anarchie geprägten internationalen System hin,diedas nutzenmaximierende Handeln von staatlichen Akteuren determiniere.Die maßgeblichen Variablen der amerikanischen Nichtverbreitungs- und Abschreckungsstrategie seien demnach die vom Machtgleichgewicht vorgegebenen Handlungsspielräume und–zwänge;das heißt nicht nur die eigenen definierten Sicherheitsinteressen und Nordkoreas bereits vorhandenes Atompotenzial, sondern auch die machtpolitischen Interessen anderer Staaten, insbesondere der amerikanischen Bündnispartner in der Region.
„The United States has been constrained in pursuing its objectives by its reliance upon others, particularly China and South Korea, whose interests diverge in significant ways from its own. With its resources tied down on other fronts in the war on terror, and with only limited economic leverageover North Korea, the United States required the cooperation of the North’s neighbors and economic partners.“[41]
Aus einer anderen, neoinstitutionalistischen Sichtweise ist die regionale Ordnung in Ostasien durch die Interdependenzen und Kooperationsbeziehungen zwischen den am Atomstreit beteiligten Akteuren geprägt. Amerikas Asien- und Nordkoreapolitik ist nicht erst seit Beginn des Sechsparteienprozesses im August 2003 in ein komplexes Korsett aus regionalen Interessenstrukturen eingebunden, das für die Hegemonialmacht mit Kooperationsspielräumen ebenso einhergeht wie mit unübersehbaren Beschränkungen eigener Handlungsmöglichkeiten.[42]Trotz unterschiedlicher Erkenntnisinteressen (Bündnispolitik, Abschreckungsdoktrin, multilaterale Kooperation etc.) teilen systemisch-strukturelle Analysen allgemein das Verständnis von den USA als einheitlicher, rational und strategisch handelnder Akteur.
Dass die US-Nordkoreapolitik durch die internationale Macht- und Einflussverteilung (zwischen den USA und anderen am Atomkonflikt beteiligten Staaten) oder durch den Insitutionalisierungs- und Kooperationsgrad globaler oder regionaler Sicherheitsbeziehungen (hier etwa in Gestalt der 2003 aufgenommenen Sechsparteiengespräche) zuweilen maßgeblich beeinflusst worden ist, erscheint plausibel. Zum Beispiel würde ein liberal-institutionalistischer Ansatz auf die Frage, warum sich die USA zur Diplomatie mit Nordkorea gedrängt sahen, auf das interdependente Handlungsspielfeld hinweisen, auf dem Akteure wie China und Südkorea ein fundamentales Interesse an der diplomatischen Aushandlung des Atomkonflikts hatten, dem die US-Regierung Rechnung zu tragen hatte. Vermutlich war das in erheblichem Maße der Fall. Aber wie ist dann z.B. der oben angesprochene strategische Widerspruch in der Nordkoreapolitik George W. Bushs zu erklären, wenn seinem außenpolitischen Handeln doch rein rationale Machtinteressen zugrundegelegen hätten? Überhaupt stellt sich die Frage, ob mit exogenen Einflussfaktoren generell das Handeln der USA im Nordkoreakonflikt analysiert werden sollte oder ob nicht auch nochandere Variablenexistieren, auf die man den Blick nicht von vornherein verschließen sollte.
So etwa die nationale, gesellschaftliche und innenpolitische Ebene, auf die vor allem das Theoriegebäude des Neuen Liberalismus seinHauptaugenmerklegt.[43]Nach einem liberalen Verständnis ist staatliche Außenpolitik nicht nur von internationalen Bedingungsfaktoren abhängig, sondern stets auch und in erster Linie innengeleitet;das heißt die institutionellen Strukturen und Prozesse des politischen Systems und die in ihm artikulierten gesellschaftlichen Präferenzen prägen die außenpolitischen Handlungen von Regierungen – in unterschiedlichem Maße – mit.[44]
Auch hier werden Bezüge von „Domestic politics“ zur Nordkoreapolitik der USA augenscheinlich–ganz besonders die Rolle des Kongresses, dessen Abgeordnete und Senatoren sozusagen dasSprachrohr innerstaatlicher und gesellschaftlicher Interessen in den USA darstellen.Das Ende des Kalten Krieges hat nicht nur die Struktur der vormalsbipolaren internationalen Ordnung paradigmatisch verändert, sondern auch das Verhältnis und die Aushandlung außenpolitischer Interessen zwischen Exekutive und Legislative nachhaltig zerrüttet.[45]„The cold war’s end brought another escalation in the level of congressional assertiveness in foreign policy making.“[46]Das machte sich deutlich während derPräsidentschaft Bill Clintons bemerkbar, besonders ab 1994, als der nun republikanisch dominierte Kongress zu einem Akteur in der Nordkoreapolitik wurde, da er die Umsetzung des Genfer Abkommens durch die Administration kontrollieren konnte. Auch unter der Präsidentschaft George W. Bushs scheint der Kongress zumindest ein zu berücksichtigenderAkteur„an der Seitenlinie“der Regierungspolitik gewesen zu sein.[47]Zu berücksichtigen ist das Verhältnis zwischen derExekutiveund der Legislative daher allemal, denn es könnte ja sein, dass US-Präsidenten bei der Formulierung ihrer Nordkoreastrategien auch auf dieses politische Umfeld Rücksicht genommen haben, sich gar von ihm haben beeinflussen oder leiten lassen.
Dennoch scheint fragwürdig, ob der alleinige Blick auf den Kongress tatsächlich die Ausrichtung, die Umbrüche und Widersprüche der Nordkoreapolitik ausreichend zu erklären vermag. Angesichts seiner verfassungsgegebenen Kompetenzen kann er zwarbeantragte Gelder für Nichtverbreitungsprojekte oder wirtschaftliche Hilfen bewilligen (oder ablehnen);er kann Gesetzesentwürfe einbringen, Resolutionen verabschieden, der Erhebung und Aufhebung von Sanktionen zustimmen oder–etwa durch Anhörungen ihrer Vertreter–Kritik an der Administrationüben und so seine verfassungsgegebene Korrektivfunktion wahrnehmen. Ob er aber in die inhaltliche Strategieformulierung eingreifen kann, lässt sich jedenfalls einer groben Sichtung des Untersuchungsgegenstandes noch nicht entnehmen.[48]Dies gilt imÜbrigen ebenso für andere„politically relevant segments of society“[49], politische oder wissenschaftliche Interessengruppen wie Think Tanks vor allem;auch wenn deren Berücksichtigung gewiss Einblicke in das gesellschaftliche Meinungsbild, gerade das von Experten, zulässt. Und so bleibt auch eine rein liberale Analyseperspektive auf die Nordkoreapolitik mit Zweifeln an ausreichender Deutungskraft behaftet.
Der Gang durch theoretische Ansätze der Internationalen Beziehungen, die interessante Einblicke in Einzelaspekte der Nordkoreapolitik versprechen, könnte gewiss noch viel weiterreichenund auch sozialkonstruktivistische Ansätze in den Blick nehmen. Rollentheoretische Zugänge etwa beleuchten kollektiv normierte Einstellungs- und Verhaltensmuster von Staaten in internationalen Systemen;[50]sie weisen damit auf das Rollenverständnis der USA als Supermacht hin–auf Werte, Normen und die Erwartungen, die sie selbst als globale Führungsnation beansprucht und die auch von der Außenwelt an sie herangetragen werden. Gleiches gilt für solche Ansätze, die sich mit der Herausbildung der Wirkmächtigkeit von nationalen Identitäten, kollektiv geteilten Welt- und Feindbildern in der Außenpolitik beschäftigen. Deren Bedeutung scheint für die Betrachtung des amerikanischen Umgangs mit„Schurkenstaaten“ geradezu evident. Das „bad faith“-Image[51], wie es Ole Holsti in der US-Politik gegenüber der Sowjetunion während des Kalten Krieges erkannt hat, prägt in der Nordkoreafrage offenkundig nicht nur die amerikanische Sicherheitsdebatte, sondern spielt auch in den Denk- und Weltbildern von Entscheidungsträgern eine Rolle, wie Katja Leikert jüngst am Beispiel der Iran- und Nordkoreapolitik gezeigt hat.[52]Zahlreiche Kongress- und Regierungsakteure–darunter Präsident Bush Junior selbst–machten ausihrer „Verachtung“ gegenüber dem „tyrannischen“ und menschenverachtenden Regime Kim Jong-ils, das sich jedwedenuniversellen Werten wie Freiheit und Demokratie widersetzt, keinen Hehl. Denkbilder und normative Ordnungsvorstellungen, gerade die von Entscheidungsträgern, sollten daher tatsächlich nicht außerhalb des hier eingenommenen Blickwinkels bleiben. Doch auch diesbezüglich stellen sich Zweifel ein, ob kollektiv geteilte Identitäten, Normen und Denkbilder alsalleinigeErklärungsvariable herangezogen werden sollten–verändern sich diese doch allgemein nurüber längere Zeiträume. Wieabersind dann einzelne Entscheidungen zugunsten der einen oder anderen Strategie, kleinere taktische Umbrüche, auch Widersprüche im Verhalten der US-Regierung zu erklären? Und warum kam es dannüberhaupt zur Diplomatiegegenübereinem Akteur, dessen Systemcharakter dem Selbstverständnis der USA doch diametral entgegensteht?
1.3.2Foreign Policy Analysis
Diese politikwissenschaftliche Studiestellt sich – ganz in der pragmatischen Tradition der oben beschriebenen Foreign Policy Analysis – dem Anspruch, eine plausible undmöglichst„realitätsnahe“ Deutung der amerikanischen Nordkoreapolitik zu leisten.[53]Sie versucht dies, indem sie ihre analytische Linse nicht a priori auf einzelne Faktoren- und Kontextebenen einstellt, die als potenzielle Determinanten von Außenpolitik infrage kommen. Vielmehr wird ein flexibler, faktorensensibler und daher integrativer Ansatz verfolgt. Dadurch soll die Herausbildung strategischer Entscheidungen und Richtungswechsel in einer chronologischen Weise und mit offenen Augen für alle möglichen politischen Einflüsse auf das außenpolitische Handeln identifiziert werden, um dann zu einer eigenständigen Interpretation zu gelangen – dies gewiss ohne dabei den Anspruch einer unumstößlichen objektiven Deutung des Untersuchungsgegenstandes zu erheben.
Diese Arbeit wird sich auf keine der einzelnen IB-Theorien, so sehr sie auch potenziell wichtige Aspekte der Nordkoreapolitik beleuchten, stützen können. Weder rationalistischeundliberale Theorien der Internationalen Beziehungen noch isolierte Analysen kognitiver Welt- undFremdbilder allein erscheinen als hilfreiche Wegweiser zur Beantwortung der Leitfragen. Die Suche nach einer Großtheorie von Außenpolitik, die alle möglichen Einflussfaktoren und Wirkungszusammhänge einschließt, ist allerdings, das ist früh zu erkennen, zum Scheitern verurteilt.Schon 1957 schrieb Bernard Cohen: „[W]hile there may be widespread recognition of the desirability of knowing more about how foreign policy is made, it is a far from simple task actually to build up a useful body of relevant knowledge.“[54]Erfüllt hat sich dieser Wunsch nicht.Christopher Hill äußerte noch im Jahr 2003 die Skepsis, „that an overaching single theory of foreign policy can ever be achieved without being bland or tautological“[55].Selbst Außenpolitik[56]in ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit zu definieren, erweist sich als keineswegs so einfach, wiedasklingen mag. So gilt erst recht das Vorhaben, zu einer umfassenden und integrativen Außenpolitiktheorie zu gelangen, nach wie vor als „frustrierendes“ Unterfangen;[57]wenn auch das Bemühen, mehrere Wirkebenen von Außenpolitik in ihren wechselseitigen Beziehungen zu erfassen, durchaus Wirkung gezeigt hat.[58]So sollte aus derSicht von Dirk Peters die Außenpolitikanalyse doch eher als eine pragmatische „Tugend denn als Manko“ verstanden werden, weil sie dem Anspruch auf eine plausible und „realitätsnahe“ Erklärung von staatlicher Außenpolitik am nächstenkomme.[59]Und Stephen Yetiv meint, dass „integrative Ansätze“ notwendig seien, um außenpolitische Entscheidungen nachvollziehen zu können: „[W]e need to run reality through multiple perspectives.“[60]
Hieran möchte diese Arbeit anknüpfen, mit einem Analyseansatz nämlich, der sich auf keiner der oben beschriebenen Ebenen ausschließlich verorten lässt, sich von vornherein auch keiner „Theorie“ verschreibt. Vielmehr geht es ja darum, die Geschichte der amerikanischen Nordkoreapolitik in ihren kontextspezifischen Phasen auf mittlerer Reichweite zu beleuchten, dabei stets Ausschau zu halten nach potenziell erklärungsfähigen Faktoren und inneren wie äußeren Handlungseinflüssen, kleinere und größere Umbrüche aufzuspüren und ihren Ursachen auf den Grund zu gehen.Vorliegende Arbeitwillmit Blick auf die Leitfrage auch die individuellen Akteure und deren Entscheidungen, Konflikte und Einflüsse – soweit dies möglich ist – ausfindig machen und einem genaueren analytischen Blickunterziehen. Ein Analyserahmen mit einem strengen theoretischen Korsett und einerallzu stark fokussierten „Linse“ auf einzelne Aspekte der Politik stünde diesem Vorhaben entgegen.
Gleichwohl sollte hier Rechenschaft abgelegt werden über das analytische Verständnis von staatlicher Außenpolitik, dem diese Arbeit anhängt. Zunächst wird von der recht simpel erscheinenden Grundannahme ausgegangen, dass Außenpolitik stets von einer Vielzahl von Variablen auf unterschiedlichen Wirkungsebenen beeinflusst wird, deren tatsächliche Bedeutung erst im Laufe der Analyse qualitativ bewertet werden kann. An einer pragmatischen Herangehensweise, wie sie Peters befürwortet, scheint daher kein Weg vorbeizugehen. Zum anderen, und damit eng verbunden, erscheint wenig zielführend, den außenpolitisch handelnden Staat als unitären Akteur, als monolithischeEinheit zu betrachten. Damit soll auch hier nicht von vorneherein dem Staat die Fähigkeit zum rationalen Handeln abgesprochen werden.Gar nicht bestritten werdensoll, dass von Regierungen vertretene Staaten mehr oder weniger klar formulierte Ziele verfolgen, die im jeweiligen „nationalen Interesse“ stehen.[61]Und natürlich entwickeln sie im Angesicht eines konkreten Problems oder einer Bedrohung ihrer Sicherheit verschiedene Handlungsoptionen, aus denen sie – mithilfe eines gewissen Kosten-Nutzen-Kalküls – auswählen, um ihr definiertes Sicherheitsinteressemithilfe der einen oder anderen Strategienutzenmaximierend zu erreichen. Doch auch die „strategischen Interaktionen“ zwischen den Akteuren (ob Gegner oder Partner) spielen stets eine Rolle bei deren jeweiliger außenpolitischenEntscheidungsfindung.[62]Und dass Außenpolitik von innenpolitischen Kontexten geprägt ist,[63]die von Entscheidungsträgern berücksichtigt werden, ist mittlerweile auch von Vertretern des strukturellen Realismus zur Kenntnis genommen worden.[64]
Jedenfalls generell von einem Modell des „rationalen“ Staates auszugehen, hat eben auch seine analytischen Tücken;denn es ist ein „faceless model, one that black boxes what occurs inside states, and treats states as unitary actors that make decisions in terms of rational choice“[65].Es gibt gewissermaßen auch keine „falschen Entscheidungen“. Dabei ist doch der Einfluss von kognitiven Faktoren[66], wie sieHerbert Simon mit dem Begriff der „bounded rationality“ prägend untersuchte, in der Außenpolitikforschung ebenso angekommen wie Graham Allisons Hinweis,demnachaußenpolitische Entscheidungen auch das Resultat von internen Machtkämpfen zwischen Individuen mit organisationellen und bürokratischen Interessen sein können.[67]Und schließlich sind Zweifel angebracht, ob Staaten in der Analyse als reine Nutzenmaximierer zu betrachten sind, die eine zweckrationale Handlungsoption wählen; obalsoder außenpolitische Entscheidungsprozess in der Realität tatsächlich immer entsprechend geordnet, strukturiert und bewusst abläuft und einem klaren Schritt-für-Schritt-Verfahren folgt.
Unterden genanntenVorbehalten lässt sich nunmehr diese Arbeit insgesamt in die Forschungstradition der „Foreign Policy Analysis“ einordnen, insbesondere inderen„zweite Generation“[68]. Diese hebt sich mit dem Anspruch von ihrer Mutterdisziplin der Internationalen Beziehungen ab, eine „Brückenfunktion“ zwischen dem internationalen System und dem Innenleben der Staaten einzunehmen, da sie das „micro level of politics with the macro level of the international system“ verbindet.[69]Von allgemeinem Belangsinddabei die „goals thatofficials representing states seek abroad, the values that underlie those goals, and the means or instruments used to pursue them“[70].Im Mittelpunkt steht das Bemühen, mehrere Wirkebenen von Außenpolitik in ihren wechselseitigen Beziehungen zu erfassen, um dem Anspruch auf eine plausible und möglichst „realitätsnahe“ Erklärung von Außenpolitik annäherndgerecht zu werden.[71]
Bei der Außenpolitikanalyse gelten einige Grundsätze;erstens: Der Staat wird als monolithisches, metaphysisches Analysekonstrukt aufgebrochen und als heterogener Akteur verstanden, der in seine konstituierenden Einzelteile zerlegt oder „desaggregiert“[72]werden muss, um Aufschluss über die Art und Weise zu gewinnen, wie er seine Außenpolitik formuliert. Vor allem kognitivistische Außenpolitikanalysen zeichnen sich durch einen methodischen Individualismus aus, bei dem der Mensch, der allein die Fähigkeit besitze, Informationen zu verarbeiten und außenpolitisch wirksame Entscheidungen zu fällen, den Staat als zentrale Akteurseinheit ablöst.Denn: „States are not agents because states are abstractions and thus have no agency. Only human beings can be true agents, and it is their agency that is the source of all international politics and all change therein.“[73]
Damit eng verknüpft wird zweitenspostuliert, dass außenpolitische Entscheidungen stets von menschlichen Akteuren getroffen werden, die ihre von Risiko, Unsicherheit und beschränkten Informationen geprägte Umwelt subjektiv und selektiv wahrnehmen.[74]Das „nationale Interesse“ von Staaten kann daher nicht als a priori vorgegeben betrachtet werden, da es der Definition durch entscheidungsmächtige Akteure mit zumeist unterschiedlichen Überzeugungen, Agenden und politischen Interessen unterliegt.[75]Robert Jervis, der sich mit der Bedeutung von „Perzeptionen und Fehlperzeptionen“ in der Außenpolitik prominent auseinandergesetzt hat, betont, dass „people differ in their perceptions of the world in general and of other actors in particular.Sometimes it will be useful to ask who, if anyone, was right; but often it will be more fruitful to ask why people differed and how they came to see the world as they did.“[76]
Die genauere Betrachtung der „Situationen“, in denen Regierungsverantwortliche entscheiden und handeln, ist für diese Arbeit wegweisend. Wie Richard Snyder etal.bereits 1954 feststellten, muss der menschliche Entscheidungsträger als zentrale Schnittstelle zwischen materiellen und ideellen Determinanten staatlicher Außenpolitik verstanden werden. Das nach außen gerichtete Verhalten von Staatenkönneerst durch den Blick auf seine Akteure und die Art und Weise,wie diese bestimmte politische Handlungsbedingungen oder „Situationen“ wahrnehmen und definieren, nachvollzogen werden:
„The situation is defined by the actor (or actors) in terms of the way the actor (or actors) relates to himself to other actors, to possible goals, and to possible means, and in terms of the way means and ends are formed into strategies of action subject to relevant factors in the situation.“[77]





























