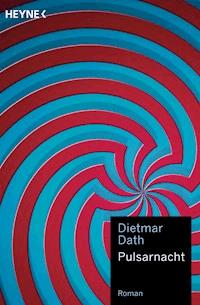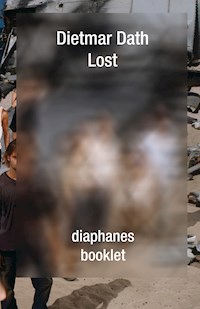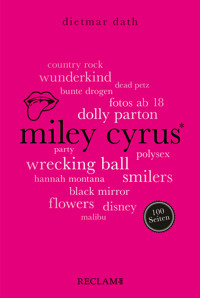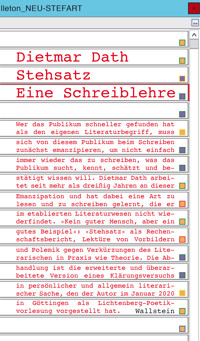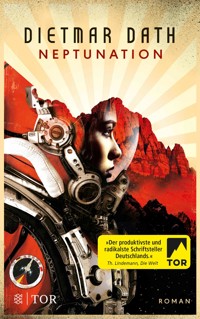19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Sowjetunion ist weg, Punk ist Retrochic und die Vernunft eine Sache von Anlageberatern, nur die alten Fragen sind die gleichen: Wie soll man leben? Woran sich orientieren? Der junge Schriftsteller David Dalek schaut sich seine Freunde, typische kreative Mittdreißiger, an und sucht nach Antworten auf die kleinen Fragen des Alltags und die großen des Universums. Im Leben seines Helden Paul Dirac, des großen Unbekannten der modernen Physik, glaubt er zu erkennen, worum es geht.
Dietmar Dath jagt Wissenschaftsgeschichte, Pop und Science-fiction durch den Teilchenbeschleuniger. Ergebnis des Experiments: ein in jeder Hinsicht phantastisches Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dietmar Dath
Dirac
Roman
Suhrkamp
Inhalt
Motto
Widmung
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
Nachwort
»… haben die Werte selbst ein
magnetisches Feld um sich,
das auch die Zerstörung anzieht …«
Hans Wollschläger
To Harlan Ellison
I am not sure
how much of my mind
he invented
EINS
Schatten
»Die Frau von der Küste hat gesagt: Du mußt entscheiden, wer sterben soll. Such irgendeinen Menschen aus – Mann oder Frau –, sonst trifft es einen, den du kennst, vielleicht sogar einen, den du liebhast. Du weißt sicher jemanden, und ich kann mich alleine einfach nicht entscheiden. Es gibt zu viele Menschen.«
So erzählt es Nicole, deren gutes Gedächtnis sie sonst davor bewahrt, über das Erinnerte zu urteilen, später ihrem Liebsten weiter, weil sie den Unterschied nicht erkennt zwischen dem, was sie da verstanden hat, und dem, was die Frau von der Küste wirklich zu ihr gesagt hat, nämlich: »Du mußt entscheiden, wer das Leben, wie es ist, nicht mehr braucht.«
Asche zu Asche, Kristall zu Kristall. Es ist ein Mißverständnis.
Nur deshalb wird alles so schwierig für den Mittdreißiger und Computerprogrammierer Paul, der Nicoles Liebster ist, für den Mittdreißiger und Schriftsteller David, den Paul seinen besten Freund nennt, für den Mittdreißiger und Psychiater Christof, der mit Paul und David zur Schule gegangen ist, für die Mittdreißigerin und Wissenschaftlerin Sonja, für und über die David ein Buch geschrieben hat, für die Mittdreißigerin und Künstlerin Johanna, die früher einmal Pauls Liebste war, und endlich für die Mittdreißigerin und Hausfrau Candela, die in Wirklichkeit weder Hausfrau noch Mittdreißigerin ist.
Auf diese Weise also kommt zustande, was man hier lesen kann, und der ganze Reiz des Textes besteht im günstigsten Fall in zweierlei Enthüllungen: Man erfährt erstens, welches entsetzliche, schöne und reiche Ergebnis das Mißverständnis der Worte der Frau von der Küste nach sich zieht, und man erfährt zweitens, wie alles ausgeht, was alle angeht.
Man liest also vom Ende, das eintreten muß, lange bevor in zweihundertfünfzig Millionen Jahren die Kontinente ineinanderkrachen, lange bevor die Andromedagalaxis in drei Milliarden Jahren mit der Milchstraße kollidiert, lange bevor die Sonne als weißer Zwerg endet, lange bevor die letzten Sterne ausbrennen, die Protonen in den Kernen der Atome zerfallen oder alle Materie durch Quantentunneleffekte zu Eisen wird.
Man liest vom Anfang des neuen Reptilienzeitalters, weil man erfahren will, was aus Nicoles Mißverständnis wird, und das eigentlich Unheimliche daran ist, daß man, während man davon liest, die Gelegenheit verpaßt, diesen Anfang zu beobachten, weil einen die Lektüre am Hingucken hindert.
Ein Mißverständnis, tatsächlich.
Freunde
Im Sommer Neunzehnhunderteinundneunzig, kurz nach Beginn der Semesterferien, liegt David morgens um sechs mit Quark in allen Gliedmaßen, einigen trotz viel warmem Wasser nicht ordentlich rausgewaschenen Kotzresten am oberen T-Shirt-Rand und verquollenem Gesicht bäuchlings auf dem Rasen hinter dem Hauptgebäude der Freiburger Universität. Er versucht eine Kurzgeschichte zu lesen. Neben ihm ruht auf dem Rücken Paul, der auch die ganze Nacht durchgemacht hat, aber eisern weiterraucht und gut beieinander ist, wie immer, ein Avatar der Coolness – nicht so wölfisch scharf und dehydriert cool wie Clint Eastwood oder Ivan Lendl zwar, dafür ist sein Gesicht zu breit, aber auf eine andere Art, die ebenfalls Starqualitäten verrät: mit sehnigem Leib, ruhiger männlicher Stimme, ungeheuer entspannten Zügen, freier Stirn.
Ein Steve McQueen: Alles, was Paul braucht, sind ein paar technische Geräte, ein bißchen Rechenzeit, Raum zum Manövrieren im Exakten, dann geht es vorwärts, wenn auch manchmal im Zickzack.
Johanna hat sechs Jahre früher, im anstrengenden Sommer Neunzehnhundertfünfundachtzig, über David und Paul zu David gesagt: »Du bist einer, der meistens nur in Gedanken handelt. Aber Paul ist umgekehrt einer, der handelt, damit er denken kann.«
»Du willst sagen«, hat David geantwortet, »ich bin bloß Leninist – aber Paul ist Lenin.«
So hat man in diesen Kreisen Neunzehnhundertfünfundachtzig noch geredet; Lenin war eine, na, sagt man nicht: Bezugsgröße? Nein. Das sagt man auch nicht mehr.
Jetzt nimmt Steve McLenin also seine Sonnenbrille ab, putzt sie mit seinem sauberen Hemdzipfel – er trägt natürlich ein weißes Herrenhemd, kein T-Shirt, denn er hat es nicht nötig, sich wie David, der nie jung war, zu beweisen, daß er jung ist – und sagt ganz überraschend etwas ziemlich Abgeklärtes: »Willste nicht mal nach Hause gehen und ausschlafen?«
»Nö.«
»Haste denn noch vor?«
»Ich wart’, bis die UB aufmacht. Ich will mir paar Bücher mitnehmen.«
»Bücher, Bücher. Bücherbücherbücher. Ich denk’, du brichst dein Studium eh ab?«
»Um Schriftsteller zu werden, ja. Deshalb die Bücher.«
Man schweigt ein paar Minuten, in denen Paul an erstklassige Mädchen denkt und David ein und denselben kurzen Absatz seiner Kurzgeschichte dreimal zu lesen anfängt, ohne zu verstehen, was dort geschrieben steht.
Dann fragt Paul: »Liest ’n da?«
»Eine Erzählung von Geoffrey A. Landis.«
»Das hilft mir ja nun gar nix.«
»Science-fiction. Über Zeitreisen, beziehungsweise über das Gegenteil davon. Schwer zu erklären. Aber erzählt ist das ganz leicht. Ich komm’ bloß nicht rein hier.«
»Und wie heißt dann so was?«
»Die Geschichte? ›Ripples in the Dirac Sea.‹«
»Hübsch. Da hat sich also wenigstens mal einer von euch ähm… Schriftstellern nicht die ewigen Einsteine und Heisenberge ausgesucht, sondern einen wirklich interessanten Physiker.«
»Inwiefern?«
»Na, dann schreib selber mal was über ihn, da wirst du merken: So leicht wie bei den Herren Berühmtheiten ist das nicht. Die, also, diese ähm sogenannte moderne Physik und ihre Interpretationen von Herrn Einstein und von Herrn Heisenberg, weißt du, das kriegst du heute von jedem Esoteriker erzählt. Die waren halt parteilich, das kann man leicht auf Parolen runterkochen. Der eine ’n altmodischer Realist und der andere ’n Positivist mit deftigem Mystik-Einschlag, aber Dirac …«
»Ja?«
»Der hat es sich schwerer gemacht. Mit dem ist die Geschichte noch nicht fertig.«
»Weißt du was?«
»Mhmh?«
»Johanna hat recht. Du bist echt Lenin.«
»Hat sie das gesagt?« Paul lächelt, kratzt sich den Bauch unterm Hemd; es gefällt ihm.
»Ja«, lügt David und hat überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei.
»Aberandererseits …Zeitreisen, also, hmpf, nee echt«, sagt Paul.
»Was dagegen?«
»Nö. Aber doch weil ... das ist immer so verbissen, dieses Science-fiction-Zeug. Die wollen jedes Mal die Vergangenheit ändern, Jesus kennenlernen, Hitler umbringen, alles bloß nach dem öden Prinzip der Aufwandsrechtfertigung gedacht, weißt du. Aus Holz.«
»Wie würdest du es denn denken?«
»Mehr so als Klingelstreich.«
»Als Klingelstreich.«
»Ja, verstehst du: Man nimmt eine Riesen-Stereoanlage, natürlich autobatteriebetrieben, mit in die Vergangenheit und baut sie nächtens im Schutz der Dunkelheit vor dem Fenster von Richard Wagner auf, dann ...«
»Paul, entschuldige bitte, aber du mußt das sofort wissen: Ich kann es wirklich kaum erwarten, zu hören, was für eine große Scheiße jetzt gleich von dir kommt, glaubst du das?«
»Dann dreht man das Ding auf maximale Lautstärke, und ab geht’s.«
»Was geht ab?«
»Die ›Star Wars‹-Titelmusik von John Williams.«
»Wieso?«
»Was wieso?«
»Wieso sollte man denn so was … so was total Subalternes und Inferiores machen?«
»Damit es ihn mal richtig graust. Den alten Wagner. Spaß muß sein.«
David sagt nichts dagegen. Er hat furchtbaren Durst.
Bei Johanna
Die Tür geht auf.
Johanna steht im dunkelgrünen Flur, lächelt, winkt den Gast herein.
Er tritt ein, legt ab. Johanna sagt: »Hallo, alter Freund. Du kommst gerade richtig. Wie’s mir geht? Diese Sauerei zu erzählen, das lohnt sich nicht. Belassen wir es bei: fein. Einfach fein. Und wie sieht’s bei dir aus? Was ist mit den großen Träumen passiert? Sind welche wahr geworden? Bist du schon verheiratet? Ach? Ich dachte, das wärst du inzwischen. Hab’s ganz vergessen: Wie hieß sie? Yeah, die gute alte Wie-heißt-sie-noch. Und bist du denn jetzt wegen mir hier, oder bist du bloß einsam? Sind wir ja alle. Doch, gefällt mir, wie du aussiehst, wie grad auf dem Fundbüro abgeholt. Rückkehr in die Welt der Menschen. Ich bin froh, daß du hier aufkreuzt. Du bringst mich gut drauf. Ich wüßte ja schon, was ich mir wünschen würde, wenn ich die Sorte wär’, die sich was wünscht: daß du mal öfter in der Gegend bist.«
Christof fragt: »In der Gegend?«
»Meiner Gegend, du Wikinger.«
»Oh Mann, Johanna, hör auf. Nicht das. Nicht diesen Witz.«
»Du hast sein Buch gelesen? Wo er das wieder ausgräbt, deinen Wikingerspitznamen?«
»Mmhmm.«
»Wie findest du es? Das Buch?«
»Weiß nicht.«
»Verstehe. Ja, so ähnlich geht es mir auch. Aber natürlich mit mehr Wörtern.«
»Klar. Willst du drüber reden?«
»Sehr gern. Das Buch erinnert mich an was, was Carter Scholz mal über Barry Malzberg geschrieben hat: Wenn er gut ist, ist er spitze, aber wenn er schlecht ist, dann ist er wahrlich abstoßend.«
»Wer sind die Typen?«
»Dichter, wie David.«
»Es gibt zu viele Dich … zu viele kreative Menschen auf der Welt. Man soll sich die wirklich nicht alle merken, das ermutigt die nur. Wollen wir eigentlich gleich los zu Paul?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht kannst du mich noch ein bißchen vorbereiten auf seine Freundin, diese Nicole. Soll ja sehr eigenwillig sein.«
»Sie ist krank. Ich weiß nicht, wie schwer, und ich weiß nicht, was es ist, aber gesund ist sie nicht.«
»Du sagst das so ernst. Das ist jetzt kein Spott, oder? Das ist deine fachlich gedeckte Meinung, als Psychiater?«
Christof grunzt, dann sagt er: »Soweit die Expertise reicht, ja.«
»Aber du bist nicht dagegen, daß sie bei ihm wohnt? Ich meine, sie ist ja wohl auch noch zig Jahre jünger als er.«
»Zehn Jahre sind es mindestens. Eher fünfzehn. Aber wenn du so fragst: Ja, ich bin dafür. Was immer das ist, was sie hat – es wird durch Paul nicht schlechter. Sie fängt eher an zu leben. Bei ihren Bauerneltern ging das wohl nicht so gut, nach allem, was ich höre.
Paul ist ihre erste richtige Chance, und vielleicht auch ...«
»Die letzte?«
»Warum wird eigentlich immer gleich alles so ernst mit dir, Johanna? Ich wollte dich bloß mal wiedersehen, Mensch.«
»Ja. Hast recht. Komm her, du alter Freund, du.« Sie umarmen einander.
Unterschied
Paul Dirac in der deutschen »Physikalischen Zeitschrift« Vol. XXIX, Neunzehnhundertachtundzwanzig, unter der Überschrift »Über die Quantentheorie des Elektrons«, gegen Ende des Textes:
Die Theorie gestattet Übergange von +e in –e. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit für diese Übergänge außerordentlich klein (...). Folglich ist die gegenwärtige Theorie eine Annäherung. Es scheint, daß diese Schwierigkeit nur durch eine fundamentale Änderung unserer bisherigen Vorstellungen behoben werden kann und vielleicht im Zusammenhang steht mit dem Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Aufhören
Warum gibt David Dalek Anfang der neunziger Jahre sein Sprachwissenschafts- und Physikstudium auf?
Man muß da zwei Fälle unterscheiden: den der Physik von dem der Sprachwissenschaft.
Das mit der Physik hat einen Anlaß und einen Grund.
Der Anlaß sind die vielen Übungen: manchmal ein Dutzend Aufgaben pro Woche, bei denen man rausfinden muß, was das Fach längst genau weiß.
Der Grund ist, daß David bei diesen Übungen klar wird, daß er wegen einer schwer definierbaren, aber deutlich empfundenen heuristischen Beschränktheit seines Verstandes wohl sehr wahrscheinlich niemals mit wissenschaftlichen Mitteln etwas herausfinden wird, was noch niemand weiß.
David hat schon vor dem Studium Literatur geschrieben, und weil er jetzt sehr ernsthaft mit der Schreiberei weitermacht, wird ihm im direkten Vergleich zur Mühsal des bloß reproduzierenden Rechnens klar, daß er zwar häufig Textideen hat, ja überhaupt ästhetische Einfälle, auch mal visuelle oder musikalische, aber eben keine wissenschaftlichen. Niemals. Keinen einzigen. Gar nichts.
Das ist nicht schlimm. Irgendwas kann jeder.
Man muß aber, wenn man nicht bloß anderen Menschen die Luft wegatmen will, unbedingt seinen Platz kennen, das heißt: seinen Beruf. Dann kann und soll man arbeiten.
Daß er die Sprachwissenschaft gleich mit verabschiedet, ist erstens ganz praktisch – so kann er sich komplett exmatrikulieren – und liegt zweitens an einem Satz, der immer schon an ihm genagt hat, seit Paul ihm Neunzehnhundertneunundachtzig zur Feier der Konterrevolution in der DDR den antiquarischen siebzehnten Band der Werke Josef Stalins, erschienen im Verlag Roter Morgen, Hamburg Neunzehnhundertdreiundsiebzig, mit der Bemerkung geschenkt hat: »Da, lies das mal. Sonst bleibst du ewig ein verblödeter Trotzkist und fühlst dich noch wer weiß wie klug dabei.«
Der Satz, den David sich aus diesem Buch zu Herzen nimmt, steht in Stalins kleiner Antwort an die Genossin J. Krascheninnikowa: »Zu einigen Fragen der Sprachwissenschaft«. Er lautet: »Es ist nicht schwer zu begreifen, daß, wenn die Sprache materielle Güter erzeugen könnte, die Schwätzer die reichsten Menschen in der Welt sein würden.« Als David das Physikstudium schmeißt, fällt ihm endlich eine praktische Anwendung dieses Satzes ein: Man soll sich, wenn es geht, wirklich nur nebenbei mit Sprache als solcher, mit ihren reinen Formen befassen, zur Koordination und Optimierung wichtigerer Dinge, nicht hauptberuflich. Er läßt also auch die Sprachwissenschaft bleiben und wird statt dessen Journalist und Schriftsteller.
Er redete nie viel
Stephen Hawking über Paul Dirac:
Nach Neunzehnhundertfünfundsiebzig sah ich ihn fast jedes Jahr bis zu seinem Tod (...). Er redete nie viel, im Gegensatz zu seiner Frau, die eine Ungarin war und eine fantastische Person. Man erzählte sich, daß seine Wortkargheit von seiner Kindheit herrühre; sein Vater habe ihm nur erlaubt, bei Tisch etwas zu sagen, wenn er dies in vollkommenem Französisch tat. Das mag stimmen, aber ich habe den Verdacht, daß er auch dann wenig geredet hätte, falls dies nicht geschehen wäre. Wenn er jedoch einmal etwas sagte, dann war es um so wertvoller.
Zu zweit
Paul hat wenig Zeit an diesem Samstagmorgen, es kommen später Gäste.
Er kann deshalb auf Nicoles Schwierigkeiten jetzt keine Rücksicht nehmen – diese Zustände, die sie manchmal kriegt, wenn sie von irgend etwas völlig fasziniert ist, wie neulich wieder, beim Blumenkaufen für Pauls Mutter, als sie mit der Verkäuferin aus keinem erkennbaren Grund eine Mordsdebatte angefangen hat darüber, warum die kleinen Töpfchen für die gelben Topfrosen so wahnsinnig billig sind, und wie toll das sei.
Gefährlich wird’s auch immer wieder im Auto: Es muß nur was im Radio kommen, was ihr gefällt, dann schmeißt sie die Haare hin und her, lacht und trommelt mit den Fingern auf dem Handschuhfach herum. Wie zum Beispiel ausgerechnet Supertramp: »Dreamer«, das ist für sie das Allergrößte. Wie der da kiekst, dieser Idiot, und wie es dazu klimpert.
Gut: Nicole ist verrückt, oder halbautistisch, soziopathisch, na: was immer das ist, was Christof seit Wochen bei ihr zu diagnostizieren versucht. Wenn man so etwas hat, darf man schon mal Supertramp toll finden. Noch schlimmer wird es aber, wenn sie dann was im Radio bringen, das ihr mißfällt. Schon fängt sie an zu kreischen, wirklich: wie am Spieß, und macht sogar die Tür auf, entriegelt sie erst und klappt sie dann raus, mitten auf der Straße, an der Kreuzung, sogar auf der Autobahn, in voller Fahrt.
Unberechenbar – und das ihm, dem Toprevolverhelden der diskreten Mathematik, Mister Computer. Aber er liebt sie. Also kommt er damit zurecht. Nur nicht heute. Er kann sie nicht mitnehmen in den Laden, weil sie dann womöglich wieder Grießbreitüten aufreißt oder das Gesicht zwischen die Früchte im Obstregal legt und erstmal tief einatmet. Er braucht nur eben noch ein paar Nudeln, die geht er ohne sie einkaufen.
»Kannst du hier auf mich warten? Geht das?« fragt er sie, als er ihr im Schnellrestaurant, das seit dem Umbau zum Edeka gehört, eine heiße Schokolade und ein Stück Käsekuchen kauft, weil er weiß, daß sie um diese Zeit, viereinhalb Stunden nach dem Frühstück, hungrig genug ist, um sich wenigstens mal zehn Minuten still mit Essen zu beschäftigen.
Nicole küßt ihn auf die Nase und setzt sich an ihren kleinen Nichtrauchertisch.
Paul beeilt sich sehr.
Er nimmt drei große Pakete Penne Rigate mit, Kochzeit elf Minuten, außerdem noch zwei Tüten Milch und eine unbehandelte Zitrone, weil er sich nicht mehr sicher ist, ob die zwei schrumpligen Dinger, die er schon in der Stadt gekauft hat, gespritzt waren oder nicht. Das viele Zeug läßt sich mit nur zwei Armen nicht leicht halten; er ärgert sich ein bißchen, daß er sich keinen Einkaufswagen genommen hat, ist dann aber erleichtert, als er wenigstens eine vergleichsweise kurze Schlange an der linken Kasse erwischt.
Die Kassiererin, eine kleine, spitzgesichtige, rothaarige Frau von Anfang Zwanzig, fragt ihn, als sie alle Sachen über die Preiserfassung gezogen hat: »Wollen Sie noch eine Tüte?«
Sie findet den schlanken, ernsten Mittdreißiger attraktiv, will ihm helfen, sieht mitfühlend die Schwierigkeiten voraus, die er haben wird, wenn er seine Einkäufe lose von hier fortbringen will. Paul hat es aber eilig: »Was? Nee. Ach, oder doch. Ja, bitte.«
Er schüttelt den Kopf und lächelt. Die Verkäuferin findet das cool und zeigt ihm, wo die Tüten liegen. Er nimmt eine raus und kriegt sie nicht auf: »Scheiße.«
»Geben Sie mal her.«
»OK. Entschuldigung, aber ich, ich muß dringend los jetzt.«
»Ja, dann, wenn’s pressiert, dann klappt’s immer alles nie so, wie man will, gell?«
»Tja, genau.«
Paul denkt, während er mit der Frau schäkert, an Nicole und macht sich Sorgen.
Die Verkäuferin kriegt die Tüte ohne Mühe auf und hält sie ihm hin, so daß er die Ware reinstopfen kann. Paul bedankt sich und läuft mit der im Galopprhythmus gegen sein Bein schlagenden Tüte los. Als er die Kurve am Blumenladen und der Backwarentheke vorbei zum Restaurant nimmt, sieht er, daß eine fremde, blonde Frau bei Nicole sitzt. Er spürt Irritation, leise Wut, auch Angst: Mit wem hat sie sich jetzt schon wieder eingelassen? Gibt das Probleme?
Die Frau sagt etwas zu Nicole, dann steht sie auf, lacht, nickt Nicole zu und geht.
Als Paul bei seiner schwierigen Freundin ankommt, ist die Fremde längst zur Tür raus.
»Wer war das? Die Frau?«
Nicole guckt auf diese herausfordernde Art, die sie draufhat, zu ihm hoch, zeigt ihm ihr schiefstes, keckstes Grinsen und erzählt es ihm dann, inklusive Mißverständnis: »Das war die Frau von der Küste. Sie hat gesagt: Du mußt entscheiden, wer sterben soll.«
Präzision
Bei den Recherchen für sein Buch über Dirac stößt David auf eine Geschichte, die Monica Dirac, eine der Töchter des Physikers, auf dem »Dirac Centennial Symposium« im Dezember des Jahres Zweitausendundzwei den zu Ehren ihres Vaters an der Florida State University in Tallahassee versammelten Wissenschaftlern erzählt hat: »Ich erinnere mich an die schwarze Katze, die wir hatten. Die ist immer durch die Klappe zum Kohlenlager im Keller, neben dem Ofen, rein- und rausgeschlüpft. Mein Vater wollte das Loch verschließen, so gut es ging, aber noch genug Platz lassen, daß die Katze weiterhin durchkonnte. Also bat er mich, sie ihm zu bringen. Da hat er dann mit einem Lineal den Abstand zwischen den Spitzen ihrer längsten Barthaare abgemessen, wegen der Spaltbreite.«
David versteht dank dieser Geschichte, was das Thema seines Buches über Dirac sein muß.
Eine Frage nämlich: Gibt es Menschen, die es fertigbringen, die Welt genauer zu sehen, als sie ist?
Spinnweben
Wenn Johanna Rauch, deren schöner vieldeutiger Name noch in ganz andere und viel grellere Geschichten führen will als die nun folgende, im Frühjahr des Jahres Zweitausendundfünf ihr jüngeres Schicksal »diese Sauerei« nennt, dann ist das nicht nur so dahingesagt und jedenfalls bestimmt keine Übertreibung.
Vor zwanzig Jahren, als Johanna, Christof, Candela, Paul, David und Sonja, die alle in dieser Geschichte vorkommen müssen, noch Teenager waren, ist Johannas Vater ein erfolgreicher und also vermögender Anwalt gewesen. Im Frühjahr Zweitausendundfünf aber hält er sich seit sechs Monaten in einer Klinik für Alkohol- und anderweitig Suchtkranke in der Nähe von Frankfurt am Main auf. Johanna besucht ihn dort häufiger als früher bei ähnlichen Aufenthalten an ähnlichen Orten, zum einen, weil sie das Gefühl hat, daß es diesmal schlimmer steht, zum andern aber auch deshalb, weil sie es sich zum ersten Mal in ihrem Leben leisten kann – der Dauerauftrag, der sie seit Jahren aus dem Gröbsten heraushält, läuft zwar weiter, aber sie braucht seine Überweisungen eigentlich nicht mehr. Sie hat jetzt endlich ein einigermaßen regelmäßiges eigenes Einkommen.
Vater Rauch sieht an Weihnachten Zweitausendundvier nicht schlecht aus, viel weniger grau im Gesicht, mit klarerem Blick als vor zwei Jahren, bei seiner letzten sogenannten Kur. Aber auch kleinere Zusammenbrüche wie den jüngsten steckt er heute schwerer weg als früher, weil er älter ist, schon auf die Siebzig zugeht. Als sicherstes Anzeichen dafür, daß er selbst genau weiß, wie heikel seine Lage werden kann, wenn er es nicht endlich schafft, trocken zu bleiben, erkennt Johanna seine tapsigen Versuche, klare Verhältnisse zwischen sich und seinen grausamen, dummen und bösen Geschwistern zu schaffen.
»Ich verstehe mich mit meinem Bruder und mit meiner Schwester nicht mehr so gut wie früher« – das sagt er, den Kopf verschämt gesenkt, undeutlich und vergrummelt zu Johanna.
Es rührt sie sehr, daß er ihr dies anvertraut, weil es ganz offensichtlich ein gestisches Geschenk für sie sein soll. Er hat nicht mehr viel, außer Geld, was er ihr schenken kann, aber weil er weiß, daß Johanna weiß, daß sein Bruder und seine Schwester, Johannas Onkel Hagen und ihre Tante Hiltrud, ihre Nichte mit schwefelgelber Erbitterung hassen und verfolgen, ja ihn bei jeder Gelegenheit gegen sie aufzuhetzen versuchen, sagt er ihr, was sie gern hört. Johanna würde ihn dafür am liebsten ein bißchen drücken, wenigstens den Arm um ihn legen. Aber sie kann das nicht; so ist sie nie gewesen, das würde ihn nur wundern, es paßt nicht.
Daher sagt sie statt dessen: »Du hast auch wirklich keinen Grund, dich mit denen gut zu verstehen.«
Sie meint damit Vorfälle wie vor drei Jahren: Damals wollte ihr Vater, der als vereinsamter Witwer in dem großen Haus auf dem Hügel häufig klaustrophobische Beklemmungen aushalten muß, eine kleine Tour unternehmen – nach Ägypten und Israel, aus Gründen privater biblischer Forschung und unmittelbarer Anschauung. Damals war Heinz Rauch unvorsichtig genug gewesen, seinem nichtsnutzigen Bruder am Telefon von der bevorstehenden Reise zu erzählen.
Daraufhin hat der aus seinem hundsrotzdummen, stinkenden Stuttgart beim einzigen Reisebüro der kleinen Stadt angerufen, in der Heinz Rauch gefangensitzt, wenn er nicht gerade wieder woanders in der Suchtklinik leidet, und hat dem Reiseveranstalter die Hölle heißgemacht: Ob der eigentlich wisse, daß Heinz »ganz schwerer« Alkoholiker sei, ob er sich auszumalen fähig sei, welche Risiken so eine Fernreise mit sich bringe, welche Krisen, skandalösen Szenen und beschämenden Schadensfälle?
Johannas Vater war trotzdem geflogen, weil der Mann vom Reisebüro sich von Verwandten seiner Kunden nicht einschüchtern oder herumkommandieren lassen wollte. Es war nichts passiert.
Johannas früheste Erinnerung an ihren Onkel Hagen: Er sitzt im Wohnzimmer ihrer Großeltern und erzählt dröhnend, daß er Taucher ist, außerdem einen Pilotenschein hat und überhaupt keinem Abenteuer aus dem Weg geht: »Ich bin ein rastloser Mensch, ich brauche das Risiko.«
Rastlos: So hat er immer dahergequakt, dieser Trottel mit seinen bunten Hemden und Fliegen und Einstecktüchlein, durch zwei verkrachte Versuche hindurch, sich selbständig zu machen, mehrere lausig unerhebliche Jobs, die er beim Erzählen zu enormen Positionen aufgeblasen hat – ich bin Landvermesser, ich betreue Kunden aus Übersee, meine Firma erhält Aufträge vom Kanzleramt –, eine kurze Ehe, an deren Ende ihn die Frau, die er mit irgendeinem unseriösen Weinhandelsprojekt fast ruiniert hätte, achtkantig an die Luft setzen mußte, mehrere Umschulungen und Hüftoperationen; unterwegs durchs tapfer FDP-wählende Arschlochleben ständig diese Auftritte, bei denen er andere Menschen zur Schnecke machen muß – er weist noch heute, da er mit Anfang Fünfzig als nicht vermittelbarer Arbeitsloser in einer halbleeren Wohnung in Stuttgart haust, in der chemisch gereinigte und gebügelte Anzüge auf einer Leine quer durchs Zimmer hängen und der Dreck sich im Spülbecken zu tropischen Landschaften türmt, mit Vorliebe Bedienungen in Kneipen zurecht, weil sie ihm das Bier falsch zapfen, oder herrscht im Intercity-Expreß den Kartenknipser an, weil der Zug Verspätung hat, oder befiehlt Johannas Vater, er solle Johanna gefälligst enterben: »Die kümmert sich einen Dreck um dich. Ich würde ja, wenn ich keinen Engpaß hätte, aber ich muß in Bewegung bleiben, ich bin ein Mann ohne Ruhe, aber das Mädchen – die ist nie was Ordentliches geworden, die läßt sich bloß treiben, das gehört eigentlich bestraft.«
Johannas früheste Erinnerung an ihre Tante Hiltrud: Die zitronensaure Frau äußert sich abfällig über eine Puppe, die Johannas Vater gekauft und über die sich die fünfjährige Johanna sehr gefreut hat: »Dieses Plastikzeug, dieser Kitsch aus Amerika, das kannst du nicht machen, Heinz, so etwas verdirbt die ganze kindliche Wahrnehmung.«
Kindliche Wahrnehmung: So geschwollen und verkniffen hat die ledergesichtige Vogelscheuche immer dahergeredet, auch später, als Johanna, die schon vor der Einschulung lesen gelernt hatte, sich mit ungefähr zwölf Jahren für Bücher zu interessieren anfing, die »nicht ihrer Altersstufe entsprechen«.
Johannas Vater hat ihr die Bücher trotzdem geschenkt. Tante Hiltrud hat dagegen Front gemacht, so schrill sie konnte: »Das ist doch Wahnsinn, die wird verzogen, so ein teures Buch über Impressionismus, das weiß die doch noch gar nicht, was das ist, mit fünfzehn Jahren. Das verwirrt sie nur, setzt ihr Flausen in den Kopf! Und Gedichte, Hölderlin, Lasker-Schüler, die liest ja alles durcheinander, da fehlt doch die Aufnahmefähigkeit. Wenn sie das alles am Lehrplan vorbei, ohne Anleitung, in sich reinstopft, dann, merk dir meine Worte – das wirst du noch bereuen, Heinz. Denk an meine Worte.«
Zu Weihnachten Zweitausendundvier besucht Johanna ihren Vater also in der Klinik.
Er gibt ihr einen Karton mit Plätzchen drin, auch ein selbstgebastelter Engel ist dabei, ein ganz prächtiges Christbaumschmuckstück.
Sie nimmt das alles mit nach Hause, rührt aber die Plätzchen tagelang nicht an. Etwa eine Woche später kommt sie von der Galerie, bei der sie aushilft, spät nach Hause und hat eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter: »Johanna, hier ist die Tante Hiltrud. Ich will dir nur mitteilen, daß der Karton, den dir dein Vater gegeben hat, von mir ist. Vor allem der Engel ist von mir, für ihn. Das Gebäck kannst du behalten, du hast es ja wahrscheinlich auch schon aufgegessen. Aber den Engel will ich wiederhaben. Der war nicht für dich bestimmt.«
Johanna lacht kurz und häßlich, als die Botschaft zu Ende ist.
Dann, beim Abendbrotmachen, wird sie in der Küche plötzlich von einer unglaublichen, flutwellenartig tobenden und brausenden Wut gepackt, absolut begriffslos, tierhaft verkrampft, sie schmeißt Teller auf den Boden, stampft in ihr Wohnzimmer, räumt den halben Schreibtisch mit einer einzigen wilden Armbewegung ab, die Bildbände, ihre Notizen und Zeichnungen, Entwürfe, Einladungen zu Eröffnungen, Zeitschriften – »Painting Today«, Filmhefte, die »Artforum«-Ausgabe mit Johannas erstem Artikel in englischer Sprache, die schon seit einem Jahr da liegt, obwohl sie das Heft nicht mehr anschaut, aber sie will es eben auch nicht ins Magazinarchiv einräumen, so stolz ist sie immer noch darauf –, alles muß zu Boden, runter, weg. Dann tritt sie danach, daß das Zeug im Zimmer herumfliegt wie ein Schwarm verrückt gewordener Vögel.
Sie schreit, sie weint und tobt. Die Nachbarin klopft nicht; sie ist das inzwischen gewöhnt, denkt Johanna, die Alte weiß, es hört gleich wieder auf.
Bevor es aufhört, brüllt Johanna: »Diese Schweine! Diese hirnlosen, toten Vampir-Arschlöcher, wann lassen die mich endlich in Ruhe! Schweine, diese miesen, verschissenen Schweine ohne eigenes Leben, die nur andere Leute kaputtmachen können! Ich will da raus! Ich will da endlich raus aus dieser schweinischen, herzlosen Drecksfamilie! Diese dummen, ekligen Monster!«
Johanna irrt sich sehr über die uralte Frau nebenan. Erstens hört die genau zu, was Johanna schreit und wie sie sich in ihrem persönlichen Scheol herumwirft und leidet. Zweitens erkennt sie, daß Johanna sich im Scheol befindet, nicht in der Gehenna. Das sind zwei Sorten von in der Bibel erwähnten Höllen: Im Scheol ruhen die Toten, an die sich Gott erinnern wird und die deshalb auferstehen werden, in der Gehenna die Vergessenen und Verdammten, die keine Aussicht auf Vergebung haben.
Drittens ist die alte Frau nicht uralt, sondern erst sechsundfünfzig.
Viertens klopft sie nicht deshalb nicht mehr, weil sie mit Johannas Anfällen inzwischen gut zurechtkommt, sondern weil das Krokodil ihr gesagt hat, sie solle aufmerksam zuhören, was die Leidende nebenan unternimmt, um Druck abzulassen. Das Krokodil von Johannas Nachbarin lebt in deren Badewanne. Niemand weiß davon. Wenn nämlich die Leute davon erführen, erführen auch die Ämter davon, und dann gäbe es eventuell Ärger.
Am nächsten Tag packt Johanna den Engel mit völligem Gleichmut sorgfältig so ein, daß er bei den bekannt rüden Transportsitten der Post keinen Schaden leidet, bringt ihn zu McPaper und denkt, als der Angestellte das an Tante Hiltrud adressierte Päckchen, in dem außer dem Engel und Packpapier nichts ist, kein Brief, keine Karte, in eine schmutzige gelbe Plastikwanne wirft: Was rege ich mich auf, es sind halt Versager.
Ganz bittere und krude Leute. Das ist wahr, aber es hilft nur bis zum nächsten Mal.
Die Bösen aber können in Ruhe warten; sie haben nichts vor, außer ihren großen Bosheiten.
Deshalb sagt Johanna zum lieben Gott: »Ich geb’ nicht auf, wenn Du nicht aufgibst.«
ZWEI
Altes Gedicht
Im ersten Sonnenschein sehen die Fragen brüchig aus, wie von fleckiger, blasser Rinde überzogen, die an vielen Stellen aufgeplatzt ist. Der Beobachter weiß, was man über ihn redet: Der alte Mann jagt einen weißen Wal. Vielleicht stimmt das, vielleicht ist es aber auch eher wie beim biblischen Jona: Er sitzt in dem Wal gefangen. Das Licht nimmt immer zu; zuviel bleibt aber im Dunklen. Ich habe Elemente einer Geschichte des ganz Kleinen und des ganz Großen gesammelt, habe die Geschichte erlebt, aber die Worte dafür fehlen noch. Ich habe nie angefangen, sie zu erzählen. Nicht einmal in den Nachrufen auf meine Freunde: Schrödinger, Kapitza ... Das einzige, was mir von der Arbeit bleibt: gemalte Rosen, statt richtiger.
Was habe ich eigentlich angestellt mit meiner ganzen Zeit? Sein Gedächtnis sucht nach einem Zuhörer, der die Geschichte verstehen kann. Oppenheimer fällt ihm ein, damals in Göttingen, vor zwei Menschenaltern: der ernste junge Amerikaner, das schmale Gesicht, die gekrümmte Körperhaltung (»zusammengefaltet«, hat Heisenberg gesagt), das Buch auf den Knien, die Lippen bewegt wie beim Beten.
»Was liest du da?« wollte Max Born wissen.
Oppenheimer verstand die Frage ganz wörtlich und nannte als Antwort deshalb nicht den Titel des Buchs, sondern las die Worte laut ab, die er eben vor sich sah:
Drauf barg er sich. Doch ich, beim Rückwärtsschreiten
Zum alten Dichter, prüfte überdenkend
Die Worte, die wohl Unheil prophezeiten.
Dickes Buch, flaschengrüner Einband.
Born zog die Stirn kraus, Heisenberg nickte: »Unser verträumter Freund liest den alten Dante – die ›Göttliche Komödie‹. Wenn du nur nicht trübsinnig wirst darüber, Oppenheimer – von der Stelle an ist es ein langer Weg aus der Hölle.«
Max Born fand das lustig; er war damals leicht überdreht und immer bereit, sich über frisch gelöste Rätsel zu freuen, wie wir alle, und wenn es die banalsten waren. Wir wußten ja nicht, wie gut wir es hatten.
Oppenheimer sah mich fragend an, der Blick schnitt Heisenberg und Born von mir ab. Damit begann eine Freundschaft. Wie hat mein Gesicht ausgesehen?
Beim Kanal
Ende der siebziger Jahre gibt es bei David Dalek zu Hause häufig Schläge. Nachmittags, wenn seine berufstätige Mutter nicht da ist, treibt er sich, anstatt seine Hausaufgaben zu erledigen, mit asozialen Kindern rum, die am nahe gelegenen Kanal wohnen, hilft nicht bei der Hausarbeit und räumt sein eigenes Zimmer nicht auf. Spielsachen und »Perry Rhodan«-Heftchen liegen überall herum. Davids Mutter ist überfordert, brüllt sie. Das heißt, sie hat Angst. Die kommt aber weniger davon, daß er sich als Kind benimmt wie ein Kind, vielmehr vom Alleinerziehen an sich. Sie glaubt und fürchtet, schreit sie, das Jugendamt nimmt ihn ihr weg, wenn er so weitermacht. Dann gibt es auch kein Geld vom abwesenden Vater mehr, statt dessen den Hohn der Verwandtschaft. Deshalb kommt sie manchmal abends ins Zimmer gestampft und hat entweder schon den Kochlöffel oder den Besen in der Pranke, oder sie greift sich sein Stekkenpferd. An diesem Steckenpferd lernt David zu der Zeit gerade, wie man so tut, als würde man zu Popmusik im Fernsehen Gitarre spielen: man macht mit der rechten Hand am Kopf des Pferdes schrabbschrabb und greift mit der linken Hand am Stock rum, weil das der Gitarrenhals ist. Auf dem Boden liegen »Sesamstraßen«-Plastikfiguren aus dem »Sesamstraßen«-Puppenhaus, das die Mutter gekauft hat, auch »Marvel«-Comics.
Die Griffe an der Nichtgitarre, die David ausprobiert, sind falsch: für die hohen Töne greift er oben, für die tiefen unten. Später wird er an Johannas Geige merken, daß das bei Saiteninstrumenten in Wirklichkeit genau umgekehrt funktioniert; Ende der siebziger Jahre kann er so etwas noch nicht wissen, weil er selber nur Blockflötespielen gelernt hat.
Die Mutter hat keine Schwierigkeit mit den richtigen Griffen; sie packt einfach etwas Längliches aus Holz, und dann kann es losgehen. Er kriegt es nur ziemlich abstrakt mit, wenn er verprügelt wird, denn die Schläge sind nicht wahnsinnig fest und auch nicht sehr präzise. Es ist, wie er sich später, als ihn sprachliche Mikrodifferenzen zwischen verwandten Wörtern immer mehr interessieren, klarmachen wird, gar kein planvolles Zuschlagen, sondern ein hilfloses Dreinschlagen. Trotzdem tut es natürlich weh und hinterläßt auch immer Spuren, die manchmal sogar von den anderen Kindern bemerkt werden. Die Asozialen vom Kanal finden das allerdings normal. Nicht bemerkt werden die Spuren dieser Schläge vom Jugendamt, zum Glück.
Am Wasser
Kann man das Erlebte und Vollbrachte zusammenfassen?
Vielleicht so: Ich habe meine Seele für einen Moment der Klarheit verkauft.
Wie sagte doch Max, damals in Göttingen, zu Werner, über mich, in meinem Beisein, als wäre ich nicht da? »Es ist beschämend. Wir alle arbeiten hier emsig zusammen, er aber sitzt allein auf seiner Insel . .. ich meine nicht nur England. Ich meine die Insel in seinem Kopf. So treibt man keine Wissenschaft, besonders nicht in diesen Zeiten, in denen jeder Tag etwas Neues bringt. Es ist ein Skandal:Was immer der Mann anfaßt, auch der größte Unfug, wird wie von allein richtig.«
Der Beobachter schließt die Augen und öffnet sie sofort wieder. Skarabäusfarben blinzelt das blanke Seetablett – halt, nein, das Blinzeln bin ja ich. An den Rändern des Wassers lebt etwas: Knacken und Knistern, dringender Betrieb von Wesen im Schilf, aufgeregte Kleinigkeiten kämpfen miteinander, fressen und werden gefressen.
Der Beobachter ist ein sehr alter Mann.
Früher einmal war er groß und schmal, jetzt steigen die Schultern mit jedem Monat, der Kopf nickt nach vorn und nach unten, das Rückgrat sinkt langsam in sich zusammen, Glied um Glied.
Er steht, weil er das weiß, nicht trotzig, sondern schicksalsergeben da, in einem unauffälligen grauen Anzug. Seine Krawatte ist so lang, daß ihre Spitze im Hosenbund steckt. Trotzdem sieht er nicht lächerlich oder bemitleidenswert aus. Seine Haltung teilt bloß mit, daß dieser Mensch sich keine Illusionen macht darüber, wieviel Haltung ihm überhaupt noch möglich ist. Der Blick aber sagt etwas anderes: Niemand, der davon lebt, Menschen zu täuschen, möchte von diesen Augen lange angesehen werden.
Die schlanken Hände des Beobachters liegen so ruhig am Körper an, daß man vermuten kann, sie wären oft mit Hobbys beschäftigt, die Fleiß und Sorgfalt belohnen – Numismatikerhände, Entomologenhände.
Sie haben kompakte Wahrheiten aufgeschrieben, geheime Namen dafür, wie die Welt ist. Der Beobachter war nie Schriftsteller und kein Philosoph, kein Dichter und kein Psychologe. Vor zwei Menschenaltern hat er Ingenieur werden sollen. Statt dessen ist er etwas viel Gefährlicheres geworden.
Was ist das eigentlich immer, mit dem Werden? Ein Witz fällt ihm ein, mit dem er eine seiner erwachsenen Töchter gern aufzieht, wenn sie wieder jammert: Aus mir wird nichts. Da lächelt er dann und sagt: Mach dir keine Sorgen, Kind, du bist längst fertig, aus dir ist schon nichts geworden.
Der Beobachter kneift die Augen zusammen, um die Grenze zwischen der Natur hier und der Stadt jenseits des Sees etwas genauer zu erkennen. Am Ufer drüben liegen jetzt Leute in ihren Zimmern im Innern von Flachdach-Hotels mit entschieden zu bunten Art-Deco-Fassaden in bequemen Betten. Ungefähr um diese Zeit, denkt der Beobachter, der einige dieser Hotels kennt, schalten sich auf zahlreichen Nachttischen Radios ein. Dann läuft das Lied »Call Me« – das singt diese neue Popgruppe jetzt schon seit über einem Jahr, andauernd und überall, hin und wieder abgewechselt von Radionachrichten, die pausenlos den Gesundheitszustand der Präsidentin erörtern. Die Präsidentin hat mit dem Rauchen aufgehört, die Präsidentin hat einen Schwindelanfall gehabt, die Präsidentin fühlt sich besser, der Präsidentin geht es schlechter, die Präsidentin wird bald sterben, die Präsidentin wird ewig leben, das Amt ist tot, es lebe die Amtsinhaberin. Ein Affenzirkus. Dieses morbide Interesse der Leute an der kranken alten Frau in Washington stößt den Beobachter ab. Was wollen sie? Die Frau ist drei Jahre jünger als ich, also praktisch eine vorsintflutliche Eidechse, ein Krokodil, das sich ins Leben verbissen hat, da sollte man nicht so genau hinsehen, das ist unhöflich.
Sollen doch die Radios statt solcher Bulletins viel lieber neue Dudelmusik wie dieses unaufhörliche »Call Me« abspielen, damit die Menschen gute Laune haben. Schließlich kriegen die früh genug ihre eigenen Lungen- und Herzleiden ab, da muß sich keiner in denen von Frau Rand suhlen.
Küssen
Neunzehnhundertsechsundachtzig gibt es in ganz Sonnenthal keine einzige Party mit Jugendlichen, auf der irgend etwas los ist, bevor Paul kommt.
Er ist derjenige, der den Alkohol mitbringt, und wenn schon Alkohol da ist, bevor er kommt, ist er der erste, der ihn trinkt. Alle machen immer gerne, was Paul will – nicht einfach nur, was er sagt – er sagt ja auch viel weniger als beispiels weise David –, sondern wirklich, was er will. Man errät es.
Die Mädchen lieben ihn natürlich. Außer Candela Lauder, die liebt keinen, der nicht älter ist als sie.
»Ist dir klar, daß Svenja was von dir will?« fragt David einmal, als sie beide besoffen sind, auf dem Balkon von Davids Wohnung, in der sie feiern, weil Davids Mutter in dieser Nacht die ganze Nacht nicht da ist. Paul schaut über seine Schulter ins Wohnzimmer von Davids Wohnung und sieht Svenja, dann sagt er: »Wen soll ich denn noch alles küssen?«
»Mich vielleicht?« sagt David und lacht. Paul stellt die Bierflasche hin und kommt näher. David sagt nichts und guckt nur, dann küßt Paul ihn. Es ist sehr kurz, schmeckt gut und bleibt das einzige Mal. Fast hätte David die Augen zugemacht dabei.
Dann kommt Johanna raus und fragt, ob Paul noch »zu rauchen« hat.
Fernsehen
So hat Paul Nicole noch nicht vor dem Fernseher sitzen gesehen wie an dem Abend, als er vom Zahnarzt nach Hause kommt, der ihm einen abgebrochenen Schneidezahn repariert hat. Sie grüßt ihn fahrig, mit »He Paul« und einer Handbewegung. Nicole hockt im Schneidersitz viel zu nah am Kasten auf dem Teppich, den Oberkörper nach vorn geneigt, als würde sie am liebsten in die Kiste kriechen, die Augen weit auf, die Lippen feucht, weil sie immer wieder drüberleckt.
»Was guckst du denn?«
»Nicht reden!« sagt Nicole, und ihre hinreißende Stirnfalte unterstreicht den Ernst der Lage. Paul wirft einen flüchtigen Blick auf das, was auf dem Schirm passiert: Zwei amerikanische Teenagermädchen stehen auf irgendeinem Schulklo vor dem Spiegel, die Blonde versucht ihren Knutschfleck am Hals unterm Kragen eines grotesk übergroßen Sweatshirts zu verbergen, ihre dunkelhaarige Freundin redet ihr gut zu; insgesamt geht es gesprächsweise sehr expertinnenartig »um Jungs«.
Paul zuckt mit den Schultern, geht in die Küche und schüttet für seine Liebste und sich einen Haufen gesalzener Chips in eine große grüne Salatschüssel. Dann nimmt er zwei Flaschen Cola – aus Glas, von der Tankstelle, ziemlich teuer, aber Nicole trinkt nicht aus Plastikflaschen, deshalb gibt es in der gemeinsamen Wohnung meistens nur Wasser, Saft oder Milch – aus dem Kühlschrank und bringt den Kram rüber.
Die Dunkelhaarige von vorhin sitzt jetzt in einer typischen US-Fernsehseriengefängniszelle, direkt neben einer anderen Zelle, in der Colin Hanks hockt, der Sohn von Tom Hanks. Der Sohn von Tom Hanks ist beleidigt. Die Dunkelhaarige – sehr niedlich, findet Paul, wenn auch, wie alle Wesen mit zwei Beinen unten, nicht ein gequetschtes Sechsunddreißigtausendstel so schön wie Nicole – redet auf Colin Hanks ein und weint. Es geht irgendwie darum, daß die Dunkelhaarige schuld ist an beider Knastaufenthalt und ihm, also das ist ja wohl die Höhe, noch nicht mal sagen will, warum. Schließlich verrät sie immerhin: »Isabel, Max und Michael sind nicht von hier«, und in dem Moment, da der Sohn von Tom Hanks diese Information als unerheblich wegwischt – Paul versteht auch nicht, was sie mit irgendwas zu tun hat, worum es hier überhaupt geht – und eher lustlos wissen will, woher sie denn seien, zeigt die Süße mit dem Zeigefinger in die Höhe.
Wie, von oben? Aus Wyoming? Kanada? Da klingelt Pauls Handy, und die immer noch vom Schirm gebannte Nicole fuchtelt erregt mit der Rechten und flüstert: »Geh ran, geh ran, nimm es ins Schlafzimmer mit!«
Als Paul zurückkommt – es war David, er braucht einen Buchtip für sein Dirac-Ding – steht Nicole auf, umarmt ihn und küßt ihn heiß und panisch ab, während im Fernsehen Werbung läuft.
Paul lacht: »Ach, jetzt gibt es mich doch wieder?«
Sie schaut ihn staunend an und sagt: »Es war doch nicht bös! Nur weil Alex fast alles dem Sheriff erzählt hätte, mit dem vertauschten Blut und daß Isabel ihn zum Ausfragen auf die Party eingeladen hat, weil sie in seinem Traum sehen kann, daß er auf sie steht, da hat Liz ja irgendwas machen müssen, und das war so spannend, ob sie ihm jetzt sagt, daß Max und die andern zwei in dem Absturz dabei waren und dann erst viele Jahre später aus den Kapseln rausgekommen sind, als Menschen!«
»Wie heißt sie denn, deine ... ähm ... ist das deine Lieblingssendung jetzt, das hast du mir ja noch nie ...«
»Oh Mann, es geht weiter!« sagt Nicole, nimmt seine Hand wie manchmal beim Spazierengehen und drückt sie vor Begeisterung. Da kann er nicht anders als sie zurückzudrücken und sich dazuzusetzen, auf den Boden. Gemeinsam schauen sie den Schluß von etwas, das laut Titeleinblendung »Roswell« heißt und eine Serie über menschliche und außerirdische Teenager zu sein scheint, die sich so kompliziert und doppelt dreiecksförmig wie möglich ineinander verlieben, oder auch nicht.
Als es fertig ist, fragt Nicole: »Gefällt dir das auch? Das war doch Wahnsinn, man denkt ja immer, jetzt küß sie halt mal endlich! Ich finde das toll, daß Max und Liz jetzt endlich richtig zusammen sind.«
Damit springt sie auf, seine Antwort nicht abwartend, und läßt den Fernseher weiterflimmern. Paul lächelt, schüttelt den Kopf, schaltet den Apparat per Fernbedienung ab und ruft ihr in die Küche hinterher: »Was machst du da eigentlich?«
»Wir müssen doch jetzt ein richtiges Abendessen machen. Wer nur Chips und Cola ißt, kriegt Krebs und alles im Bauch verfault. Oder kannst du noch nichts Richtiges essen wegen dem Zahn?«
»Doch, ich kann«, ruft Paul.
»Also dann machen wir jetzt Nudeln, und wegen deiner Frage tut’s mir leid vorhin, daß ich das nicht beantwortet habe, also klar ist ›Roswell‹ meine Lieblingssendung.«
»Wieso?« fragt er, als er in die Küche kommt, und umarmt sie von hinten.
»Was?«
»Wieso ist das deine Lieblingssendung?«
Sie prustet, als wollte sie sagen, was für eine pipileichte Frage, und dann erklärt sie, während sie die Nudeln ins kochende Wasser schüttet: »Na das ist doch das Tollste, man muß immer total gespannt wissen, wie es weitergeht, weil das sind Verliebte, wo man es überhaupt nicht weiß, weil sie Menschen und Außerirdische sind, total verschieden halt, genau wie du und ich. Wie es ausgeht. Weil Liebesgeschichten, wo alles einfach ist, sind ja langweilig.«
Aus Fulda
David lernt Candela Lauder nicht erst Neunzehnhundertachtzig auf dem Gymnasium kennen, sondern schon Neunzehnhundertsiebenundsiebzig auf der Dr.-Max-Metzger-Grundschule in der Sonnenthaler Adam-Müller-Straße. An dieser breiten, unebenen und hellen Straße ist er schon in den katholischen Kindergarten gegangen; während der Grundschulzeit besucht er außerdem täglich den katholischen Hort daneben.
In jenem Kindergarten hat ihn einmal eine für das Erziehen verantwortliche Frau mit dem schönen Künstlernamen Schwester Einbetha einen Nachmittag lang in eine Besenkammer eingesperrt, weil er dauernd so geschrieen hat. In dieser Besenkammer hat er dann versucht, irgend etwas kaputtzumachen, aber da standen und lagen nur Gegenstände herum, die so dumm und primitiv waren, daß es daran leider gar nichts kaputtzumachen gab. Dies ist ein Gleichnis auf die katholische Soziallehre.
Neunzehnhundertsiebenundsiebzig also lernt David Candela kennen und erfährt von ihr durch extrem penetrantes Ausfragen, daß sie im von Südbaden unermeßlich weit entfernten Fulda geboren ist, was er in den darauffolgenden vier Jahren, bis er ihr erneut begegnet und sich in sie verliebt, wieder vergißt, weil, wie jeder weiß, vier Jahre in diesem Alter ein Äon sind.
In der Grundschule, drei Stühle entfernt von Candela, langweilt er sich schrecklichst und schreibt auf Anweisung der psychisch gestörten Lehrerin dauernd grauenhafte, deprimierende Sachen von Pinter und Beckett in sein Heft wie: »Die Kinder spielen im Hof. Die Kinder spielen im Garten. Die Kinder spielen in der Scheune. Die Kinder spielen im Haus. Die Kinder spielen auf der Wiese.«
Wenn die Kinder auch im Unterricht spielen, verteilt die psychisch gestörte Lehrerin, bei der immer das rechte Auge zuckt, Strafaufgaben und böse Spitznamen. David kriegt zwar einige Strafaufgaben ab, aber keinen bösen Spitznamen. Den verpaßt die psychisch gestörte Lehrerin dafür dem Mädchen, das sich beim rituellen Aufgerufenwerden und den eigenen vollen Namen Hersagen immer mit »Candela Alexandra Franziska Lauder« vorstellt. Die Lehrerin nennt dieses Mädchen »Candela Quatscheviel«, wird aber nach vielen derartigen Witzen, weil sie immer häufiger grundlos anfängt zu heulen, auch im Unterricht, schließlich abgeholt und nicht mehr gesehen.
Banjofrosch mit Flügeln (im Schilf verborgen)
Plicketiplick, pickpickpick.
An irgendeinem schönen Morgen, der so ist wie dieser, wenn dieses Leben zu Ende ist, werde ich wegfliegen, plicketiplick, pickpickpick, am Morgen früh, wenn ich sterbe, Halleluja, eins-zwei-drei, ich fliege weg. Der kommende Tag, am Himmel über der Wasserfläche und in der eingesunkenen Brust des Beobachters, ist eine geschlossene Seerose, die bald blühen wird. Die Ordnung des Ganzen im zunehmenden Sonnenlicht: Gerade, Parallele, Strecke, Winkel, Abstand, Flächeninhalt, der See eine Punktmannigfaltigkeit, Wellenmuster, darin Einbettungen von Wölbungen und Satteln, ich fliege weg.
Unterm Spiegel regen sich Schatten von Fischen, schlank, schwarz und glatt.
»Poisson«, sagt der Beobachter leise.
Wo die Fische sind, zittert die Wasseroberfläche.
Seine Töchter, überlegt der Beobachter, schlafen sicher noch, aber seine Frau sitzt ebenso sicher schon am Frühstückstisch. Die erste Mahlzeit stellt die Energie bereit für den ganzen geschäftigen Tag. Manci wird’s nicht mögen, daß sie allein frühstücken muß. Sie redet gern viel und braucht auch dann, wenn sie mal nicht reden mag, immer Leute um sich. Ihn hat das nie gestört.
Grübeln
»Ich hab ’ne Theorie«, sagt David am achten Januar Neunzehnhundertvierundachtzig zu Paul, als sie beide wie üblich mit anderen am Fahrradrondell vor dem Theodor-Heuss-Gymnasium von Sonnenthal stehen und rauchen.
»Theorie zu was?«
»Warum du hier der Boß bist und ich nur dein Propagandachef, also – du bist der Politiker und ich nur der politische Intellektuelle bei unserem ganzen Marxismus hier. Du entscheidest, ich begründe, und …«
Paul schnickt eine aufgerauchte Kippe nah an Davids Gesicht vorbei, um ihn zu ermahnen, daß er diesen Teil kennt, das alles schon weiß. David streicht sich eine lange Haarsträhne aus dem Gesicht und sagt: »Es liegt nämlich am Schulweg. Der Schulweg zum Gymnasium hat das entschieden, wer von uns grübelt und wer nicht.«
»Ach.«
»Ja, paß auf: Ich muß morgens aus der Bühlmatt auf die Feldbergstraße und mich dann schon entscheiden, ob ich den Berg hoch an der Sporthalle vorbei auf die Roggenbachstraße will oder rechts vorbei am Grundstück von Christofs Eltern die Feldberg lang bis zur Himmelreichstraße. Die geh’ ich dann entweder hoch, oder die Roggenbach runter, bis ich auch auf der Himmelreich bin, und auf dem Weg kann ich in diverse Spiegel gucken, Ladenfenster und so, dann muß ich an der Wehrer Straße über diese lebensgefährliche Autoscheiße und in die Schlierbachstraße rein, die geh’ ich geradeaus lang, an den winzigen Kreuzungen mit der Goethestraße und dem Achtmüllerweg vorbei, dann bin ich da. Du? Du gehst bloß die Schwarzwaldstraße hoch an Sonjas Haus vorbei, die Hebbelstraße geradeaus, fertig. Du mußt wach sein, wenn du ankommst, dich dem Leben stellen, wie wir alle, und hast wenig Zeit, dich selber aufzuwecken. Ich kann beim Latschen ausschlafen, träumen und grübeln. Mich im Spiegel anschauen. So ist das gekommen.«
»Quatsch«, sagt Paul, sieht aber amüsiert aus und geschmeichelt.
Bei den Menschen (beruflich)
Der Beobachter blickt nach oben: Das ist der Nachteil am Tageslicht, daß man die Sterne nicht mehr sehen kann, obwohl man weiß, da sind sie überall.
Ein schwarzer katholischer Priester geht neben einer alten, weißhaarigen Frau zu einer der grüngestrichenen Bänke am Uferhang. Der Priester ist um die dreißig Jahre alt. Er stützt die Frau und tätschelt ihr ein bißchen zu väterlich den Arm. Denn die Menschen, denkt der Beobachter, meinen es ja andauernd nur gut.
Nicht seiner Haltung nach, wohl aber wegen der Kleidung, ein wenig auch wegen des Gesichts, erinnert der Priester den Beobachter an den Abbé Lemaître.
Strahlende Theologenaugen – ganz anders als die beiden unruhigen Flammen in Oppenheimers Wolfsgesicht. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen denen, die, wie Oppenheimer, ihren Gott noch suchen, lebenslang, wenn nötig, und denen, die ihn, wie Lemaître, schon gefunden haben, oder von ihm gefunden worden sind: Die einen gucken, um zu sehen, die andern sehen eher selber nach was aus, beim Schauen.
Im April Neunzehnhundertdreiunddreißig war das, in diesem Jahr, über das ich mich heute noch wundere.
Wie viele Nukleonen gibt es im ganzen Weltall? Der Abbé war’s, der mich ursprünglich auf diese Frage gebracht hat. Jahrmarktsspiel: Wie viele Münzen sind in diesem Glas?
Es war kein Spiel für Lemaître, nicht für Eddington und Milne, auch für den armen Gamow nicht. Der Abbé hat uns damals einen schönen Floh ins Ohr gesetzt, mit seiner wunderbaren »Ursprungshypothese«. Urknall, sagen sie heute. Das kosmische Ei, aus dem alles geschlüpft ist. War ich eigentlich selber dabei, damals im Kapitza-Club, bei diesem Treffen? War ich überhaupt in Cambridge? Ich weiß es nicht mehr.
Was hat man gesehen und gehört, was nur gelesen? Und ist das Gelesene nicht sogar wahrer, weil es abstrakter gewußt wird? Wenn ich auch vielleicht wirklich nicht dabei war, kann ich mir’s doch sehr gut vorstellen: die aufmerksamen Leute in dem kleinen wohlriechenden Raum, Lemaîtres geübt profunde Predigerstimme, voll und warm: »Nun, ein unendlich dichter Punkt, nehme ich an. Hieraus emaniert das Weltall, hieraus entfaltet sich alles, im Anfang, wie wir in meinem andern Fach sagen. Und Sie verzeihen, aber exakter kann man nicht davon sprechen: Es war wirklich finster auf der Tiefe.«
Der junge Priester tätschelt immer noch den Arm der greisen Frau.
Beide haben sich hingesetzt, die Alte erträgt alles geduldig, vielleicht auch geschmeichelt. Der arme Kerl tätschelt seine Angst vor dem Tod weg, denkt der Beobachter.
Wie es eben ist, wie es eben kommen mußte: Inzwischen sind so viele von uns nicht mehr am Leben. Lemaître selber, Milne, der arme Gamow auch nicht mehr.
Ich selber? Ich kehre immer wieder zu den offenen Fragen aus der besten Zeit zurück, die wir hatten, zur Quantenelektrodynamik, auch zur Kosmologie. Kleine Fragen und große: alle sind wichtig, die wir noch nicht beantworten können. Lange vor der Sache mit den Quanten habe ich den Ort betreten, an dem sie entschieden werden, mit der Arbeit über Sternatmosphären – der gute Lehrer Milne hat mir diese Tür geöffnet. Später habe ich immer wieder versucht, Kleines und Großes aufeinander zu beziehen: Quanten auf das Alter des Alls und die Anzahl der Nukleonen darin …
Zehn hoch achtzig …
Das einzige, was gegen die Versuchung hilft, Wichtiges durch Raten erwischen zu wollen, sind präzise formale Einfälle. Die queer numbers, die neuen Schreibweisen. Alles hängt an einem Komma oder einer Klammer. Mutter hat immer gesagt: Erst denken, dann schreiben.
Aber manchmal, in guten Zeiten, denkt das, was man schreibt, für einen mit.
Die Mathematik hat mich zum Denken benutzt, durch mich hindurch sind ihre Einsichten zur Welt gekommen. Pauli hat drüber gespottet: »Der Mann verkündet Naturgesetze wie vom Berge Sinai – fabelhafte Mathematik, eine runde Sache, aber das ist doch keine Physik mehr.«
Pauli: leider auch schon tot.
Der Schatten des Beobachters auf dem stoppelkurzen Gras ist leicht geknickt, weil der Boden sich hier eine Welle erlaubt, als wäre er Wasser. Der Beobachter steht zwischen einer Lebenseiche und zwei Königspalmen. Drüben, zweihundert Meter nördlich, wachsen noch mehr von diesen Palmen, immer paarweise einträchtig nebeneinander. Hab’s mit Gartenarbeit versucht, methodisch und logisch, hat nie funktioniert. Manci hat mich ausgelacht: »Kein grüner Daumen, hilfloser Mann.«
Was zum Teufel hat ein verdammter Daumen damit zu tun? Immer muß alles vermenschlicht werden, die sachlichsten Probleme, kein Wunder, daß die Welt nicht weiterkommt.
Andererseits, wie sagte der Große: »Mir hat es eigentlich immer sehr geholfen, alles zu vermenschlichen. Ich habe mir immer vorzustellen versucht, wie es ist, wenn man diese Dinge selber erlebt, die wir untersuchen. Das EPR-Papier, das Äquivalenzprinzip, diese ganzen Ideen sind so entstanden. Sogar das Photon habe ich versucht, mir als etwas mit Bewußtsein vorzustellen. Was erlebt, was sieht ein Photon – verstehen Sie?«
Nein, das hat der Beobachter nicht verstanden. Wann war das, diese Unterhaltung?
Princeton Vierunddreißig, als ich Manci kennenlernte? War Eugene auch dabei, bei dem Gespräch?
Ich habe den Großen selten bei seinen Feldzügen begleitet, ihn nicht recht öffentlich unterstützt, aber wenn man’s genau nimmt, waren wir nicht so weit auseinander – er hat sich der Kopenhagener Deutung ebenso widersetzt wie ich mich jetzt weigere, diesen ganzen modernen Renormierungs-Schund anzuerkennen.
Aus einem Kofferradio am Rand eines Pärchenpicknicks gibt eine angestrengte Kopfstimme das Unvermeidliche von sich: »Call me, call me any, any time.«
Der letzte dünne Nebelrest, unscharfer cremiger Schleier, zergeht überm Lake Bradford; Vogelschreie wie schroff angestrichene Geigensaiten fallen über die gedämpften kleinen Plastiktrompeten quarrender Frösche her, die Banjomelodie im Schilf zergeht.
In jüngeren Jahren bin ich auf Berge geklettert, hab’ lange Fußmärsche bewältigt, bei denen nicht nur Manci außer Atem kam. Ich höre Werner noch nach Luft schnappen und rufen: »Um Himmelswillen, jetzt bleiben Sie doch mal stehen!«
Dabei ist er selbst Pfadfinder gewesen, ein Kletterkönig im Harzgebirge und weißgottwo.
Eine Menge Natur und Elementenaufruhr haben wir zusammen gesehen: riesige Wellen ums zerbrechliche Schiff, Neunzehnhundertneunundzwanzig, gewaltige Brecher, grüne Gewitter, knochenweiße Blitze.
»Jetzt nehmen Sie sich halt mal ein nettes Mädchen und tanzen ein bißchen. So viele nette Mädchen gibt’s hier an Bord, aus den besten Familien, da kann man doch nicht widerstehen! Tanzen Sie! Tun Sie mit!«
Mir ist fast der Kragen geplatzt, aber dann habe ich mich bezwungen und mit dem, was mein Vater mir als »schneidende Höflichkeit« beigebracht hat, möglichst kühl erwidert: »Ich frage Sie, Heisenberg: Woher wissen Sie im voraus, welche Mädchen nett sind? Sie kennen sie doch überhaupt nicht.«
»Um Himmelswillen, Dirac . .. meine Güte.«
Das war alles gewesen. Keine richtige Antwort, nur dieser Stoßseufzer, und das Augenverdrehen.
Via Deutschland
Keine fünfhundert Meter weit weg von da, wo der Beobachter mit der Zunge schnalzt, um die nirgendwo hinführenden Erinnerungen zu verscheuchen, steht eine Beobachterin.
Die Frau ist längst noch nicht alt, aber auch kein junges Mädchen mehr.
Sie hat goldblonde Haare, die sind glatt und hinterm Kopf zum Zopf zusammengebunden. Hohe Wangenknochen, kleine Nase: eine echte Schönheit, trotz dem etwas zu dicken Hals und den ziemlich schmalen Lippen. Sie trägt ein hellblaues T-Shirt, bunte Shorts und flaschenglasbraune Gummisandalen. Sie kommt von ganz woanders, hat Zwischenstop in Deutschland eingelegt, wo sie sich umgesehen hat, weil sie mit diesem Land viel verbindet, dann ist sie nach Frankfurt gefahren und von dort aus mit dem Flugzeug weitergereist nach Florida.
Anders als die meisten Touristen und Geschäftsreisenden an Bord der Lufthansa-Maschine hat sie während der langen, stillen Stunden des Transatlantikflugs nicht in Romanen, Zeitschriften, Zeitungen oder Reiseführern gelesen, sondern einen kleinen Aufsatz aus der deutschen Zeitschrift »Die Naturwissenschaften« studiert, den der Beobachter dort vor fast zehn Jahren, Neunzehnhundertdreiundsiebzig, unter dem Titel »New Ideas of Space and Time« auf englisch veröffentlicht hat.
Wenn sie nicht diesen Aufsatz las, hat sie sich die Zeit mit ein paar Übungen in ihrem kleinen gelben Notizbuch vertrieben: Hamilton-Operatoren für die Zeitentwicklung eines Teilchens mit einem Freiheitsgrad unter Potentialeinfluß nach der Schrödinger-Gleichung, selbstadjungierte Operatoren im Hilbert-Raum, Störungssätze.
Würde der Beobachter dieses Notizbuch durchblättern, dann könnte ihn von dessen Seiten ein Gesicht ansehen, das ihm vertraut ist.
Die Beobachterin ist dem Grund ihrer Anwesenheit jetzt sehr nahe.
Sie blickt durch die Doppellinsen eines kleinen Zeiss-Opernglases auf den alten Mann, der immer noch mit blinzelnden Augen am Ufer steht und langsam ein- und ausatmet.
Sie ist müde, in der Nacht zuvor hat sie nicht geschlafen.
Gestern abend erst haben ihre Nachforschungen ergeben, daß der Alte sich mit einer nicht allzu kleinen positiven Wahrscheinlichkeit heute morgen hier an diesem Seeufer einfinden würde. Es ist alles richtig; es passiert immer das, was passieren soll.
Die Frau nimmt ein kleines schwarzes Diktiergerät (japanisches Fabrikat) aus ihrer Kunstleder-Umhängetasche, führt es zum Mund, drückt mit dem Daumen die Aufnahmetaste und spricht aufs Band: »Ich hab’ ihn gefunden, er steht bloß einen Steinwurf weit weg von mir, wirkt leicht eingefallen, müde. Und wie ich erwartet hatte: sehr alt. Aber die Körperhaltung, die ist trotzdem königlich – er weiß wohl, wer er ist.«
Der Beobachter hört Stimmen.
Das beunruhigt ihn nicht: Die meisten Menschen hören solche Stimmen vor dem Einschlafen oder beim Aufwachen, vielleicht, mutmaßt er, gehören sie wie zum täglichen so auch zum Lebensabend. Wraiths. Gespenster der letzten Tage, das heißt: der letzten Woche, die eben erst vergangen ist:
»Was denkst du, Dad, warum ziehen die Menschen überhaupt zusammen in gemeinsame Wohnungen, gemeinsame Häuser? Männer und Frauen, meine ich? Warum verbringen sie ihr Leben zusammen? Der reine Fortpflanzungsinstinkt kann es ja wohl nicht sein. Es passiert ja sogar Homosexuellen.«
»Ich weiß es nicht.«
»Natürlich weißt du’s nicht. Niemand weiß es.«
»Ah.«
»Manchmal … ich weiß, du kannst das nicht glauben, aber manchmal stellt man Fragen nicht, weil man unbedingt gleich eine Antwort hören will, verstehst du?«
»Wozu dann?«
»Um … oh je … ach Gott, ich meine … weil man halt drüber reden will, nicht?«
Der Beobachter schüttelt den Kopf.
Die Stimme der Tochter schweigt.
Eine Frage stellen, weil man reden will?
Dieses ganze verzettelte Sichäußern – und wie oft beleidigen die Leute damit einander, meistens unabsichtlich, und wenn ihnen dann das Blut in den Schläfen pocht, der Hals im Kragen anschwillt, die lebenslange Wut sich meldet, die fast alle im eisernen Griff hat, so daß sie sich jederzeit aus den kleinlichsten Anlässen zurückgesetzt fühlen, nicht geliebt, ausgebootet, verlacht, mißverstanden, und immer wird geredet und geredet, dann ist der Schaden groß, dann tut es allen leid, und damit fängt auch schon die nächste Runde an.
Erst denken, dann schreiben? Schriftlich sieht’s auch kaum besser aus: Wenn man wirklich nur veröffentlichen würde, was man sicher weiß, wenn man nicht von Angst und Ehrgeiz angetrieben würde, sähe die Bilanz bestimmt besser aus. »Nature«, »Science«, »Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion«, »Journal of the London Mathematical Society«, »Communications of the Dublin Institute for Advanced Studies«, und unser aller Mutter: »Proceedings of the Royal Society« – reprints, preprints, viel zu oft fauler Zauber, Herausgeber, Gremien, Schreiben, nur damit man gedruckt wird, vielstimmige Unordnung, ein nicht zu ordnendes Chaos.
Statt daß es auf der ganzen Welt einfach nur einen verbindlichen Ort gäbe, wohleingerichtet, zwischen zwei Buchdeckelnam besten, wo Platz für nichts anderes ist als schöne Mathematik, und ein Ende der Spielchen ums Primat irgendeiner läppischen Entdeckung.
Wird es eigentlich immer schlimmer damit, stimmt das?
Haben das damals die Alten nicht auch gedacht? Fowler war nicht entzückt, daß ich kein Interesse an Experimenten hatte. Er dachte, weil ich doch vom Ingenieurswesen herkam, müßte ich eigentlich ganz wild drauf sein.
Diese Studenten heute, die auftreten, als wären sie Newton persönlich, weil sie müssen, weil ihnen sonst niemand Gehör schenkt, das abgeschmackte Auftrumpfen überall, dieser Gestus, einfach abstoßend. Selbst ein ständig unter Druck stehender Hansdampf wie Werner hätte den Mund nie so voll genommen, und wenn Pauli zuschlug, bei Debatten, dann war das immer der Sache wegen: weil er etwas nicht glaubte, weil ihm etwas faul vorkam, wie oft genug bei meinen Theorien – aber eben nicht, weil er der große Wolfgang Pauli war.
Vielleicht sitzt er jetzt wirklich im Himmel, wie in diesem Witz, den der kleine Tscheche in Coral Gables erzählt hat: Pauli tritt vor Gott und fragt, warum ist die Feinstrukturkonstante gerade 1/137? Und Gott fängt an, die Sache zu erklären, schreibt Gleichungen an eine Tafel. Da schüttelt Pauli den Kopf: Nein nein, so geht das nicht …
Zwei Silberreiher, dicht überm Wasser, schlagen harmonisch mit den Flügeln, gewinnen Höhe. Ihre Hälse haben die Farbe der Sterne; sie schreien nicht, gleiten nur immer aufwärts in großzügigen Bögen, wenden sich dann nach Osten und verschwinden über den hohen Nadelbäumen am nordwestlichen Saum des Apalachicola-Waldes.
»Professor Dirac?«