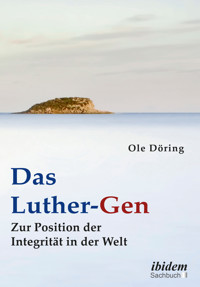6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
null
Das E-Book Diskriminierung: zur Rehabilitierung eines Grundbegriffes der Aufklärung. wird angeboten von Duncker & Humblot und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
[225]
Jahrbuch Wissenschaftsfreiheit, 1 (2024): 225 – 255https://doi.org/10.3790/jwf.2024.1431801
Diskriminierung: zur Rehabilitierung eines Grundbegriffes der Aufklärung
Von Ole Döring*, Carola Freiin von Villiez** und Tobias Reichardt***
I. Einleitung
Der Begriff der Diskriminierung ist in aller Munde, scheint aber angesichts seines nahezu inflationären Gebrauchs in der öffentlichen Debatte seine begriffliche Schärfe und damit argumentative Aussagekraft eingebüßt zu haben. Dies soll hier anhand einer kritischen Auseinandersetzung mit einem ideologischen und zu pauschalen Gebrauch in Politik und Philosophie, Theorie und Praxis exemplarisch aufgezeigt werden. Im Zuge einer Unterscheidung verschiedener alltagssprachlicher, fachlicher und moralischer Verwendungsweisen soll das ihm innewohnende Potential zur problematischen Differenzierung sowie auch deren vernünftige Einordnung verständlich gemacht und so eine Aussicht auf normative und inhaltliche Klärung der Debatten um die Relevanz des Begriffs der Diskriminierung angeboten werden. Mithilfe seiner Analyse im Kontext weiterer relevanter Begriffe, die in diesem Zusammenhang häufig – dabei oftmals in strategischer Absicht – ins Spiel gebracht werden, soll (gleichwohl ohne Vollständigkeitsanspruch und unter Beschränkung auf begriffliche Grundlagen) seine systematische Funktionsfähigkeit, argumentative Aussagekraft und methodologische Relevanz rehabilitiert werden.
II. Worum geht es?
Bei Diskriminierung im Sinne des deutschen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes von 2006 geht es (§ 1) um „Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion [226] oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität“. Die Autoren einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes stellen einleitend klar: „diese ‚Gründe‘ markieren nicht Unterschiede, Differenz oder Diversität, sondern benennen Lebensrealitäten als Diskriminierungserfahrungen.“1 Damit trennen die Autoren sehr strikt zwischen objektiven Unterschieden, die offenbar als irrelevant abgetan werden, und Diskriminierungserfahrungen. Diese Differenzierung zwischen Gründen und Erfahrungen ermöglicht eine rationale Auseinandersetzung über berechtigte Ansprüche, begründete Wahrnehmung und gesellschaftliche Normierung, mit deren Hilfe natürliche und gemachte Unterschiede, Selbsterfahrung, Selbst-und Fremdbestimmung im Sinne der Menschenwürde sortiert und von Zuschreibungen ebenso wie von normativen Kurzschlüssen befreit werden können.
Etymologisch leitet sich diskriminieren vom lateinischen discernere her. Discernere enthält eine zweifache Disjunktion, einmal dis- also Gesondertes, von etwas anderem Separiertes, und einmal -cernere also etwas Besonderes, für sich Eigenartiges. Hier liegt die Verschränkung von Unterscheiden und Urteilen vor.
Das Problem der Diskriminierung geht an die sprachlichen, logischen und ontologischen Grenzen unseres menschlichen Denkens und Selbstverstehens. Die Thematik des rechten Unterscheidens ist nicht erst eine politische, soziale oder psychologische und beginnt auch nicht erst mit der wissenschaftlichen Methodik. Sie ist eine klassisch philosophische, in der sich, mit der Aufklärung, die prominente Position Kants und die wirkmächtige Diskussion der deutschen Frühromantik begegnen: weshalb „Hölderlin und Novalis die Urteilung bald in semantischen, bald in erkenntnistheoretischen Begriffen artikulieren“2, wir also hier die Wurzel einer echten fundamentalen Doppeldeutigkeit von Sein und Identität haben, die einander konstituieren, indem sie jeweils über sich und über einander hinausweisen. Man kann diese unvermeidliche konzeptuelle Spannung bis zum Skandal dramatisieren oder mit selbstironischem Humor behandeln. „Die ironische Rede [der Frühromantiker Hölderlin, Reinhold und insbesondere Novalis um 1790] hält den undarstellbaren Ort des Unendlichen offen, indem sie das Endliche permanent als das nicht Gemeinte diskreditiert.“3
[227]
Zweihundert Jahre später erscheint die Erinnerung an die urteilsbildende Semantik des „Diskriminierens“ angebracht. Mit dem Fortschritt biologischer und biotechnischer Kompetenz geht seit dem 19. Jahrhundert die Forderung einher, die entsprechenden naheliegenden Missverständnisse aufzuklären, die kategorialen Fehlurteilen zugrunde liegen. Diese sortieren sich typischer Weise in Varianten des naturalistischen Fehlschlusses – also von Aussagen, die unvermittelt von deskriptiven Aneignungen von Wissen auf präskriptive Zuschreibung von Qualitäten übergehen. Dabei liegt nicht nur ein logischer Fehler vor (vom Sein aufs Sollen), sondern auch ein praktischer. So entstehen jeweils zwei ganz unterschiedliche Fälle des zu-und absprechenden falschen Unterscheidens. Die negative Diskriminierung deskriptiver Art fasst Gegenstände zusammen, die sich aufgrund ihrer Andersartigkeit spezifisch von anderen unterscheiden (Obst ist kein Säugetier), negative Diskriminierung präskriptiver Art unterscheidet diese aufgrund einer normativen Subsumtion (Obst ist mehr wert als ein Säugetier), unabhängig davon, ob man dem Werturteil oder der Beschreibung der Sachverhalte zustimmt.
Die positive Diskriminierung beruht auf einem zusätzlichen Urteilsschritt, der eine spezifische Distinktion konstituiert. In deskriptiver Art fasst sie Gegenstände zusammen, die sich aufgrund ihrer Eigenart spezifisch von anderen unterscheiden (Äpfel und Birnen sind als Obst etwas anderes als Menschen und Wale als Säugetiere), positive Diskriminierung präskriptiver Art unterscheidet aufgrund einer normativen Subsumtion (Obst ist mehr wert als Säugetiere), unabhängig davon ob man dem Werturteil oder der Beschreibung der Sachverhalte zustimmt.
Hier gilt es, die Klassifikation besonders gut zu begründen bzw. kritisch zu prüfen, wenn entsprechende Aussagen einen Erkenntniswert behaupten. Die besonders im Englischen gebräuchliche Rede von „positiver Diskriminierung“ („affirmative action“) zum vermeintlichen Ausgleich von unmoralischen, oft als „strukturell“ beschriebenen Diskriminierungstatbeständen ist in diesem Sinne besonders erklärungspflichtig. Sie erinnert eher an die vor-aufklärerische Metaphysik des Talions-bzw. Retaliations-Prinzips zum Ausgleich einer durch „Schlechtes“ verursachten Störung des Gleichgewichts der Schöpfung als an einen Ausdruck vernünftigen Urteilens. Urteile, besonders solche, die positiv oder negativ unterscheiden, ob deskriptiv oder praktisch, müssen sowohl ihre Heuristik als auch ihre Normativität ausweisen können. Andernfalls disqualifizieren sie sich selbst als unseriös.