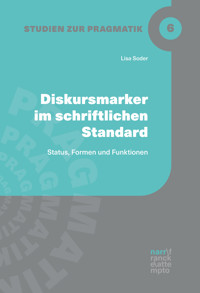
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Studien zur Pragmatik
- Sprache: Deutsch
Dieser Band behandelt einen der spannendsten Gegenstände im Bereich der linguistischen Pragmatik: die sogenannten Diskursmarker, die bisher nur als typisch mündliches Phänomen diskutiert werden und zu denen es nur wenig konkrete empirische Forschung gibt. In theoretischer Hinsicht geht es um eine Schärfung des Verständnisses dessen, was man unter Diskursmarker sinnvollerweise fassen kann. Nach einer integrativ gehaltenen Systematisierung der bisherigen Forschung wird ein begriffliches Modell entwickelt, das der empirischen Datenerhebung zugrundegelegt wird. Im Zentrum der empirischen Untersuchung steht die Erfassung des Formen- und Funktionenspektrums von Diskursmarkern im geschriebensprachlichen Standarddeutsch sowie die Aufdeckung medialitäts- und konzeptionalitätsübergreifender Eigenschaften, aber auch spezifisch schriftlicher Phänomene.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 909
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[1]Diskursmarker im schriftlichen Standard
Herausgegeben von
Prof. Dr. Eva Eckkrammer (Mannheim)
Prof. Dr. Claus Ehrhardt (Urbino/Italien)
Prof. Dr. Anita Fetzer (Augsburg)
Prof. Dr. Rita Finkbeiner (Mainz)
Prof. Dr. Frank Liedtke (Leipzig)
Prof. Dr. Konstanze Marx (Greifswald)
Prof. Dr. Sven Staffeldt (Halle)
Prof. Dr. Verena Thaler (Innsbruck)
Die Bände der Reihe werden einem single-blind Peer-Review-Verfahren unterzogen.
Bd. 6
Lisa Soder
[3]Diskursmarker im schriftlichen Standard
Status, Formen und Funktionen
[4]Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
DOI: https://www.doi.org/10.24053/9783381102723
© 2023 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Satz: typoscript GmbH, WalddorfhäslachCPI books GmbH, Leck
ISSN 2628-4308ISBN 978-3-381-10271-6 (Print)ISBN 978-3-381-10272-3 (ePDF)ISBN 978-3-381-10273-0 (ePub)
[5]Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Vorwort
1
Einleitung
1.1
Gegenstand und Ziel
1.2
Wegweiser durch die Arbeit
2
Theoretische Vorüberlegungen
2.1
Zur Diskursmarkerforschung
2.1.1
Diskursbegriff und Diskursmarkerkonzeptionen
2.1.2
Primär funktional orientierte Ansätze
2.1.3
Primär formal orientierte Ansätze
2.1.4
Neuere Ansätze
2.2
Externe und interne Form-Funktionszusammenhänge
2.2.1
Diskursmarker und Modalpartikeln: Zwei Seiten derselben Medaille?
2.2.2
Diskursmarker und die Links/Rechts-Peripherie-Hypothese
2.2.3
Zwischenfazit
2.2.4
Diskursmarker und Konnektoren – zwei Seiten derselben Medaille?
2.2.5
Zusammenfassung
2.3
Das Potenzial der Vagheit – Warum die Annahme einer eigenen Kategorie sinnvoll ist
2.3.1
Grund 1: Simultane Polyfunktionalität
2.3.2
Grund 2: Erhöhter Grad an diskursiver Reichweite und Multirelationalität
2.3.3
Grund 3: Amalgamierungen als Indiz für Dekategorisierungsprozesse
2.3.4
Bedingung 1: Medialitäts- und konzeptionalitätsübergreifender Gebrauch und medialitäts- und konzeptionalitätsunspezifische Funktionalität
2.3.5
Bedingung 2: Differenzierte Konzeption und begründete Gewichtung der Kriterien
2.4
Diskursmarker-Konzeption dieser Arbeit
2.4.1
Form (Syntax)
2.4.2
Funktion
2.4.3
Semantik
2.4.4
Skopus
2.4.5
Prosodie bzw. Interpunktion
2.4.6
Projektion
2.4.7
Position
2.4.8
Sequenzialität und Bezug
2.4.9
Morphologie
2.4.10
Variabilität
2.4.11
Bedeutungsgehalt
3
Diskursmarker im schriftlichen Standard – Formen und Funktionen
3.1
Thesenlage und Forschungsstand zur Medialität von Diskursmarkern
3.1.1
Thesenlage
3.1.2
Forschungslage zu Diskursmarkern im geschriebenen Deutsch
3.2
Zentrale Fragestellungen und Ziele der empirischen Untersuchungen
3.3
Methodisches
3.3.1
Begriffsverständnis – Schriftlicher Standard
3.3.2
Zum Korpus
3.3.3
Herangehensweise bei der Erfassung des Formenspektrums
3.3.4
Zur Typologisierung der Hauptfunktionen
3.4
Hauptfunktionen schriftlicher Diskursmarker
3.4.1
Beginneinleitungsmarker
3.4.2
Endeinleitungsmarker
3.4.3
Themenbeendigungsmarker
3.4.4
Digressionsmarker
3.4.5
Regressionsmarker
3.4.6
Progressionsmarker
3.4.7
Rekurrenzmarker
3.4.8
Themensplittingmarker
3.4.9
Konsensmarker
3.4.10
Dissensmarker
3.4.11
Reformulierungsmarker
3.4.12
Korrekturmarker
3.4.13
Kontrastmarker
3.4.14
Konklusionsmarker
3.4.15
Performanzmarker
3.5
Liste von schriftlichen Diskursmarkern mit dominierenden Funktionen
3.6
Zusammenhänge zwischen Spender- und Zielkategorie
3.7
Die Klasse der Korrekturmarker als Beispiel für die kategoriale Offenheit
3.8
Gibt es genuin schriftsprachliche Diskursmarker?
3.9
Zwischenfazit
3.9.1
Zur Statusfrage mit Blick auf die Medialität und Konzeptionalität
3.9.2
Zur Statusfrage mit Blick auf die Grammatik und Pragmatik
4
‚Interaktionale‘ Diskursmarker im ‚monologischen‘ Text
4.1
Methodisches
4.2
Das funktionale Spektrum der ‚interaktionalen‘ Klassiker
weil
,
obwohl
und
wobei
4.3
Zum Gebrauch der schriftlichen Diskursmarker
weil
,
obwohl
und
wobei
4.3.1
Funktionen von
weil
als schriftlicher Diskursmarker
4.3.2
Primärfunktionen der schriftlichen Diskursmarker
obwohl
und
wobei
4.3.3
Textuelle Funktionen von
obwohl
und
wobei
4.4
Funktionsbeschreibungen der ‚Gesprächspartikeln’
nun
,
nun ja
und
nun denn
4.5
Das funktionale Spektrum der schriftlichen Diskursmarker
nun
,
nun ja
und
nun denn
4.6
Diskursmarker und die ‚Sprache der Nähe‘
4.6.1
Diskursmarker zur Inszenierung eines informellen Duktus
4.6.2
Diskursmarker zur Inszenierung von Nähekommunikation
4.6.3
Resümee
4.7
Diskursmarker und Polyphonie
4.7.1
Bachtins Polyphoniekonzept
4.7.2
ScaPoLine (Nølke/Fløttum/Norén 2004) – ein Ansatz zur linguistischen Polyphonie
4.7.3
Diskursmarker zur Erzeugung und Indizierung von Polyphonie im Text
5
Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverszeichnis
Anhang – Diskursmarkerliste mit Beispielen
[9]Danksagung
Mein Dank gilt Prof. Dr. Wolf Peter Klein, der diese Arbeit betreut hat. Ich danke ihm für die wertvollen Ratschläge, die beständige Gesprächsbereitschaft, aber auch für den Freiraum, der mir gegeben wurde. Und ganz besonders danke ich ihm für das Vertrauen in mich, ein solches Vorhaben überhaupt anzugehen. Ohne Zweifel wäre mein Lebenslauf nach der Vollendung meines Studiums ein anderer gewesen.
Mein aufrichtiger Dank gilt auch den beiden anderen Mitgliedern meines Mentorats, Prof. Dr. Renata Szczepaniak und Prof. Dr. Sven Staffeldt, für die Bereitschaft, die Betreuung auch unter zeitlich knappen Bedingungen auf sich zu nehmen, und für ihre bedeutsamen Impulse in Gesprächen zur vorliegenden Arbeit. Zuletzt – und ganz besonders – danke ich meinen Eltern, meinen Geschwistern und Marieke.
Würzburg, Im August 2023Lisa Soder
[11]Vorwort
Sprachwissenschaftlich ist klar, dass die Beschreibung der deutschen Sprache mindestens in zweifacher Hinsicht differenziert werden muss: Es ist zwischen der Standardvarietät und anderen Varietäten des Deutschen zu unterscheiden, außerdem zwischen dem gesprochenen Deutsch und dem geschriebenen Deutsch. Das sind linguistische Binsenweisheiten, leichter Stoff für die ersten Semester jedes sprachwissenschaftlichen Studiums. Dass diese simplen Abgrenzungen aber nicht immer einfach zu greifen sind, weiß jeder, der sich empirisch, detailliert und ernsthaft der Erforschung der deutschen Sprache gewidmet hat. Das lässt sich verschärfen. Denn man könnte geradezu behaupten: Nur derjenige ist – ganz altmodisch gesprochen – dem Wesen der deutschen Sprache auf der Spur, der in den obigen Unterscheidungen vorübergehend verloren gegangen ist. Lexikalisch verdeutlicht: Gehört ein bestimmtes Wort nun zur Standardvarietät oder nicht? Ist es typisch mündlich oder typisch schriftlich? In solchen einfachen Fragen liegt von Fall zu Fall eine erhebliche Brisanz. Sie besitzt sicherlich gewisse labyrinthische Gehalte. Man kann sich eben darin verlieren. Ein einfacher Ausweg ist nicht in Sicht. Das gilt nicht nur lexikalisch, sondern auch für morphologische, syntaktische und pragmatische Themen. Besonders deutlich wird diese Brisanz vielleicht an dem Gegenstand dieses Buches, also den sog. Diskursmarkern: Welche Wörter gehören überhaupt dazu? Welche tragen einen standardsprachlichen Charakter, welche nicht? Welche gibt es nur im Mündlichen oder nur im Schriftlichen? Oder spielen solche Grenzziehungen bei den Diskursmarkern eher keine Rolle? Welche semantischen und pragmatischen Funktionspotenziale stecken hinter den Diskursmarkern? Wie kann man diese Problemkreise überhaupt einigermaßen systematisch und sprachwissenschaftlich ertragreich beleuchten?
Bei der Behandlung dieser schwierigen Fragen ist Lisa Soder nicht verloren gegangen, im Gegenteil. Mit bemerkenswerter Stringenz und beeindruckender Transparenz hat sie sich auf diesem weiten Feld einen innovativen Weg gebahnt. Das Ergebnis ist eine methodologisch glasklare, in hohem Maße terminologiebewusste Studie, hinter der die künftige Forschung zweifellos nicht mehr zurückfallen kann. Die Arbeit umfasst im Kern einen detailliert begründeten Vorschlag, mit welchen Operationalisierungen und empirischen Fundierungen man die oben genannten Fragen zu den Diskursmarkern substanziell beantworten und weiterdenken kann. Wie bei jeder wissenschaftlichen Analyse wären an bestimmten Punkten auch andere Abzweigungen denkbar gewesen. [12]Weil wir stets erfahren, warum Lisa Soder gerade den Weg gegangen ist, der im folgenden nachvollzogen werden kann, bietet uns dieses Buch aber zumindest einen sicheren Weg aus einem sprachlichen Labyrinth. Wer also mehr über den Status solcher Wörter wie allemal, egal, ferner, insofern, mithin, sowieso oder wenngleich wissen möchte, ist hier richtig. Ich wünsche eine interessante Lektüre. Viele Erkenntnisse zur deutschen Gegenwartssprache und ihrer realistischen Erforschung sind garantiert. Sowieso. Und allemal.
Wolf Peter Klein (Würzburg)
[13]1Einleitung
Es ist keineswegs nur der einzelne Lehrsatz, dem wir uns beugen, sondern es ist vor allem bedeutsam, daß uns überhaupt der Glaube an die Notwendigkeit der Regelung eingeflößt wird, daß wir unser Verständnis und die Empfindung für die Freiheit des sprachlichen Lebens verlieren (Behaghel 1927: 18).
Sprache befindet sich in einem steten Wandel. Nichts ist in Stein gemeißelt. Eine ermüdende Binsenweisheit und dennoch eine Tatsache, die manch einem missfällt. Während man in der Sprachwissenschaft Wandelphänomenen entspannt und mit interessierter Aufmerksamkeit begegnet, stehen Laien diesen – sollten Wandelphänomene ihnen überhaupt bewusst sein – eher skeptisch gegenüber. Manche Sprechergruppen versuchen, sich Sprachwandel sogar bewusst zu widersetzen. Nicht selten werden damit apokalyptische Tendenzen assoziiert. Schnell ist die Rede von „Sprachverfall“, dem „Niedergang der deutschen Sprache“ oder der „Zerstörung der deutschen Sprache“. Öffentlichen Aufregungen begegnet man seitens der Sprachwissenschaft – zu Recht – mit Gelassenheit, doch zuweilen auch mit Unverständnis und Überheblichkeit. Das wiederum zu Unrecht. Schließlich hat sie lange genug die Kommunikation zu interessierten Laien vernachlässigt und sie sprachpflegerischen Hobbylinguisten und Kolumnisten überlassen. Und was ihre Grammatikschreibung angeht … nun ja: Sie scheint tatsächlich wie in Stein gemeißelt. Begriffe, Regeln, Kategoriensysteme und Bewertungen von sprachlichen Varianten werden seit Jahrzehnten reproduziert. Vor dem Hintergrund, dass die Bereiche der sogenannten Kerngrammatik – Phonologie, Morphologie und Syntax – als weitgehend etabliert gelten und sich systematische Veränderungen dort vergleichsweise langsam vollziehen, ist dagegen zunächst nichts einzuwenden. Auffällig ist nur, dass sich die Grammatikschreibung in ihrer schriftzentrierten Tradition und allgemeinen Tradiermanier fast ausschließlich nach Kommunikationsformen einer extremen Distanzschriftlichkeit richtet. So blieben und bleiben historisch stabile Muster der spontanen Sprechsprache oft unsichtbar (vgl. Sandig 1973), was nicht nur ihre Diskriminierung weiterhin fördert, sondern angesichts der blinden Flecken auch zu einer verfälschten Wahrnehmung im öffentlichen (und manchmal auch im wissenschaftlichen) Diskurs [14]führen kann – etwa, was das Alter oder die Gründe für die Herausbildung einer bestimmten Konstruktion betrifft.
Ein solcher Diskriminierungskandidat ist das Phänomen, das in der Forschung als Diskursmarker bezeichnet wird. Im öffentlichen und/oder laienlinguistischen Diskurs erlangen (bisher) nur bestimmte Vertreter Prominenz, wie zum Beispiel die nebenordnende Konjunktion weil oder obwohl mit Hauptsatzstellung (weil/obwohl sie hat keinen Hunger). Solche Abweichungen von der bekannten und präskriptiven Norm werden von der Öffentlichkeit als Indikator für den Verlust des deutschen Nebensatzes gedeutet (vgl. Nübling et al.: 1). In den neunziger Jahren wurde deswegen sogar die Aktionsgemeinschaft ‚Rettet den Kausalsatz‘ ins Leben gerufen. Die mediale Aufregung um den vermeintlichen „Siegeszug des Hauptsatzes“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.11.2014) ist inzwischen abgeklungen. Doch im alltäglichen und schulischen Kontext werden derartige und verwandte syntaktische Muster immer noch als falsch beurteilt, verurteilt oder gar geahndet, um im nächsten Gespräch – ohne es zu bemerken – denselben ‚Fehler‘ zu begehen. Die germanistische Sprachwissenschaft vernachlässigte zunächst sprachgeschichtliche Aspekte und begann in den neunziger Jahren solche Konstruktionen als ein zeitgenössisches Phänomen des Mündlichen zu diskutieren. Inzwischen wissen wir, dass auch weitere Vertreter (ich mein, nur, wobei, obwohl) bereits für das 19. Jahrhundert oder gar frühere Jahrhunderte belegt sind (vgl. Freywald 2018, Imo 2010, 2016, 2017).
Neben weil gehören zu den berühmten Ausdrücken, die unter dem Stichwort ‚Herausbildung zum Diskursmarker‘ diskutiert werden, die Adverbien also und jedenfalls, die Nebensatzeinleiter obwohl und wobei, die Frageformeln weißt du? und ne? oder der Matrixsatz ich mein. In ihrer Funktion als Diskursmarker zeigen die Ausdrücke und ihr Verwendungskontext bestimmte Eigenschaften, die sie von der ‚kern‘-grammatischen Klasse ihrer morphologischen Dubletten unterscheiden lässt. Für eine erste Veranschaulichung sei ein vielzitiertes Beispiel von obwohl angeführt:
Als Subjunktion:
Sie isst, obwohl sie keinen Hunger hat.
Als Diskursmarker:
A:
brauchst du noch en KISSEN?
B:
hm. ne. das reicht (0.5) obWOHL (.) das isch DOCH unbequem. (zit.n. Günthner 1999a: 414)
Obwohl als Diskursmarker verliert seine konzessivtypische Funktion und übernimmt eine diskursive Korrekturfunktion. Formal erscheint es prosodisch und syntaktisch desintegriert und leitet nun einen Hauptsatz ein, der sich nicht mehr nur auf einen vorausgehenden Teilsatz bezieht, sondern auf den vorangehenden Redebeitrag.
[15]Auffällig ist, dass die Frage nach der Herausbildung, dem Status und der Gebrauchsnorm von sogenannten Diskursmarkern auch nach drei Jahrzehnten für geschriebene und für gesprochene Sprache in der Forschung von unterschiedlicher Brisanz ist. Während die Frage in der Schriftsprachenforschung geradezu ignoriert wurde, hat sich das Erkenntnisinteresse im Wesentlichen auf die gesprochene Sprache konzentriert. Zugegebenermaßen ist das nicht verwunderlich. Die Frage der Einheitenbildung gilt für die geschriebene Distanzsprache mit dem Verweis auf die Grammatikschreibung als weitgehend beantwortet. Die dominante grammatische Einheit ‚Satz‘ samt seiner Teileinheiten ist schließlich umfassend in den zahlreichen (Satz-)Grammatiken beschrieben. Ausdrücke, die – wie Diskursmarker – außerhalb des Satzrahmens stehen, fallen logischerweise aus der Betrachtung heraus. So ist bisher noch unklar, ob es sich bei solchen Phänomenen nur um vage gesprächsorganisierende Einheiten handelt oder sie gar als schematische textstrukturierende Konstruktionen zu begreifen sind, die einen Platz in der (Text-)Grammatikschreibung verdienen. Die vorliegende Arbeit will eine Brücke zwischen der gesprächsorientierten Diskursmarkerforschung und der Schriftlinguistik schlagen.
1.1Gegenstand und Ziel
Das sprachliche Phänomen, das man im deutschsprachigen Raum bevorzugt als Diskursmarker bezeichnet, wird bisher nur als typisch (oder sogar explizit) mündliches Phänomen diskutiert. Die wenigen Untersuchungen, die sich mit medial schriftlichen Diskursmarkern beschäftigen, basieren auf Texten sog. konzeptioneller Mündlichkeit bzw. auf schriftlichen Texten interaktionaler Kommunikation. Forschungen, basierend auf normgrammatischen Texten einer Distanzsprache, sind rar oder nehmen eine dezidiert textlinguistische Perspektive ein, ohne einen Bogen zur Diskursmarkerforschung zu spannen. An diesem Forschungsdesiderat setzt meine Arbeit an. Erstmals werden Diskursmarker aus einer rein schriftsprachlichen Perspektive beleuchtet und primär in Texten des schriftlichen Standards korpusgestützt aus einer synchron-gegenwartssprachlichen Perspektive untersucht. Eine nicht unproblematische Voraussetzung ist die Tatsache, dass selbst in der interaktional ausgerichteten Diskursmarkerforschung immer noch kein Konsens über die Terminologie, den Status sowie das Formen- und Funktionenspektrum herrscht. Ohne feste Anhaltspunkte zur Identifizierung von Diskursmarkern und zu deren Abgrenzbarkeit zu ähnlichen Kategorien wird die (empirische) Suche nach dem Phänomen sowie dessen Analyse nicht nur erschwert, sondern es fehlt auch die theoretische Basis, die einen Vergleich und die Untersuchung in schrift[16]lichen Kommunikationsgattungen erst möglich macht. Zudem zeigt bereits eine erste Sichtung der Forschungsarbeiten, dass die Schnittstellen zu benachbarten Kategorien je nach angesetzter Definition manchmal beträchtlich erscheinen. Ein erster Schritt dieser Arbeit besteht daher in der Auseinandersetzung und Evaluation der bisherigen Forschungsergebnisse zu gesprochensprachlichen Diskursmarkern, um die erste – allgemeine – Forschungsfrage zu beantworten:
F1
Warum und unter welchen Umständen ist die Annahme einer eigenen Kategorie Diskursmarker gerechtfertigt?
Auf der Basis der kritischen Auseinandersetzung und Neusortierung der bisherigen Thesen- und Forschungslage wird ein differenzierter Kriterienkatalog zur Definition und Identifizierung erarbeitet. Um die Erforschung des Phänomens in verschiedensten Kommunikationsformen zu ermöglichen und die Anwendung des Katalogs für andere Teildisziplinen (z.B. Text- und Diskurslinguistik) fruchtbar zu machen, wird er medialitätsübergreifend und theorieunabhängig konzipiert. Der Katalog bildet die theoretische Basis für empirische Untersuchungen, die der Beantwortung weiterer Fragestellungen dienen:
F2
Wie sieht das Formen- und Funktionenspektrum von Diskursmarkern im (normgrammatischen) Schriftlichen aus?
F3
Sind Diskursmarker nur als Einheiten einer ‚Grammatik der Interaktion‘ (vgl. Günthner 2017: 126) aufzufassen oder als medialitäts- und konzeptionalitätsübergreifende Phänomene?
F4
Liegt ihre Funktion im schriftlichen Gebrauch nur in der Simulation eines interaktionalen Duktus (vgl. Tagg 2012: 106) und der „Inszenierung unmittelbarer Nähekommunikation“ (Sandro 2012: 198)?
F5
Gibt es auch genuin schriftsprachliche Diskursmarker und spezifisch schriftsprachliche Funktionen? Wenn ja, wie konstituieren sich diese?
1.2Wegweiser durch die Arbeit
Diese Arbeit gliedert sich nach der Einleitung in zwei große Teile: einen primär theoretischen Teil, der Kapitel 2 umfasst und sich der Forschungsfrage (F1) widmet, und einen primär empirischen Teil, der die Kapitel 3 und 4 umfasst und der Beantwortung der übrigen Fragen dient. Kapitel 2.1 skizziert zunächst den terminologischen Wirrwarr um das diskutierte Phänomen und die verschiedenen Ansätze in der Forschung zu Diskursmarkern, wobei ein besonderer [17]Fokus darauf liegt, die generelle Problematik der Abgrenzbarkeit zu verwandten Kategorien anhand exemplarischer Beispiele zu veranschaulichen. Die in der Forschungslandschaft diskutierten Ausdrücke und diesbezügliche Erläuterungen zur konzeptionellen Herangehensweise lassen einen Mangel an einem syntaktisch-funktionalen Distributionsmuster erkennen. Daher geht Kapitel 2.2 näher auf die Schnittstellen zu Konnektoren und Modalpartikeln ein. Auf der Basis der vorangehenden Darstellungen wird in Kapitel 2.3 zur Diskussion gestellt, warum und unter welchen Umständen die Annahme einer eigenen Kategorie gerechtfertigt ist. Es folgt mit Kapitel 2.4 die Vorstellung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Diskursmarker-Konzeption, die sodann als theoretische Basis für die empirischen Untersuchungen in Kapitel 3 und 4 dient.
Mit Kapitel 3 beginnt die Auseinandersetzung mit schriftlichen Diskursmarkern. Nach einer Präsentation der bisherigen Thesen- und Forschungslage zur Verwendung im Geschriebenen und der Herausstellung diesbezüglicher Hypothesen und Desiderata in Kapitel 3.1 kommt es in Kapitel 3.2 zur Formulierung der davon abgeleiteten zentralen Fragestellungen und Ziele der empirischen Untersuchungen. Die empirischen Untersuchungen gliedern sich wiederum in zwei Teile, die jeweils verschiedene Fragestellungen fokussieren. Sie erfordern verschiedene methodische Herangehensweisen, die daher gesondert in Kapitel 3.3 bzw. 4.1 erläutert werden. Während sich Kapitel 3 primär auf die Erfassung des breiten Formen- und Funktionenspektrums von Diskursmarkern im Schriftlichen allgemein und speziell im schriftlichen Standard konzentriert, stellt Kapitel 4 Einzelanalysen zu einer Auswahl an Ausdrücken und deren Gebrauch im schriftlichen Standard vor.
Nach der Typologisierung der schriftlichen Funktionen und ihrer exemplarischen Erläuterung in Kapitel 3.4 präsentiert Kapitel 3.5 die Liste schriftlicher Diskursmarkerformen samt dominierender Hauptfunktionen, die auf der Basis der korpusgestützten Analysen ermittelt werden konnten. Im Anschluss erfolgt eine Ergebnisanalyse, die als eine Art Nebenschauplatz in dieser Arbeit zu betrachten ist. Zunächst werden Zusammenhänge zwischen Spender- und Zielkategorie diskutiert (Kapitel 3.6). Genauer gesagt geht es darum, tendenzielle Korrelationen zwischen semantischen und kategoriellen Ursprungsklassen und der Herausbildung zum Diskursmarker und der spezifischen Diskursfunktionen zu identifizieren. Exemplarisch wird die heterogene Klasse der Korrekturmarker als Beispiel für die kategoriale Offenheit diskursiver Zielfunktionen dargestellt (Kapitel 3.7). Kapitel 3.8 nähert sich der Frage nach der Existenz genuin und typisch schriftlicher Formen an. Das dritte Kapitel schließt mit einem Zwischenfazit zur Statusfrage mit Blick auf die Medialität und Konzeptionalität einerseits und zur Statusfrage mit Blick auf die Grammatik und Pragmatik andererseits (Kapitel 3.9).
[18]Kapitel 4 behandelt die Verwendung von Diskursmarkern, die mit einem hohen Grad an Interaktionalität assoziiert werden, und zwar unter Bedingungen kommunikativer Distanz, d.h. in Texten des schriftlichen Standards. Vorgestellt werden Ergebnisse zu korpusgestützten Untersuchungen zu einer Reihe von Einzelausdrücken. Es handelt sich einerseits um die vielrezipierten ‚interaktionalen‘ Klassiker wobei, obwohl und weil und andererseits um die in der Forschung kaum bzw. nicht berücksichtigten Diskursmarker und Diskursmarkerkombinationen nun, nun ja und nun denn. Im Vordergrund steht dort die Frage nach etwaigen textuellen und rhetorischen Funktionen (d.h. Forschungsfrage F4 und F5). Kapitel 5 schließlich bringt eine Zusammenfassung der wichtigsten Befunde und Schlussfolgerungen und endet in einem Ausblick für die Angewandten Sprachwissenschaften.
[19]2Theoretische Vorüberlegungen
Die fundamentale Voraussetzung für die Erforschung eines sprachlichen Phänomens in verschiedenen Kommunikationsformen ist das Wissen um seine Gestalt. Je intensiver man sich dem Forschungsdiskurs zum Phänomen, das man als Diskursmarker bezeichnet, widmet, desto deutlicher zeichnet sich ab, dass diese notwendige Basis nicht hinreichend gegeben ist. Welche Eigenschaften als definitorisch oder peripher assoziiert werden – und vor allem auch warum – bleibt meist im Unklaren. Konzeptuelle Grenzen zu anderen Kategorien können – wenn überhaupt – nur als unscharfe Ränder identifiziert werden. Auch die Tatsache, dass immer noch kein Konsens in der interaktional ausgerichteten Diskursmarkerforschung über die Terminologie, den Status, das Formen- und Funktionenspektrum herrscht, ist gerade aus methodischer Sicht nicht unproblematisch. Ohne feste Anhaltspunkte zur Identifizierung von Diskursmarkern und zu deren Abgrenzbarkeit zu verwandten Kategorien wird die empirische Suche nach dem Phänomen sowie dessen Analyse nicht nur erschwert, sie ist auch heuristisch fragwürdig. Erschwerend kommt hinzu, dass es Stimmen gibt, die überhaupt keinen Anlass sehen, das als Diskursmarker bezeichnete Phänomen als eigene Klasse abzugrenzen (z.B. Breindl et al. 2014: 1137, Ágel 2016: 89). Im Vordergrund steht daher zunächst die Frage, warum und unter welchen Umständen die Annahme einer eigenen Kategorie gerechtfertigt ist. So wird ein erster Schritt dieser Arbeit darin bestehen, die Unstimmigkeiten des Diskurses zu identifizieren und zu entwirren. Auf der Basis einer kritischen Auseinandersetzung, Evaluation und Neusortierung der bisherigen Forschungsergebnisse wird – unter bestimmten Voraussetzungen – für den eigenständigen Status argumentiert und ein differenzierter und medial unspezifischer Kriterienkatalog entwickelt. Er soll die Erforschung des Phänomens in verschiedensten Kommunikationsformen ermöglichen und findet in den empirischen Untersuchungen, die in den Folgekapiteln vorgestellt werden, seine Anwendung.
Anmerkung zur Terminologie: Mit dem Terminus Diskursmarker werden äußerst heterogene Ausdrücke bezeichnet. Einschlägige, in der Forschung dargelegte Beispiele solch heterogener Gebräuche müssen auch in diesem Kapitel exemplarisch präsentiert und diskutiert werden. Auch ich werde, aus praktischen Gründen, in diesem Zusammenhang die Bezeichnung Diskursmarker verwenden und insofern die Terminologie der Autoren übernehmen. Die mit der begrifflichen Verwendung ausgelöste existentielle Präsupposition soll [20]jedoch vorerst nicht gelten. Der Terminus ist als vorläufige Bezeichnung zu verstehen (sozusagen als ‚Diskursmarker in question‘) und bezieht sich auf derartige Phänomene nur so lange, bis es zur Vorstellung der hier erarbeiteten Konzeption kommt (Kapitel 2.4). Ab Kapitel 3 liegt der Bezeichnung Diskursmarker die hier angesetzte Konzeption zugrunde, die in Kapitel 2.4 vorgestellt wird.
Anmerkung zur Uneinheitlichkeit in der Quellenlage in Kapitel 2: Für die kommende Argumentation werden Belege aus verschieden kommunikativen Gattungen herangezogenen (informelles Gespräch, Zeitungsartikel, digitales Diskussionsforum). Da es in diesem Kapitel um Grundsatzfragen zu Diskursmarkern geht und deren elementare Operationen in verschiedenen kommunikativen Gattungen vergleichbar sind, wird der mediale wie konzeptionelle Unterschied der Gattungen hier außen vorgelassen.
2.1Zur Diskursmarkerforschung
Zu den sprachlichen Phänomenen, die im deutschsprachigen Raum bevorzugt als Diskursmarker bezeichnet werden, ist mittlerweile eine recht umfangreiche Literatur zu finden. Zwar hat sich in der deutschen wie internationalen Forschungsliteratur der Terminus Diskursmarker durchgesetzt, das Angebot an Bezeichnungen, die das dort diskutierte Phänomen berühren, bleibt dennoch erstaunlich breit. In der Vielfalt der verwendeten Termini entsteht der Verdacht, dass in vieler Hinsicht noch Klärungsbedarf besteht. Tatsächlich enthüllen bereits die Bezeichnungen, dass sich die Perspektive, die auf das Phänomen eingenommen wird, deutlich unterscheiden kann, was nicht unerhebliche Probleme bei der Identifizierung der infrage kommenden Diskursmarker nach sich zieht. Konkret deutet dabei die terminologische Varianz nicht nur auf einen fehlenden Konsens in Bezug auf den Status hin, sondern auch auf das Formen- und Funktionenspektrum sowie auf die Verortung und die Einsatzmöglichkeiten im Kommunikationszusammenhang.
Während die Benennungen Diskursmarker, Operator, Gliederungssignal, Diskurskonnektor und Parajunktor suggerieren, dass es sich um eine funktionale Kategorie handelt, verweisen die Begriffe Gliederungspartikel, Diskurspartikel, Parataktische Konjunktion und Parakonjunktion auf eine – wenn auch nicht einheitliche – Wortartenzugehörigkeit. Dagegen nehmen die Bezeichnungen Vor-Vorfeld-Ausdruck, Eröffnungssignal, Schlusssignal und Satzrandkonstruktion Bezug auf die formale Positionierung und stehen nicht nur hinsichtlich ihres Stellungsverhaltens in Opposition – nämlich initial vs. final –, sondern auch in Bezug auf ihre grammatiktheoretische Verortung – [21](topologisch-)satzgrammatisch vs. syntaktisch-deszendent und sequenziell-diskursgrammatisch. Des Weiteren werden morphologische Charakteristika terminologisch indiziert: Die Begriffe Dialogwort, Gesprächswort oder Diskurspartikel deuten darauf hin, dass es sich dabei um Einworteinheiten handelt, wohingegen bei den Termini Satzrandkonstruktion und Vor-Vorfeld-Ausdruck (auch) von Mehrworteinheiten auszugehen ist. Letztere lassen zudem eine primär formale Herangehensweise bei der Definition des Phänomens vermuten. Dagegen scheint bei den Begriffen Operator, booster, fumble oder Marker eine primär funktionale Perspektive im Vordergrund zu stehen. Und schließlich verweisen die Bezeichnungen text-connective-marker, Diskursmarker, Gesprächswort, Dialogwort und conversationalgreaser auf unterschiedliche Verwendungskontexte.
Terminus
Autoren (Auswahl)
Terminus
Autoren (Auswahl)
Booster
Beeching 2009, Hyland 1998b/2000
Nichtpropositionaler Konnektor
Pasch et al. 2003: 369
Conversational Greaser
Fillmore 1976
Operator
Fiehler et al. 2004
Dialogwort
Bochmann 1989
Parajunktor
Àgel 2016
Diskursmarker/discourse marker
Gohl/Günthner 1999, Günthner 1999, Günthner/Imo 2003, Fischer 2014, Fraser 1990, Imo 2007a,b/ 2017a, Lenk 1998, Mroczynski 2012, Schiffrin 1987
Parakonjunktion
Thim-Mabrey 1985, Glück/Sauer 1997
Diskurskonnektor/discourse connective
Kroon 1998, Pérennec 1995
Parataktische Konjunktion
Freywald 2018
Diskurspartikel
Aijmer 2002, Dammel 32010, Kehrein/Rabanus 2001, Kroon 1995, Schourup 1982
Pragmatischer Marker
Brinton 1996, Beeching 2016
Eröffnungs-/Schlusssignal
Schwitalla 1976, Duden-Grammatik 92016
Responsiv
Zifonun et al. 1997
Fumble
Edmondson 1981
Rückversicherungssignal
Duden 82009: 1216
[22]Gesprächswort
Burkhardt 1982
Satzrandkonstruktion
Imo 2007a: 63
Gliederungssignal
Gülich 1970, Koerfer 1979, Weinrich 32005, Pérennec 1995
Start-/Endsignal
Duden 82009: 1216
Gliederungspartikel
Métrich/Faucher 2009, Willkop 1988
text-connective-marker
Diewald 2013
Hedge
Hyland 1998a, Weatherall 2011, Schweineberger 2014
Textkonnektor
Pérennec 1995
Konnektivpartikel
Bührig 2007, Zifonun et al.1997, Eroms 2001
Verwaister Adverbkonnektor
Fahrländer 2013
conceptual theticals
Kaltenböck et al. 2011
vocal hiccups
Croucher 2004
Metakommunikativer Konnektor
Breindl et al. 2014
Vor-Vorfeldausdrücke
Thim-Mabrey 1988
Tab. 2.1: Terminologische Varianz
In Bezug auf verschiedene Bereiche spiegeln die teils widersprüchlichen Benennungen eben jenen Dissens wider, der in der Diskursmarker-Forschung zu beobachten ist. Denn auch nach 30-jähriger Forschung auf diesem Gebiet wird immer noch diskutiert und bleiben die Fragen unbeantwortet, ob Diskursmarker als Wortart oder als funktionale Kategorie aufzufassen sind, ob sie lediglich initial oder auch final oder sogar medial auftreten können, ob sich dabei die Positionsbeschränkung auf Sätze, Äußerungen oder Redezüge bezieht, ob sie als grammatische oder pragmatische Einheiten (bzw. grammatikalisierte oder pragmatikalisierte Einheiten) zu werten sind (vgl. Blühdorn et al. 2017a). Bezüglich der funktionalen Spannbreite herrscht ebenfalls Uneinigkeit und zur Frage, welches Spektrum an Ausrücken infrage kommt, findet man keine Antwort. Strittig und diskutiert, aber kaum untersucht ist außerdem die Frage, ob Diskursmarker als Einheiten einer Grammatik der gesprochenen Sprache aufzufassen sind oder als medialitätsübergreifende und – noch seltener – als konzeptionalitätsübergreifende Kategorie. Die Differenzen und Lücken im Forschungsdiskurs wurzeln nicht zuletzt darin, dass es an einer einheitlichen Definition mangelt. Es scheint, als formulierte jede Studie zu Diskursmarkern [23]ihre eigene Definition. Auf welche Kriterien zur Beschreibung und Identifizierung dabei zurückgegriffen wird, hängt jeweils davon ab, welcher Subklasse von Diskursmarkern sich eine Arbeit widmet oder ob von einer eher weiten oder eher engen Konzeption ausgegangen wird. Im folgenden Kapitel werden einschlägige Konzeptionen aus der Forschung vorgestellt.
2.1.1Diskursbegriff und Diskursmarkerkonzeptionen
Wie der Name bereits andeutet, entfalten Diskursmarker ihre funktionale Spannbreite im Diskurs selbst. Hierbei ist Diskurs nicht als ein Begriff im Rahmen einer diskursanalytischen Tradition im Anschluss an Foucaults Diskursbegriff zu verstehen, die sich zum Ziel setzt, hinter der Sprache liegende Wissensstrukturen und sprachliche Machtmechanismen aufzudecken. Stattdessen geht diese Arbeit von einem pragmatischen Begriffsverständnis von Diskurs aus, das in der angloamerikanischen Tradition der discourse analysis, einer Diskurslinguistik als Gesprächsforschung, anzusiedeln ist.1 Einen solchen Zugang wählt Schiffrin (1987), die ein Diskursmodell entwickelt, das insbesondere die Vielschichtigkeit und Verzahnung von evozierbarer Bedeutung im Diskurs berücksichtigt, die weit über den propositionalen Gehalt und die Satzgrenze hinausgeht:
If we attempt to analyze the structure (or syntax) of discourse without also analyzing the meaning that is conveyed (both semantic and pragmatic) or the action that is performed (the interactional force), and without also viewing such properties as joint accomplishments of both speaker and hearer, we may not get very far in understanding what quality (or qualities) distinguish discourse from a random collection of sentences, propositions, or actions (Schiffrin 1987: 20).
Es geht ihr im Grunde also darum, herauszufinden, was Diskurs – und damit meint sie kohärenten Diskurs – von einer einfachen Ansammlung von Sätzen, Propositionen und Sprechhandlungen unterscheidet. Dafür muss nicht nur die reine Struktur und propositionale Semantik von Sätzen analysiert werden, sondern auch die vermittelte pragmatische Bedeutung und das, was Sprecher und Hörer gemeinsam leisten, um Verstehen zu schaffen, um Kohärenz im [24]Diskurs herzustellen. Diskurs findet nach Ihrer Auffassung auf fünf verschiedenen Ebenen statt (s. Abbildung 2.1).
Abb. 2.1: A Discourse Model nach Schiffrin (1987: 25)
Die einzige traditionell-systemlinguistische Ebene von Schiffrins Diskursmodell stellt die Propositionale Ebene (ideational structure) dar, auf der die kontextunabhängige Bedeutung sprachlicher Einheiten anzusiedeln ist. Es geht dabei um propositional-semantische Bedeutung, die grammatische Struktur und die lexikalische Form von Äußerungen. Bei der Handlungsebene (action structure) dagegen wird die pragmatische Bedeutung von Einheiten relevant oder besser gesagt: die Handlungen, die durch sprachliche Äußerungen vollzogen werden. Die turn-Ebene (exchange structure) verkörpert eine weitere nicht-sprachliche Ebene, die sich auf das ‚Drankommen‘ und ‚Dransein‘ in der Interaktion bezieht, auf den Wechsel der Sprecher- und Hörerbeiträge. Im Vordergrund steht hierbei die Frage, wie solche turns2 funktionieren und wie sie abgewickelt werden. Die Hintergrundinformationsebene (information state) nimmt dagegen Bezug auf die kognitiven Fähigkeiten der Sprecher3 und Hörer, insbesondere auf die Organisation von Wissen und Metawissen4. Schließlich muss auch berücksichtigt werden, warum im Diskurs bestimmte Dinge ge[25]äußert werden oder eben nicht, wann und warum ein Sprecher davon ausgeht, dass etwas präsupponiert ist oder zum Weltwissen gehört, oder wann und warum er es für nötig hält, etwas zu erwähnen. Auch auf der Beziehungsmanagementebene (participation framework) spielen die Aktanten eine zentrale Rolle. Hier geht es jedoch weniger um ihre kognitiven Leistungen als um ihre sozialen. Denn in welcher Weise Sprecher und Hörer zu Propositionen, Handlungen und turns Bezug nehmen, hängt in einem großen Maße von der Beziehung ab, in der sie zueinander stehen.
Zurecht thematisiert Schiffrin (1987: 27) in diesem Zusammenhang, dass die Begriffe Sprecher und Hörer in ihrem Modell unterdifferenziert oder stark vereinfacht präsentiert sind und verweist auf Goffmans (1981) verschiedene Identitätsrollen, die rezipierende und produzierende Aktanten einnehmen können. Allerdings bleiben ihre Erläuterungen zum Diskursbegriff und den Diskursteilnehmern interaktional-mündlich ausgerichtet. Ihr Modell ist aber durchaus für sowohl dialogische als auch monologische schriftliche Kommunikationsräume geeignet. Schließlich werden auch durch schriftliche Äußerungen Handlungen vollzogen. Selbstverständlich muss auch in schriftlichen Texten die Rolle tatsächlicher und angenommener Hintergrundinformation beachtet werden. Zweifellos darf gerade bei dialogischer Schriftkommunikation die turn-Ebene nicht außer Acht gelassen werden. Und natürlich richtet auch der Produzent eines monologischen schriftlichen Textes diesen auf einen – wenn auch – impliziten Leser (vgl. Iser 21979) oder implizierten Leser (vgl. Genette 2009), den ich später lieber virtuellen Rezipienten nenne, aus (s. Kap. 4.6.2).
Da Schiffrins Diskursverständnis dem Kohärenzbegriff sehr nahe steht, nennt sie ihr Diskursmodell auch „model of coherence“ (Schiffrin 1987: 24). Kohärenz versteht sie dabei als „the outcome of joint efforts from interactions to integrate knowing, meaning, saying and doing“ (Schiffrin 1987: 29). Das Besondere an ihrem Ansatz ist, dass sie nicht wie die meisten (text-)linguistischen Schriften lediglich die Kohärenz zwischen Propositionen thematisiert, sondern dass sie sich bei der angesprochenen Verzahnung von Wissen, Bedeutung, Sagen und Handeln eben nicht auf eine einzige Ebene im Diskurs bezieht. Sie geht von einer Kompetenz der Sprachteilnehmer aus, alle Informationen, die auf den fünf kommunikativen Ebenen des von ihr entwickelten Diskursmodells evoziert werden, sinnvoll miteinander zu verknüpfen. An genau dieser Stelle werden Diskursmarker relevant, denn ihnen wird eine Schlüsselrolle bei der Verknüpfung dieser Ebenen zugesprochen: „It is this multifunctionality on different planes of discourse that helps to integrate the many different simultaneous processes underlying the construction of discourse, and thus helps to create coherence“ (Schiffrin 2001: 58). Somit ist auch schon eine erste zentrale Funktion angesprochen, die sich in einer Vielzahl der Diskursmarkerdefinitionen [26]anderer Autoren wiederfinden lässt: die Herstellung von Diskurskohärenz. Trotz eines Konsenses bezüglich dieser Funktion verrät schon der erste Blick auf den terminologischen Wirrwarr, dass es sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt, das sprachliche Phänomen kategorisch zu beschreiben. Grob lassen sich in der (internationalen) Forschungstradition zwei Ansätze ableiten und zusammenfassen: eine primär formal ausgerichtete Herangehensweise, bei der die syntaktische Desintegration als ausschlaggebendes Kriterium angesetzt wird, und eine primär funktionale Herangehensweise, bei der die Herstellung von Diskurskohärenz durch nicht-propositionales Operieren im Zentrum der Betrachtung steht. Im folgenden Kapitel werden die beiden Ansätze vorgestellt, wobei ein besonderer Fokus darauf liegt, deren Schwachstellen aufzuzeigen, da diese m.E. zu den bis heute strittigen Forschungsfragen führen.
2.1.2Primär funktional orientierte Ansätze
Zu den früheren funktionalen Ansätzen gehören beispielsweise die Arbeiten von Schiffrin (1987) und Brinton (1996) für das Englische, von Kroon (1995/1998) für das Lateinische oder von Fiehler et al. (2004) für das Deutsche, da bei ihnen funktionale Kriterien über formalen stehen. So beschreibt Schiffrin (1987: 31) Diskursmarker als „sequentially dependent elements which bracket units of talk“ und weist damit der sequentiellen, diskursorganisierenden Funktion hohes Gewicht zu. Auch für Kroon (1995) steht diese Eigenschaft im Mittelpunkt, wobei sie in besonderem Maße die relationale Funktion betont und damit ihre Bezeichnung discourse connective gegenüber discourse marker verteidigt (vgl. ebd. 36). Fiehler et al. (2004) vertreten eine ganz ähnliche Position. Sie wählen zwar nicht den Konnektorbegriff, sprechen aber von Operatoren, die sie als Teil einer zweigliedrigen Struktur, der Operator-Skopus-Struktur, betrachten, welche sich durch eine bestimmte relationale Funktion zwischen Operator und Skopus auszeichnet: Der Operator könne im Diskurs entweder nach vorn verweisen und eine Verstehensanweisung für die Folgeäußerung, den sog. Skopus, liefern. Oder die Relationierung sei rückwärts gerichtet und nehme dabei eine Gelenkfunktion5 ein (vgl. ebd. 243). Formale Stellungskriterien bleiben bei diesem Ansatz weniger relevant. Es wird davon ausgegangen, dass Operatoren nur einen mittleren syntaktischen Integrationsgrad haben (vgl. ebd. 286) und dass sie im prototypischen Fall zwar Initialstellung einnehmen – also vor ihrer Bezugsäußerung stehen –, aber auch in äußerungsmedialer oder -finaler Position auftreten können. Damit bilden Operatoren sowohl im Hinblick auf ihr Funktionenspektrum als auch auf ihr Formenspektrum eine recht [27]heterogene Klasse6. Brinton (1996) greift zur Bezeichnung pragmatic marker. Sie präzisiert die relativ allgemein gehaltene Auffassung (von Schiffrin) und stellt aber gleichzeitig ein sehr breit angelegtes Funktionenspektrum auf, das sich über alle kommunikativen Ebenen erstreckt. Zu den wichtigsten Funktionen zählt sie die Herstellung sequenzieller Bezüge, die Themenorganisation und die Einleitung von Reparaturen oder Korrekturen (action structure/ideational structure), das Anzeigen von turn-Übernahmen/-abgaben und sprachliche Markierungen, dass man das Rederecht behalten will (exchange structure), die Wahrung des Gesichts und die Erzeugung von Höflichkeit (participation framework). Mit dieser Beschreibung wird ein sehr weites Feld pragmatischer Funktionen umrissen, weswegen sich Brinton für den Begriff pragmatic marker ausspricht, ohne sich jedoch explizit gegen die Bezeichnung Diskursmarker zu positionieren: „While both the terms discourse and pragmatic are suitably broad, suggesting that the items denoted function on a level above the syntax of the individual clause, […] pragmatic better captures the range of functions filled by these items“ (Brinton 1996: 30). In der deutschen Forschungstradition wird dennoch vielfach an der Bezeichnung Diskursmarker festgehalten, auch wenn von einem Funktionenspektrum ausgegangen wird, das nicht nur die oben genannten Eigenschaften einschließt, sondern diese sogar um die Funktion der epistemischen Rahmung sowie der Markierung jeglicher metakommunikativer Kontextualisierungshinweise (neben der diskursiven Korrektur- oder Reparaturfunktion) erweitert (vgl. z.B. Gohl/Günthner 1999, Auer/Günthner 2003, Mroczinsky 2012, Helmer/Deppermann 2017). In allen Funktionen operieren Diskursmarker nicht auf propositionaler Ebene, sondern auf sogenannter „Diskursebene“7.
[28]Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich all diese Funktionen unter dem breit gefassten Kriterium Herstellung von Kohärenz subsumieren lassen. Oder umgekehrt: Diskursmarker schaffen gerade dadurch Kohärenz, indem sie metakommunikative Bezüge zwischen Äußerungen indizieren, Sprecherwechsel koordinieren, Themenwechsel und Themenrelationen in der Narration oder Argumentation markieren, epistemische Einstellungen anzeigen und dabei das Gesagte sowohl in Bezug auf das Hintergrundwissen als auch auf die interpersonale Beziehung der Diskursteilnehmer kontextualisieren. Problematisch an primär funktionalen Ansätzen ist, dass dieselben Aufgaben auch von anderen Kategorien geleistet werden. Dazu zählen beispielsweise Konjunktionaladverbien, Sprechaktadverbial(sätz)e oder Modalpartikeln (i.w.S.). Insbesondere betrifft dies die Korrekturfunktion, die epistemische Markierung und die metakommunikative Verknüpfungsfunktion. Im Folgenden werden einschlägige, in der Forschung diskutierte Diskursmarkergebräuche exemplarisch präsentiert, um die Problematik der funktionalen Überschneidung zu anderen Kategorien zu veranschaulichen.
2.1.2.1Funktion 1: Marker metakommunikativer Verknüpfung
In Zusammenhang mit Diskursmarkern wird in besonderem Maße das Schlagwort diskursstrukturierend und gesprächsorganisierend angeführt. Was genau darunter zu verstehen ist, wird nur selten von den Autoren expliziert. Entweder – so scheint es – werden darunter jegliche Funktionen, die im Zusammenhang mit Diskursmarkern thematisiert werden, subsumiert oder es wird damit auf die sequenzielle Funktion aufmerksam gemacht. Denn gerade indem Diskursmarker Diskurseinheiten verbinden, Äußerungs- bzw. Textsequenzen rahmen und sequenzielle Bezüge kennzeichnen, strukturieren sie (allgemein ausgedrückt) den Diskurs oder organisieren sie (speziell ausgedrückt) das Gespräch. Eine besondere Rolle spielt hierbei die metakommunikative Verknüpfungsfunktion oder anders formuliert: Diskursmarker „signal a comment specifying the type of sequential discourse relationship that holds between the current untterance – the utterance of which the discourse marker is a part – and the prior discourse“ (Fraser 988: 21–22). Diese Aufgabe leistet zum Beispiel das als Diskursmarker reanalysierte sprich (vgl. Kaiser 2016) im folgenden Gesprächsausschnitt:
[29](1)
01
diese tunnel ham eine sehr geringe ERDüberdeckung
02
von wenigen MEtern,
03
und wurden DAher in den jahren zwischen
04
neunzehnhundertzehn und za
05
neunzehnhundertZWANzig, (.)
06
in (.) OFfener bauweise erstEllt. (-)
07
SPRICH;
08
man hat einen GRAben gegrAben;
09
°h hat den TUNnel,
10
°h als geWÖLbe erstellt und hat_s wieder ZUgedeckt;
(zit.n. Kaiser 2016: 212, Bsp. 6)
Die imperativische Form des Verbs sprechen operiert hier nicht in ihrer ursprünglichen Funktion als Aufforderung, sondern fungiert als Reformulierungsmarker. Mit der Verwendung eines solchen Markers „weist ein Sprecher die Denotate der verknüpften Konnekte als identisch und in Bezug auf den Ausdruck verschieden aus“ (Breindl et al. 2014: 1141). Verknüpft wird demnach nicht propositional, sondern auf der Ebene der Ausdrucksform, d.h. metakommunikativ. Bezogen auf Schiffrins Diskursmodell, wird dadurch die pro[30]positionale Ebene mit der Handlungsebene verknüpft, indem Propositionen bzw. Sachverhalte assertiert werden und diese Propositionen als Sprechhandlungen in Relation gesetzt werden.
Abb. 2.2: Aktivierte Diskursebenen beim Reformulierungsmarker sprich
Sprich übernimmt dabei die Aufgabe, den Typus der sequenziellen Relation zwischen beiden Konnekten zu signalisieren und trägt damit zur Strukturierung der Informationspräsentation bei. Reformuliert wird in diesem Fall die Bezeichnung für das architektonische Vorgehen offene Bauweise in Z. 6 (=Konnekt 1). Der Skopus der alternativen Formulierung (=Konnekt 2) erstreckt sich jedoch weder über eine einzelne Satzkonstituente noch über eine Äußerung, sondern wird expandiert und umfasst eine ganze Äußerungssequenz: die durch sprich eingeleitete Explikation besteht aus insgesamt drei minimalen Kommunikationseinheiten, die formal durch drei Sätze repräsentiert werden (Z. 8–10). Da davon ausgegangen wird, dass Diskursmarker neben der lokalen auch eine globale Kohärenz schaffen, indem sie nicht nur Bezüge zwischen adjazenten Äußerungen herstellen, sondern auch zwischen Äußerungen, die weit über die Satzgrenze hinausgehen (vgl. Schiffrin 2001: 57), gilt die diskursive (nicht notwendigerweise strukturelle!) Skopusausweitung als typische Eigenschaft dieser Kategorie. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass eine Expansion des Skopus nicht zwangsläufig beim Einsatz von Diskursmarkern zu erwarten ist, sondern lediglich die Möglichkeit zur Ausweitung geschaffen wird.
Die Aufgabe der metakommunikativen Verknüpfung kann bekanntermaßen auch von Nebensätzen übernommen werden. Als Beispiel wird die nebensatzwertige Partizipialphrase anders gesagt angeführt, die aus funktionaler Sicht ihre beiden Konnekte in gleicher Weise, auf der Ebene der Ausdrucksform, verknüpft, indem die Relation als Reformulierung markiert wird:
(2)
Auch die Zeit endet in der rückwärtslaufenden Simulation nicht an diesem Punkt, sondern tickt im Planck-Sekundentakt durch ihn hindurch. Dadurch, so Bojowald, ergebe sich eine Geschichte des Universums vor dem Urknall, ebenfalls mit Raum und Zeit. Anders gesagt, war der Urknall der ‚Endknall‘ eines Universums, das vor dem unseren existierte und das unter dem Einfluss der Schwerkraft der darin befindlichen Massen kollabierte. Der Vorläuferkosmos, glaubt Bojowald, glich weitgehend dem unseren: „Hätte es darin Astronomen gegeben, hätten sie etwas Ähnliches gesehen wie wir, nämlich Sterne und Galaxien. Nur wäre deren Licht nicht in den roten, sondern in den blauen Spektralbereich verschoben gewesen, denn sie flogen aufeinander zu.“ (FOCUS; 15.06.2009, S. 52–55)
Zwar ist auch in diesem Fall der ‚Reformulator‘ linksadjazent und damit vor seinem zweiten Konnekt positioniert. Anders als das syntaktisch desintegrierte [31]sprich ist die Partizipialphrase jedoch in ihr zweites (internes) Konnekt, da im Vorfeld positioniert, integriert. Dies hat zur Folge, dass die Möglichkeit zur Expansion der diskursiven Reichweite verhindert wird. Geht der Bezugsrahmen nicht über die Satzgrenze hinaus, kann auch nicht mehr von der für Diskursmarker typischen Herstellung sequenzieller Bezüge gesprochen werden. Eine syntaktische Desintegration solcher Einheiten ins Vor-Vorfeld begünstigt jedoch die Möglichkeit zur Skopusausweitung, was als erstes Indiz eines Form-Funktionszusammenhangs gewertet werden kann:
(3)
Tony Blair will den Hochschul-Spagat ganz bewusst. Erstens soll bis 2010 die Hälfte aller unter 30-Jährigen eine Hochschule besuchen. Zweitens sollen die britischen Hochschulen weiterhin in der Liga der weltbekannten Universitäten mitspielen. Anders gesagt: Es sollen so viele Engländer wie möglich studieren. Und die britischen Hochschulen sollen die US-Elite-Institutionen attackieren können – das kostet Geld. (die tageszeitung, 04.12.2002)
Diesmal tritt anders gesagt syntaktisch desintegriert in Gelenkposition zwischen seinen beiden Konnekten auf. Dass sich der Skopus solcher desintegrierten Einheiten tatsächlich ausweitet, ist in vielen Fällen nicht mit Sicherheit auszumachen. Anders jedoch in diesem Fall. Dass die diskursive Reichweite nicht nur prospektiv sondern auch retrospektiv über die Satzgrenze hinausgeht, lässt sich an Folgendem festmachen: Dem ersten Konnekt sind zwei denotative Aspekte, die in Form von zwei Sätzen realisiert sind, zuzuordnen, da eben jene im zweiten Konnekt sukzessiv in derselben Reihenfolge reformuliert werden. Die sequenzielle Struktur sieht folgendermaßen aus: [[K1 [Den.1 + Den.2]] + anders gesagt + [K2 [ref. Den.1 + ref. Den.2]]]. Damit ist ein rein lokaler Bezug auszuschließen, d.h. es kann sich nicht nur um eine Reformulierung des links-adjazenten Satzes durch den rechts-adjazenten Satzes handeln, sondern einer Sequenz, die sich über zwei eigenständige Hauptsätze erstreckt.
2.1.2.2Funktion 2: Diskursiver Korrekturmarker
Beispiel (4) illustiert einen vielfach rezipierten Gebrauch von wobei als Diskursmarker. Während das Pronominal- bzw. Relativadverb in prototypischer Verwendung einen konzessiven oder relativisch-komitativen Nebensatz mit Verbletztstellung einleitet, weist das als Diskursmarker reanalysierte wobei andere formale und funktionale Merkmale auf: wobei leitet hier weder einen Nebensatz noch einen selbstständigen Interrogativsatz ein, sondern ist syntaktisch desintegriert vor einem Verbzweitsatz mit Linksversetzung – ein typisches Hauptsatzphänomen (Green 1976) – positioniert.
[32](4)
und so hihi schlagermusik und=so. (0.5)
wobei s- so so mache schlager (.)
die find ich zum teil
gar nicht so übel. (zit.n. Günthner 2000: 12)
Auch in semantischer Hinsicht ist diese Konstruktion nicht mit einem formal-semantischen konzessiven wobei-Nebensatz-Gefüge zu vergleichen, da eindeutig keine Lesart im Sinne von ‚wenn p, dann normalerweise nicht q’ vorliegt. Stattdessen schränkt wobei die Gültigkeit der vorausgehenden Behauptung ein (vgl. Günthner 2000: 13). Die Bedeutung des Diskursmarkers lässt sich wie folgt paraphrasieren: ‚ich möchte meine vorher vollzogene Äußerung korrigieren, und zwar …‘ (vgl. Mroczinsky 2012: 138). Korrigiert wird hier konkret die geäußerte Abneigung gegen Schlagermusik, indem der Bezugsrahmen der Abneigung, ‚jegliche Schlagermusik‘, in der Folgeäußerung eingeschränkt wird auf einen Teil der Schlagermusik. Als Korrekturmarker operiert wobei nun nicht mehr auf der Sachverhaltsebene, sondern fungiert als Verstehensanweisung für die Folgeäußerung, womit das Verknüpfungspotenzial auf der Sprechaktebene anzusiedeln ist. Indiziert wird also keine propositionale, sondern eine metapragmatische Bedeutungsrelation zwischen zwei strukturell selbstständigen Äußerungen (in diesem Fall steht die Äußerung B in einer korrektiven, genauer gesagt, einschränkenden Relation zur Äußerung A). Bezogen auf Schiffrins Diskursmodell wird damit wiederum die propositionale Ebene mit der Handlungsebene verknüpft, indem Propositionen als Sprechhandlungen in eine Relation – eben die der diskursiven Korrektur – gesetzt werden.
Formal-kategorisch gesehen hat das Konjunktionaladverb allerdings mit dem Diskursmarker wobei nur wenig gemein. Im Gegensatz zum Diskursmarker, der syntaktisch desintegriert und typischerweise äußerungsinitial fixiert ist, gehört das Adverb zur Klasse der nicht positionsbeschränkten Konnektoren (vgl. Breindl et al. 2014: 1174) und ist damit frei verschiebbar und in sein internes Konnekt integrierbar. Zwar besteht damit die Möglichkeit zur Positionierung im syntaktisch unabhängigen Vorvorfeld, diese Verwendung gilt jedoch als markierter Sonderfall. In Bezug auf die Semantik weist allerdings in der traditionellen Verwendung immerhin Gemeinsamkeiten zum konzessiven, nebensatzeinleitenden wobei auf, indem es – neben adversativen – ebenfalls konzessive Relationen zwischen zwei Propositionen kodiert (vgl. Breindl et al. 2014: 1174). Folgendes Beispiel zeigt eine formal-kanonische Verwendung des Konjunktionaladverbs in einem völlig anderen Textraum, nämlich in einem monologischen Pressetext, und dennoch sind in funktionaler Hinsicht deutliche Parallelen zur obigen Diskursmarkerverwendung festzustellen.
[33](5)
Wenn die Krise zu Ende geht, dann kann Salzgitter – gestärkt für den Wettbewerb – durchstarten. Zu lange darf sie allerdings nicht dauern. (Hannoversche Allgemeine, 27.3.2009, S. 9; zit.N. grammis-Konnektorendatenbank)
Formal gesehen, tritt allerdings in diesem Fall kanonisch integriert im Mittelfeld auf. Dass jedoch weder die Annahme der konzessivtypischen konditionalen Präsupposition noch die Annahme der adversativen Präsupposition eine sinnvolle bzw. eine semantisch analoge Interpretation ergibt, zeigen Umformulierungen in kanonisch-konzessive (6, 7) bzw. -adversative Subjunktorgefüge (8, 9) oder Paraphrasierungen in kanonisch-parataktische Reihungen mit prototypisch-konzessiven Konjunktionaladverbien (10, 11), die jeweils die Sinnhaftigkeit der ursprünglichen Konstruktion auflösen:
(6)
#Obwohl sie [die Krise] nicht zu lange dauern darf, kann Salzgitter – gestärkt für den Wettbewerb – durchstarten, wenn die Krise zu Ende geht.
(7)
#Obwohl Salzgitter – gestärkt für den Wettbewerb – durchstarten kann, wenn die Krise zu Ende geht, darf sie nicht zu lange dauern.
(8)
#Während sie [die Krise] nicht zu lange dauern darf, kann Salzgitter – gestärkt für den Wettbewerb durchstarten, wenn die Krise zu Ende geht.
(9)
#Während Salzgitter – gestärkt für den Wettbewerb – durchstarten kann, wenn die Krise zu Ende geht, darf sie nicht zu lange dauern.
(10)
#Wenn die krise zu Ene geht, dann kann Salzgitter – gestärkt für den Wettbewerb – durchstarten. Trotzdem darf sie nicht zu lange andauern.
(11)
#Sie [die Krise] darf nicht zu lange dauern, trotzdem kann Salzgitter – gestärkt für den Wettbewerb – durchstarten, wenn die Krise zu Ende geht.
Läge Konzessivität vor, müsste allerdings anzeigen, dass „eine Koinzidenz, die nach einer angenommenen Regularität eigentlich hätte eintreten müssen, entgegen den Erwartungen nicht eingetreten ist“ (Zifonun et al. 1997: 2283). Um dies zu überprüfen, sind insbesondere Umformulierungen in Subjunktorgefüge hilfreich, deren internes Konnekt auch dann problemlos ein echtes, d.h. aussagenlogisches konzessives Verständnis8 bereiten müsste, wenn es in das Vorfeld seines externen Konnektes eingebettet ist. Die Linearität der geäußerten Sachverhalte sollte dabei keine Rolle spielen. Formal betrachtet stellt dies kein [34]Problem dar, wie die Bsp. (6) und (7) zeigen. Semantisch betrachtet zeigen die Paraphrasen jedoch, dass Umformulierungen ohne eine Veränderung der ursprünglichen Lesart nicht möglich sind und eine (aussagen-)logisch basierte Verknüpfung blockiert ist. Woran liegt dies? Da es sich bei kanonischen Konzessivgefügen um asymmetrische Konstruktionen handelt (vgl. Breindl et al. 2014: 686), gibt es jeweils nur eine geltende Hauptaussage. In (6) lautet die Hauptaussage vereinfacht: ‚Salzgitter kann durchstarten‘. Mit dem obwohl-Konnekt wird eine blockierte Bedingung zum im Hauptsatz geäußerten Sachverhalt (=Folgekontrast) geäußert und eine – da grammatikalisiert – konventionelle Implikatur evoziert: ‚wenn p, dann normalerweise nicht q‘. Bezogen auf Bsp. (6) lautete diese: ‚wenn die Krise nicht zu lange dauern darf, kann Salzgitter normalerweise nicht durchstarten‘ oder positiv formuliert: ‚wenn die Krise undefiniert lange / zu lange dauern darf, kann Salzgitter normalerweise durchstarten‘. Daneben wird durch den konditionalen wenn-Nebensatz eine Bedingung für den geäußerten Sachverhalt im Hauptsatz dargelegt: das Ende der Krise. Diese Bedingung steht jedoch im Widerspruch – und zwar nicht im diskursiven, sondern logischem – zur durch obwohl evozierten Präsupposition. Welche Relationsbedeutung – wenn nicht logisch-konzessiv – indiziert allerdings in der ursprünglichen Konstruktion? Es zeigt eine Relation an, die dem wörtlichen Sinn von lat. concessio viel näher steht als dem formalsemantischen Verständnis von Konzessivität, nämlich die der Einräumung (welche grundsätzlich eine pragmatische Diskursrelation und niemals eine rein propositionale darstellt). Auf den im Erstkonnekt geäußerten Sachverhalt, dass Salzgitter durchstarten kann, wenn die Krise zu Ende geht, folgt eine Einräumung durch das interne Konnekt von allerdings, indem die geäußerte Bedingung, das ‚Ende der Krise‘, eingeschränkt wird auf das ‚Ende einer Krise, die nicht zu lange dauern darf‘. Durch das Hyponymieverhältnis wird auch der Reparatur- oder Korrekturcharakter der Konstruktion deutlich, wenn auch die Korrektur nicht vollständig erfolgt. Damit operiert allerdings in dieser Verwendung auch nicht mehr auf der sachverhaltsbezogenen Ebene, sondern muss sprechaktbezogen interpretiert werden. Funktional gesehen leistet allerdings in diesem Fall also eine vergleichbare Aufgabe wie der oben diskutierte Diskursmarker wobei: das Anzeigen einer Einschränkung der Gültigkeit einer vorausgehenden Äußerung.
Interessant wird an diese Stelle, dass hier die sprechaktbezogene Lesart von allerdings nicht grundsätzlich Umformulierungen in VL-obwohl-Gefüge blockiert. Folgende Paraphrasen zeigen, dass diese durchaus möglich sind, sofern das Antezendens-Konnekt im Vorvorfeld (bzw. an der Nullstelle) positioniert ist oder als Parathese realisiert ist, sich also in beiden zulässigen Fällen syntaktisch und prosodisch desintegriert zeigt:
[35](12)
?Obwohl sie [die Krise] nicht zu lange dauern darf: Salzgitter kann – ge-stärkt für den Wettbewerb – durchstarten, wenn die Krise zu Ende geht.
(13)
OKObwohl sie [die Krise] nicht zu lange dauern darf: Wenn die Krise zu Ende geht, kann Salzgitter – gestärkt für den Wettbewerb – durchstarten.
(14)
OKWenn die Krise – obwohl sie nicht zu lange dauern darf – zu Ende geht, dann kann Salzgitter – gestärkt für den Wettbewerb – durchstarten.
(15)
OKSalzgitter kann – gestärkt für den Wettbewerb – durchstarten, wenn die Krise – obwohl sie nicht zu lange dauern darf – zu Ende geht.
Auf Korrelationen zwischen den formalen Eigenschaften der Relation einer Konstruktion und ihrer Interpretation weisen auch die Autoren des Handbuchs der Konnektoren 2 hin. Zu subordinierenden Konnektoren wird festgesellt (s. Bsp. 16, 17, 18), dass kausale, konzessive und konditionale Relationen präferiert sprechaktbezogen gelesen werden, wenn das Antezendens-Konnekt syntaktisch desintegriert an der Nullstelle vorkommt (Breindl et al. 2014: 200).
(16)
Weil du das Handy dabei hast: Könntest du bitte die Polizei alarmieren?
(17)
Obwohl du mich kein einziges Mal angerufen hast: Hier sind zwei Kinokarten für heute.
(18)
Auch wenn das nun alles etwas negativ klingt: Journalistin zu sein ist für mich nach wie vor einer der spannendsten Berufe, den ich kenne. (http://www.ucip.ch/th/kg) (zit.n. ebd.: 201, Bsp. 117,118 und 119)
Der Zusammenhang von linearer Abfolge und Desintegriertheit der Konnekte (und nicht nur des Konnektors) sollte auch beim Permutations- und Substitutionstestverfahren zur Identifizierung der Verknüpfungsebene Berücksichtigung finden (s. auch Kap. 2.2.4).
2.1.2.3Funktion 3: Dissensmarker
Während in den obigen Belegen die diskutierten Einheiten monologisch verwendet werden, zeigen die folgenden Beispiele einen dialogischen Einsatz. Erstaunlich daran ist, dass auch in dieser Verwendung Funktionsüberschneidungen bei wobei und allerdings zu beobachten sind und dass in beiden Gebräuchen sogar eine weitere Diskursebene (neben der propositionalen und Sprechaktebene) relevant wird. Wird der Marker wobei dialogisch gebraucht, sodass die Relatata turn-übergreifend positioniert sind, übernimmt er weniger die Funktion der Korrektur bzw. Selbstkorrektur, sondern ist als Dissensmarker bzw. Fremdkorrektur zu interpretieren, da er verwendet wird, um Nichtübereinstimmung mit der vorausgehenden Äußerung des ersten Sprechers einzuleiten (vgl. Günthner 2000: 17), wie (19) zeigt:
[36](19)
Eva:
des is nämlich NOCH schlimmer wie der wohnt,
weil der nämlich noch AUßERhalb wohnt.
hier () bist ja wenigstens im paradies. (1.5) ((Essengeräusche))
Karl:
ja. (1.5) ((Essengeräusche))
wobei AUßERHALB (-)
(das=is) in konstanz natürlich.
also (-) was heißt das schon (.) außerhalb.
(zit.n. Günthner 2000: 18)
Zunächst stimmt Karl Evas Äußerung zu (→ Affirmationspartikel ja), doch nach einer kurzen Pause formuliert er seine durch wobei eingeleitete Nichtübereinstimmung und widerspricht damit Evas Behauptung, der Bekannte wohne „außerhalb“. In ähnlicher Weise fungiert allerdings in (20), Zeile 206 als Dissensmarker. Und das, obwohl auch hier das Adverb in kanonisch integrierter Form, positioniert im Vorfeld, auftritt:
(20)
ID: FOLK_E_00221_SE_01_T_01
Im Gesprächsausschnitt stellen LM und DN Vermutungen darüber an, welche Variante ihres Namens Selina als Rufnamen bevorzugt, ihren Spitznamen oder ihren vollen Namen. Zunächst äußert LM die Vermutung, Selina bevorzuge ihren vollen Namen, da sie mit diesem unterschreibe. Dem entgegnet DN mit einer durch allerdings eingeleiteten Äußerung und bringt ihre/seine Nichtübereinstimmung in Bezug auf LMs Schließverfahren zum Ausdruck. DN wendet ein, dass auch sie/er den Reflex habe, mit ganzem Namen zu unterschreiben, es aber schöner finde, beim Spitznamen gerufen zu werden. Allerdings leitet hier jedoch weniger einen Einwand ein, der sich auf den Inhalt der [37]Aussage bzw. die Richtigkeit dieser Aussage bezieht. Vielmehr bezieht er sich auf deren Relevanz des durch die Aussage realisierten Sprechakts. Ohne allerdings wäre die Äußerung zwar ebenfalls als Gegenargument interpretierbar9, durch den Einsatz des Adverbs wird sie jedoch als solches explizit indiziert, wenn auch in abgeschwächter Form: Denn allerdings drückt eine „Warnung vor naheliegendem, aber in diesem Fall nicht zutreffenden Schluss aus vorher Gesagtem“ aus (König et al. 1990: 19) oder liefert eine „relative Einschränkung einer These, ohne sie ganz unglaubwürdig zu machen“ und signalisiert ein „Gegenargument, dessen Implikatur die These in ihrem Gewissheitsgrad nur relativ schwächen, [38]nicht auf den geringst möglichen Stand der Gewissheit bringen soll.“ (Lötscher 1989: 224–225). Damit ist erklärbar, wie einige Lexika zur Einschätzung gelangen, dass durch allerdings zwar eine Einschränkung, ein Einwand oder Widerspruch markiert wird, dies aber in irgendeiner Weise schwächer und damit „höflicher“ geschieht als beispielsweise beim Kontrastmarker aber (z.B. Helbig 1988: 84, HDG 1984: 35, Bührig 2007, Métrich/Faucher (2009: 45), s. auch Breindl 2003: 81).
Abb. 2.3: Aktivierte Diskursebenen beim Dissensmarker wobei
Ähnliches stellt Günthner (2002: 72) zu wobei in dissensmarkierender Verwendung fest: „Da bei wobei die Semantik einer möglichen Aussagenpräzisierung noch mitschwingt, eignet es sich als ‚gesichtsschonendes‘ Vorlaufelement einer Nichtübereinstimmung: Statt eines expliziten Dissensmarkierers (wie nein oder stimmt nicht) gibt wobei zunächst einmal vor, eine Ergänzung bzw. Präzisierung zu liefern“. Neben der Indizierung einer metapragmatischen Bedeutungsrelation evoziert demnach sowohl das Pronominaladverb als auch das Konjunktionaladverb in sprecherübergreifender Verwendung zusätzlich eine diskursfunktionale Bedeutungskomponente, die der Gesichtswahrung bzw. der Erzeugung von Höflichkeit dient und damit auf der Beziehungsmanagementebene anzusiedeln ist.
2.1.2.4Funktion 4: Epistemischer Marker
Modalität – und damit auch epistemische Modalität – ist eine „semantisch-pragmatische Beschreibungsperspektive, welche sich im weiteren Sinne auf die Art und Weise der Stellungnahme des Sprechers zur Geltung des durch eine Äußerung ausgedrückten Sachverhaltes der aktuellen Welt bezieht“ (Glück 52016: 437). Damit gelten Ausdrucksformen, die zur Einschränkung des Geltungsanspruchs oder zur Evidentialität einer Aussage in Verbindung stehen als epistemische Markierungsstrategien. Prädestiniert sind dafür die morphologische Kategorie des Modus oder der Modalpartikeln (i.w.S.). Allerdings verschleiert die produzentenorientierte Perspektive auf die Haltung eines Sprechers und auf kontextisolierte Sätze, dass jeder Kommunikation eine gemeinsame Wissensbasis aller Beteiligten zugrunde liegt. Da im Laufe des Wissenstransfers aus dem individuellen Wissen der Beteiligten gemeinsames Wissen wird, ist für die Epistemikforschung das Modell des common ground (Stalnaker 2002) bedeutend. Als epistemische Marker gelten nicht nur Ausdrücke, die subjektive Sprechereinstellungen zur Aussagengeltung markieren, sondern auch intersubjektive Wissensrahmen evozieren. Die dialogische Spezifik von Diskursmarkern lässt freilich auch solche Funktionen vermuten. Bereits in der frühen Forschung werden Diskursmarkern Operationen auf epistemischer Ebene zugesprochen. Meist bezieht sich die operative Leistung dabei auf das Verknüpfungspotenzial desintegrierter, als Diskursmarker reana[39]lysierter Subjunktionen (wie weil oder obwohl), die nicht mehr sachverhaltsbegründend oder -opponierend wirken, sondern wissensbezogen. In jüngeren Arbeiten der Forschungslandschaft werden zunehmend auch anderen Diskursmarkern epistemische Funktionen attestiert, deren Operationen weniger mit dem Konnexionskonzept gemein hat, sondern – wie im Folgenden gezeigt wird – viel mehr mit den spezifischen modalisierend-modifizierenden Leistungen der Modalpartikeln.
Von Modalpartikeln10 wird gemeinhin angenommen, dass auch sie ein sehr breites Spektrum an pragmatischen Funktionen übernehmen. Als charakteristisch gelten folgende Verwendungsweisen: Modalpartikeln als „Illokutionsindikatoren“, als „Ausdrucksmittel für epistemische Einstellungen“, „Sprechereinstellungen“ und -bekundungen und als „metapragmatische Instruktionen“. In zuletzt genannter Funktion dienen sie der „Identifizierung von Widersprüchen“, der „Verankerung der Äußerung im Kommunikationszusammenhang“ oder als „Stärkeindikatoren“ (vgl. König 2010: 84–90 und Schulz 2012: 64). Zunächst ist festzuhalten, dass alle genannten Funktionen ebenfalls der Herstellung von Diskurskohärenz dienen.
Insbesondere sogenannte question tags wie weißt du?, oder?, gell?, nicht wahr? oder nich(t)? werden in der Forschung unter dem Stichwort finale Diskursmarker thematisiert.11 Bei ihrem Einsatz zeigen sie meist die für Diskursmarker typischen Eigenschaften der semantischen Verblassung und der Reduktion der phonologischen Substanz (vgl. Auer/Günthner 2003). Gesprächsausschnitt (21) zeigt ein Beispiel für die Verwendung der phonetisch reduzierten Negationspartikel nicht in äußerungsfinaler Position mit steigender Intonation.
Der Diskursmarker ne ist jedoch nicht zu verwechseln mit dem Vergewisserungssignal12ne in (21), das zwar ebenfalls äußerungsfinal positioniert ist und ein steigendes Tonmuster aufweist, aber zu einer Bestätigung auffordert:
[40](21)
Lo:
da FREUT sie sich bestimmt; (.) HOFF [ich; ]
Em:
[beSTIMMT;] (-) FREItag is der geburtstag;=ne,
Lo:
ja geNAU; (-) hm_hm, (-)
Em:
COO:L; (zit.n. König 2017: 241)
Damit ist es als eigenständiger illokutionärer Akt aufzufassen und erscheint logischerweise – sofern die Interaktion kooperativ und erfolgreich erfolgt, d.h. der illokutionäre Effekt und der damit verbundene standardisierte perlokutionäre Erfolg eintritt – nicht nur äußerungsfinal sondern gleichzeitig redezugfinal. Anders verhält sich ne in (22), das redezugmedial auftritt und eben keine verbale Reaktion einfordert, weil unmittelbar mit dem eigenen Redebeitrag fortgesetzt wird, sondern als „Evidenzmarker“ (Hagemann 2009, König 2017) fungiert, ohne dabei einen eigenständigen illokutionären Akt bilden.
(22)
A:
also die (.) äh TROPfenfolge ist reguliert weil er sich orientiert hat an: diesen: stalagmiten und stalaktiten wirklich aus den:
höhlen-
B:
[hm=hm-]
A:
[das ] hat er geFORSCHT, er hat auch solche forschungen VORher gemacht mit anderen apparaturen (und so weit) so und so baut sich das auf; man kann (.) äh wenn man jetzt geologe ist auch das ALter solcher (.) äh tropf:steine nach:vollziehen; das kriegt man HIN;=ne?
B:
=hm=hm- (zit.n. Hagemann 2009: 165, Bsp. 2)
Illokutionär relevant (in Bezug auf seine Vorgängeräußerung „das kriegt man HIN“) ist der Ausdruck dennoch, denn:
‚ne?‘ fügt der zugrunde liegenden assertiven illokutionären Kraft eine zusätzliche Ausprägung in der Dimension des Durchsetzungsmodus hinzu, der zufolge A Zustimmung oder Einverständnis andeutungsweise erfragt, obwohl sie diese bereits unterstellt. Sprecherin A behauptet also nicht nur den thematisierten Sachverhalt, sondern versucht auch ihren Gesprächspartner B auf die Anerkennung der ausgedrückten Proposition festzulegen, indem sie anzeigt, dass die Geltung der in der Bezugsäußerung zum Ausdruck gebrachten Proposition evident ist. Damit indiziert Sprecherin A Konsens und erhöht den Nachdruck, mit dem sie den assertiven illokutionären Zweck (die Anerkennung des Wahrheitsanspruchs durch einen Kommunikationspartner) der Bezugsäußerung durchzusetzen beabsichtigt. Mit der [Bezugsäußerung von „ne“] vollzieht Sprecherin A also einen Sprechakt mit einer speziellen assertiven illokutionären Kraft: Sie stellt eine evidente Behauptung auf (ebd.: 166).
[41]Zusammengefasst fungiert äußerungsfinales, redezuginternes ne als Ausdrucksmittel für Illokutionskraftkomponenten (genauer: als Ausdrucksmittel für den Durchsetzungsmodus eines illokutionären Zwecks), indem durch den tag ein unbestimmter assertiver Sprechakt zu einem speziellen – dem der (evidenten) Behauptung – indikatorisch modifiziert wird. Dieselbe Aufgabe leisten bekanntlich auch Modalpartikeln (i.w.S.) wie wirklich, vermutlich oder sicherlich. Rolf (1997: 75) konstatiert: „Aufgrund der Bedeutung von wirklich […] drückt ein Satz wie Er ist wirklich hier aus, daß der Sprecher die Wahrheit des Gesagten garantiert; der Sprecher vollzieht einen speziellen assertiven Akt, den des Versicherns“.
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass ne? als Evidenzmarker „die inhaltsbezogene Aufgabe“ hat, „Hintergrund- oder Hilfsinformationen bereitzustellen“ (Hagemann 2009: 166). Damit ist gemeint, dass der Rezipient durch die Verwendung von ne? zur Kenntnis gelangen soll, die Bezugsäußerung als Hilfsinformation ohne Weiteres zu akzeptieren und „in ihrer informellen Relevanz als dem Thema beigeordnet, jedoch nicht dem aktuellen Fokus zugehörig eingestuft“ betrachten soll (ebd.). Erstaunlich ähnlich klingen Königs (2010) Einschätzungen zur Abtönungspartikel ja im folgenden Beispiel:
(23)
Übrigens, Karl zahlt ja gar keine Steuern. (Kontext: Sprecher hält dem Hörer nicht bekannte Unterlagen in der Hand) (zit.n. ebd.: 86, Bsp. 17b)
Er notiert hierzu, dass die geäußerten Sachverhalte für den Angesprochen auch völlig neu und nicht aus dem Kontext erschließbar sein können – diese Bemerkung ist insofern relevant als der Abtönungspartikel ja in der Forschung häufig die Funktion der ‚Erinnerung an Bekanntes‘ zugeschrieben wird13 – und dass für solche Fälle wesentlich sei, dass „ganz klare und starke Evidenz für die Richtigkeit der Aussage besteht. […] Insofern hat ja eher die Funktion eines Evidenzmarkers als die Funktion, eine triviale Kontextabgleichung zu signalisieren“ (König 2010: 86–87). Aus dem non-verbalen Kontext ergibt sich, dass ja in dieser Äußerung gar nicht an Bekanntes erinnern oder auf Offensichtliches hinweisen kann. Aus dem verbalen Ko-text erschließt sich außerdem, dass die Bezugsäußerung von ja in ihrer Relevanz als dem Thema beigeordnet zu verstehen ist. Letzterer Aspekt wird zwar von König nicht explizit thematisiert, interessanterweise führt er aber in diesem Zusammenhang ausgerechnet ein Beispiel an, das das Adverb übrigens enthält, welches zu den diskursbezogenen metakommunikativen Konnektoren zählt und sein internes Konnekt „als relevanzschwache Nebeninformation“ (Breindl et al.: 2014: 1152) kennzeichnet. [42]Natürlich könnte man einwenden, dass die relevanzbezogene Abstufung der Bezugsäußerung ja gerade nicht primär durch die Abtönungspartikel ja geleistet wird, sondern durch den Einsatz von übrigens. Königs Beispiel erscheint jedoch ko-textlos und konstruiert, und gerade weil sprachliche Konstruiertheit in linguistischen Schriften v. a. dann eingesetzt wird, um die Anschaulichkeit bedeutungsbezogener Exemplifizierungen zu erhöhen, könnte man unterstellen, dass für ihn auch dieser diskursfunktionale Aspekt im Zusammenhang mit ja relevant wird.
Abb. 2.4: Aktivierte Diskursebenen beim Evidenzmarker ne
Es lässt sich festhalten, dass sowohl Modalpartikeln als auch Diskursmarker epistemische Funktionen übernehmen können. In diesem besonderen Fall werden Äußerungen durch den Einsatz der Ausdrücke nicht nur illokutionär modifiziert, sondern auch hinsichtlich ihrer argumentativen oder narrativen Relevanz eingeordnet. Als Ausdrucksmittel für Illokutionskraftkomponenten evozieren sie eine pragmatische Bedeutungskomponente, die auf der Sprechaktebene anzusiedeln ist, als Hilfsinformationsmarker evozieren sie diskursfunktionale Bedeutung und sind damit auf der Hintergrundinformationsebene anzusiedeln.
[43]Vorweggreifend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich der Typ der Bedeutung – wie ich später argumentieren werde –, der durch sog. finale (redezuginterne) Diskursmarker evoziert wird, deutlich von dem der diskutierten sog. initialen Diskursmarker unterscheidet. Während durch den Gebrauch sog. initialer Diskursmarker eine Indizierung einer diskursfunktionalen Bedeutungsrelation erfolgt, diese Relationsbedeutung und/oder eine der Bezugsäußerungen zwar zusätzlich durch weitere nicht-propositionale Bedeutungskomponenten modifiziert werden kann, findet dagegen beim Einsatz von (insbesondere redezuginternen) finalen Diskursmarkern durch das Hinzufügen einer pragmatischen bzw. diskursfunktionalen Bedeutungskomponente lediglich eine Modifizierung der Bezugsäußerung bzw. deren Einordnung im diskursiven Kontext statt (siehe hierzu auch Kap. 2.2).
2.1.3Primär formal orientierte Ansätze
Zu den frühen primär formalen Ansätzen gehören beispielsweise die Arbeiten von Fraser (1990) oder Lenk (1998) für das Englische und Ortner (1983), Thim-Mabrey (1988) und Auer (1997) für das Deutsche. Bei ihrer Herangehensweise haben sie gemein, dass sie bei der Erfassung des Ausdrucksspektrums zunächst ein formales Stellungskriterium heranziehen, nämlich die Position vor einem Satz bzw. einer Äußerung. Lenk (1998: 51) beschränkt die Klasse der discourse markers





























