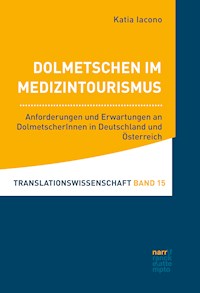
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Translationswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutschland und Österreich sind aufgrund ihrer medizinischen Standards beliebte Zielländer für internationale PatientInnen, die nach einer Zweitmeinung zu einer Diagnose bzw. zu einem Therapievorschlag oder einer speziellen medizinischen Behandlung suchen. Der finanzielle und organisatorische Aufwand medizinischer Reisen führt zu hohen Erwartungen der PatientInnen an die Behandlung und an alle beteiligten AkteurInnen. In diesem Kontext werden DolmetscherInnen häufig zu Hauptansprechpersonen der PatientInnen, die sich an sie mit zusätzlichen organisatorischen Wünschen wenden. Dieser Band untersucht die Erwartungen und das erweiterte Anforderungsprofil, mit denen DolmetscherInnen im Medizintourismus in Deutschland und Österreich konfrontiert sind. Er richtet sich an DolmetscherInnen sowie an ÄrztInnen und VertreterInnen medizinischer Institutionen, die mit DolmetscherInnen zur Überwindung von Sprachbarrieren zusammenarbeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katia Iacono
Dolmetschen im Medizintourismus
Anforderungen und Erwartungen an DolmetscherInnen in Deutschland und Österreich
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2021 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.narr.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8233-8472-4 (Print)
ISBN 978-3-8233-0267-4 (ePub)
Inhalt
Einleitung
DolmetscherInnen, die die Kommunikation zwischen PatientInnen und medizinischem Personal aus unterschiedlichen Sprach- und Kulturräumen dolmetschen, leisten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der medizinischen Beratungen bzw. Behandlungen und minimieren etwaige Risiken, die aufgrund von Missverständnissen entstehen können. In den meisten Fällen zielt die verdolmetschte Kommunikation darauf ab, anderssprachigen Menschen, die der Sprache des Landes, in dem sie leben, nicht mächtig sind, Zugang zum Gesundheitswesen zu ermöglichen. Es handelt sich hierbei in der Regel um Menschen mit Migrationshintergrund der ersten oder zweiten Generation, die die Landessprache nicht oder nicht ausreichend beherrschen, um ein medizinisches Gespräch vollständig zu verstehen. In unserer globalisierten Gesellschaft gibt es aber auch Situationen, in denen PatientInnen nicht im Land der medizinischen Institution, die sie aufsuchen, wohnhaft sind. Sie reisen aus medizinischen Gründen in ein anderes Land, um sich dort einer Behandlung zu unterziehen. Innerhalb der Europäischen Union werden solche Reisen durch die Richtlinie 2011/24/EU geregelt. Diese Mobilität von PatientInnen wird in der Fachliteratur mit verschiedenen Termini bezeichnet, die häufigsten im deutschsprachigen Raum sind Medizintourismus, Gesundheitstourismus und PatientInnenmobilität. Für die vorliegende Studie wurde aufgrund ihrer Verbreitung im deutschsprachigen Raum die Bezeichnung Medizintourismus gewählt.
In dieser Studie wird davon ausgegangen, dass das Dolmetschen in medizintouristischen Settings einzigartige Merkmale hinsichtlich der Dolmetsch(dienst)leistung aufweist und sich daher vom Dolmetschen in anderen medizinischen Settings unterscheidet. So setzt die Inanspruchnahme der benötigten medizinischen Leistung eine Reise in ein anderes Land voraus, deren Organisation mit Mühen und Aufwand verbunden ist. Darüber hinaus benötigen viele PatientInnen sowohl von den VertreterInnen medizinischer Institutionen als auch von den DolmetscherInnen zusätzliche Dienstleistungen organisatorischer Natur, um die medizinische Reise überhaupt bewältigen zu können. Der finanzielle und organisatorische Aufwand einer solchen Reise beeinflusst die Erwartungen der PatientInnen an die Behandlung sowie an das medizinische Personal und nicht zuletzt an die DolmetscherInnen. Dies führt wiederum zu einer Veränderung des Anforderungsprofils der DolmetscherInnen. In der vorliegenden Studie wird der Medizintourismus in den Zielländern Österreich und Deutschland untersucht. Die Wahl dieser beiden eher höherpreisigen medizintouristischen Zielländer, die über eine gute bis sehr gute medizinische Infrastruktur verfügen, wurde aus folgenden Gründen getroffen: Auf der einen Seite ist davon auszugehen, dass die Bereitschaft, Dolmetschservices in Anspruch zu nehmen, und die Erwartungen an alle beteiligten AkteurInnen – auch an die DolmetscherInnen – höher sind, wenn hoch spezialisierte und zumeist kostspielige medizinische Behandlungen angestrebt werden; auf der anderen Seite verfügte die Autorin aufgrund ihrer Dolmetschtätigkeit bereits über einen Zugang zu medizintouristischen Settings in Österreich.
Die Forschungsfragen der vorliegenden Studie lauten wie folgt:
Wie sieht das translatorische Betätigungsfeld jener DolmetscherInnen aus, die in Deutschland und Österreich im Medizintourismus arbeiten? Was ist anders im Vergleich zum klassischen medizinischen Dolmetschen?
Welche Erwartungen und Anforderungen werden von PatientInnen und ÄrztInnen an DolmetscherInnen im Medizintourismus gestellt? Welche zusätzlichen Kompetenzen benötigen sie dafür (z.B. Managementkompetenzen, unternehmerisches Denken, spezifisch medizintouristisch-institutionelles Wissen)?
Inwieweit wären DolmetscherInnen bereit, diesen Erwartungen und Anforderungen gerecht zu werden? Wären sie bereit, außertranslatorische Aufgaben zu erfüllen und die dazu nötigen Kompetenzen zu erwerben?
Dabei werden Erwartungen wie folgt verstanden:
als explizit in der Anfrage und während der Kommunikation geäußerte Bedürfnisse und Wünsche der BedarfsträgerInnen sowie
als nicht direkt kommunizierte Bedürfnisse und Wünsche der BedarfsträgerInnen.
Als Anforderungen werden in Anlehnung an Risku (2016b: 44) die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Dolmetsch(dienst)leistung und somit hauptsächlich Kompetenzanforderungen verstanden.
Die Theorie des translatorischen Handelns (vgl. Holz-Mänttäri 1984) und der pragmatische bzw. soziologische dolmetschwissenschaftliche Ansatz (vgl. u.a. Wadensjö 1998 und Roy 2000) bilden den theoretischen Rahmen der vorliegenden Studie. Im Sinne des translatorischen Handelns werden DolmetscherInnen als ExpertInnen verstanden, die den Bedarf ihrer BedarfsträgerInnen analysieren und verbalisieren, ihnen eine bedarfsgerechte Dienstleistung anbieten und zur Erreichung komplexer Ziele mit anderen ExpertInnen, wie z.B. dem medizinischen Personal, zusammenarbeiten. In ihrem translatorischen Handeln treten DolmetscherInnen als selbstbewusste ExpertInnen auf und wählen ihre Strategien mit dem Ziel, Verständigung zwischen den GesprächsteilnehmerInnen zu ermöglichen. Sie sind keine unsichtbaren AkteurInnen: Sie koordinieren die Gespräche, damit alle Beteiligten zu Wort kommen, und klären Missverständnisse, die ungeklärt zu erheblichen medizinischen Folgen führen könnten (vgl. u.a. Baraldi/Gavioli 2012). Sie vertreten also die Interessen aller Beteiligten, ohne persönliche Vorteile anzustreben und sind somit allparteilich (vgl. Kadrić/Zanocco 2018).
Forschungsziel der vorliegenden Studie ist die Untersuchung des Dolmetschens im Medizintourismus unter Berücksichtigung seiner rechtlichen, wirtschaftlichen und translationswissenschaftlichen Besonderheiten. Aus rechtlicher Sicht werden der rechtliche Rahmen, die PatientInnenrechte und ÄrztInnenpflichten beleuchtet. Aus wirtschaftlicher Sicht wird der Medizintourismus als neues Marktsegment für DolmetscherInnen untersucht; im Fokus steht die Analyse des Angebots an translatorischen und außertranslatorischen Dienstleistungen. Aus translationswissenschaftlicher Perspektive wird das Augenmerk auf den Situationskontext und seine Unterschiede zu anderen medizinischen Settings – auch hinsichtlich der Bedürfnisse und Erwartungen der Beteiligten sowie der Anforderungen an die DolmetscherInnen – gelegt.
Die Auseinandersetzung mit den Aufgaben und Arbeitsbedingungen der DolmetscherInnen im Medizintourismus ist sowohl für den translationswissenschaftlichen Diskurs als auch für curriculare und didaktische Überlegungen sowie die weitere Entwicklung des Berufsbilds von Relevanz. Die Erfassung und Beschreibung der Erwartungen der am Situationskontext beteiligten AkteurInnen sowie der Anforderungen an die DolmetscherInnen helfen, zusätzliche Kompetenzen, welche DolmetscherInnen auf dem Markt benötigen, zu identifizieren und ein umfassendes Kompetenzprofil zu erstellen. Dadurch soll angehenden DolmetscherInnen ein Berufsbild präsentiert werden, das aufgrund der hohen Erwartungen der PatientInnen und VertreterInnen der medizinischen Institutionen in vielen Fällen eine Erweiterung der Dienstleistungen und eine Veränderung der klassischen Aufgaben und Kompetenzen für DolmetscherInnen mit sich bringt.
Die vorliegende Studie geht zuerst näher auf den Medizintourismus ein, da dieser den Rahmen der analysierten dolmetschvermittelten Kommunikation bildet. In Kapitel 1 folgt auf eine begriffliche Definition des Terminus Medizintourismus eine Auseinandersetzung mit den Besonderheiten des Medizintourismus aus rechtlicher, wirtschaftlicher und ethischer Sicht. In diesem Zusammenhang werden die grundlegenden Merkmale der betroffenen PatientInnen wie ihre Beweggründe beleuchtet. In Kapitel 2 liegt der Fokus auf dem Dolmetschen in medizinischen und medizintouristischen Settings. Neben einem kurzen Überblick über translationswissenschaftliche Untersuchungen des medizinischen Dolmetschens wird auf die Besonderheiten der medizinischen und nicht medizinischen Kommunikation im Medizintourismus sowie auf das professionelle translatorische Handeln von DolmetscherInnen eingegangen. Kapitel 3 beinhaltet eine erste theoretische Auseinandersetzung mit den Erwartungen und Anforderungen an DolmetscherInnen in medizinischen und medizintouristischen Settings. Dieser Vorstellung folgt in Kapitel 4 die Erläuterung der in der Studie angewandten Forschungsmethoden, in deren Rahmen auf die einzelnen Forschungsphasen des Forschungsdesigns eingegangen wird. Die weiteren Kapitel der Arbeit beschäftigen sich mit der Analyse der Erkenntnisse aus der ethnografischen Feldforschung (Kapitel 5), den qualitativen Expertinneninterviews (Kapitel 6) und der explorativen Online-Erhebung (Kapitel 7). In Kapitel 8 folgt eine Zusammenfassung aller erlangten Erkenntnisse und der sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen für Forschung, Didaktik und Beruf. Die zwei Anhänge enthalten Auszüge aus der Forschungsdokumentation wie die Dokumentation der Bildung der induktiven und deduktiven Kategorien für die Inhaltsanalyse der Interviews.
Eine abschließende Anmerkung zur verwendeten Sprache. In der gesamten Studie werden die Termini DolmetscherInnen und Dolmetschende nicht als Synonyme verstanden. Als DolmetscherInnen werden Menschen mit einschlägiger Ausbildung, die im Sinne des translatorischen Handelns im Kooperationsgefüge als ExpertInnen auftreten, bezeichnet: Meist sind es ausgebildete DolmetscherInnen oder Personen, die über viel Dolmetscherfahrung verfügen und/oder an einer Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen haben. Die Bezeichnung Dolmetschende wird hingegen für Menschen ohne einschlägige Ausbildung und Erfahrung verwendet. Darüber hinaus wurde aus ethischen Gründen beschlossen, bei der Darstellung und Analyse der empirischen Daten auch das Geschlecht der vulnerabelsten InterviewpartnerInnen zu anonymisieren (die/der PatientIn statt die Patientin oder der Patient), um diese zusätzlich zu schützen.
1Medizintourismus als Marktsegment für DolmetscherInnen
Der Begriff Medizintourismus beschreibt ein Phänomen, das zwar in seiner derzeitigen Ausprägung jung und wenig erforscht ist, dennoch reicht die Idee bzw. das Konzept, eine medizinische Reise zu unternehmen, weit in die Vergangenheit zurück. So zog bereits im alten Griechenland die Stadt Epidaurus Leidende aus dem Mittelmeerraum an, die im Thermalwasser der heiligen Stätte des Gottes Asklepius Linderung suchten (vgl. Quast 2009: 14). Generell waren die PilgerInnenfahrten zu den Asklepieia, ehemaligen wichtigen griechischen Heilstätten, die sowohl über ein Sanatorium als auch über einen Tempel verfügten, sehr beliebt. Im heiligen Tempel verbrachten die Reisenden mehrere Nächte in der Hoffnung, dass Asklepios ihnen im Traum die richtige Diagnose stellen oder eine erfolgreiche Behandlungsmethode verraten würde. Ebenso beliebt waren die Reisen zu Thermal- und Badeorten (vgl. Quast 2009: 14), mit denen eine Linderung verschiedener Krankheiten beabsichtigt wurde. Medizinische Reisen bildeten fortan eine Konstante der Geschichte und wurden aus unterschiedlichen Beweggründen unternommen.
1.1Begriffsdefinition und -abgrenzung
Der Medizintourismus wurde in der Translationswissenschaft bis jetzt nur am Rande erwähnt (vgl. Tipton/Furmanek 2016: 114, Angelelli 2019: 32). Die in den vergangenen Jahren an den österreichischen Universitäten in Wien und Graz verfassten Masterarbeiten (vgl. Ivașcu 2014, Muršič 2015, Chistyakova 2016, Slavu 2017, Weissenhofer 2017, Horová 2018) zeigen jedoch erstes Interesse junger ForscherInnen am Dolmetschen in diesem Marktsegment. ForscherInnen aus den Bereichen Tourismus, Medizin, Wirtschaft und Marketing haben sich hingegen bereits der Erforschung des Medizintourismus gewidmet. Die verschiedenen Ansätze vorhandener Forschungsarbeiten finden sich nicht nur in den verwendeten Bezeichnungen Medizintourismus und Gesundheitstourismus, sondern auch in deren Definitionen wieder, die je nach Verständnis der zugrundeliegenden Begriffe Medizin, Gesundheit und Tourismus sehr stark variieren. Teilweise wird Medizintourismus mit Gesundheitstourismus (vgl. Berg 2008, Illing 2009) gleichgesetzt, teilweise wird er als Unterbegriff des Gesundheitstourismus gesehen (vgl. Quast 2009, Reisewitz 2015). Eine genaue Definition des Terminus Medizintourismus bedarf allerdings einer Abgrenzung vom Begriff des Gesundheitstourismus, wofür zuerst die in den Benennungen Medizintourismus und Gesundheitstourismus enthaltenen Begriffe erklärt werden sollen. Für den Begriff Tourismus wird in der Regel auf die Definition der Welttourismusorganisation zurückgegriffen: „Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business/professional purposes“ (IRTS 2010: 1). Zu den Motiven für diesen temporären Ortswechsel zählen laut Berg (2008: 3), Experte für Tourismusmanagement, unter anderem Erholung, Regeneration, Heilung sowie Kultur. In der Entscheidung 1999/34/EG der Kommission vom 09.12.1998 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 95/57/EG des Rates über die Erhebung statistischer Daten im Bereich des Tourismus, Anhang 2.1, definiert die Europäische Union Tourismus als „[…] die Tätigkeit von Personen, die zu Orten außerhalb ihrer gewohnten Umgebung reisen und sich dort höchstens ein Jahr lang zu Urlaubs-, geschäftlichen oder anderen Zwecken aufhalten“ (1999/34/EG, Artikel 2, Absatz 2.1). Unfreiwillige Reisezwecke sind allerdings nicht Teil der Definition: „Ärztlich verordnete unfreiwillige Aufenthalte in Krankenhäusern und sonstigen medizinischen Einrichtungen, die klinische/medizinische Behandlungen bieten, sind ausgeschlossen“ (1999/34/EG, Artikel 2, Absatz 2.1). Je nach Auslegung dieser Definition könnte sie anerkannte Tourismusformen wie den Kurtourismus oder auch Teile des Medizintourismus ausschließen, da nicht eindeutig erläutert wird, wie sich Freiwilligkeit von Unfreiwilligkeit unterscheiden lässt. In vielen Fällen fassen nämlich PatientInnen, die sich trotz unterschiedlicher Beweggründe auf eine medizinische Reise begeben, selbstständig und ohne ärztliche Zuweisung oder Verordnung den Entschluss, eine Reise anzutreten. Außerdem nehmen viele von ihnen im Zielland übliche touristische Angebote in Anspruch.
Der Duden bietet für den Terminus Medizin die folgende Definition: „Heilkunde, Lehre vom gesunden und kranken Organismus […], Wissenschaft von den Ursachen, der Heilung und Vorbeugung von Krankheiten“ (Dudenredaktion 2012). Illing, Experte für Gesundheitstourismus, Wirtschaft und Qualitätsmanagement, definiert Gesundheit wie folgt: „als der Zustand der optimalen Leistungsfähigkeit eines Individuums für die Erfüllung der Aufgaben und Rollen, für die es sozialisiert wurde“ (Illing 2009: 8).1 Er führt an, dass modernere Definitionen des Begriffes allerdings sowohl das medizinisch-wissenschaftliche als auch das biopsychosoziale Modell berücksichtigen. So versteht die medizinisch-wissenschaftliche Schule Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit und sieht einen Menschen als gesund an, wenn dessen gesamter Körper richtig funktioniert. Aufgrund von messbaren und empirischen Kriterien kann das Ausmaß der Krankheit beurteilt werden, die eine „messbare Fehlfunktion bestimmter Körperteile“ (Illing 2009: 8) darstellt. Das biopsychosoziale Modell betont hingegen nicht nur die dichotomische Dimension von Gesundheit oder Krankheit, sondern hebt neben der biologischen Erkrankung auch die psychischen und sozialen Faktoren hervor. In diesem Modell gilt die Gesundheit als „positiver und funktioneller Gesamtzustand im Sinne eines dynamischen biopsychosozialen Gleichgewichtszustandes, der erhalten bzw. immer wieder hergestellt werden muss“ (Illing 2009: 8). Die holistische Dimension der Gesundheit ist auch in den Prinzipien der Weltgesundheitsorganisation festgehalten: „A state of complete physical, social and mental well-being, and not merely the absence of disease or infirmity“ (WHO 1946: 1). Dieses ganzheitliche Verständnis der Gesundheit wird in den meisten Definitionen von Gesundheitstourismus (vgl. Berg 2008, Illing 2009) berücksichtigt, in denen ein temporärer Ortswechsel aus gesundheitlichen Gründen oder zu Heilungszwecken angeführt wird. Für Illing ist das Ziel die Erreichung eines „Gleichgewichtszustandes zwischen körperlichem und seelischem Leistungsvermögen“ (Illing 2009: 49). Berg betont hingegen die „Erhaltung, Stabilisierung oder die Wiederherstellung der Gesundheit“ (Berg 2008: 39), während Tourismusexperte Claude Kaspar (1996: 55) „das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden“ hervorhebt. Verfolgt wird das Ziel der Genesung an einem fremden Ort durch die Inanspruchnahme medizinischer oder balneologischer Leistungen, therapeutischer Beratung und Betreuung, sportlicher Aktivitäten und gesunder Ernährung (vgl. Berg 2008: 39). Im Rahmen des Gesundheitstourismus erfolgen jedoch weder medizinische Notfallbehandlungen noch geplante Behandlungen, die in erster Linie die Gesundheit wiederherstellen sollen:
Gesundheitstourismus hat das Ziel, einen Gleichgewichtszustand zwischen körperlichem und seelischem Leistungsvermögen und den tagtäglichen Anforderungen von Umwelt, Mitwelt und Selbstwelt zu erreichen. Die zur Zielerreichung verwendeten Verfahren (Methoden) sind salutogenetische, medizinische sowie ergänzende und werden an Orten (Spa, Region) abseits vom gewöhnlichen Lebensumfeld angeboten, die durch die behandlerische Kompetenz der dort arbeitenden Fachkräfte wie auch des Gebäudes und der natürlichen Umwelt gekennzeichnet sind. (Illing 2009: 49)
Medizinische Behandlungen, die einen Aufenthalt in einem ausländischen Krankenhaus und eine ärztliche Untersuchung im Ausland voraussetzen, sind hingegen dem Medizintourismus zuzuschreiben (vgl. Illing 2009: 6, Quast 2009: 9). In ihrer betriebswirtschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Medizintourismus definiert ihn Quast wie folgt:
Medizintourismus ist ein Synonym für die Begriffe Patienten-, Klinik- und Operationstourismus und beschreibt die Bewegung von Patienten, die aus unterschiedlichen Gründen medizinische Dienstleistungen an Orten außerhalb ihres gewöhnlichen Umfeldes in Anspruch nehmen, wobei der Aufenthalt die Dauer eines Urlaubes nicht überschreitet und vielfach mit der Nachfrage touristischer Aktivitäten kombiniert wird. (Quast 2009: 6)
Medizintourismus kann für Quast einen nationalen oder einen internationalen Charakter aufweisen und in freiwilligen Patiententourismus und staatlichen Operationstourismus unterteilt werden.2 In der ersten Kategorie sind günstigere Behandlungen im Inland oder Ausland anzuführen, deren Kosten zum größten Teil von den PatientInnen getragen werden. Im staatlichen Operationstourismus sind PatientInnen hingegen aufgrund von Versorgungsengpässen gezwungen, medizinische Dienstleistungen im Ausland zu beziehen, deren Kosten von der Krankenversicherung übernommen werden. Der freiwillige Patiententourismus kann laut Quast wiederum in medizinische Patientenreise und touristische Patientenreise unterteilt werden, abhängig davon, ob die Reise hauptsächlich aus medizinischen Gründen unternommen oder ob die medizinische Behandlung mit einem Urlaub kombiniert wird (vgl. Quast 2009: 7f.). Differenziert wird des Weiteren zwischen krankheitsorientierten Reisen, die darauf abzielen, einen Krankheitszustand zu bekämpfen, und nicht krankheitsorientierten Reisen, deren Ziel die Durchführung von gründlichen Untersuchungen oder kosmetischen Eingriffen darstellt (vgl. Quast 2009: 7). Beide Behandlungsarten können sowohl ambulant als auch stationär erfolgen. Für Quast ist Gesundheitstourismus eine Unterform des Tourismus und erfolgt präventiv oder aus medizinischen Gründen. Unter den präventiven Gesundheitsreisen finden sich als Sonderformen der Erholungs-, Wellness-, Fitness- und Sport- sowie Beauty-Tourismus, während die medizinische Gesundheitsreise in Rehabilitations-, Kur- und Heilbäder- sowie Medizintourismus unterteilt werden kann (vgl. Quast 2009: 9ff.).
Berg beschreibt den Medizintourismus ebenfalls als spezielle Unterform des Gesundheitstourismus und bezeichnet ihn als Patiententourismus. Dabei geht es um „die selbstbestimmte und bewusste Entscheidung, medizinische Leistungen in einem anderen Land als dem Herkunftsland in Anspruch zu nehmen und diese überwiegend selbst zu bezahlen“ (Berg 2008: 169). Er weist darauf hin, dass in der Vergangenheit diese Art des Gesundheitstourismus vorwiegend in eine bestimmte Richtung ging – aus dem Ausland nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und USA –, während heutzutage auch BürgerInnen der oben erwähnten Staaten medizinische Reisen in andere Länder unternehmen. In all diesen Definitionen bildet also die Tourismus- bzw. Reisekomponente den gemeinsamen Nenner von Gesundheits- und Medizintourismus: In beiden Fällen wird eine gesundheitlich oder rein medizinisch bedingte Reise in ein anderes Land als das Herkunftsland geplant. Im Gesundheitstourismus zielen die in Anspruch genommenen Dienstleistungen auf die Erhaltung oder Förderung der Gesundheit ab. Im Medizintourismus werden hingegen Dienstleistungen angeboten, mit denen die Wiederherstellung der Gesundheit im Rahmen einer medizinischen Leistung beabsichtigt wird.
Reisewitz beschreibt ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen Gesundheits- und Medizintourismus: Im Medizintourismus stellt die geplante Maßnahme eine medizinische Dienstleistung dar, die „Eingriffe in die körperliche Integrität von einer gewissen Schwere“ (Reisewitz 2015: 8) mit sich bringt, und für deren Ausübung ein hohes Maß an fachlicher Qualifikation seitens der Ausführenden erforderlich ist. Medizintourismus ist jene
Aktivität von Personen, die sich an einen im Ausland belegenen [sic!] Ort außerhalb ihres gewöhnlichen Umfeldes begeben, um sich dort ohne Verlagerung ihres Lebensmittelpunktes für einen gewissen Zeitraum aufzuhalten, und die dabei Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die in Deutschland als Ausübung der Heilkunde gemäß §1 Abs. 2 HeilPraktG angesehen werden und deren Notwendigkeit sich nicht erst vor Ort akut ergeben hat. (Reisewitz 2015: 9)
Berufe, die diese Qualifikationen aufweisen und in deren Ausübung die oben erwähnten Eingriffe vorgenommen werden dürfen, sind laut Reisewitz in Anlehnung an §1 Abs. 2 HeilPraktG ÄrztInnen, ZahnärztInnen sowie HeilpraktikerInnen.3 Zu den von ihnen durchgeführten Eingriffen zählen auch plastische bzw. Schönheitsoperationen, da sie einen höheren Schwierigkeitsgrad aufweisen und die durchführenden ÄrztInnen bestimmte Fachkompetenzen benötigen, obwohl die chirurgischen Maßnahmen nicht immer als reine gesundheitswiederherstellende Maßnahmen zu betrachten sind. In seiner Auseinandersetzung mit den rechtlichen Fragen des Medizintourismus unterscheidet Reisewitz – je nachdem, wann und wo der Entschluss zur Behandlung gefasst wird – zwischen zwei Arten von Behandlungsreisen: Spontanbehandlungen und geplanten Behandlungsreisen (vgl. Reisewitz 2015: 10f.). Im ersten Fall wird der Entschluss erst am Behandlungsort gefasst, d.h., der Zweck der Reise ist nicht die Behandlung; im zweiten Fall wird die Behandlung im Vorfeld geplant. Reisewitz weist darauf hin, dass bei einer geplanten Behandlungsreise die ausgewiesenen Risiken wegen der guten Planungsmöglichkeiten geringer als bei Spontanbehandlungen sind.
Auch im englischen Sprachraum verweden die Termini medical tourism und health tourism verwendet. In der Encyclopædia Britannica wird medical tourism mit den Bezeichnungen health tourism, surgical tourism, medical travel und internation travel for the purpose of receiving medical care gleichgesetzt (vgl. Rogers 2016) und als Mobilität von PatientInnen definiert, die eine medizinische Behandlung in einem anderen Land aus unterschiedlichen Gründen in Anspruch nehmen. Connell (2011: 7) verwendet in seinen früheren Werken zum Medizintourismus den Terminus medical tourism als Überbegriff für etwaige Reisen, bei denen die Gesundheit die wichtigste Rolle spielt und eine Behandlung mit einer gewissen Schwere beabsichtigt wird. In der englischsprachigen Literatur wird allerdings immer wieder die Frage aufgeworfen, ob das Wort tourism adäquat ist. Obwohl der Bezeichnung medical tourism eine Tourismusdefinition als reine Ortsverlegung bzw. PatientInnenmobilität zugrunde liegt, soll das Wort Tourismus auch „pleasure and relaxation“ (Connell 2011: 3) suggerieren. Dabei wird argumentiert, dass diese beiden Komponenten nicht immer im Vordergrund stehen. So betont Connell (2015: 398) in einem späteren Werk, dass der Terminus medical tourism inadäquat sei, da viele PatientInnen auf medizinisch bedingte Reisen verzichten würden, wenn sie sich der gewünschten Behandlung in ihrem Herkunftsland unterziehen könnten oder dürften. Englischsprachige AutorInnen, die ebenso diese Meinung vertreten, bevorzugen Bezeichnungen wie international medical travel (vgl. Ormond 2015) oder transnational health care (vgl. Botterill et al. 2013 und Connell 2015).
Im Rahmen der vorliegenden Studie wird aufgrund seiner Verbreitung im deutschsprachigen Raum der Terminus Medizintourismus verwendet. Die Autorin versteht darunter eine vorübergehende Verlegung des Wohnortes der PatientInnen ins Ausland aus medizinischen Gründen. Im Rahmen des Medizintourismus unterziehen sich PatientInnen entweder einer geplanten gesundheitswiederherstellenden Behandlung, zu der häufig im Herkunftsland kein Zugang besteht, oder suchen nach einer Diagnose für eine seltene und somit schwer diagnostizierbare Krankheit bzw. einer ärztlichen Zweitmeinung zu einer Diagnose oder zu einem Therapievorschlag.
1.2Die wirtschaftliche Bedeutung des Medizintourismus
Aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung scheint der Medizintourismus das Potenzial zu haben, ein weiteres Marktsegment für DolmetscherInnen zu werden, die im Bereich Medizin arbeiten bzw. ihr Angebot an translatorischen Dienstleistungen diversifizieren möchten. Schon im Jahr 2006 verzeichnete die weltweite Gesundheits- und Medizintourismusindustrie einen Umsatz von über 60 Milliarden Dollar (vgl. Quast 2009: 16). Laut Patients Beyond Borders werden derzeit im Medizintourismus zwischen 74 und 92 Milliarden Dollar erwirtschaftet; 21 bis 26 Millionen PatientInnen aus verschiedenen Ländern geben pro medizinische Reise im Durchschnitt 3.550 Dollar für Untersuchungen, Reise und Transport aus (vgl. PBB 2020).
Die in der medizintouristischen Literatur beschriebenen Reisen können sowohl in Richtung günstigere Länder wie Ungarn oder Thailand als auch in Richtung teurere Regionen wie Europa und USA erfolgen.1 Ausschlaggebend für die Wahl des Reiseziels ist in erster Linie der Grund der Behandlungsreise. In Österreich wurden bisher kaum Studien durchgeführt, die den Medizintourismus, wie er in der vorliegenden Studie definiert wird, analysierten und die Anzahl der PatientInnen, die Österreich als Behandlungsort wählen, zentral erfassten.2 Die meisten Studien betreffen den breiter angelegten Gesundheitstourismus und zielen zumeist darauf ab, das Potenzial für die Tourismusindustrie zu eruieren. Die ermittelten Daten belegen die faktische internationale Präsenz von PatientInnen in Österreich sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung: 2009 machten die gesundheitstouristischen Nächtigungen rund 23% (18 Millionen) der gesamten gewerblichen Nächtigungen (ohne Ferienwohnungen) aus, von denen circa zehn Prozent dem „Medical Wellness-Tourismus“ zuzuordnen waren (vgl. BMWFW 2014: 8). In einer Studie des österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft wird der „Medical Wellness-Tourismus“ wie folgt definiert: „Der medizinische Aspekt steht im Fokus der Anwendungen und Behandlungen. Auch der Bereich der Privatkuren (Kuraufenthalte, die nicht durch Sozialversicherungsträger finanziert werden) ist diesem Segment zuzuordnen“ (BMWFJ 2011: 3). Statistische Angaben werden vor allem von Krankenhäusern im privaten Sektor präsentiert. So ließen sich 2011 beispielsweise 11.200 PatientInnen in der Privatklinik Döbling in Wien betreuen, davon kamen etwa zehn Prozent aus dem Ausland (vgl. Gottsauner-Wolf 2012: 3). In den 19 österreichischen Privatkliniken dürften laut österreichischer Wirtschaftskammer acht bis zehn Prozent der Behandelten aus dem Ausland stammen. Diese Gruppe von PatientInnen trägt die Kosten für die gewünschte medizinische Dienstleistung in den meisten Fällen selbst (vgl. Gottsauner-Wolf 2012: 1). Häufig stellen seltene Krankheiten oder komplizierte chirurgische Eingriffe die Gründe für medizinisch bedingte Reisen dar (vgl. Gottsauner-Wolf 2012: 1, Klobassa 2016: 10). In österreichischen Krankenhäusern kann eine starke Präsenz von PatientInnen aus Russland, den arabischen und den GUS-Staaten, Rumänien, der Ukraine, der Schweiz und Weißrussland beobachtet werden (vgl. Klobassa 2016: 38). Zwar ist die finanzielle Situation der PatientInnen nicht in allen Fällen ausschlaggebend für den Entschluss zu einer medizinischen Reise, dennoch gehören die meisten PatientInnen, die sich in Österreich behandeln lassen, der Mittel- und Oberschicht an und bezahlen ihre medizinische Reise aus eigenen Mitteln (vgl. Klobassa 2016: 48ff.). PatientInnen, die nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, greifen häufig auf Privatinitiativen wie Crowdfunding, Wohltätigkeitsveranstaltungen u.a. zurück oder machen ihre Ansprüche auf Basis der Patientenmobilitätsrichtlinie (vgl. 1.3) geltend. In der bislang einzigen Studie, die sich speziell dem Medizintourismus in Österreich widmet, präsentiert Klobassa (2016: 18) Österreich als ein weitgehend unbekanntes Land im weltweiten Medizintourismus, das aber aufgrund der sehr guten Qualität der medizinischen Versorgung und der hohen PatientInnensicherheit ein großes Potenzial in dieser Hinsicht aufweist. Im Rahmen ihrer Studie führt Klobassa die Unbekanntheit der medizintouristischen Destination Österreich auf eine fehlende professionelle Werbung zurück, da in Österreich bislang nur Privatkliniken über ausreichend Erfahrung mit PatientInnen dieser Art verfügen und aktiv PatientInnenakquise betreiben. Das Potenzial des Medizintourismus wird in Österreich aufgrund einer nicht professionellen Vermarktung des Angebots nicht ausgeschöpft (vgl. Gottsauner-Wolf 2012: 2). Die österreichischen Krankenhäuser scheinen zu zögern. Die öffentlichen Spitäler konzentrieren sich überwiegend auf die Versorgung der im Inland lebenden Bevölkerung, während die privaten Kliniken durch den zusätzlichen Aufwand – von der Visumbeschaffung bis zur Beauftragung von DolmetscherInnen – von der Betreuung der Gäste abschrecken lassen. Eine wichtige Rolle im Medizintourismus spielen einzelne ÄrztInnen, die auch außerhalb des Landes über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügen, oder Internetportale, die den Behandelten ein umfassendes und spezialisiertes Leistungsspektrum anbieten (vgl. Gottsauner-Wolf 2012: 2f.).
Deutschland zählt hingegen zu den beliebtesten medizintouristischen Destinationen und hat das Potenzial dieses Sektors bereits erkannt (vgl. Spielberg 2009, Grätzel von Grätz 2010). Hier wird der Medizintourismus durch die Bildung von Gesundheitsclustern (vgl. Gottsauner-Wolf 2012: 2) wie jenem der bayerischen Landesregierung Bavaria – Better State of Health begünstigt, das in der Vermarktung des jeweiligen Landes als Anlaufstelle für ausländische PatientInnen von großer Bedeutung ist.3 Die Vernetzung von Kliniken, ÄrztInnen, Hotels und DienstleisterInnen ist für den Erfolg des Medizintourismus in Deutschland verantwortlich (vgl. Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 2016). Das Potenzial des Medizintourismus kann als Wirtschaftsfaktor genutzt werden, wenn eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen und VertreterInnen der Gesellschaft vorhanden ist (vgl. Kirsch 2017: 22).4 Anders als in Österreich werden in Deutschland von verschiedenen Institutionen regelmäßig Studien zum Medizintourismus veröffentlicht. Laut dem Statistischen Bundesamt Deutschland ließen sich im Jahr 2007 70.898 ausländische PatientInnen in deutschen Kliniken behandeln (vgl. Spielberg 2009), während die Anzahl deutscher StaatsbürgerInnen, die im selben Jahr im Ausland eine Behandlung in Anspruch nahmen, von den deutschen Kassenverbänden auf ca. 300.000 geschätzt wurde (vgl. Reisewitz 2015: 13). Im Jahr 2014 wurden 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet und 251.000 ausländische PatientInnen unterzogen sich stationären bzw. ambulanten Behandlungen in Deutschland, was laut einer Studie der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin einer Steigerung von 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach (vgl. Deutsche GesundheitsNachrichten 2016, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 2016).5 Laut Juszczak (2008: 6) ließen sich PatientInnen folgender Nationalitäten 2007 in Deutschland am häufigsten behandeln: Auf Platz 1 befinden sich die Niederlande (6.732), gefolgt von Frankreich (5.608), Österreich (4.823), Polen (4.763), Belgien (3.383), Russland (2.807), der Schweiz (2.566), Italien (2.375), Großbritannien (2.297) und den USA (1.856). Auch zehn Jahre später kommen die meisten PatientInnen noch aus diesen Herkunftsländern (vgl. OperationsKarriere 2018).
1.3Der Medizintourismus innerhalb der Europäischen Union
Auch innerhalb der Europäischen Union reisen PatientInnen aus medizinischen Gründen. In diesem Kontext wird der Medizintourismus vorwiegend als PatientInnenmobilität bezeichnet. Durch die Einführung der Richtlinie 2011/24/EU – auch Patientenmobilitätsrichtlinie genannt –, die PatientInnen aus der EU, aus dem EWR-Raum sowie aus Liechtenstein, Island und Norwegen den Zugang zur sicheren und qualitativ hochwertigen grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung garantiert, wird die PatientInnenmobilität geregelt und begünstigt:
Diese Richtlinie zielt darauf ab, Regeln zu schaffen, die den Zugang zu einer sicheren und hochwertigen grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in der Union erleichtern und die Patientenmobilität im Einklang mit den vom Gerichtshof aufgestellten Grundsätzen gewährleisten und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Gesundheitsversorgung fördern, wobei gleichzeitig die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Festlegung der gesundheitsbezogenen Sozialversicherungsleistungen und für die Organisation und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen und medizinischer Versorgung sowie der Sozialversicherungsleistungen, insbesondere im Krankheitsfall, uneingeschränkt geachtet werden sollen. (RL 2011/24/EU)
Die Patientenmobilitätsrichtlinie schafft ein Regelwerk für die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Diese haben eine nationale Kontaktstelle einzurichten, die die BürgerInnen über ihre Ansprüche informieren soll, und sind für die „Festlegung der gesundheitsbezogenen Sozialversicherungsleistungen und für die Organisation und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen und medizinischer Versorgung sowie der Sozialversicherungsleistungen […]“ zuständig (RL 2011/24/EU). Durch die Einführung der Patientenmobilitätsrichtlinie wurden PatientInnenreisen in Europa zumindest auf finanzieller Ebene erleichtert, denn die Kosten für die Behandlung in einem anderen EU-Land können bis zu der Höhe erstattet werden, die bei einer ähnlichen Behandlung im Inland angefallen wären (vgl. RL 2011/24/EU bzw. BMG 2016). Bei komplexeren Behandlungen, die ein „erhöhtes Planungsbedürfnis“ (BMG 2016, Pt. 14) aufweisen bzw. einen stationären Aufenthalt erfordern, ist meistens eine Genehmigung einzuholen. Die EU-Richtlinie schreibt vor, dass der Antrag in folgenden Fällen vor der Behandlung einzureichen ist: bei Übernachtungen im Krankenhaus, für Behandlungen mit „Einsatz einer hoch spezialisierten und kostenintensiven medizinischen Infrastruktur oder medizinischen Ausrüstung“ (RL 2011/24/EU, Art. 8 Abs. 2 Buchstabe a) und für Behandlungen mit einem Risiko für die PatientInnen (vgl. RL 2011/24/EU, Art. 8, Abs. 2, Buchstabe b). 14 EU-Länder verlangen einen solchen Antrag vor der Behandlung für die im Artikel 8 Abs. 2 Buchstabe a beschriebenen Eventualitäten; allerdings hat kein einziges dieser 14 Länder die Kriterien für die Kostendeckeng im Rahmen einer Übernachtung in einem Krankenhaus definiert (vgl. Europäische Kommission 2015b: 4ff.). Darüber hinaus haben nur neun Länder spezifiziert, welche Kriterien für die Hochspezialisierung herangezogen werden, obwohl dies laut Richtlinie verlangt wird. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Antrags seitens der Krankenkasse kann je nach Herkunftsland 20 bis 150 Tage betragen (vgl. Europäische Kommission 2015b: 18). Diese Zeitspanne macht die langfristige Planbarkeit der Behandlung schwierig, da für eine Genehmigung in vielen Fällen die genaue Aufstellung der Kosten samt Datum der Behandlungen anzuführen sind. Einer der Gründe für eine positive Entscheidung seitens der Behörde im Herkunftsland sind die Kosten und die Verkürzung von Wartezeiten (vgl. Kirsch 2017: 31), während der Qualitätsfaktor nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Patientenmobilitätsrichtlinie sieht darüber hinaus vor, dass der Mitgliedsstaat, in dem die Behandlung erfolgt, PatientInnen aus anderen Mitgliedstaaten Informationen zur Verfügung zu stellen hat, anhand derer diese eine sachkundige Entscheidung treffen können (vgl. Spickhoff 2015: 17). GesundheitsdienstleisterInnen müssen detaillierte Informationen u.a. zu ihren Preisen und ihrem Zulassungs- oder Registrierungsstatus bereithalten. Dies bedeutet aber nicht, dass solche Informationen für PatientInnen mit einer anderen Sprache als jener des Ziellandes ausführlicher sein müssen (vgl. Spickhoff 2015: 17).
Aufgrund der dargelegten Beschränkungen stellen die Beantragung und Organisation einer Auslandsbehandlung trotz des erleichterten Zugangs zur medizinischen Versorgung innerhalb der EU für PatientInnen nach wie vor eine große Herausforderung dar. In der von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen Studie zur PatientInnenmobilität namens „Study on Public Service Translation in Cross-border Healthcare“ (vgl. Angelelli 2015) zeigte sich, dass PatientInnen, die der Sprache des Ziellandes nicht mächtig sind, trotz der erwähnten Richtlinie nicht den gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben wie die im Zielland lebenden Menschen. Die gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Union enthalten keinen expliziten Hinweis auf die Zuständigkeit für die Zurverfügungstellung von Sprachdienstleistungen im Falle einer PatientInnenmobilität, was bedeutet, dass die PatientInnen selbst für die Beauftragung einer/eines DolmetscherIn oder einer/eines ÜbersetzerIn Sorge zu tragen haben (vgl. Angelelli 2015); darüber hinaus werden Übersetzungs- und Dolmetschkosten nicht zurückerstattet. Die fehlende gesetzliche Regulierung der Zuständigkeit sowie die nicht erfolgende Rückerstattung translatorischer Kosten können in manchen Fällen dazu führen, dass vonseiten der PatientInnen auf professionelle translatorische Leistungen verzichtet wird. Dies kann allerdings die Qualität und den Erfolg der medizinischen Behandlung negativ beeinflussen.
1.4Beweggründe für medizinische Reisen
Die Beweggründe von PatientInnen im Medizintourismus unterscheiden sich hinsichtlich der Behandlung im Vergleich zu inländischen PatientInnen stark. Für Kirsch (2017: 13) bedarf es deswegen neben einer seriösen wissenschaftlichen Untersuchung des Phänomens ebenso einer differenzierten Betrachtung dieser zwei PatientInnengruppen, die durch ihre „unterschiedlichen Motive bei der Auswahl einer Destination, differierenden Bewertungen und Bedürfnisse sowie die weitaus stärkere Heterogenität von Auslandspatienten“ (Kirsch 2017: 14) geprägt sind. In der medizintouristischen Fachliteratur ist bereits eine relativ genaue Beschreibung der Hintergründe medizinischer Reisen zu finden. Berg (2008) identifiziert folgende Beweggründe:
medizinische Leistungen, die im Ausland kostengünstiger und oft sogar qualitativ hochwertiger in Anspruch genommen werden können
PatientInnenmobilität innerhalb der Europäischen Union
Aufstieg vieler Zielländer (wie Thailand) vom Billigtourismusland in Richtung hochwertigen Tourismus
Bestrebung nach Rentabilität seitens der Krankenhäuser und Kliniken
medizinische Unterversorgung in Entwicklungsländern
lange Wartezeiten für chirurgische Eingriffe
Illing (2009) und Quast (2009) fügen folgende Gründe für dieses Phänomen hinzu:
aufgrund der Globalisierung der Sozial- und GesundheitsdienstleisterInnen möglich gewordene Behandlungen in einem anderen Staat, für die ein Antrag auf Rückerstattung der Kosten gestellt werden kann
demografische Entwicklung und der damit verbundene Anstieg an Krankheits- und Pflegefällen
restriktive Zuteilungspolitik des Staates und die konsequente Reduktion des Leistungsumfangs der kostenlosen medizinischen Behandlungen
steigender Rationalisierungsdruck auf Krankenhäuser und die damit verbundenen Notwendigkeit, eine Behandlung an einem anderen Ort durchzuführen
Investitionsbereitschaft der Menschen in die Gesundheit
Ausbau von Flughäfen und die sich daraus ergebende vereinfachte Mobilität
Reisewitz (2015: 14ff.) weist weiters darauf hin, dass medizintouristische Reisen nicht nur aufgrund der Reduzierung des Leistungsumfanges der gesetzlichen Krankenversicherung im Herkunftsland und aufgrund der neuen Möglichkeiten internationaler Mobilität, sondern auch zur Vermeidung langer Wartezeiten im Herkunftsland angetreten werden. Neben dem qualitativen Mehrwert der Auslandsbehandlungen werden „Komforterwägungen“ (Reisewitz 2015: 16) sowie das „Streben nach möglichst perfekter körperlicher Konstitution“ (Reisewitz 2015: 17) angeführt. Auch ExpertInnen im medizinischen Bereich befassen sich immer häufiger mit den Ursachen für Medizintourismus. So unterscheidet die „ÄrzteZeitung“ (vgl. Wallenfells 2015) hinsichtlich der Beweggründe für die PatientInnenmobilität drei Typen von medizintouristischen PatientInnen: PatientInnen, die auf eigene Kosten medizinische Behandlungen im Ausland mit höchsten Qualitätsansprüchen verlangen; PatientInnen, die im Ausland kostengünstige Behandlungen in Anspruch nehmen; PatientInnen, die aufgrund langer Wartelisten im Herkunftsland ins Ausland gehen und auf Kassenkosten (z.B. gemäß der Richtlinie 2011/21/EU) diese Eingriffe vornehmen lassen. Diese Differenzierung vernachlässigt aber jene Menschen, die eine Behandlungsreise aufgrund hoch spezialisierter Eingriffe unternehmen – z.B. jene Menschen, die wegen einer bionischen Handprothese nach Wien reisen, da diese Operation in ihrem Herkunftsland nicht durchgeführt wird – und sich dennoch der Patientenmobilitätsrichtlinie bedienen, um eine Teilerstattung der Behandlungskosten zu erhalten. Auch grenzüberschreitende Bewegungen von PatientInnen zwischen Nachbarländern lassen sich immer häufiger beobachten.1 Darüber hinaus weist Connell (2011 sowie 2015) darauf hin, dass neue Typen von medizinischen Reisenden beobachtet werden können: Menschen, die in Ländern wohnen, in denen gewisse Behandlungen unmöglich oder illegal sind (z.B. Abtreibungen, Fruchtbarkeitsbehandlungen u.a.) sowie Menschen, die zu einem früheren Zeitpunkt ausgewandert sind, aber später aus Kostengründen nur zum Zweck einer bestimmten medizinischen Behandlung (auch einer einfachen Gesundheitsvorsorge) in ihr Herkunftsland zurückreisen.
Wie unter 1.3 bereits erwähnt, wurde das medizinische Reisen innerhalb der Europäischen Union mit der Patientenmobilitätsrichtlinie erleichtert. In diesem Zusammenhang fasst Kirsch (2017: 7ff.) die Ergebnisse der Umfrage „Eurobarometer 2015“ (Europäische Kommission 2015a) zusammen: 5% der Befragten aus allen EU-Ländern unterzogen sich einer spontanen oder geplanten Behandlung in einem anderen EU-Land, fast die Hälfte der Befragten konnte sich solch eine Behandlung innerhalb der EU vorstellen (vgl. Kirsch 2017: 18). 55% der Befragten, die sich keine Behandlung in einem anderen EU-Land vorstellen konnten, gaben als Grund Bequemlichkeit, Angst vor Verständigungsschwierigkeiten oder Unsicherheit betreffend die rechtliche Lage an (vgl. Kirsch 2017: 19). Darüber hinaus wurden die häufigsten Gründe für Behandlungen im Rahmen des Medizintourismus (vgl. Kirsch 2017: 19f.) erforscht: die Nichtverfügbarkeit der benötigten Behandlung im Herkunftsland (71%), die höhere Qualität der medizinischen Behandlung im Zielland (53%), der Wunsch nach namhaften SpezialistInnen, die die Behandlung durchführen (38%), sowie die Dringlichkeit der Behandlung (34%). Der Kostenfaktor wurde nur von 23% der Befragten als Reisegrund angegeben, was laut Kirsch der These zu widersprechen scheint, dass Medizintourismus überwiegend in Richtung günstigerer Destinationen verlaufen würde.
1.5Das medizintouristische Angebot
Die Analyse des medizintouristischen Angebots unterscheidet sich je nach Definition des Begriffs Medizintourismus und Ausgangsdisziplin der Forschenden. Berg (2008) und Illing (2009) konzentrieren sich zum Beispiel auf den Gesundheitstourismus in puncto Wellness und beschreiben das umfassende Angebot, das von der Vermittlung der Reise über die Dienstleistungen von Kurorten und Bädern bis zu Beherbergungsmöglichkeiten reicht. Quast (2009) legt ihren Fokus auf den Medizintourismus von Deutschland aus in Richtung anderer Zielländer und analysiert unter anderem dessen Produkt,1 Infrastruktur und Distributions- und Kommunikationskanäle. Quast (2009: 28ff.) unterteilt das medizintouristische Angebot in primäre, sekundäre und tertiäre Angebote. Das primäre Angebot stellt das eigentliche Produkt dar: die medizinische Leistung. Im sekundären Angebot sind Zusatzprodukte enthalten, die zwar keinen rein medizinischen Zweck erfüllen, aber die Voraussetzung für den Erfolg der medizinischen Reise bilden. Beispiele der Produkte innerhalb dieser Kategorie sind die Klinik mit ihrer Einrichtung und Ausstattung, die Verpflegung, die kürzeren Wartezeiten im Vergleich zu den regulären Behandlungen, die Dolmetschleistungen, die Möglichkeit der Religionsausübung und die Berücksichtigung religiöser und kultureller Traditionen. Das tertiäre Angebot beinhaltet schließlich ergänzende Produkte wie die Erledigung der Reiseformalitäten für die Betroffenen und deren Begleitpersonen, die Betreuung vor Ort, die Organisation von Taxi- oder Bustransfers sowie Freizeitaktivitäten und Vor- und Nachsorge.
1.5.1Art der medizinischen Behandlung
Die Identifikation der im Medizintourismus angebotenen Behandlungsarten ist nicht nur aufgrund der in zahlreichen Fällen fehlenden statistischen Zentralerfassung medizintouristischer Daten, sondern auch durch unterschiedliche Auslegungen des Begriffs Medizintourismus relativ schwierig. So ist eine strukturierte Präsentation der Behandlungsarten für das medizintouristische Zielland Österreich aufgrund fehlender Studien kaum möglich. Im Rahmen der Interviews mit vier medizintouristischen Fachexperten, die für die Untersuchung des Medizintourismus in Österreich von Klobassa (2016: 41ff.) geführt wurden, wurden folgende medizinische Bereiche erwähnt, die von ausländischen PatientInnen häufig angefragt werden: Chirurgie sowie Schönheitschirurgie, Herz- und Lungenchirurgie, viszerale Chirurgie und Onkologie. Darüber hinaus reisen zahlreiche PatientInnen für eine Vorsorgeuntersuchung oder Diagnoseüberprüfung nach Österreich (vgl. Kobassa 2016: 22). In seiner Unterscheidung zwischen dem qualitäts- und dem kostenorientierten Medizintourismus analysiert Berg (2008: 171ff.) die verschiedenen Behandlungsarten. Im qualitätsorientierten Medizintourismus, der Länder wie Deutschland, die Schweiz, Österreich, die skandinavischen Länder oder die USA als Behandlungsorte umfasst, gibt es insbesondere eine Nachfrage für komplizierte Eingriffe, die im Herkunftsland der PatientInnen aufgrund mangelhafter Versorgung oder veralteter Behandlungsmethoden nicht durchgeführt werden können. Die größte Nachfrage gibt es bei schweren Frakturen, Erkrankungen der inneren Organe, Herz-, Kreislauf- und Atemwegserkrankungen sowie kosmetischen Operationen (vgl. Berg 2008: 171ff.). Im kostenorientierten Medizintourismus, der durch eine Bewegung aus den oben genannten reicheren Ländern in Richtung günstigerer medizintouristischer Zielländer gekennzeichnet ist, unterziehen sich hingegen PatientInnen aus Gründen der Kostenersparnis einer Behandlung in Drittländern: Im Herkunftsland sind die Kosten der gewünschten Behandlungen zu hoch, weshalb sie sich für eine Behandlung im Ausland entscheiden. In manchen Fällen werden die Kosten sogar von der Krankenversicherung des Herkunftslandes erstattet. Bei dieser Art des Medizintourismus gibt es unter anderem eine Nachfrage für Zahnersatz, Kuren, Augenbehandlungen und Schönheitsoperationen (vgl. Berg 2008: 171ff.). Die vom österreichischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft beauftragte Studie „Gesundheitstourismus in Österreich 2014“ konzentriert sich in erster Linie auf touristische Angebote mit explizitem Gesundheitsbezug in Thermen und Kuranstalten (vgl. BMWFW 2014). Reine medizintouristische Angebote werden von der Studie außer Acht gelassen. Laut einer Umfrage des Eurobarometers 2015 (vgl. Europäische Kommission 2015a, Kirsch 2017: 20) wurden im Jahr 2014 innerhalb der Europäischen Union folgende Behandlungsarten im Rahmen des Medizintourismus häufig in Anspruch genommen: Onkologie (53% der Befragten), Herzchirurgie (38%), Zahnmedizin (28%), diagnostische Behandlungen (26%), Endoprothetik (Hüftgelenke und Knieprothesen) (19%), Behandlungen von grauem Star (17%).
1.5.2Dienstleistungskette im Medizintourismus
Laut Quast (2009: 31ff.) ist zwischen drei Arten medizinischer Reisen zu differenzieren: Individualreisen, Pauschalreisen und der Inanspruchnahme individueller Angebote. Bei der Individualreise übernehmen die PatientInnen meist selbst die Organisation der Gesamtreise und greifen nur in speziellen Fällen auf die Unterstützung Dritter zurück. Bei der Pauschalreise wird den PatientInnen ein Komplettpaket offeriert, das auch maßgeschneidert sein kann. Im dritten Fall erstellen Reiseagenturen oder andere Vermittlungsinstanzen individuelle Angebote basierend auf den Bedürfnissen der PatientInnen.
Unabhängig von der Art der Reise nehmen PatientInnen im Medizintourismus unterschiedliche Dienstleistungen in Anspruch, damit sie sich der gewünschten medizinischen Behandlung unterziehen können. Die sich daraus ergebende organisatorische Servicekette (vgl. Quast 2009: 31) besteht aus mehreren Dienstleistungen, die vor, während oder nach der medizinischen Reise benötigt werden. Vor der Reise erfolgen z.B. die Übermittlung von Informationen, die Buchung der Reise sowie der behandlungsrelevanten Termine und die tatsächliche Anreise. Während der Reise werden Dienstleistungen in Anspruch genommen, die mit der Unterkunft und Verpflegung sowie mit der medizinischen Behandlung im Zusammenhang stehen; in manchen Fällen werden auch touristische Aktivitäten angefragt.1 Nach der Behandlung erfolgen die Rückreise ins Herkunftsland und eine Nachbetreuung durch die medizinische Einrichtung.
Die Erwartungen seitens der PatientInnen an die angebotene medizintouristische Leistung können je nach Art des betriebenen Medizintourismus stark variieren. Insbesondere bei Menschen mit einem höheren sozialen Status werden häufig Wünsche beobachtet, deren Erfüllung eine umfangreiche Planung und Koordination der medizinischen Reise erfordern. In seiner Untersuchung russischer PatientInnen in Deutschland stellt Juszczak (2017: 56) fest, dass von diesen neben den Behandlungsterminen und Check-ups bei verschiedenen SpezialistInnen auch Transfer- und Übernachtungsmöglichkeiten angefragt werden. Darüber hinaus wünschen sich viele PatientInnen eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch eine Pflegekraft sowie ein Unterhaltungsprogramm für die Begleitpersonen. In Tab. 1 werden die Erwartungen russischer PatientInnen nach Juszczak (2017: 50f.) zusammengefasst.
Starfaktoren
Kritische Faktoren
Optionale Faktoren
Strategische Faktoren
(Hohe Wichtigkeit/hohe Zufriedenheit)
(Mittlere Wichtigkeit/hohe Zufriedenheit)
(Mittlere bis geringe Wichtigkeit/hohe Zufriedenheit)
Vorbereitung der Unterlagen (u.a. Übersetzung der Dokumente)
Kommunikation in russischer Sprache und Dolmetschdienstleistungen
Zimmerausstattung
24-Stunden-Erreichbarkeit
Unterstützung bei der Abrechnung
Detaillierte Rechnungsstellung
Russischsprachiges Personal in der Klinik
Reiseorganisation und Transfers
Betreuung durch die VermittlerInnen
Nachbetreuung
Freizeitgestaltung
ChefärztInnenbehandlung
Flexibilität
Erwartungen russischsprachiger PatientInnen nach Juszczak (2017: 50f.)
Zu den Erwartungen der PatientInnen mit hoher Wichtigkeit zählen außerdem translatorische Leistungen in Form von Übersetzungen und Dolmetschungen. Obwohl sich Tab. 1 nur auf russische PatientInnen bezieht, ist anzunehmen, dass manche dieser Erwartungen sprach- und kulturübergreifend sind. Andere Erwartungen könnten hingegen vom PatientInnenstatus und von der Auswahl der Destination abhängen (vgl. Kirsch 2017: 14). So weist Spielberg bezogen auf arabische PatientInnen in Deutschland darauf hin, dass viele PatientInnen hohe Erwartungen hegen, neben dem medizinischen Produkt eine Reihe von Dienstleistungen benötigen und sich häufig eine individuelle Rundumbetreuung „einschließlich touristischer Angebote, Rücksichtnahme auf Ernährungs- und religiöse Gewohnheiten, Transfer- und Dolmetscherdienste […]“ wünschen (Spielberg 2009: 2).
1.5.3Stakeholder im Medizintourismus
An der medizintouristischen Servicekette können mehrere Stakeholder beteiligt sein, die über unterschiedliche wirtschaftliche Interessen und Angebote verfügen. Zu diesen zählen laut Klobassa (2016: 11):
Versicherungen, die die Risiken der PatientInnen übernehmen und die Ausführenden der Behandlung versichern
AnbieterInnen von Gesundheitsleistungen
AnbieterInnen von Konferenzen zum Medizintourismus, die den verschiedenen Stakeholdern Weiterbildungsmaßnahmen und Informationsaustausch zu aktuellen Marktentwicklungen ermöglichen
Finanzdienstleistungsunternehmen, die die PatientInnen bei der Finanzierung der Reise unterstützen
Reiseagenturen, die die medizinische Reise vermitteln sowie organisieren und die PatientInnen betreuen
verschiedene PatientInnenvermittlungsinstanzen, die als Broker die Geschäftstransaktionen auf Provisionsbasis ermöglichen
Circa 90% der Krankenhäuser in Deutschland, die im Medizintourismus tätig sind, greifen auf PatientInnenvermittlerInnen zurück (vgl. Juszczak 2017: 61). Die Bezeichnung PatientInnenvermittlerIn kann nicht einheitlich definiert werden, da sie sowohl Einzelpersonen, die über Auslandskontakte verfügen, als auch professionelle Agenturen, die MitarbeiterInnen oder Niederlassungen im Ausland haben, oder Reisebüros, die auch Check-ups vermitteln, umfasst (vgl. Juszczak 2017: 61). Klobassa (2016: 18) bezeichnet die PatientInnenvermittlerInnen als medical tourism companies, als im Medizintourismus aktive Instanzen, die zwischen den anderen Stakeholdern, insbesondere zwischen AnbieterInnen der medizinischen Behandlung, Kliniken und PatientInnen vermitteln.
Im Rahmen ihrer Studie zu den Bedürfnissen internationaler PatientInnen führt Boscher (2017: 115f.), Expertin im Bereich PatientInnenvermittlung, jene Tätigkeiten an, die notwendig sind, damit PatientInnen die gewünschte medizinische Leistung im Ausland in Anspruch nehmen können. Dazu gehören:
die Kontaktherstellung
die Bearbeitung der Erstanfrage
die Ermittlung der medizinischen Ausgangssituation oder des medizinischen Problems
die Recherchetätigkeit, um die richtige medizinische Einrichtung sowie die passenden SpezialistInnen zu finden
die Sammlung aller Daten und Unterlagen zur Krankengeschichte
die Einholung von Behandlungsangeboten und Kostenvoranschlägen
die Erklärung der Inhalte im Gespräch mit den PatientInnen
die Abklärung finanzieller Angelegenheiten
die Unterstützung bei der Visumbeantragung
die Organisation der Termine
die Organisation der An- und Abreise sowie der Unterkunft
Einige dieser Tätigkeiten – in manchen Fällen sogar alle – können von PatientInnenvermittlerInnen übernommen werden. Sie organisieren und koordinieren wesentliche oder eben alle Bereiche der medizinischen Reise und entlasten dadurch die PatientInnen. In vielen Fällen verfügen sie sowohl im Quell- als auch im Zielland über ein Büro sowie über einen starken Internetauftritt in allen für ihren Markt relevanten Sprachen. Boscher (2017) führt an, dass die meisten PatientInnenvermittlerInnen informell arbeiten und sich ihres Netzwerkes im Herkunftsland der PatientInnen bedienen, um die Zielgruppe zu erreichen. Sie stammen zumeist aus dem Herkunftsland der PatientInnen, leben im medizintouristischen Zielland und sind mit dessen Gesundheitssystem vertraut. PatientInnenvermittlerInnen schließen entweder mit den PatientInnen oder mit Kliniken einen Vertrag ab, der den Umfang der Dienstleistung und deren Honorierung festlegt (vgl. Boscher 2017: 120ff.). Allerdings ist die reine Vermittlung von PatientInnen sowohl in Deutschland als auch in Österreich problematisch, da ÄrztInnen laut ihrer Berufsordnung keine Provision für die Vermittlung von PatientInnen kassieren dürfen (vgl. Boscher 2017: 122f.). Darüber hinaus wurde in Deutschland die Dienstleistung des reinen Vermittelns für unzulässig und sittenwidrig erklärt, da Vermittlungsinstanzen nicht über das nötige fachlich-medizinische Wissen verfügen, um PatientInnen an angemessene Kliniken zu vermitteln, und die Gefahr besteht, dass sie nur jene Kliniken, mit denen sie einen Vertrag abgeschlossen haben, weiterempfehlen (vgl. Boscher 2017: 123f.). Diese Umstände führten dazu, dass viele PatientInnenvermittlerInnen ihre Leistung als PatientInnenbetreuung deklarieren und in Rechnung stellen (vgl. Stuckenberg 2018). Zu den wichtigsten Kompetenzen von PatientInnenvermittlerInnen zählt Boscher die Sprach- und Kulturkompetenz (vgl. Boscher 2017: 119). Für ärztliche Gespräche arbeiten einige PatientInnenvermittlerInnen mit DolmetscherInnen zusammen, die sie nach erfolgreicher Vermittlung der medizinischen Reise häufig wieder kontaktieren (vgl. Boscher 2017: 128ff.). In vielen Fällen scheint aber die Qualität der translatorischen Leistung zur Überwindung von Sprachbarrieren für PatientInnenvermittlerInnen keine primäre Rolle zu spielen (vgl. u.a. Slavu 2017, Weissenhofer 2017). Alle Stakeholder, die als Teil der medizintouristischen Servicekette fungieren, sind verschiedenen Risiken – u.a. Problemen während des Transports, Unfällen jeglicher Art oder unerwarteten Erkrankungen vor dem Antritt der Reise oder am Behandlungsort – ausgesetzt, die zu einer Behinderung oder Stornierung der Behandlung führen können. So ein Fall kann für alle Beteiligten schwerwiegende Folgen haben, die in vertraglichen Vereinbarungen jedoch geregelt sein können. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass eine plötzliche Erkrankung oder der Tod von PatientInnen ebenso für die DolmetscherInnen erhebliche Schwierigkeiten finanzieller, organisatorischer und psychologischer Natur mit sich bringen. Daher sollten DolmetscherInnen genauso Vorkehrungsmaßnahmen treffen, um in solchen Situationen über eine finanzielle Vorsorge oder einen psychologischen Selbstschutz (Self-Care-Maßnahmen) zu verfügen.
In manchen Fällen können sogar Krankenhäuser, ÄrztInnen oder PatientInnen die Aufgaben der PatientInnenvermittlung oder die Koordination übernehmen. Krankenhäuser spielen im Medizintourismus in Deutschland (vgl. Berg 2008: 173) und Österreich (vgl. Gottsauner-Wolf 2012: 2) eine umstrittene Rolle, da ihnen häufig vorgeworfen wird, mit der Beteiligung am Medizintourismus auf zusätzlichen Profit abzuzielen und ihren eigentlichen Zweck – die nationale Gesundheitsversorgung – aus den Augen zu verlieren. In Deutschland und Österreich haben zwar zahlreiche Krankenhäuser den Medizintourismus als attraktive zusätzliche Einnahmequelle (vgl. Berg 2008: 173) erkannt, allerdings nehmen sie kaum Risiken auf sich, da neue Märkte wie der Medizintourismus nur schwer vorhersehbar sind (vgl. Gottsauner-Wolf 2012: 3). In Deutschland finden sich – insbesondere in großen Städten – zahlreiche Krankenhäuser (vgl. Elsholz 2013: 36f., Klinikum der Universität München 2020, UKE 2020), die internationale PatientInnen anwerben und über international offices verfügen, die den PatientInnen den organisatorischen Aufwand, der mit einer medizinischen Behandlung im Ausland verbunden ist, abnehmen. Auch in Österreich steigt – wie bereits erwähnt – die Zahl privater Krankenhäuser, die ausländische PatientInnen aktiv umwerben und die hochqualitative österreichische Medizin sowie Kulturkompetenz des dort tätigen Personals als Werbefaktor nutzen. So übernimmt PremiQaMed, ein österreichischer Betreiber privater Gesundheitsunternehmen (z.B. Privatklinik Döbling), auf Wunsch internationaler PatientInnen die Planung und Koordination der medizinischen Reise inklusive der Beschaffung des Einreisevisums, der Hotelreservierung und der Beauftragung von DolmetscherInnen (vgl. Gottsauner-Wolf 2012: 2). Allerdings stellt Klobassa (2016: 49) ein generelles mangelndes Engagement in Österreich fest: „Private Krankenhäuser und Ärzte werben lediglich für sich selber. Dies führt aber nicht zu volkswirtschaftlichen Vorteilen“ (Klobassa 2016: 49). Laut Klobassa ist der Medizintourismus in Österreich generell durch einen fehlenden gemeinsamen Auftritt der Krankenhäuser und ÄrztInnen geprägt. Krankenhäuser fallen darüber hinaus unter die Zuständigkeit der Bundesländer, was ein Gesamtkonzept zusätzlich erschwert.
1.5.4Das Internet und die Suche nach dem passenden Angebot
Das Internet nimmt mittlerweile eine besonders wichtige Funktion im Rahmen der Informationsbeschaffung ein. Auch im Bereich des Medizintourismus ist eine verstärkte Präsenz von Internetseiten, die entweder als Vermittlungsportale oder als Dokumentationsquellen fungieren, festzustellen (vgl. u.a. Medical Tourism 2020). Mittlerweile nutzen viele medizintouristische PatientInnen das Internet als wichtige Informationsquelle für die Auswahl des ausländischen Behandlungsorts (vgl. Reisewitz 2015: 32, Klobassa 2016: 9). Auch Klinikverzeichnisse stellen eine hilfreiche Informationsquelle dar und ermöglichen zum Teil einen direkten Kontakt zwischen PatientInnen und der ausgewählten medizinischen Einrichtung. Die Internetauftritte der verschiedenen Einrichtungen unterscheiden sich allerdings sehr stark hinsichtlich des Inhalts, der Qualität und der technischen Aufbereitung (vgl. Juszczak 2017: 56). Rein deutschsprachige Websites erfahren weniger Resonanz als jene, die zumindest auch auf Englisch verfügbar sind. Bei der Gestaltung des Inhalts von Websites für den medizintouristischen Auftritt weist Juszczak (2017: 58) auf die Notwendigkeit hin, nicht nur die Fremdsprache, sondern auch die jeweiligen kulturellen Aspekte zu berücksichtigen. Aus translatorischer Sicht ist der Medizintourismus daher unbedingt als zusätzliches Einsatzgebiet für ÜbersetzerInnen zu sehen.
Im Internet kann des Weiteren das Aufkommen zahlreicher Foren (vgl. AINPU 2020) beobachtet werden, die vonseiten der PatientInnen oder von nationalen Verbänden ins Leben gerufen werden und dem informellen Informations- und Erfahrungsaustausch jener Menschen dienen, die von einer bestimmten Pathologie betroffen sind. Neben detaillierten Berichten über ihr persönliches Leiden und ihre Therapie werden ForennutzerInnen auch Informationen zu und Kontaktdaten von ÄrztInnen sowie anderen DienstleisterInnen wie DolmetscherInnen zur Verfügung gestellt. Diese Foren können als eine Form von Empfehlungsmarketing eingestuft werden und für DienstleisterInnen in diesem Bereich von großem Nutzen sein. Auch Länder oder Städte setzen auf eine verstärkte Internetpräsenz, um ausländische PatientInnen anzuwerben. Als Beispiel dienen die Stadt Wien (Wien Tourismus 2020) und Köln (Köln Tourismus 2020), die auf den jeweiligen Tourismusportalen die hervorragende Medizin der städtischen Krankenhäuser bewirbt. Um die Zielgruppe adäquat anzusprechen, werden auf den erwähnten Seiten die Vorteile der privaten Krankenhäuser wie kurze Wartezeiten, hohe Qualität und attraktive Nebenleistungen – unter anderem nach Bedarf auch die Bereitstellung von DolmetscherInnen – besonders hervorgehoben. Diese vermehrte Internetpräsenz bringt allerdings einige Gefahren mit sich, denn manche Angebote können unseriös sein (vgl. Gottsauner-Wolf 2012: 3).
1.6PatientInnentypen
Je nach Beweggrund für die medizinische Reise ist es möglich, verschiedene Klassifizierungen der PatientInnen vorzunehmen. Berg (2008: 87ff.) bietet in seinem Modell einen Überblick über unterschiedliche PatientInnentypen. Ausgangsbasis der Klassifizierung ist die für Marketinganalysen klassische Segmentierung der Nachfrage. Berg hebt dabei das unterschiedliche Potenzial der PatientInnen hinsichtlich ihrer Bereitschaft, die Kosten für Gesundheits- oder medizinische Leistungen selbst zu tragen oder auf die Krankenversicherung zurückzugreifen, hervor (siehe Tab. 2).
PatientInnen als präventive NachfragerInnen
Proaktives Verhalten: präventive Gesundheitsmaßnahmen
Zahlwillig, aber oft nicht zahlfähig
PatientInnen als kurative NachfragerInnen
Gesundheitsleistungen, um eine bereits aufgetretene oder eintretende Krankheit ambulant oder stationär zu behandeln
Wunsch nach alternativen Heilungsmethoden
PatientInnen als rehabilitative NachfragerInnen
Postkurative Behandlung (normalweise von TherapeutInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen oder in speziellen Rehabilitationseinrichtungen)
Mehrheit der Leistungen im Angebot der Krankenversicherung enthalten
PatientInnen als NachfragerInnen nach Pflege
Menschen in dauerhaft pflegebedürftigem Zustand; ständige Betreuung (auch Körperpflege, Ernährung und Haushaltsversorgung)
PatientInnentypen nach Berg (2008: 8)
Juszczak und Ebel (2009: 103f.) unterscheiden zwischen den Typen von PatientInnen ausgehend vom medizintouristischen Angebot und ergänzen die von Berg ermittelten Bedürfnisse und Behandlungen um neue PatientInnentypen (siehe Tab. 3).
Medizin-
touristInnen
Medizinischer Eingriff im Ausland
Die gewählte Klinik kann zwar die Zielgruppe aus medizinischer Sicht optimal betreuen, deren Angehörigen kann sie aber kein Zusatzprogramm (Hotelbuchung, Freizeitgestaltung usw.) anbieten.
Low-Care-PatientInnen
Schnelle Behandlung im Ausland und sofortige Entlassung
Die Nachversorgung kann im Hotel (oft in einem PatientInnenhotel oder in einer Hotelstation im Krankenhausverband) stattfinden.
GesundheitstouristInnen
Präventive Untersuchung bei ÄrztInnen im Ausland (Vorsorgeuntersuchung)
Medical-Wellness-TouristInnen
Wellnessangebote im Hotel
Relevanz eines gesunden Lebensstils
Mögliche Verbindung medizinischer Untersuchungen
Business-Health-PatientInnen
ArbeitgeberIn stellt einen Gesundheitscheck als incentive zur Verfügung.
Hotelübernachtung und Rahmenprogramm im Paket enthalten
Reha-PatientInnen sowie Angehörige
Medizinische Behandlung inklusive Nutzung touristischer Angebote an den behandlungsfreien Tagen
Chronisch Kranke und Angehörige
Angehörige suchen nach einer Urlaubsmöglichkeit, die mit der Behandlung oder Versorgung einer kranken Person kombiniert werden kann.
PatientInnentypen nach Juszczak und Ebel (2009: 103f.)
Cohen (2008: 25ff.) führt folgende Begriffe ein, um zwischen TouristInnen und PatientInnen zu unterscheiden: mere tourist, medicated tourist, medical tourist proper, vacationing patient, mere patient. Zur ersten Kategorie des mere tourist gehören jene Menschen, die einfach reisen wollen und keine medizinischen Dienstleistungen während des Urlaubs in Anspruch nehmen. Als medicated tourists gelten reisende Menschen, die sich während des touristischen Aufenthaltes einer ungeplanten dringenden Behandlung unterziehen müssen. Zur Gruppe des medical tourist proper zählen jene PatientInnen, die sowohl aus touristischen als auch medizinischen Gründen verreisen. Als vacationing patients gelten Personen, die eine Reise hauptsächlich aus medizinischen Gründen unternehmen und während des Auslandsaufenthaltes einige touristische Angebote in Anspruch nehmen. Die letzte Kategorie der mere patients bezieht sich schließlich auf PatientInnen, die während des Auslandsaufenthaltes nur eine medizinische Behandlung wünschen und kein touristisches Angebot nutzen.
Ein komplexeres Bild der MedizintouristInnen skizziert Mainil (2012: 48ff.).1 Um seine Typologisierung leichter nachzuvollziehen, werden in Tab. 4 die von ihm verwendeten Akronyme kurz erklärt.
TBAs
Trans-border access
seekers
PatientInnen, die lange, geplante Reisen unternehmen, zumeist über ausreichende finanzielle Mittel verfügen und sich hoch spezialisierte und qualitative Behandlung erwarten, die in ihrem Ursprungsland nicht vorhanden sind oder längere Wartezeiten erfordern
CBAs
Cross-Border access
searchers
Menschen, die aus Grenzregionen stammen, oder Menschen, die einer Sprachgruppe angehören, die über mehrere Länder verstreut lebt und Anspruch auf Rückerstattungen oder Förderungen für die Kosten der Behandlung im Ausland haben oder hoch spezialisierte Behandlungen suchen
RCAs
Receiving context actors
Alle Einrichtungen und AkteurInnen, die für die medizintouristischen PatientInnen am Behandlungsort von Bedeutung sind
SCAs
Sending context actors
Alle Einrichtungen und AkteurInnen im Ursprungsland der medizintouristischen PatientInnen, wie zum Beispiel Versicherungsgesellschaften oder nationale Behörden
Akronyme für die PatientInnentypen nach Mainil (2012: 57)
CBAs und TBAs unterscheiden sich voneinander wegen der Kulturnähe und -distanz. Für Erstere ist die Wahrscheinlichkeit höher, eine medizinische Behandlung in einem Land zu finden, die ihrem Ursprungsland in kultureller Hinsicht entspricht. TBAs bewegen sich hingegen zwischen Regionen mit größeren Kulturunterschieden und haben im Rahmen ihrer medizinischen Reise komplexere Herausforderungen zu meistern. Abb. 1 zeigt die möglichen Kombinationen der oben erwähnten Kategorien.
PatientInnentypen nach Mainil (2012: 57)
Die Kategorien 1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 4B, 5A und 5B stellen eine heterogene Gruppe dar, deren VertreterInnen aus weit entfernten oder mehr oder weniger benachbarten Ländern stammen (CBAs oder TBAs) und sich in einer privaten oder öffentlichen ausländischen Einrichtung behandeln lassen. Sie können jedoch in allen Fällen auf eine öffentliche oder private Krankenversicherung zurückgreifen. Die PatientInnen der anderen Kategorien können jeweils CBAs oder TBAs sein, haben aber keinen Anspruch auf Rückerstattungen oder Förderungen für die Kosten der Behandlung, die in einer privaten oder öffentlichen ausländischen Einrichtung erfolgen kann (vgl. Mainil 2012: 57). Trotz seiner Komplexität zeigt dieses Modell ein facettenreiches Bild der PatientInnen im Rahmen des Medizintourismus und kann sehr hilfreich für ein tieferes Verständnis der an dolmetschvermittelten Interaktionen beteiligten AkteurInnen sein, denn auch die kulturelle Nähe oder Distanz zwischen Quell- und Zielland sowie die finanzielle Abwicklung der medizinischen Reise spielen eine wichtige Rolle hinsichtlich der Ermittlung ihrer Erwartungen und Anforderungen an die DolmetscherInnen.





























