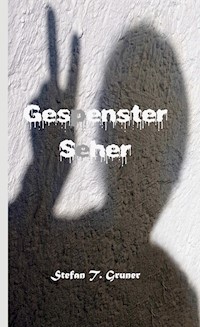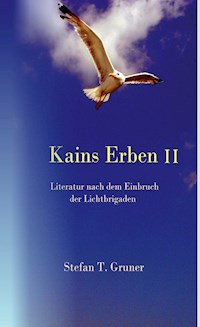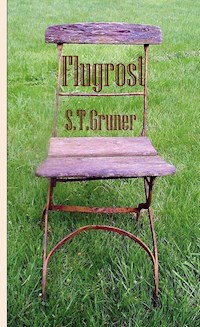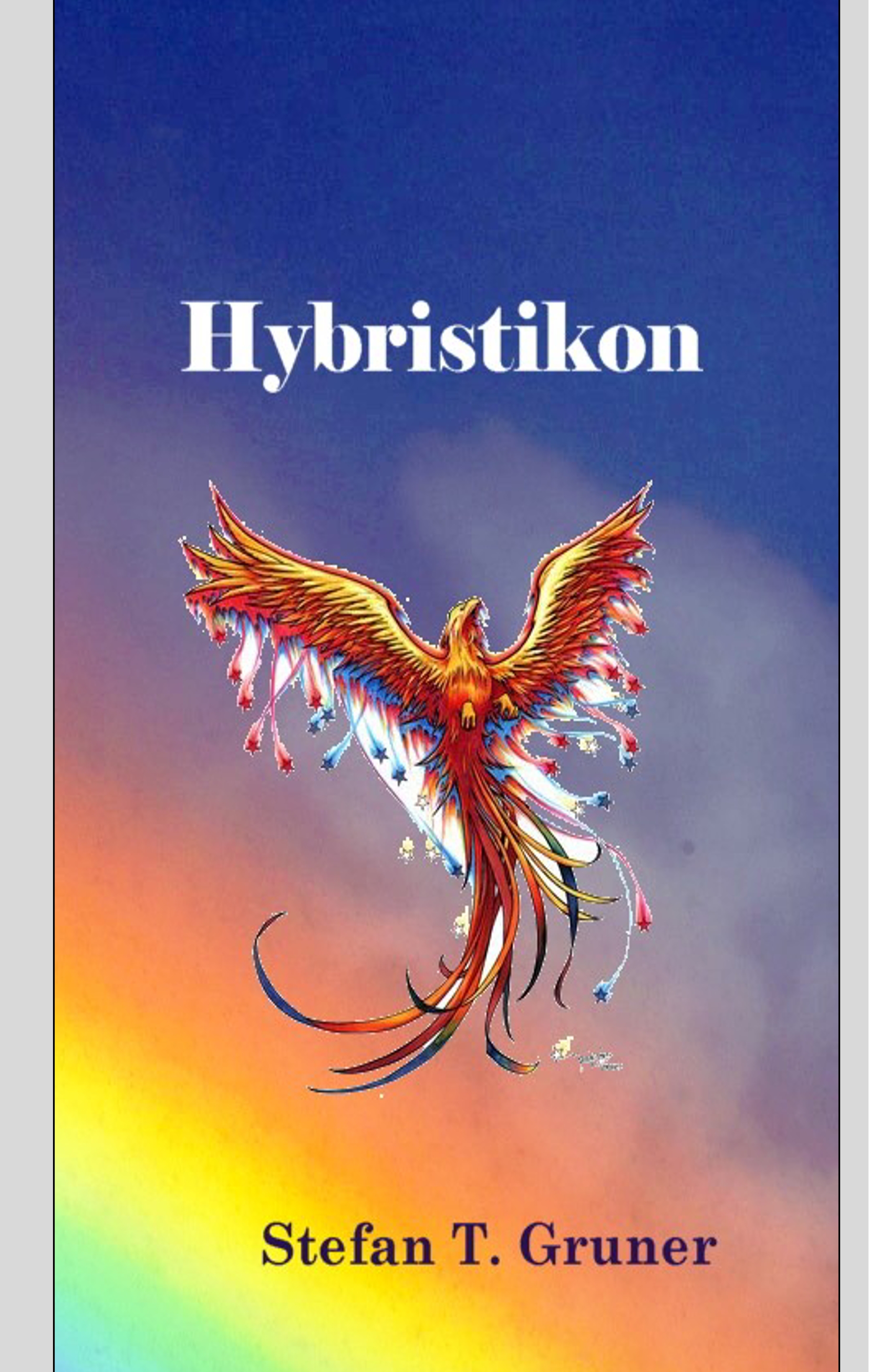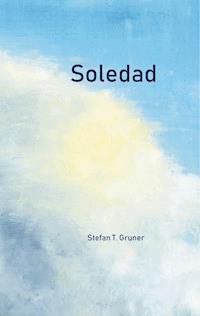Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hubert Fichte plante einen Roman über einen weiblichen Don Quijote. Es ist bei dem Plan geblieben. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts reisten Europäer, vom Unbehagen an ihrer Kultur getrieben, in "exotische" Länder , um das "ganz Andere" zu erleben, zu verstehen und sich - sofern es ihnen den verlorenen Zauber wiedergab - anzueignen. Woran diese Aneignungen samt Rückverzauberungsversuchen scheitern, verdeutlicht Hubert Fichte bei seiner intensiven Beschäftigung mit afroamerikanischen Riten und Heilmethoden. Inzwischen hat sich die Richtung gedreht. Die "ganz Anderen" dringen auf der Flucht vor Armut, Gewalt, Verfolgung und Perspektivlosigkeit nach Europa. Die echte Aneignung (nicht Vereinnahmung!) des Fremden, früher freiwillig und weit weg, ist jetzt eine Notwendigkeit vor Ort, will man die Falle der Populisten vermeiden, die aktuell genau jene abweisen, zu denen ihre Vorgänger für erhoffte Jungbrunnenerlebnisse gereist sind. Bei geschätzten 300 Millionen Migranten weltweit ist die Frage, was echte Aneignung von Fremden hindert oder ermöglich, keine akademische mehr. Hubert Fichte und seiner Partnerin, der Fotografin Leo-nore Mau, geben auf beides Antwort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hubert Fichte bietet Stoff für uferlose literaturtheoretische und konventionskritische Betrachtungen.
Hier liegt der Schwerpunkt ausschließlich auf der Aneignung von Fremden.
Ein Überl0ebensthema.
Sämtliche evolutionären Prozesse gründen auf der Fähigkeit, Teile der Umwelt im Wechsel von Akkommodation und Assimilation zur Eigenwelt zu machen, sich in Anderes zu fügen, es zu vereinnahmen oder − in einer wahren Aneignung – eine gegenseitige Veränderung zu schaffen, in dem beide unbeschadet aufgehoben sind.
Fichte wird als Ganzkörperautor, als Prophet der neuen Sinnlichkeit gelobt. Er steht für den Versuch, seinen eigenen Körper, den Weltkörper und den Sprachkörper ineins zu setzen.
Aneignung bedeutet Selbsterweiterung. Selbsterweiterung setzt Selbstanbietung voraus. Ein krisenträchtiger Prozess! Einerseits fällt es schwer, vom Ich zu lassen, andererseits ist erst bei der Bereitschaft zu Ich-Aufgabe Aneignung von etwas anderem möglich. Ein Schlitterkurs zwischen Allmacht und Ohnmacht.
Fichte meint, es gebe nur einen Gegenstand der Forschung: ihn selbst. Dieses Selbst nennt sich mal Detlev, mal Jäcki, mal Hubert. Sich spiegelnde Selbstausrisse. Eine Montage. Identität eine Illusion. Fakt und Fiktion im Geschriebenen eins.
Der Ausgangspunkt: die Selbstbefragung.
Angestoßen durch den Schock des Befragtwerdens als Kind in einem Kloster-Heim (Erlernen von Schuld).
Später im eigenen Befragen den Spieß umgedreht (Interviews).
Noch später seine Fragen ans Sein und ans Wahre (Forschung).
Das Spalt-Bewusstsein: Fausts Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust. Rimbauds Ich ist ein anderer. Horváths Ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Dieser Zwiespalt hält beweglich, bietet Erweiterung, birgt Risiken, bleibt prinzipiell unabgeschlossen; eine endgültige Versöhnung mit dem ganz Anderen liefert nur der Tod.
Fichte, geboren 1935, lebte als Kind im großelterlichen Mietshaus in Hamburg Lokstedt. Die Mutter, Dora (Mascha) Fichte, arbeitete als Stenotypistin, der jüdische Vater, Reinhard Oberschützky, verließ die Familie kurz nach Huberts Geburt.
Die Mutter erklärt Hubert zum Halbwaisen, obwohl der Vater in Schweden lebt, wohin er emigrierte, um dem Naziregime zu entgehen (oder um ihr, dem Kind, Deutschland oder allen zusammen zu entkommen). Einen Kontakt zum Vater hat es nie gegeben.
Hauptsächlich übernehmen die Großeltern Ida und Paul Fichte seine Erziehung. Großeltern sind große Eltern der Mutter, die oft fehlt. Eine innere Unwucht.
1939 Kriegsbeginn. Völkische Hochstimmung. Kollektive Ekstase für die, die sich als Zugehörige bezeichnen dürfen. Hubert erfährt seine nur halbe Zugehörigkeit zunächst weniger im Sinn der Rassengesetze, sondern im Sinn seines Temperaments. Die Straßen sind beherrscht von Felsenfressermutigen. Fichte hat eher etwas vom „sachten Vorgehen der Tide“. Die Eroberungssüchtigen, Totschlägerwilligen verursachen bei Menschen wie ihm höchstens die Frage warum und woher Gewalt und Vernichtung und wie kriegt man das weg?
1941 wechselt Fichte im Zuge der Kinderlandverschickung in das katholische Waisenhaus von Schrobenhausen / Oberbayern. Die Mutter arbeitet im dortigen Rathaus als Sekretärin.
Die Grundhaltung des Kindes: er steht im Waisenhaus abseits von den anderen auf dem Balkon.
Abseits.
Abgesondert.
In der Beobachter-Distanz.
Ein Besonderer.
Auf dem Balkon:
Erhöht.
In einer Position, die Übersicht ermöglicht.
Ein Abgehobener.
Zunächst kämpft er mit der Benennung Waise. An dem Wort scheint ein Makel zu hängen. Die Klosterfrauen behandeln ihn anders als andere. Er wird strenger kontrolliert, mit Fragen bedrängt, zur Gewissensprüfung gezwungen. Sind Waise krank? Böse? Müssten sie eingesperrt werden? Darf man ihnen die Hand geben?
Die Mutter erklärt ihm, dass Waise mit ai die ohne Eltern oder mit nur einem Elternteil seien und nicht etwa die, die von weisen alten Männern gelobt werden.
Wie kommt das Kind zu einer solchen Wort-Deutung? Gab es schon weise alte Männer, die den Vier- bis Fünfjährigen lobten? Und wieso macht das Lob von weisen alten Männern den Gelobten krank?
Böse?
Dass er eingesperrt gehört?
Dass man ihm besser nicht die Hand gibt?
Die Außenseiterrolle in dem von katholischen Schwestern geführten Haus: er ist nicht nur norddeutsch, er ist evangelisch. Ein Abtrünniger. Ein Irrgläubiger. Ihm fehlt die einzig wahre, die katholische Sicht. Ihm bleiben die erlösenden Glaubensinhalte verwehrt.
Umso mehr faszinieren ihn die Zeremonien, die jene ihm verschlossenen Inhalte am Altar in Szene setzen.
Dem Kind − behauptet der rückblickende Autor − fällt die Ähnlichkeit zwischen religiösen Riten am katholischen Altar (Ministrant) und den profanen Riten in seiner Heimatstadt (Hamburger Straßenjungen) auf: Am Altar schwenken zwei Jungen silberne Weihrauchfässer, in Hamburg schwenken die Jungen Rauchfässer aus Konservendosen an steifen Drähten.
Das Klosterkind ist zwar ein Beobachter, der abseits steht, doch dies „abseits“ bezeichnet nur die räumliche Distanz. Im Gegensatz dazu durchlebt Detlev, was er aus dem räumlichen Abstand sieht, am eigenen Leib. Seine Art der Anteilnahme übersteigt das gewöhnliche Mitgefühl.
Es ist körperliche Übernahme.
Ein Talent.
Ein Fluch.
Die Kirche ergreift. Die Nonnen sind Schwestern. Große Geschwister. Hauben. Vögel. Röcke. Heilige Frauen. Unberührbare. Das wenige Fleisch, was man von ihnen sieht, hat Sogkraft: Stirn, Augen, Nase, Wangen, Mund, Kinn bündeln in sich die Sinnlichkeit des mehrheitlich verhüllten Restkörpers.
Verborgenes, das aus den Augen schimmert.
Verborgenes, das die Lippen wölbt.
Detlev ist in dem Kleinkind-Alter, in dem man bedingungslos dazugehören möchte (im Gegensatz zum späteren jugendlichen Jäcki, der sein Außenseitertum zelebriert). Detlev drückt sich an die knöchellangen Röcke der Gottesdienerinnen. Seine Umarmungsversuche, die unterhalb der Taille bleiben, haben etwas unfreiwillig Sittenwidriges.
Die Schwestern wehren ohne Erklärung ab.
Detlev träumt, dass Schwester Appia hereinschwebe, sich herabbeuge, mit ihrem ausgestreckten Finger unter den Sack mit den zwei Murmeln drücke, genau zwischen seinem Arschloch und seinem Pfeiferl, und mit flatternden Schleiern wieder wegfliege.
Detlev will katholisch werden. Detlev will heilig werden. Detlev will dazugehören. Da ist eine Gewissensprüfung fällig. Eine hochnotpeinliche Befragung. Seine ersten Erfahrungen mit dem Machtgefüge der Befragung − als Opfer.
Als Befragter.
Als Bedrängter.
Als einer der Antwort geben muss.
Gott selbst, nicht die Schwestern befragen ihn.
Gott selbst will durch den Mund von Schwester Appia wissen, ob Detlev bereit sei, sich dem Himmelsvater zu unterwerfen. Nur an ihn als einzig wahren Gott zu glauben. Für das Bekenntnis zu Ihm alle Anfeindungen, alle Leiden auf sich zu nehmen. Als erstes seiner evangelischen Irrlehre den Rücken zu kehren. Sich danach eher ans Kreuz schlagen zu lassen als Ihm abzuschwören und seinen Stellvertreter in Rom zu verraten.
Diese Fragen, von Misstrauen und Kontrolle begleitet, wie sie die anderen Insassen nicht ertragen müssen, jagen Detlev Ängste, Gewissenszweifel und Schuldgefühle ein.
Er ist aus dem Norden,
er ist evangelisch,
er ist anders,
so brauen sich die schrecklichen, zur Bekehrung zwingenden Fragen über ihm zusammen.
Heilig geht nicht ohne Passion − nicht ohne Leidenschaft und ohne Leiden! Das Kind erfährt: dem Herrn Jesus Christus müsse die Passion sehr weh getan haben, doch habe der Heiland gewusst, dass er bald wieder bei seinem Vater im Himmel sein werde, während Judas schon am Baum hänge und ihm der Teufel jedes Eckchen seiner Seele durchnagle.
Sie hätten dem Herrn Jesus Christus Rosenstängel mit entsetzlich langen Dornen auf den Kopf gedrückt.
Detlev solle sich nur einmal ausmalen, sie täten es mit ihm, hier!
Seine Haut würde zerreißen, die Dornen würden durch die Knochen in seinen Kopf stechen und die Peiniger würden schreien: Dem Judenhund, dem Judenschwein geschieht es recht!
Sie zögen ihm die Fingernägel aus, sie steckten ihn unter Wasser, zerstampften seine Füße, bänden ihn an eine Elektrisiermaschine.
Das seien die üblichen Schmerzen der Passion.
Möchte er, dass sie ihm ebenso wehtun, damit er später neben Gottes Thron sitzen dürfe?
Detlev erschauert.
Detlev will.
Da sei der Jude, der ein Schwein sei. Da sei sein Körper, der aufgerissen, von entsetzlich langen Dornen bis zu den Knochen durchbohrt und in Schmerzen aufgelöst werden müsse, um die Seele in die Schar der Heiligen steigen zu lassen.
Da sei die Passion der einzige Weg zur Erlösung.
Da sei der Tod die Voraussetzung zur Auferstehung.
Da sei die Vernichtung des vergänglichen Fleisches unverzichtbar, um als verwandeltes, ewiges Wesen wiederzukommen.
Detlev, wie er sich in naiver Freude bei seiner Ankunft zeigte, solle besser sein körperliches Gefängnis zerschlagen, damit der wahre, geistselige Detlev in ihm erwache, der einzige Teil an ihm, der in den Himmel steigen könne.
Detlev stimmt zu. Detlev nennt seine Mutter die Gottesmutter Maria, den abwesenden Vater Gottvater, sich selbst abwechselnd das Christkind in der Krippe und den Christus am Kreuz.
Die Mutter eröffnet ihm, der Vater sei Jude (gewesen), er selber also, Detlev, Halbjude. Der Vater sei gestorben, er also, Detlev, Halbwaise. Detlev will nicht halb dies und halb das, er will ganz und gar.
Volljude und Vollwaise!
Und die komplette Passion!
Dornen durch den Kopf, Nägel durch Füße und Hände.
Dann mit dem Seelenleib neben Gottes Thron!
Er wolle Pfarrer werden, schwört er den Schwestern.
Katholischer Pfarrer.
Aber er will auch nach Hamburg zurück zu den Großeltern. Zu den evangelischen Großeltern. Ins sündenverseuchte Hamburg. Für die katholischen Schwestern ist er damit abtrünnig. Aus ihrer Sicht läuft er vor seiner Bestimmung, läuft vor dem einzig echten Gott davon.
Er darf noch beim Krippenspiel mitspielen. Es wird seine erste Theatererfahrung − die Inszenierung einer heiligen Heimsuchung ohne innere Heimsuchung!
Beim Verlassen des Waisenhauses sieht Detlev seinen Vater groß bis an die Wolken. Die Mutter nimmt Detlevs Koffer. Sie gehen am Sankt-Josephs-Brunnen vorüber Richtung Bahnhof.
Der Brunnen hatte dem Tagträumer Detlev eine bewegende Todesfantasie beschert: Am Sankt-Josephs-Brunnen laufe das Wasser jeden Tag, laufe schon als er noch nicht geboren war und werde noch laufen, wenn Oma sterbe, wenn Mutti sterbe, wenn er sterbe.
Detlev beginnt zu weinen über seinen Tod, über den Tod der Mutter und der Großmutter... alle, alle wieder weg, wenn das Brunnenwasser ungerührt weiterlaufe, wer könne sich eine solche Grausamkeit ausgedacht haben?
Gott?
Detlev entfernt sich von dem Waisenhaus und von dem Gott des Waisenhauses.
Von Jesus Christus.
Nicht von der Vorstellung einer Verwandlung durch Passion − durch leidenschaftliches Leiden, Zerstechen, Zerreißen des Fleisches, Herausfahren aus dem Körper hinein in den besseren, sakralen Zustand.
1943 ziehen die Mutter und Detlev nach Hamburg Lokstedt zurück. Ins großbürgerliche Großelternhaus. Dort schockt den Neunjährigen im Sommer des gleichen Jahres die tagelange Bombardierung Hamburgs, Operation Gomorrha genannt. Es sind die schwersten Luftangriffe, die Hamburg je erlebte.
Ein Feuerregen biblischen Ausmaßes, wie es der Name schon androht. Ein Himmelsgericht soll in einer Neuauflage von Gottes Zorn auf Sodom & Gomorrha Hamburg niedergehen.
Gomorrha: eine überflüssiger Anleihe aus einem abgestandenem Mythenquark.
In Wahrheit geht es immer nur Mensch gegen Ander-Mensch.
Erst warfen Deutsche Bomben auf England, dann warfen Engländer Bomben auf Deutschland.
Da hatte kein Gomorrha-Rächer seine Hand im Spiel.
Der alliierte Angriff bestand aus einer ausgefeilten Vernichtungsstrategie, gestaffelt in drei Wellen.
Zunächst flatterten in der Nacht Unmengen von Stanniolstreifen herab, die die damaligen Funkmessgeräte der deutschen Abwehr-Flak außer Kraft setzten, sodass diese ohne Ortung in die Luft schossen.
Es folgten Sprengbomben und Luftminen − Wohnblockknacker − die Dächer, Wände und Mauern durchschlugen, Türen aus den Angeln hoben und Fensterscheiben platzen ließen.
Auf die so geöffneten und gut durchlüfteten Häuser regneten Brandbomben herab, die sich an allem Brennbaren entzündeten und in der zweiten Angriffsnacht vom 27. auf den 28 Juli durch die großflächigen Flammenherde − zusätzlich begünstigt durch eine heiße Sommernacht − einen Feuersturm auslösten.
Feuersturm bedeutet, dass die Brandgase die kühleren Luftschichten bis zu sieben Kilometer Höhe durchstießen und einen gewaltigen Kaminsog-Effekt bewirkten, der Orkanstärke erreichte und in der Lage war, Menschen in seine Flammensäule zu reißen.
Es entwickelte sich eine Kernhitze von 1000°. Dachbalken, Hausrat, entwurzelte Bäume flogen durch die Luft, die Alstertarnung, ein Drahtgeflecht mit Blechplättchen, schmolz. Schutzbunker wurden zu Todesfallen. Menschen erstickten in den Kellern, erlitten den Hitzschlag, verbrannten auf der Straße.
Wer mit dem abgeworfenen Phosphor in Berührung kam, brannte. Tauchte er im Flusswasser unter, erstickte er die Flammen, entzündete sich jedoch wieder, sobald er auftauchte und dem Phosphor Sauerstoff bot. So hatte er nach Augenzeugenberichten nur die Wahl zu ertrinken oder zu verbrennen.
In der Feuersturm-Nacht warfen 739 britische Flugzeuge über 100.000 Spreng- und Brandbomben ab. Es starben in dieser Nacht mehr als 30.000 Menschen. Am nächsten Morgen blieb es auf Grund der kilometerhohen Rauchsäule dunkel über der Stadt. 900.000 Hamburger flohen ins Umland. Die Hälfte aller Häuser war vernichtet.
KZ-Häftlinge mussten die Trümmer beseitigen, Leichen bergen und Blindgänger-Bomben entschärfen.
Solche Erlebnisse machen sprachlos. Es scheint keine Worte zu geben, die dem Entsetzen gerecht werden. Es scheint sogar, dass sich alle Worte verbieten, um das Ungeheure nicht zu verharmlosen, das Unbegreifliche nicht doch begreifbar zu machen.
Am Ende noch ästhetische Effekte aus dem Inferno zu schlagen!
So wie nach Auschwitz alles Dichten verdächtig schien.
Ereignisse dieser Art sind immer auch Sprachkrisen.
Zunächst ist es unmöglich, für das Entsetzliche Worte zu finden. Dann erscheint die Gefahr, durch Worte dem Entsetzlichen das Entsetzen zu nehmen. Schließlich kommen Bedenken auf, ob man das Bild einer völligen Verwüstung der Nachwelt überhaupt vermitteln soll.
Wozu dies alles niederschreiben? fragt sich der Schriftsteller Hans Erich Nossack (der in dem Hamburger Bombardement die Wohnung und seine Manuskripte verlor).
In seinem Bericht Der Untergang hält Nossack fest, dass das, was ihn umgab, nichts mit den erlittenen Verlusten zu tun hatte. Der tatsächlich erlebte Untergang sei das nicht zu verarbeitende Fremde, das eigentlich Nicht-Mögliche gewesen.
Wie sollte sich ein Überlebender dieses eigentlich Nicht-Mögliche aneignen? Mit welchen Beobachtungen? In welchen Bildern? Durch welche Sätze?
Das Weiterfunktionieren der normalen Sprache in den meisten Augenzeugenberichten lasse an der Echtheit der in dieser Sprache wiedergegebenen, so noch nie dagewesenen Zerstörung zweifeln, fand der Schriftsteller W. G. Sebald. Es sei überhaupt unwahrscheinlich, dass jemand, der diesem Feuersturm entkam, mit ungetrübtem Verstand weiterleben könne.
Schon die Beschäftigung eines Unbeteiligten an dem Geschehen bedrohe dessen Gesundheit.
Wolf Biermann (mit sechs Jahren im Zentrum der Hamburger Feuersturm-Nacht) meint in ähnlicher Richtung: Nur Daten und Fakten anhäufen, nur zeigen, wie schlimm alles war, reiche nicht. Selbst dabei gewesen zu sein könne sogar den Versuch zu beschreiben behindern, weil man immer wieder überwältigt werde von den eigenen Emotionen und Konfusionen.
Man müsse ein großer Dichter sein, um solche Ereignisse auszudrücken, und „großer Dichter“, das werde nicht ausgesucht nach dem eigenen Leidensanteil, den originalen Wunden, wie ungerecht es den Augenzeugen auch erscheine.
W. G. Sebald (kein Augenzeuge, aber Autor von Luftkrieg und Literatur) meint, die Berichte der Augenzeugen müssten durch einen synoptischen, künstlichen Blick ergänzt werden, um in die Tiefen ansonsten nicht wiederzugebender Zerstörung vorzudringen.
Danach wäre das faktische Grauen erst durch die Verwandlung in Fiktives gegeben und für die Welt ohne Verharmlosung nachvollziehbar gemacht.
Sieht man auf Picassos Guernica das Trümmerfeld des von Deutschen zerbombten Ortes in Nordspanien?
Nein.
Sondern zerrissene Körperteile in einem von einer Glühbirne und einer Petroleumlampe erleuchteten Raum, in dessen Zentrum ein in sich verdrehtes Pferd schreit.
Links taucht ein menschenähnlicher Stierkopf auf, der den Klagerufen der Mutter über ihrem toten Kind die letzte Verzweiflung verleiht.
Weder Stier noch Pferd kann es in dem Zimmer gegeben haben. Picasso setzt um, was W. G. Sebald fordert: Versagt die Darstellung vor dem Ausmaß eines Grauens, müsse es durch einen synoptischen, künstlichen Blick ergänzt werden, um in die Tiefen des ansonsten nicht Wiederzugebenden vorzudringen.
In dem albtraumhaft gedrängten Raum schlägt Waffentechnik am menschlichen Verständnis vorbei ins Kreatürliche, zerfetzt bis in die Grundlagen, was Bombenwerfer wie Bombardierte gemeinsam aus der Welt hebelt.
Für den Rest der Lebewesen unzumutbar macht.
Hubert Fichte (achtjähriger Augenzeuge) verschlägt es nach zwei erfolgreichen Romanen immer noch die Sprache, wenn es um die Hamburger Bombardierung geht.
Im bayrischen Waisenhaus hatte er sich die Marter ausmalen müssen, die zu ertragen waren, um vom Körper getrennt neben Gottes Thron Platz nehmen zu dürfen.
Im Hamburger Bombardement wird aus den Marterfantasien Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit besagt, dass alle vorstellbaren und unvorstellbaren Leiden tatsächlich eintreten können − ohne Gott und ohne tröstende Auffahrt zu seinem Thron.
Nach der Feuersturm-Nacht sei der Himmel trotz wolkenfreier Sonne auf Grund der gigantischen Rauchsäule schwarz gewesen, so der Bericht der Überlebenden.
Schwarzsilberne Stanniolstreifen klebten an den Dachziegeln. Verwirrung herrsche bis zu den Tieren.
Die Gitter an Hagenbecks Zoo seien geschmolzen, Absperrungen zerbombt, Zebras seien in der Karlstraße aufgetaucht, Elefanten und Büffel auf der Kaiser-Friedrichstraße.
Fichtes Familie flieht nach Schlesien (in die Heimat der Großeltern). Weihnachten seien sie wieder zurück, versprechen sie sich gegenseitig, aber Weihnachten war nicht mehr Weihnachten für Detlev nach den Kriegseindrücken. Die Wörter fühlten sich viel zu dick im Mund an. Das Wort „Weihnachten“ sei kaputt. Ein „Tannenbaum“ sei jetzt etwas, das von den Bombern abgeworfen werde und aufglühe, um die Ziele zu erleuchten.
Das Trümmerfeld der Sprache. Der Geschmack der Luft um die verfaulenden Krüppelglieder bedeute, dass es aus sei.
Dass die Wörter aus dem tradierten Sinn, das Bewusstsein aus der gewohnten Zeit gefallen seien.
Dass der Schock so etwas wie einen fortlaufenden Stillstand erzeugt habe.
Dass es in einer Umwelt, die sich in Minuten bis zur Unkenntlichkeit verwandle, kein rechtzeitig mehr geben könne.
Dass jedes schmückende Adjektiv schon eine Denkbewegung voraussetze, die den Schock verfälsche.
Dass jede lineare Wortführung versage vor der geschmolzenen Zeit, dem brennenden Wasser, den zerfetzten Körpern.
Dass Ziffern nur Mengenangaben und Entfernungs-Unterschiede vermittelten.
Vielleicht seien in dem Flächenfeuer auch die Buchstaben in den Flammen aufgegangen.
Die Bleilettern der Druckereien geschmolzen.
Die Gehirne, die Buchstaben ordentlich zusammenfügen, verbrannt.
Sollten sich Schriftsteller anzünden?
Wäre die einzig authentische Wiedergabe des Hamburger Feuersturms, zwei Seiten eines Buches schwarz einzufärben?
Oder einen schwarzen, fettglänzenden Fleck auf zwei Seiten des Buches zu drucken und am Rand des Kleckses Silben rausgucken zu lassen?
Ein Ohrläppchen rausgucken zu lassen?
Oder vermitteln Ideogramme das Feuer, die Aschensäule, die Kellerschrumpfleichen besser als Worte?
Ideogramme sind − wie schwarze Seiten − universal verständliche Zeichen zum Ausdrücken des Unsagbaren.
Also nur Protosprachliches noch gerechtfertigt?
Für den ehrgeizigen Literaten Jäcki-Fichte, der sich nach zwei Romanen an die Wiedergabe der Schock-Ereignisse wagt, keine Lösung.
Die Buchstaben seien nicht alle verbrannt!
Es gebe neue Buchstaben, mit denen über das Verbrennen berichtet werde. Zumindest als Programm.
Ein Lebensprojekt.
Die beste – einzig passende − Aneignung eines Erlebnisses, das sprachlos macht, scheint die Mimikry: Auf Zerstörung durch zerstörte Sätze reagieren.
Dem bislang unbekannten Grad der Fassungslosigkeit durch eine bislang unbekannte Sprache gerecht werden.
Den üblichen Fluss der Rede zerhacken.
Die Brandopfer wie in einer Litanei aufzählen.
Wortreihungen wie Bombeneinschläge setzen.
Auf logische Zusammenhänge verzichten.
Die durch die Straßen irrenden Zootiere nicht vergessen; vom Gitter und Gehege des Zoos befreit, nur um in der brennenden Stadt zu sterben.
Carl Heinrich Hagenbeck: Der Bulle gelangte durch die zerstörte Tierparkeinfriedung in die Kaiser-Friedrichstraße und wurde hier von einem Polizeiwachtmeister umgelegt.
Zebras galoppierten an Opa Fichtes Haus vorbei. Giraffen seien nicht auf den Straßen herumgelaufen. Dabei hätten Giraffen mit meterlangen Feuerschleppen an den langen Hälsen den Schock surreal abgerundet.
Imitation ermöglicht, etwas anderes zu werden; auch, mit anderem fertig zu werden.
Detlev will, zum jugendlicher Jäcki herangewachsen, alles ausprobieren, Dichter und Denker, Bauer und Held sein.
Er setzt sich eine blonde Perücke auf und imitiert Detlev, der die Iphigenie auf Tauris imitiert.
Und die Erzählposition? Wolle er nun Jäcki oder Detlev sein? Hahaha, lacht der Damenimitator Cartacalo/la.
Jäcki sei eine von Detlevs Imitationen!
Nach dem Hamburger Feuer-Erlebnis habe eine neue Realität begonnen, die eine neue Sprache fordere: Unvollständige Bemerkungen verweisen darauf, dass es in der Sprache Beziehungen gebe, die durch das formale Schema nicht zu fassen seien. Anstelle schlüssiger Handlungen und sauber komponierter Geschichten Paradoxa, Lügen, Überflüssiges, Antinomien, Montage, Willkür...
Melopoeia.
Er könne nicht unverändert die nach dem Krieg veränderte Gesellschaft verändern.
Alles sei anders. Wer schreibe wie davor, als sei das Neue mit der alten Sprache zu fassen, lüge.
Verrate die Realität und die Sprache.
Er könne nicht ohne die Deformation der Sprache über die Deformation der Sprache sprechen.
Muss bei dem Plan Ein neuer Mensch mit neuer Sprache der alte Mensch zerrissen werden?
Die neue Sprache eine zerrissene sein?
Offensichtlich.
Der Passionsweg − vom himmlischen Gebot auf die irdische Not zurückgebogen − sei unvermeidlich.
Die profane Passion wird der Startpunkt aller Suchbewegungen, die Fichte vom Theaterverfasser zum Romanschreiber und Forscher treiben und über Hamburg hinaus in die halbe Welt reisen lassen.
Das Sezieren, Zerreißen, Wunden schlagen, den üblichen Verstand und das profane Bewusstsein zu brechen, um mit verloren gegangenem magischen Wissen und Bewusstsein wieder zu erwachen, bleibt das durchgängige Motiv seiner literarischen und außerliterarischen Unternehmungen.
(Eine Unterscheidung, die es für ihn nicht gibt).
Fichte macht sich daran, durch die Verkrustungen der christlichen Kultur zu den abgedrängten, für ihn in den afroamerikanischen Riten bewahrten Fundamenten eines überlegenen Wissens vorzustoßen.
Sich dieses Wissen zurückzuerobern und den rational verkopfte, sinnlich verstopfte Industrianern Europas zur Genesung anzubieten.
Und untrennbar damit verbunden ihre verkopfte, sinnlich verstopfte Literatur zu erneuern.
Zugrunde liegt ein verlockender Gedanke: Wenn man die Spur von den heutigen zivilisatorischen Auswüchsen über alle Verzweigungen zum gemeinsamen magischen Stamm zurückverfolge, sei man an der eigentlichen Heilsquelle.
Das Bild vom Baum der Evolution.
Der Mensch selbst ein Baum. So die magische Vorstellung.
Teil eines Geflechts von gesellschaftlichen Beziehungen und göttlichen Kräften.
Jede Voodoo-Zeremonie beginnt mit den Gesängen für Legba.
Am Eingang eines jeden Heiligtums steht der Baum, der ihm geweiht ist.
Ein säkular-sakral-erotischer Code.
Steine, Pflanzen, Tiere − in Pflanzen verwandelte Menschen.
Solange die Magie wirkt.
Solange die Wörter durch die Haut gehen.
Über alle Verästelungen zurück zum Stamm, der das noch Ungetrennte einer Gemeinschaft zeigt.
Aber damit nicht genug! Es geht noch weiter zurück!
Weiter zurück zu den Wurzeln, in die Tiefen des gemeinsamen Urwissens.
Bewahrt in einer Ursprache, die im Tanzen, Gestikulieren, symbolischen Zeigen steckt.
In der „Körpersprache“ der Urmenschen.
Dem universell gültigen Verständigungsmittel des ersten Menschenpaares.
Vor dem babylonischen Auseinanderfall in die unterschiedlichen Sprachen der in unterschiedliche Gegenden auswandernden Nachkommen!
Eine verlockende Vorstellung.
Wäre nicht das Urpaar mit seiner Ursprache im Urland ein Urirrtum.
Was wissen wir schon?
Der Mythos von Adam und Eva. Gefangen im Bild eines logisch notwendigen Anfangs und eines logisch unbestreitbaren Endes.
Warum nicht vom Beginnlosen ins Endlose?
Was wissen wir schon?
Lemaître entwickelte die Idee vom Urknall. Miller verwies auf die Ursuppe. Goethe suchte die Urblume. Linguisten tasteten sich über Vergleiche zur Ursprache vor, Anthropologen zum Sprachursprung. Theologen zum Urgeist.
Warum könnte der fest geglaubte physikalische Urknall nicht eine weitere Systole im Herzpumpengeschehen des Universums sein?
Wer wagt zu widerlegen, dass es jenseits aller benannter und ausgemalter Urgeister eine fluxe Geistigkeit gibt?
Warum sollte sich alles lineare Geschehen nicht zur Spirale einer ewigen Wiederholung krümmen?
Was wissen wir schon?
Die Idee, durch die Zurückgewinnung der Magie, die die falsch benannten „Primitiven“ noch besitzen, Genesungskuren für die falsch benannten „Hochentwickelten“ auf den Wege zu bringen, teilt Fichte mit den europamüden Zeitgenossen.
Während Artaud „primitive“ protosprachliche Kräfte im Pariser Theater freisetzen will und Genet sich im französischen Gefängnis zum weißen Neger erklärt, ist Michel Leiris der erste Surrealist, der sich als Ethnologe nach Afrika begibt, um in der Fremde das Eigene, im Eigenen das Fremde zu begreifen.
Dabei schafft Leiris die Grundlagen zu einer Ethnopoetik, die hinter allen Spielarten von Gebräuchen, Riten, sozialen Regeln und „schamanischen“ Kulten universale Verzauberungsstrategien herausfiltert. („Schamanisch“ in der erweiterten Form der ursprünglich auf Sibirien beschränkten Bezeichnung für spirituell begabte Priester, Heiler und Wahrsager genommen. Andere magische Religionsgruppen lehnen die ihnen übergestülpte Bezeichnung eines „schamanischen“ Kultes ab, weil damit Unterschiede verwischt werden, auf die sie Wert legen)
Die universalen Verzauberungsriten bieten für Leiris wiederum neue Sprachformen gegen das verkrustete Repertoire der abendländischen Poesie... wissend, dass das, was er zu fassen bekommt, immer nur der Schatten und nicht die Beute sei.
Nach der Rückkehr in die zerbombte Stadt arbeitet Fichtes Mutter an verschiedenen Theatern als Statistin und Souffleuse. Durch ihre Kontakte bekommt der jugendliche Fichte einige kleinere Rollen im Theater und im Film.
1950, ein Jahr nach der beginnenden Freundschaft mit dem über vierzig Jahre älteren Schriftsteller Hans-Henny Jahnn, bricht Fichte die Schule ab, besteht aber nicht wie gehofft die Prüfung an der staatlichen Schauspielschule und beginnt seine „Zeit des Vagabundierens“.
Stationen sind Provence (Schafhirte), Paris (Lagerleiter im Hilfswerk des Arbeiterpriesters Abbé Pierre Grouès), Holstein (Landwirt), Schweden (Leiter der Landwirtschaft in einem Heim für schwererziehbare Kinder), Finnland und Portugal.
Ab 1961 unternimmt er gemeinsame Reisen mit der Fotografin Leonore Mau. Er hat durch einige Prosatexte in Zeitungen auf sich aufmerksam gemacht, versteht sich als freier Schriftsteller und liest in der Gruppe 47 aus seinem Roman-Manuskript Das Waisenhaus.
Sein nächste Roman, Die Palette, wird Fichtes größter Verkaufserfolg. Es ermöglichen Leonore Mau und ihm einen ersten längeren Brasilienaufenthalt.
Dem Roman Detlevs Imitationen »Grünspan«, in dem er das erste Mal eine sprachliche Annäherung an die Hamburger Bombennächte wagt, folgt 1974 der Roman Versuch über die Pubertät, der den Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen, vom Romanschreiber zum ethnologischen Forscher, zum „Ethno-Poeten“ nachzeichnet.
Für die Erforschung der synkretistischen Religionen Afroamerikas reisen Leonore Mau und Fichte nach Nordund Westafrika, Nord-, Mittel- und Südamerika und in die Karibik. Auf den Spuren von Jahnn sind sie in Frankreich und Ägypten unterwegs, verbringen Monate in Portugal und leben zwischendurch in der gemeinsamen Wohnung in Hamburg.
Ein für beide widersprüchliches Leben und Arbeiten. Was eine Weile begeistern konnte, wird verworfen, umgedeutet, ironisiert, vermischt, bekämpft... dann wieder aufgenommen, aber anders. Als Fichte seinen Versuch über die Pubertät veröffentlicht, hat er schon die Stationen Ägypten, Bahia, Argentinien, Chile, Haiti, Tansania, Äthiopien, Trinidad und die Dominikanische Republik hinter sich.
Er baut Interviews zu einer eigenen literarische Gattung aus (Interviews aus dem Palais d‘Amour, Interview mit dem Ledermann, Wolli Indienfahrer als gesonderte Buchformate).
Schreibt Theaterstücke, Erzählungen, Reportagen, Forschungsberichte, Glossen, Essays, Features für den Rundfunk und Zeitschriftenbeiträge.
Das Genre-Mix nutzt er in den umfassenden, auf neunzehn Bände angelegten Werkplan seiner Geschichte der Empfindlichkeit, vom Ehrgeiz und Anspruch her ein Projekt, das an Großromane wie Jahnns Fluss ohne Ufer oder Prousts Suche nach der verlorenen Zeit hinsichtlich Innovation und epochaler Wirkung heranreichen soll.
In der Zeit seiner ethnologischen Feldforschung zerstückelt er die Texte immer weiter, montiert sie mit disparaten Elementen aus nichtliterarischen Bereichen neu.
Er nutzt das magische Initiationsritual:
bluten,
Bewusstsein brechen,
sterben,
mit höherem Bewusstsein auferstehen.
Poesie.
Körper war Mode. Dass die Sprache des Körpers an Wucht und Direktheit der artikulierten Wortsprache überlegen sei und die Messlatte für eine künftige Dichtung abgebe, ist poetisches Programm. So strebt auch Fichte nach Texten, bei denen es an Speichel, Smegma, Samen, Pisse, Scheiße, Blut, Galle und Hirnliquor nicht fehle, um den Leser in einen Zustand der körperlich spürbaren Empfindlichkeit zu bringen.
An die Stelle der zu menschlicher Selbstentfremdung führenden Logozentrik müsse Somazentrik treten, die dem Menschen helfe, wieder zu sich zu kommen...
Urgewaltige Tänze und Schreie der ganz anderen Kulturen in die eigene expressionistisch-surrealistisch-dadaistische Performance einzubauen, endete zu Beginn des 20. Jahrhunderts schnell im heuchlerischen Spektakel.
Fichte ist denn auch nicht an den „Primitiven“, den angeblich naturbelassenen Ureinwohnern in versteckten Winkeln der Welt interessiert; er konzentriert sich auf die archaischen Relikte in der Moderne.
Dschungelromantik ist seine Sache nicht. Er will durch die Rückeroberung eines verschütteten Wissens, das die afroamerikanischen Sklaven in ihren Riten bewahrt haben, den modernen Unterdrückten, auf die er in der Hamburger Außenseiterszene stößt, Rituale der Befreiung liefern.
Es gelte nicht, vor der entzauberten, herzlosen Zivilisation ins Ackerbauleben zu fliehen, es gelte, Zauber und Herz − die unversehrt unter der Kruste der Zivilisation verborgen seien − wieder offenzulegen.
Die Rückeroberung eines magischen Wissens hebe den Mensch wie die Literatur über das Niveau des unbefriedigenden Spektakels hinaus.
Poesie brauche Magie. Magie sei ohne Religion nicht zu haben. Der säkulare, analytische Fichte − er hoffe die Sprache der Mathematik auf die Literatur anwenden zu können! − muss das Sakrale ernst nehmen.
Das geschieht bei der Erforschung der afroamerikanischen Religionen.
Davor erlebt Fichte das Profane in einer ihm bis dahin unbekannten, „ganz andren“ Form:
Jäcki trifft als jungen Mann in der »Palette«-Bar auf eine Hamburger Gammler-Szene. Der Junge, der damals Detlev hieß und sich beim Verlassen des Waisenhauses von Gott verabschiedete, ist nun ein fremdsprachenmächtiger Dichter, bisexuell, in freier Partnerschaft mit der Fotografin Irma (Leonore Mau) lebend, entschlossen, durch eine ganz andere Erfahrung ein ganz andere Literatur zu schaffen.
Ein Schritt hin zu dieser ganz anderen Literatur ist Die Palette. In dem Roman überblenden sich frühere Erlebnisse mit der aktuellen Situation. Wenn Jäcki die vier Stufen zur Hamburger Kneipe gleichen Namens hinuntergeht, tauchen Erinnerungen an seine Zeit als Schäfer in der Provence auf: Vor Schafställen gebe es keine Stufen. Schafe stiegen nicht gerne Treppen. In Pissoirs gehe man Stufen hinunter, in Bunker, in Krematorien, in die Pathologie, in Weinkeller... Es ließen sich mythologische Beziehungen zum Hinabsteigen herstellen.
Die »Palette« ist eine im Souterrain gelegene Dreiräume-Bar. Ihr Name ist Programm. Hier trifft sich die komplette Palette der Außenseiter − damals Gammler genannt − bis zu den outcasts of the outcasts der outcasts.
Der Klappentext spricht von einer Ganovenballade. Von jugendlichen Herumtreibern und Umhergetriebenen, von Nestflüchtern und Querschlägern im Sozialgefüge der Unterwelt ist die Rede. Fichte nennt die in der
»Palette« Versammelten Transvestit, Schneevertreiber, Klotante, Loddl, Brüchebauer, Akutotrinker. Es gebe Nutten, Stricher, Kleinkriminelle, Mörder, Schnorrer...
Den gutbürgerlichen Sohn zieht es in die andere Welt, die Unterwelt, die zugleich sein eigenes Anderssein bedient. Dabei ist das »Palette« Klientel keineswegs nur ein Haufen unterbelichteter Säufer, Drogenhändler und Sexverkäufer. Hier ballt sich erstaunliche Bildung:
Fensterputzer Karl hält immer sein Notizbuch bereit, weil es sehr schwierig sei, sich lückenlos zu bilden. Die Kneipennachbarn stimmen zu und erwähnen flüssig ihre eigene Lektüre, von Däubler, Ovid, Horaz, Nietzsche, Strindberg, Steiner, Rimbaud, Büchner, Bang, Brecht, Joyce, Wedekind, Faulkner, Jahnn, Genet, Sartre, George, Proust, Bisco, Borges, Barnes, Kasack bis Wittgenstein ziemlich alles, was man damals gelesen haben musste. Arno Schmidt nicht zu vergessen, sagt Halleluja: Er habe Arno Schmidt in die »Palette« eingeführt... Für Schudl existiert nur die göttliche Komödie, Faust, das Geheul und Kerouac... Benn und Bense, na, die dürften wohl auch nicht vergessen werden, ergänzt Willi Hanfschmitt.
Was da tatsächlich von Fensterputzer Karl, Halleluja, Schudl, Willi Hanfschmitt oder doch eher vom gern mit großen Namen um sich werfenden Jäcki kommt, sei dahingestellt.
Die bis zur Sucht gehende Anziehungskraft des anderen Milieus ist von vornherein nicht zu trennen von der Ahnung, dass hier auch die Möglichkeit zu einer anderen literarischen Darstellungsform steckt. Angesichts der disparaten Mischung der »Palette«-Stammgäste wird Jäcki klar, dass er daraus keine ordentliche Geschichte ableiten kann. Skizzen ja, Schlaglichter, stilisierte Auftritte, hochgestochenes Gelaber, Sexualgeprotze, Intrige, Demütigung, Verständnissuche, Gewalt ja − zusammenhängende Handlung, Entwicklungsgeschichte einzelner Personen, plot, cliff-hanger, page-turner und sonstiges Roman-Trallala nein.
Traditionelle Erzähler, die Figuren entfalten, Schicksale ausmalen möchten, klammern gern das Inkohärente, Alberne, Gemeine, Allzugebildete, Fehlgebildete, Hochgestochene, Ungehörige, Überkomplizierte und Beschränkte aus, sofern sie‘s nicht in ein sinnstiftendes Muster bringen können.
Jäcki entschließt sich zu einem ungeglätteten Bericht aus dem Keller der Gesellschaft, auf den sich jeder Leser seinen Reim machen könne. Er wählt die Wiedergabe der vordergründig kaum zueinander passenden »Palette» Besucher, stellt ihre gegenläufigen Ansichten und unvereinbaren Handlungen wertfrei nebeneinander, verzichtet auf jede ordnende Klammer.
Die »Palette« ist nicht nur das Paradies des Voyeurs und sexuell hyperaktiven Jäcki, es ist der Schürfplatz für den Dichter, der spürt, dass er aus diesem Versammlungsort der Outcasts eine ungewöhnliche Literatur abfiltern kann. Die Aussicht macht Jäcki »paletten«-süchtig und bis zur Schließung der Bar zum Dauergast.
Schlägereien durchziehen die Ereignisse in und um die »Palette«. Jäcki greift nie ein. Er ist Anhänger unbedingter Gewaltlosigkeit. Im dritten Raum der »Palette« schlägt Armin Anne. Armin boxt. Er trifft ihr Ohr. Das Ohr reißt ein. Er trifft mit dem Handrücken Annes Wange. Er schlägt mit der Handkante zwischen Annes Kiefer. Blut läuft aus Annes Mund. Jäcki sieht hin und erlebt mit. Ist Schläger und Geschlagene. Mischt sich nicht ein. Als Anhänger Gandhis verbietet er sich jede Gewalt.
Ihn fasziniert Gewalt.
Jäcki ist nicht nur fasziniert, er ist physisch beteiligt, wenn Gewalt passiert. Schläge prasseln, Opfer schreien, Blut fließt... Jäcki reagiert überfühlig. Mitleid wäre das falsche Wort. Es ist Einverleibung; ein alle Sinne beteiligendes Anverwandeln.
Die Maus auf Sardinien, die in Benzin getunkt wird, erregt in ihm mehr als Mitleid − er selber werde in Benzin getunkt! Er werde angezündet. Ein Zickzackblitz im eigenen Körper. Mitschmerzen. Er fühle sogar Schmerzen an den Eiern, als sie dem Ferkel rausgeschnitten werden... Leid gegen andre sei Leid für ihn selbst.
Er findet Ratten ekelhaft. Andererseits schmerzen ihn genau die Stellen, an denen er sie brennen sieht. Warum nimmt ihn das körperlich mit? Und vor allem: Warum die anderen nicht? Ihm fehlt jede Erklärung. Er kann nur rufen: Steckt die Ratten nicht an! Aus Furcht, selber brennend zwischen den Beeten herumzulaufen.
Das Mitleiden ersetzen durch Mitleiben − durch eine leibliche Übernahme.
Er fragt sich seit den Bomben auf Hamburg:
Woher die Gewalt?
Woher die Grausamkeit?
Keiner gibt befriedigende Auskunft.
Gewalt ist.
Grausamkeit ist.
Aber wozu?
Und unausweichlich?
Für immer?
Er habe (im Sinne von Gandhi) die Fliegen aus der Milch geangelt. Er habe den Frosch sicher über die Straße geleitet. Er habe jedes Geschlecht in sich gefühlt und imitiert. Und dann der Schrei: Was Neues! Das kenne er noch nicht: Gewalt!
Vielleicht sei er auch nur eine kreischende Tunte mehr, die aus Langeweile einen guten Offizier abgebe...
Gewalt wird ein Geheimnis bleiben. Schock, Sucht, Suche. Paradoxe Wollust.
Jäcki liegt an einer gewaltfreien Menschheit. Er beschwört in seinem gesamten Schaffen die Wiedergewinnung der Empfindlichkeit. Er möchte den sexuell unbelästigten, befriedigten, friedlichen Menschen.
Den Menschen, der im Lustausleben so kreativ ist wie am aufeinander Eindreschen uninteressiert.
Halb tot sei er gewesen vor Nonviolence. Sein bisexueller Hunger, der Hunger nach Körper, sei ein Hunger nach nonviolenziger Violence.
Das Bombardement auf Hamburg, das der Neunjährige erlebte, habe ihm ein Lebensthema hinterlassen. Seit seinem neunzehnten Jahr befasse er sich mit Gandhi und versuche, die Forderungen der Nonviolence − vom FIeischverbot und von sexueller Enthaltsamkeit abgesehen − zu erfüllen.
Die Lust am Leib! Eros. Täglich bestätigt.
Woher aber die Gewalt gegen den eigenen Leib, Thanatos?
Woher der Impuls zur Selbstverstümmelung, der immer in irgendeinem Winkel des eigenen Leibes auf der Lauer liegt?
Sollte Freud, mit dem sich Jäcki seit seinem Schwedenaufenthalt beschäftigt, bei der Annahme von zwei gleichrangigen „Trieben“ richtig liegen?
Gibt es einen Todestrieb, mit dessen Einführung Freud viele seiner Anhänger und Schüler vor den Kopf stieß?
Und was daran ist im direkten Sinn triebhaft?
Wäre das Streben nach Lust und die Vermeidung von Schmerz das oberste Prinzip des Leibes, woher dann die Lust am Schmerz, der anfallsartige Impuls zur Selbstvernichtung?
Die Frage nach dem Woher und Wofür der Grausamkeit und der Gewalt wird für Fichte Obsession.
Beginnend bei der Grausamkeit gegen sich und seine frühere − erfolgreiche und gut bezahlte − Sprache.
Spott zerfleischt, was so flüssig lesbar begann.
Aus dem ersten Satz des Buches vom Waisenhaus, Detlev steht abseits von den anderen auf dem Balkon wird nun, Detlev steht abzwei von den Affen auf dem ö.
Ein nachgeäffter Satz? Parodie? Zerstörung? Zweifel an der Gültigkeit der früheren, ordentlichen Sätze? Die Zerschlagung einer so nicht mehr haltbaren Erinnerung, einer so nicht mehr glaubwürdigen Sprache?
Keine Wandlung ohne Passion! war die Lehre im Kloster und schien die Lehre aus den Nächten der Zerstörung Hamburgs.
In der Lederszene des Hamburger Untergrunds wiederholt sich die Annahme, durch Leiden erlöst zu werden, befriedigt zu werden, wenn auch dort nur in abgesprochenen Inszenierungen, entsprechend beschränkt erfolgreich.
Immerhin deutet die Lederszene einen Zusammenhang an, den Fichte bis zu seinen afro-asiatischen Wurzeln verfolgt: Was, wenn der Drang, sich bis auf die Knochen zu zerreißen, nicht der Gegner, sondern der Komplize von Eros wäre?
Was, wenn die „perversen“ Rituale der Lederszene nur die verkümmerten, ihrer magischen Wurzeln beraubten Verhaltensweisen wären, deren eigentliche Bedeutung in den afroamerikanischen Initiationsriten bewahrt ist?
Gegen Ende des Romans findet Jäcki, sämtliche Personen der »Palette« seien Varianten des eigenen Selbst: alle er! Genauer: alle durch ihn hindurch. Alle in ihm aufgesogen.
Ein Ideal von absoluter Schöpfung: Wer oder was immer auftaucht, es sind Absonderungen des Eigenen.
Wie die mythischen Urzeuger, die doppelgeschlechtlichen Mischwesen: Selbstentzünder.
Gefolgt von den Frauenverdrängern.
Wie eine Welt schaffen ohne Mutterschoß?
Antwort:
Schöpfen durch das Wort!
Von Ptah bis Jehova.
Die Geburt des Patriarchats.
Göttinnen aus dem Zeugungsprozess ausradiert.
Für die Erschaffung der Welt reicht Herz und Zunge.
Wortzeugung an allem Weiblichen vorbei!
Es werde Licht und es wurde Licht.
Es werde
Fensterputzer Karl, Halleluja, Schudl, Willi Hanfschmitt, Pozzi, Irma, Ziffra, Herr Bösig, Heidi, Lydia, Mirko, Lausi, Grischa, Schusch, Igor, Toni, Egon, Arnim, Anne, Wilfried, Barbara, Ferdinand, Britt, Bensdorf, Manuel, Enoch, Telemann, Ramonita, Alex, Kitty, Leuleu, Ulrike, Helga, Tripper-Susi, Dolores, Claes, Klaus, Cartacalo/la, Otto Bröckelmann, Raschie, Gläseremil, Arnim, Camille Desmoulins, Sänti, Grischa, Klaus-Martin der nicht Klaus-Martin heißt, Pörgel, Mutti Wimpel, Loddl, Ole, Hammed, Günter Sauerwein, Giselher, Dr. Bublitz, Dr.
Rosenkreutzer, die Blume zu Saaron, Reimar Renaissancefürstchen, der schwarze Joe, Gregor der Maler, Nina die Herrliche, Jürgen die Galionsfigur von vorne und von hinten…
und es wurde
Fensterputzer Karl, Halleluja, Schudl, Willi Hanfschmitt, Pozzi, Irma, Ziffra, Herr Bösig, Heidi, Lydia, Mirko, Lausi, Grischa, Schusch, Igor, Toni, Egon, Arnim, Anne, Wilfried, Barbara, Ferdinand, Britt, Bensdorf, Manuel, Enoch, Telemann, Ramonita, Alex, Kitty, Leuleu, Ulrike, Helga, Tripper-Susi, Dolores, Claes, Klaus, Cartacalo/la, Otto Bröckelmann, Raschie, Gläseremil, Arnim, Camille Desmoulins, Sänti, Grischa, Klaus-Martin der nicht Klaus-Martin heißt, Pörgel, Mutti Wimpel, Loddl, Ole, Hammed, Günter Sauerwein, Giselher, Dr. Bublitz, Dr.
Rosenkreutzer, die Blume zu Saaron, Reimar Renaissancefürstchen, der schwarze Joe, Gregor der Maler, Nina die Herrliche, Jürgen die Galionsfigur von vorne und von hinten…
Eine Allmachtsfantasie.
Nichts über Halleluja und Barbara berichten, nimmt Jäcki sich vor: Sie nachmachen in Wörtern! Einverleiben und als Eigenes absondern. Seine Fiction sei nie ganz ohne Non-Fiction. Non-Fiction der Rohstoff. Fiction die Übernahme. Das Ergebnis sei der Gegenstoff, die Metawörter, die Antigrammatik, die dem Leser in den Leib fährt.
Hofft er.
Eigentlich sollten die Seiten kein Buch ergeben, sondern die »Palette« selbst als Extrakt enthalten. Der Dichter will kein Papiertiger sein. Statt sich geistig an den schwarzen Buchstabenschnüren auf bedruckten Seiten entlang zu hanteln, wünscht er sich den direkte Sprung vom Wort zur Welt.
Der urpoetische Akt.
Ja, eine Allmachtsfantasie.
Ja und?
Fakten sind, werden aber erst durch Fantasie so mundgerecht – das heißt gedächtnishaftend − serviert, dass sie im Kopf Veränderungen bewirken und insofern erst völlig zu sich kommen.
Jäcki hat das Personal der »Palette« auf Zetteln an die Wände der Hamburger Wohnung genagelt (das Hämmern führt im realen Leben von Fichte und Mau zu Abmahnung und Kündigungsversuchen von Seiten ihrer Vermieter).
Nach drei Jahren schließt die »Palette«-Bar. Das Buch, das mehr als ein Buch sein soll, ist fertig. Jäcki nimmt die Zettel von der Wand, schmeißt körbeweise Einfälle weg und Wörter...
Er denkt an einen Roman über die »Palette« in Katalogform: an einen Roman nur aus Empfindungen.
Fichte bekommt nach werbeträchtigen Lesung im Hamburger »Starclub« kurzzeitig das Image eines Pop-Poeten (er wolle auch mal die fünf Beatles sein: hier klinge sein Sound, hier klatsche sein Unbewusstes und sein Überich in die Hände).
Kritiker bis hoch zum „Literaturpapst“ Reich Ranicki loben Die Palette − Kritiker bis hinab zum Kirchenblatt-Mitarbeiter schmähen Die Palette.
Der Verkaufserfolg ist gesichert.
Detlevs Imitationen »Grünspan« schließt in Rückblenden die zeitliche Lücke zwischen dem Kind vom Waisenhaus und dem jungen Mann der Palette.
»Grünspan« heißt die „psychodelische“ Disko-Bar, die nach der »Palette« zum Gammler-Treff wird, also zeitlich das Leben von Jäcki fortschreibt. Doch der neue Treffpunkt im »Grünspan« reicht nicht mehr an die »Palette« heran.
Es verhindert eine einfache Fortsetzung der Ganovenballade nach dem Motto, macht die eine Bar dicht, spinnen wir in der nächsten weiter.
„Grünspan“ zeigt sich aber auch auf Detlevs Kopf, nachdem ihm die Maskenbildnerin für einen Theaterauftritt − er spielt an einem Hamburger Theater den Frieden − unechten Goldstaub in die Haare geblasen hat, der sich nicht ganz aus den Haaren spülen ließ. Als Ove nach einer Physikstunde Detlev in den Schwitzkasten nimmt und ihn − dem Wort getreu − zum Schwitzen bringt, kommt es zur verräterischen chemischen Reaktion. Ove wuschelt Detlevs Haare durcheinander und schreit Grünspan! Detlev hat Grünspan auf dem Kopf! Ove hält Detlev fest. Die ganze Klasse kommt und bewundert Detlevs schuppige Grünspankopfhaut...
Eine Enttarnung, die verletzt, aber auch das Besondere an Detlev offenbart.
Detlev und Jäcki beginnen im Grünspan Roman einen Dialog. Der eine, Kindliche, der noch bei Mutter und Großeltern wohnt, erzählt von den Eindrücken bei der Bombardierung Hamburgs, als die Tiere des Hagenbeck-Zoos aus den gesprengten Gehegen an Opas Haus vorbei in die Stadt rannten und verendeten, der andere, ein frisch prämierter Beststellerautor, berichtet aus seinem Leben nach Schließung der »Palette«, erwähnt seine Wohngemeinschaft mit der Fotografin Irma, überdenkt die Tücken der Imitation, die ihn ständig verändern, andererseits auch eine veränderte Literatur ermöglichen.
Detlev, Jäcki, Hubert... sind sie austauschbar? Spiegelungen? Wo verlaufen die Grenzen?
Die Grundfrage bei jedem Versuch der Aneignung.
Der verunsicherte Leser fragt mitten in den Text der Aneignungen hinein: Aber Jäcki und Detlev sind doch zwei Figuren aus Fleisch und Blut?
Der Dichter verweigert die Klärung:
Sie und ich und Detlev und Jäcki und Jäckis Ich und Detlevs Ich und mein Ich und Ihr Ich...
Mimikry beginnt bei der Vorspiegelung, etwas Anderes zu sein, ist aber auch die einzige Möglichkeit, anders zu werden.
Weiter zu kommen.
Der Dichter Jäcki nimmt sich vor, Gelogenes – sogar doppelt Gelogenes – stehenzulassen, um Wahrheiten zu sagen, die sich dem direkten Zugriff entziehen.
Was ist echt?
Falsche Frage.
Das Ambivalente liegt im Leib. Der Leib ist ein Resonanzkörper. Er ist plastisch. Er ist psychosomatische Knetmasse. Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust?
Wieso zwei? Es sind Hunderte.
Der Leib ist nicht ambivalent, er ist polyvalent.
Was ist echt? Wo ist mein wahres Ich?
Die einen sagen: Vergiss dein wahres Ich! Es ist eine Illusion: Ich will nicht gefunden, es will immer wieder neu entworfen werden.
Es ist deine Entscheidung. Deine Verantwortung. Das kann dir keiner abnehmen.
Die Botschaft des Existenzialismus.
Die anderen sagen: Suche dein wahres Ich! Es existiert.
Es ist deine Bestimmung, die du nach der Geburt nur nicht mehr erinnerst und mühsam wiederentdecken musst.
Die du aber ohne priesterliche Hilfe einer Mãedesanto oder eines Paidesanto nicht finden kannst.
Der „schamanische“ Gegenentwurf.
Fichte wird sich sowohl mit der existenzialistischen als auch mit der afro-hinduistischen Auffassung beschäftigen. Ohne sich für eine zu entscheiden.
Im Grünspan überwiegen noch die Aneignungen unterschiedlicher Lebensentwürfe durch Imitationen von Personen im Umfeld. Es geht um die Übernahme möglichst vieler anderer ins Eigene.
Nachahmung ist − im Gegensatz zu ihrem schlechten Ruf − Schöpfung.
Das Gute an der Nachahmung ist, dass man werden kann, was man nachahmt, und so erweitert, was man bislang war.
Das Schlechte an der Nachahmung ist, dass man werden kann, was man nachahmt, und dann nicht mehr weiß, wie es zu dem passt, was man bislang war.
Imitation gefährdet sogar noch den, der das Andere bekämpft. Dirty Harry, der gute Cop, entdeckt am Ende seiner Jagd auf den Bösen keinen Unterschied mehr zwischen sich und ihm. Er wirft seine Polizeimarke dem gerade zur Strecke gebrachten Unhold hinterher.
Wer gegen Ungeheuer kämpft, indem er ihr Verhalten imitiert, muss aufpassen, nicht selber zum Ungeheuer zu werden (Roger Caillois).
Detlev vergöttert seine Mutter wie eine Kopie der Mutter Gottes.
Die Mutter ist ihm Sonne, Mond und Sterne.
Die Mutter ist das Glück, die Schönheit, die Morgenröte, die Wärme, die Größe, der beste Vater, die Zukunft...
Wäre da nicht Robert.
Robert hat eine dicke, ordinäre Mutter, die Schwarzhandel treibt. Robert gehorcht seiner Mutter nicht. Er nennt sie du Alte, du Dicke, du fettes Stück, du bist bekloppt, los, gib jetzt Geld her, ich will was zu fressen, du alte Fotze.
Detlev bewundert Robert. Detlev fängt an, Robert nachzumachen. Mutti hat ihm nichts getan. Es quält Detlev, dass er sich beim Kopieren von Robert immer widerlicher der Mutter gegenüber benimmt.
Er begrüßt sie mit Na, Alte.
Manchmal hört er auf, Robert nachzuäffen, aber dann merkt es die Mutter nicht so schnell und er sieht, wie sie sich unter seiner schäbigen Behandlung verwandelt.
Detlev verändert sich − den Mutterverächter Robert imitierend − zum Mutterverächter.
In dem veränderten Umgang mit der Mutter verändert sich die Mutter.
Ist der Mutter-Überhöhende oder der Mutter-Erniedrigende näher am wahren Selbst?
Hat er insgeheim schon vorher die Mutter vom Sockel gestoßen und wird von Robert nur darin bestärkt, endlich dazu zu stehen?
Oder hat er sich nur, weil er Robert bewundert, auch dessen Mutterverachtung angeeignet, die ihm nicht entspricht, also quält?
Fichte wird ein eigenes Buch − Die Geschichte der Nanã, dem zwölften Band in der Geschichte der Empfindlichkeit − darauf verwenden, die reale und die ideale Mutter zusammenzubringen: In dem Candomblé-Tempel Casa das Minas, São Luiz, Brasilien, wolle er das Bild seiner Mutter zerstören und neu schaffen, wolle die reale Mutter Dora mit der mythischen Figur der Nanã, der ältesten Göttin der Casa das Minas, zusammenblenden.
Als Nanã solle Dora wieder auferstehen, als Urmutter, Schlammmutter, Nachtmutter, als Nanã der Frösche, mit schwülen Händen.
Nanã backt die Welt aus Schlamm zusammen.
Sie ist der Tod, der Durchgang.
Er müsse aus der Stenotypistin ein Kunstwerk zusammentippen.
Fichtes Mutter wehrt sich gegen solche Versuche. Sie sagt, sie wolle nicht wieder in einem Roman verarbeitet werden. Der Grund ihrer Weigerung, sich in eine Kunstfigur zu verwandeln, mag in ihrem sicheren Gespür liegen, durch die Erhöhung auf dem Papier real vernichtet zu werden.
Dass dieses von Hans-Henny Jahnn übernommene Motiv − Reales morden, um Ideales zu gestalten − ihren Sohn poetologisch umtreibt, war ihr nicht entgangen.
Das Verhältnis zur Mutter wird zusätzlich belastet, weil er an der fixen Idee festhält, ungewollt gewesen zu sein.
Was sie bestreitet.
Warum hätte sie ihn auch lieben sollen, fragt er sich, wo er für sie aus seiner Sicht nichts weiter als ein Polyp gewesen sei, der sich nach einer schnellen Nummer mit einem Juden in ihren Eingeweiden festgebissen habe, sie aufblähte, ihr Becken sprengte und dann nicht mehr wegzukriegen war?
Eine Rassenschande, der Balg, der wie zum Beweis des nicht beseitigten Störers schrie, speichelte, nicht einschlafen wollte, redete, fraß, der sie ins Konzentrationslager hätte bringen können, um dort, mit ihm auf dem Arm und einem Stück Seife in der Hand, das sie nicht mehr benutzen würde, zur „Dusche“ in die Vergasung zu gehen.
Trotz der Versicherung Doras, solche Fantasien seien absurd, hielt Fichte daran fest.