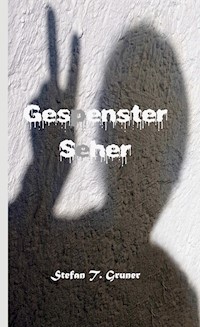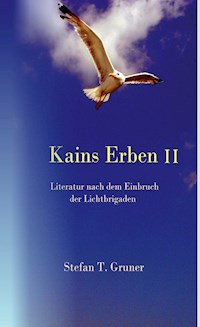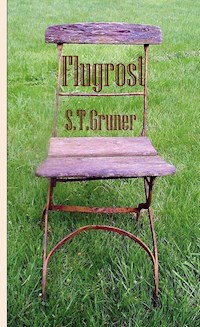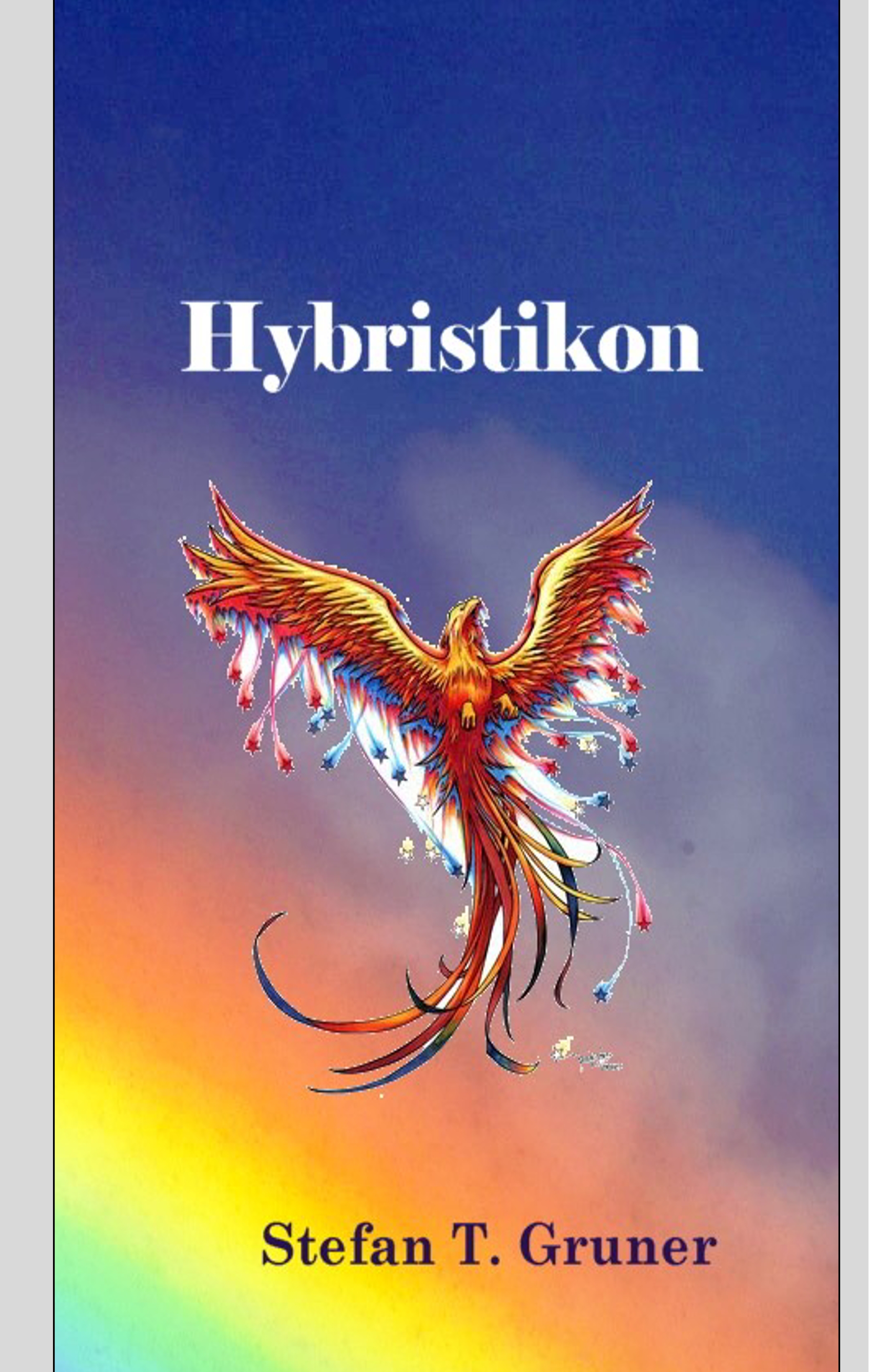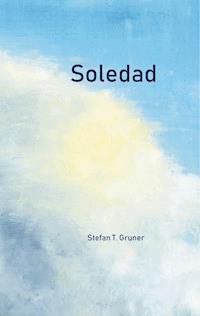
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Jugendliche fahren in den Sommerferien auf ein Dorf. Es sind siebzehnjährige Internatsschüler eines von Franziskanern geführten Heims, beide von den Eltern getrennt. Der Sommer ist grausam heiß. Die Jungen sind verwirrt, unberechenbar, latent gewaltsüchtig. Der eine von ihnen lässt über seinen Vormund eine Wohnung im Nachbardorf anmieten und versucht im Grunde nur, die Hitze zu überstehen. Er macht Liebe mit der Schwester des Freundes, der seinerseits jeden, den er trifft, dazu überreden will, die Sonne anzubeten. Das Abenteuer des Buches liegt in seiner Langeweile. Es dehnt die Verzweiflung. Soledad - spanisch für Einsamkeit - ist gleichzeitig, in die beiden Wörter sol und edad zerlegt, das Zeitalter der Sonne. Wenn der Planet zerkocht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über der Straße flimmern Hitzeschlieren. Das Licht brennt Löcher in die Augen. Die Luft entflammt Gesicht und Hände. Es ist Hochsommer, als wir mit unseren Leinentaschen aus dem Backofen des Heims unter die Gluthaube der Sonne treten. Kinder klickern unter dem Schatten eines Kastanienbaums mit lackierten Tonkugeln, die sie Murmeln nennen. Sie zielen die Murmeln in ausgehobene Kuhlen auf dem Stück Erde, das dem umpflasterten Baum geblieben ist. Wer eine Murmel in eine der Kuhlen versenkt, darf die herumliegenden Murmeln mit der Seite seines Zeigefingers anstoßen – nicht schieben oder umlenken! – und jede auf diese Art getitschte Murmel einsammeln.
Die Regeln sind nicht verhandelbar.
Die Wurzeln des Kastanienbaumes wölben sich wie gebogene Leiber von Tieren, die sich vergeblich kopfüber in die harte Erde bohren möchten. Die Kuhlen sind alt und abgeschliffen und manche so flach, dass sie kaum noch als Kuhlen durchgehen, was zu Streit führen könnte, aber niemanden kümmert. Die meisten Kinder haben die Lust am Spiel verloren, oder sie waren von vornherein nicht begeistert und haben nur mitgemacht, um in der Gruppe zu bleiben. Jetzt lehnen sie mit hängenden Armen am Stamm der Kastanie und sehen den letzten Spielern zu. Wir halten einen Moment an und beobachten sie, und je länger wir hinschauen, desto deutlicher erscheinen die letzten Spieler als fremdgesteuerte, aus Raum und Zeit gefallene Irrwesen.
Die Straße läuft bolzengerade zum Ortskern abwärts. Es ist die einzige Straße, die wir vom Heim zur Schule betreten dürfen. Wir sind die trottende Klosterherde, Gottes Hammel auf Satans Hufen, und die Leute sehen zu uns herüber. Sie kennen uns. Sie bedauern uns wegen unserer ärmlichen Kleidung, unserem anspruchslosen Dasein. Sie schätzen sich glücklich, ihre eigenen Kinder vor unserem Schicksal bewahrt zu haben. Sie lächeln uns zu. Sie kennen unsere Namen. Wir stampfen im Pulk, blöken, es hilft nichts. Wir traben durch die Spießruten ihrer freundlichen Blicke. Innerlich spucken sie auf uns. Was haben wir angestellt, um dieses Gefälle hinnehmen zu müssen? Nichts. Das reicht.
Im Heim leben wir so beengt, dass wir darauf achten, uns nicht kennenzulernen.
Wir versammeln uns um die Stehtheken der Bahnhofshalle. Einer nach dem anderen verschwindet, um einen Zug zu erreichen, der ihn an einen Ort bringt, wo ihn Ärger erwartet. Jeder nickt und lacht und schreit Zustimmung, um Zustimmung zugeschrien zu bekommen. Stein meckert sein Meckern, Amel winkt sein Winken, wir tun verständig, tun, als würden wir verstanden. Basti denkt an Selbstmord. An Mord. An Selbstverstümmelung. An einen Amoklauf mit abgesägter Schrotflinte. Oder einfach daran, Erde über sich zu werfen. Amel hebt Taschen durch geöffnete Zugfenster, die besser durch die Tür gepasst hätten, was dann aber nicht nach letzter Hilfe aussieht. Ben posiert mit einer Zeitung unterm Arm. Ingo notiert falsche Adressen. Finke und Jörg fluchen sich in einen kleinen Rederausch. Keiner erzählt Näheres, keiner will Näheres hören.
Wir kennen den gleitenden Übergang vom Schulterklaps zum Genickschlag. Ron schleift seine Leinentasche wie eine Steinkeule hinter sich her. Er fragt, warum ich nicht auf sein Dorf mitkomme. Mir fallen keine Gründe ein abzulehnen. Ich tausche meine Fahrkarte, stelle mich neben Ronni auf den Bahnsteig und warte auf seinen Zug, der jetzt auch meiner ist.
Hin und wieder sehe ich aus dem Zugfenster, um irgendeine Veränderung der Landschaft zu bemerken. Ron sieht seine Hände an. Wir ärgern einen Mann im sonst leeren Abteil, weil wir uns auf kein Gespräch einlassen, aber auch nicht lesen oder schlafen. Er will nicht begreifen, dass zwei junge Kerle sich derart aufmerksam anschweigen können.
Von dem Ort, an dem wir aussteigen, müssen wir noch vier Kilometer gehen. Ron ist aufgekratzt. Er heißt eigentlich Adalmar, ein Name, den er hasst und den keiner mehr in den Mund zu nehmen wagt, es sei denn er sehnt sich nach einem schmerzhaften Erlebnis. Rons Kraushaar ist hellrot, ein Feuerschopf. Seine Bewegungen haben etwas Zielloses, Flackerndes, wenn es um nichts geht. In seinem Hirn tanzen Wespen. Feinde nennen ihn krank. Es ist es sehr einfach mit ihm: Bekommen wir mit einer Gruppe Streit, schiebt er sich vor und verlangt einen Gegner, bevor alle übereinander herfallen. Klein wie er ist, ist sofort ein Riese bereit, sich mit ihm anzulegen. Den schlägt er dann – in seinem beherrschten Vorgehen wie ausgewechselt – zusammen.
Ron gibt mir seine Leinentasche, geht in den Rückwärtsgang, streckt die Arme vor mir aus. Die Arme bedeuten die beiden Seitengebäude des heimatlichen Hofes, sein Rumpf stellt das Hauptgebäude dar. Er nickt in die jeweilige Richtung, die er beschreibt: das Tor, der Hof, die Ställe, der Wohntrakt, die Scheune, der Geräteschuppen ... Er gibt sich begeistert, zieht mich am Ärmel wie eine entlaufene Ziege, die er heimführt.
Als wir vor dem Hof stehen und ich ihm versichere, es sei genau, was ich mir durch seine Erklärungen vorgestellt habe, und er fünf Mal „tatsächlich?“ gesagt hat und gerade das Holztor mit dem Fuß aufstoßen will, dreht er sich wieder in meine Richtung und fragt, ob ich der Meinung bin, dass an ihm ein Maler verlorengegangen sei, was ich umgehend bejahe. Und als er es noch einmal, dringlicher, wissen will – Maler, Augenmensch – gebe ich die gleiche Antwort, und er beginnt den Hof, den wir jetzt vor uns haben, noch einmal mit Armen und Rumpf dazustellen, mit dem Rücken zum Hof.
Ich setze den Leinenbeutel auf die Erde, nehme ihn aber sofort wieder auf, weil eine Frau das Hoftor öffnet, und dann lasse ich ihn wieder fallen, um sie begrüßen zu können, und sie nimmt ihrerseits den Beutel an sich und pufft damit Ron, der sie mit Indianergeheul umtanzt, in Ermangelung echter Wiedersehensfreude. Sie nennt ihn „mein Junge“, ist aber nicht seine Mutter. Seine Mutter zahlt den Hofaufenthalt, um ihn nicht sehen zu müssen. Ich warte, wie sich die Dinge entwickeln. Schließlich gehen wir ohne weiteres Tamtam ins Haus.
Im Innern ist es überraschend dunkel. Es riecht nach warmer Milch und geschnittenem Gras und Dung und Schweiß und Schnaps. Ich sehe Plastiktische. Stuhlgerümpel. In den Fensterluken Lederblumen und Vogelbauern. Auf dem Gasherd fünf Töpfe in Betrieb, ein Waschzuber. Wasserblasen im Kampf mit scheppernden Deckeln. Der Boden ist übersät mit Schuhwerk. Dauernd schiebt sich eine neue Figur durch die Tür, schaut ein anderes Gesicht durchs Fenster.
Wir stehen eine Weile herum. Ron und ich gehen wieder ins Freie. Natürlich hätte ich jetzt nichts mehr sagen brauchen, aber ich sage doch, „ganz groß, Mann“, und das gibt den Ausschlag, dass er jetzt in den Grenzen seiner Möglichkeiten begeistert ist.
Ron redet mich mit „Jo“, „Fetzer“, „Ed“, „Marko“ oder „Sohn Gottes“ an, besonders gern mit „Sohn Gottes“, die größte Beleidigung, die nur noch unter Freunden ausgetauscht werden darf. Ansonsten bezeichnet er mich als nicht familientauglich, Schrecken aller Mütter, berührungsfeindlich, beziehungsunfähig und ähnlichen Untugenden eines Findelkinds. Es stimmt, nicht weil es stimmt, sondern weil er es sagt.
Die Felder vor uns schillern wie in Maschinenöl getauchte und zum Trocknen ausgelegte Laken. Als sei die Flamme eines Schneidbrenners über sie hinweggestrichen, strecken Baumgruppen ihre verkokelten Äste mahnend in den Himmel. Ich sage „mahnend“, um Zeichen zu setzen. Ihnen fehlen die Worte. Dafür sind wir auf der Welt. Wer es anders sieht, muss noch viel lernen. Der Glutnagel der Sonne ist in die Mitte einer blau pulsierenden Himmelskuppel gehämmert. Nichts entgeh ihrer Strahlkraft, die jeden Winkel ausleuchtet, alles überscharf zeigt, nur um es im nächsten Moment im siedenden Licht aufzulösen. Jeder Augenblick verkündet eine Zeitenwende, so viel steht still. Ich denke an Rons Ersatzmutter, der ständig etwas „wie Schuppen von den Augen fällt“, woraufhin alle ihre Gläser absetzen, die Löffel in der Suppe lassen und auf die neue Erkenntnis warten. Danach ist alles wie gehabt.
Es sind einige Tage seit unserer Ankunft vergangen. Da mir an dem Dorf nichts missfällt, lasse ich über meinen Vormund meine Sachen aus der Stadtwohnung kommen – eine Wohnung, die mir genauso gefallen hat, aber nun Geschichte ist. Ron besteht darauf, mich im Hof unterzubringen, in einem Gästezimmer „mit Meerblick“, nur dass im Moment das Wasser bis zum Horizont verdunstet ist. Kein Problem für ihn: „Wer will, der sieht!“ Ich sehe das Meer, obwohl ich es nicht sehe, weil er es sagt.
Ich erkläre ihm, meine eigenen vier Wände zu brauchen.
Er sagt „klar“ und bietet seine Hilfe an.
„Der Vormund lässt Packer kommen.“
„Gut.“
Wir liegen am Hofzaun, die Schultern an den Zaunlatten. Zuerst starre ich noch in die Natur um zu sehen, ob mir bei ihrem Anblick ein Wort einfällt, das sich so anfühlt wie eine Kartoffel im Mund. Dann lange ich meine Kupfermünzen aus der Hosentasche, alte englische Half Pennies, solide zweieinhalb Zentimeter große Stücke, und beginne sie über die ausgestreckten Beine auf den Boden zu werfen. Ich versuche, jeweils zwei Münzen aufeinander zu werfen oder wenigstens so, dass eine die Kante der anderen deckt.
Dabei hängt der zweite Wurf stark vom ersten ab. Zur Probe lege ich eine Münze auf den Boden und werfe die andere eine Zeit später, nachdem ich mich abgelenkt habe. Es scheint günstiger, wenn ich die gesamte Umgebung vor meiner Hand beachte, statt nur die zum Ziel gesetzte Münze. Das beste Vorgehen ist: die Münze in ihrem Umfeld ansehen, auf die Hand wirken lassen und werfen.
Wichtig ist die Absichtslosigkeit – absichtslos werfen. Wer meint, dass äußerste Willenskraft entscheidet, muss sich sagen lassen, dass am Ende eine geübte Beiläufigkeit siegt.
Eine Trance, die vollbringt, was der Werfer mit aller Konzentration zu erreichen versucht, aber erst schafft, wenn sein Wille abgeschaltet ist. Das zu erleben ist nur dem vergönnt, der genügend Zeit hat, um so Nichtigkeiten wie Ha‘Penny Würfe bis in die blinde Perfektion zu treiben. Zum Beispiel ich. Oder Ron. Schangeln ist eines der wenigen nie aufgegebenen Spiele zwischen uns. Wir müssten lange suchen, um etwas gleichwertig Stumpfsinniges zu finden. Die Münzen werden an eine Wand geschnippt. Wer mit seiner Münze am nächsten an die Wand kommt, darf die restlichen Münzen einsammeln, auf die Handfläche legen, hochwerfen, mit dem Handrücken auffangen, wieder hochwerfen und im Kammgriff – Handfläche nach unten – schnappen. Was er nicht fängt, geht an die anderen zurück.
Beim Hochwerfen vom Handrücken kommt es darauf an, möglichst knapp zu heben und die Münzen in Klumpen zusammen zu halten. Geübte können über dreißig Ha‘Penny Münzen schnappen.
Unser Stammplatz ist die Stelle am Hofzaun, von wo aus wir die Gegend überblicken. Ich werfe die Ha’Pennies im ich-er-ich-er-Stil, wenn Ron keine Lust mehr zum Schangeln hat. Ron wirft lieber Messer: In einem auf den Boden geritzten Viereck wird der erste Klingeneinstich ausgezogen, der nächste Stich muss das kleinere Feld treffen und so fort. Wenn wir gegeneinander antreten, um eine Entscheidung zu treffen – Abendessen im Hof oder in der Dorfkneipe – ist es immer das Messer. Das Problem mit dem Messer besteht inzwischen darin, dass es kaum noch ein Stück Erde gibt, in das die Klinge eindringt. Seit Wochen kein Tropfen Regen, kein Morgentau, nichts. Ron behauptet, wenn es so weitergeht, platzen den Kühen die Augen auf der Weide. Ihm selbst brummt schon der Schädel, und er ist immerhin noch ein Tier, das sich zu helfen weiß.
Meist übt jeder für sich – Ron mit dem Messer, ich mit den Münzen. Dann verbietet die Hitze jede weitere Bewegung und wir starren über die Felder. Keine Menschen, keine Maschinen. Die Sonne schwebt über unseren Köpfen, eine Lichtdusche mit Gluthammerschlägen.
Darf ich sagen, die Sonne wirft Schatten? Wirft sie? Oder erst der Zaun? Oder wirft umgekehrt der Schatten den Zaun gegen die Sonne? Oder schattet es, sonnt es, zaunt es ohne Werfer? Darf ich sagen, der Zaun geht um den Hof? Hat er Beine? Genau genommen nicht. Wer’s genau nimmt, hat statt Wörter Schimmel im Mund. Trau keinem Satz ohne schmelzende Ränder zu seinem Gegensatz und so weiter. Mir fallen Ausdrücke über Vorfälle ein, die den Vorfällen selbst die Sensation ablaufen ... Eines Tages wird vor unseren Augen ein Junge von einem Lieferwagen erfasst und durchs Anstaltstor gerammt. Man ruft den Pater, der sich in seiner Verwirrung zunächst auf den benommenen Fahrer stürzt, von einem Passanten jedoch mit „Pater, so erledigen Sie doch erst mal den Jungen!“ auf die gebotene Reihenfolge hingewiesen wird – zusammen mit dem Scherz, den das Wort „erledigt“ treibt und im Gedächtnis ankert, was sonst schnell vergessen wäre.
Ein wippender Punkt taucht hinter dem Kornfeld auf. Er flimmert weiß über unseren Schuhspitzen, schlierenhaft undeutlich, wird größer und bekommt Arme und Beine und winkt zu uns herüber. Es ist Rons Schwester, eine Flamme, an der er sich verbrannt hat. Seine Hassliebe, etwas Vollbusiges, Bildhübsches, Blutjunges und was nicht noch an Albernheiten, mit denen er mich verkuppeln will, was – wie ich inzwischen weiß – der eigentliche Grund seines Vorschlags war, mit auf den Hof zu kommen: nur um die Schwester „auf andere Gedanken zu bringen“. In andere Arme zu treiben. Er nennt sie Schwester wie er seine Ersatzmutter Mutti nennt, es könnte seine Ersatzschwester sein, seine leibliche Schwester, es bleibt in der Schwebe. Jedenfalls liebt er sie und verbietet sich diese Liebe, schiebt sich am Zaun hoch, klopft Hemd und Hose ab, flucht und ist weg.