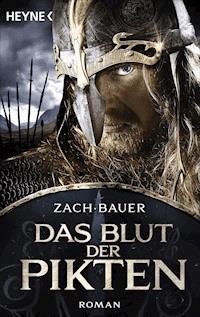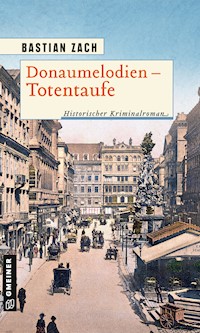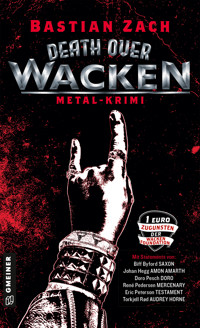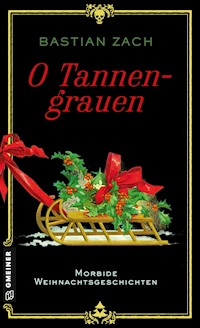Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Geisterfotograf Hieronymus Holstein
- Sprache: Deutsch
Wien, 1876. Als dem Geisterfotografen Hieronymus Holstein der Mord an drei jungen Frauen untergeschoben wird, hat dieser nur sieben Tage Zeit, um seine Unschuld zu beweisen. Gemeinsam mit seinem Freund, den alle nur den „buckligen Franz“ nennen, nimmt er die Nachforschungen auf. Die Suche nach einer ominösen Frau, deren Bekanntschaft Hieronymus am Abend des ersten Mordes gemacht hatte, führt ihn durch alle Wiener Gesellschaftsschichten, während sich die Schlinge um seinen Hals enger und enger zieht …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bastian Zach
Donaumelodien – Praterblut
Historischer Kriminalroman
Zum Buch
Der Tod ist ein WienerWien, Frühsommer 1876. Als dem Geisterfotografen Hieronymus Holstein der grausame Mord an einer jungen Frau am zwielichtigen Spittelberg untergeschoben wird, hat dieser nur sieben Tage Zeit, um seine Unschuld zu beweisen. Gemeinsam mit seinem Freund Franziskus Maria Rudolphi, den alle nur den „buckligen Franz“ nennen, nimmt er die Nachforschungen auf. Als kurz darauf zwei weitere junge Frauen tot aufgefunden werden, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Mit geschickten Verkleidungen mischt sich Hieronymus unters Volk der geschichtsträchtigen Kaiserstadt und sucht fieberhaft nach jener mysteriösen Frau, deren Bekanntschaft er am Abend des ersten Mordes gemacht hatte. Eine Spur führt zu den skurrilen Schaustellern des Wiener Wurstelpraters, eine weitere in die feine Wiener Gesellschaft. Doch schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen Freund und Feind, und Hieronymus wird in einen Strudel aus Lügen und Halbwahrheiten gerissen, während sich die Schlinge um seinen Hals enger und enger zieht …
Bastian Zach wurde 1973 in Leoben geboren und verbrachte seine Jugend in Salzburg. Das Studium an der Graphischen zog ihn nach Wien, als selbstständiger Schriftsteller und Drehbuchautor lebt und arbeitet er seither in der Hauptstadt. Die Liebe zu historischen Geschichten, die in seiner Wahlheimat Wien an jeder Ecke lauern, inspirierte ihn zu seinem Kriminalroman-Debüt.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Teresa Storkenmaier
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © Praterstern in Wien
© ullstein bild – ImagnoKarte auf S. 6/7: Wienbibliothek im Rathaus, Druckschriftensammlung, K-314355
ISBN 978-3-8392-6372-3
Widmung
Für Christine.
Karte
Wien, 1876
I
Ein pochender Schmerz in den Schläfen riss ihn aus einem traumlosen Schlaf, den er nicht hatte kommen sehen. Der über ihn hereingebrochen sein musste, nachdem er am Abend mit dieser adretten Dame –
Wo war er überhaupt?
Hieronymus Holstein atmete tief ein, sog die Luft gierig durch die Nase. Es roch muffig und säuerlich zugleich. Nach Laken, in die man zu viele Nächte lang geschwitzt hatte. Übelkeit machte sich in ihm breit.
Er wollte die Augen öffnen, doch ihm war, als versuchte jemand mit Gewalt, ihm die Lider zuzudrücken. Er stemmte sich dagegen. Dann, nach einem schieren Kraftakt, hatte er es endlich geschafft.
Er sah sich um.
Es war Nacht. Die Wände des schmucklosen Raumes, in dem er lag, konnte er nur erahnen. Vor dem einzigen Fenster waren die Läden geschlossen, nur in schmalen Bahnen schnitt das kalte Licht des Mondes durch vereinzelte Spalten.
Hieronymus tastete um sich. Er lag auf einem Bett. Die Decke unter ihm fühlte sich schmierig und rau zugleich an, der Strohsack darunter war durchgelegen. Er setzte sich auf.
Wie kam er hierher? Und wo zur Hölle war »hier«?
Er atmete erneut tief ein. Ein feiner Geschmack nach Eisen machte sich in seinem Mund breit.
War er allein?
Hieronymus’ Blick fiel auf jene Ecke des Zimmers, die völlig von der Dunkelheit vereinnahmt war. Er stutzte – lag dort etwas am Boden?
Er rappelte sich auf, merkte, wie sich alles um ihn herum zu drehen begann. Gleißende Blitze tanzten vor seinen Augen, schienen sich rasend schnell zu vermehren. Er taumelte, setzte sich so schnell er konnte wieder auf den groben Holzrahmen der Bettstatt. Trotz seiner einunddreißig Jahre fühlte er sich wie ein Greis. Als wäre er in wenigen Stunden um Jahrzehnte gealtert.
Das alles ergab keinen Sinn. Ja, er sprach gern jenen Flüssigkeiten zu, die man gären, brauen und destillieren konnte. Auch in dieser Reihenfolge. Aber das letzte Mal, als er so viel getrunken hatte, dass er beim Aufwachen nicht mehr wusste, wo er sich befand, musste Jahre zurückliegen.
Der eherne Geschmack wurde stärker.
Hieronymus fuhr sich durch die halblangen, schweißnassen Haare, rieb sich die Stirn, als könnte er so klarer denken. Aber es half nicht, im Gegenteil. Nun machte sich auch noch ein beklemmendes Gefühl in ihm breit, schnürte ihm den Brustkorb enger und drückte ihm die trockene Kehle zu.
Wieder der Blick in die Ecke. Was lag dort?
Er beugte sich vor, stapfte langsam und gekrümmt auf das am Boden liegende Bündel zu. Hieronymus kramte in seiner Westentasche. Er holte eine Schachtel Schwefelhölzer hervor, zog eines der Holzstäbchen heraus und rieb es an. Die kleine Flamme kam ihm schneidend hell vor, auch wenn sie die Dunkelheit kaum zu vertreiben mochte. Doch tatsächlich – vor seinen Füßen lag etwas. Aber kein ganzes Etwas, vielmehr einzelne Teile …
Hieronymus kniete sich nieder, streckte den Arm mit dem Flämmchen aus – und prallte sogleich zurück, als hätte er einen Faustschlag ins Gesicht erhalten. Vor ihm lag eine Frau am kalten Bretterboden.
Nackt.
Zerstückelt.
Gleich so, als ob man einer Marionette alle Glieder einzeln ausgerissen und diese dann achtlos weggeworfen hätte. Er wagte einen zweiten Blick, streckte das brennende Holzstäbchen in ihre Richtung. Sie war jung. Ihr Kopf lag inmitten ihrer Körperteile. Unzählige Sommersprossen zierten ihr fein gezeichnetes Gesicht. Ihre langen blonden Haare mussten bei der Trennung des Kopfes vom Rumpf einfach mit abgehackt worden sein, so abrupt endeten sie. Mund und Augen waren entsetzlich weit aufgerissen. Die Finger hatte sie merkwürdig verkrampft. Ihr Rumpf war voller Blut, schien ansonsten jedoch scheinbar unversehrt.
Aber das war nicht alles, was das Schwefelholz zu erhellen vermochte. Hieronymus erkannte, dass sein Hemd und seine Jacke voll von getrocknetem Blut waren. Wie auch seine Hände.
Das durfte doch alles nicht –
Plötzlicher Lärm drang durch die schäbige Holztür des Zimmers. Stimmengewirr, Befehle. Schritte, die eine knarrende Treppe hinaufpolterten.
Mit einem Mal wich jegliches Gefühl von Übelkeit und Schwindel aus Hieronymus. Er sah zum Fenster und wusste, dass dies sein einziger Ausweg war. Ganz gleich, in welchem Stockwerk er sich befand, er musste handeln.
Ein Krachen.
Jemand hatte sich gegen die Zimmertür geworfen, die vorerst standhielt.
Nach einem weiteren Versuch sprang sie jedoch donnernd auf. Ein Mann im dunkelgrünen Waffenrock der Sicherheitswache stolperte in den Raum, eine Petroleumfunzel in der Hand. Hinter ihm der Schein weiterer Laternen.
Ohne zu zögern, sprang Hieronymus auf. Er hechtete zum Fenster, hob die Arme schützend vors Gesicht und stürzte sich hindurch.
II
Die nächsten Augenblicke kamen Hieronymus vor, als liefen sie verlangsamt vor seinem geistigen Auge ab, gleich so, als würde man ein Zoetrop nicht schnell genug drehen.
Das Splittern von Glas.
Das Bersten von Holz.
Die plötzliche Kälte der nächtlichen Luft.
Und der freie Fall in die Tiefe …
Hieronymus sah in den Himmel, in die dunklen Wolken, vom Licht des Mondes nur schemenhaft umrissen, die immer kleiner wurden, während er auf die Erde zustürzte. Gleich würde sein Leib zerschmettern.
Ein Aufprall.
Wieder ein Splittern. Wieder ein Fall, dieses Mal abgebremst. Er schloss die Augen, gleich würde es so weit sein –
Dann der endgültige Aufprall, gefolgt von einem stechenden Schmerz, der durch Hieronymus’ ganzen Körper schnitt.
Stille.
Allmählich drang das Gewirr von Stimmen an seine Ohren, das dumpfe Geräusch von Tonkrügen, die aneinandergestoßen wurden. Das Lachen von Frauen und das Grölen von Männern. Die Melodie eines Akkordeons.
Nein, das konnte nicht das Paradies sein – Hieronymus war dem Tod offenbar noch einmal von der Schippe gesprungen. Er tastete um sich. Kalte, regennasse Pflastersteine. Er öffnete die Augen. Ein Baugerüst aus Holz reckte sich über ihm in die Höhe, die Plattform durchgebrochen.
Er wandte den Kopf zur Seite, sah eine enge, spärlich beleuchtete Gasse, die bergab verlief und menschenleer war. Er drehte den Kopf zur anderen Seite – zwei Wachmänner, die am Eingang des Hauses standen, aus dessen Fenster er gerade gesprungen war, starrten ihn ungläubig an.
In diesem Augenblick schoss der Überlebenswille durch Hieronymus’ Körper, gleich einer Welle, die mit der Wucht der Gezeiten auf einen Felsen brandete und ihn unter sich begrub. Die Schmerzen waren verflogen, etwaige Wunden vom Sturz nicht zu spüren. Er sprang auf und hastete die Gasse hinunter, weg von dem Haus, weg von den Wachmännern.
Ein Fuß vor den anderen, herrschte er sich innerlich an, nur nicht taumeln, nur nicht stolpern.
Gleich darauf hörte er, wie hinter ihm Pfiffe schrillten, Befehle gebrüllt wurden und Schritte ihm folgten. Die beiden Wachmänner hatten sich wohl aus ihrer Erstarrung gelöst.
Hieronymus bog in die nächste Gasse ein, versuchte sich zu orientieren, ohne langsamer zu werden. Aber die einstöckigen Häuser, deren Stuckfassaden ihn verschmutzt und abgebröckelt anstarrten, boten wenige Anhaltspunkte. So sah es überall in Wiens Außenbezirken aus. Es könnte selbst Baden oder gar Prag sein. Prag. Beim Gedanken an die Stadt, die Zeugin seiner Geburt gewesen war, umfing ihn eine eigenartige Beklemmung, sodass er sich selbst davon überzeugen wollte, dass er unmöglich dort sein konnte.
Er warf einen schnellen Blick auf ein Straßenschild an der Ecke eines Hauses: »VII. Neubau«.
An der nächsten Kreuzung blieb er stehen, versuchte zu Atem zu kommen. Ein Funken Hoffnung keimte in ihm auf – seine Verfolger schien er abgeschüttelt zu haben.
»Halt! Stehen bleiben!« Zwei Wachmänner stürmten auf Hieronymus zu, ihre kurzen, leicht gebogenen Säbel in die Höhe gereckt.
Er fluchte innerlich. So schnell und weit, wie er gedacht hatte, war er offensichtlich nicht gelaufen. Hieronymus nahm die nächstbeste Gasse, rutschte aus und fiel auf das nasse Straßenpflaster.
Er fixierte die Kreuzung vor ihm, die beinahe völlig im Dunkeln lag und daher die Möglichkeit bot, listig die Richtung zu ändern. Er sprang auf, wollte gerade loslaufen, als in jenem Augenblick zwei weitere Wachmänner genau in diese Kreuzung einbogen und auf ihn zurannten.
Hieronymus nahm hinter sich die beiden Verfolger wahr, sah vor sich die zwei anderen. Schaute zu seiner Rechten, wo ein besonders enger Durchgang in dunkles Nichts führte, gesäumt von heruntergekommenen Häusern, die den Anschein erweckten, als würden sie jeden Moment über ihm zusammenstürzen.
Seine letzte Chance.
Er lief los. Gefühlt bei jedem zweiten Schritt streifte Hieronymus an einer der beiden Mauern, die ihn einschlossen, hatte die beklemmende Vorahnung, sie wollten ihn am Vorankommen hindern. Doch er biss die Zähne zusammen, rannte buchstäblich blindlings geradeaus – und prallte mit einem Mal gegen einen Lattenzaun.
Er fiel in den Unrat, der die Gasse knöchelhoch bedeckte, setzte sich auf, drückte sich mit dem Rücken gegen das Hindernis – und sah, wie die schattenhaften Umrisse seiner Verfolger auf ihn zugelaufen kamen …
III
Die Morgensonne warf ihre ersten wärmenden Strahlen auf die Kaiserstadt, ließ ihre unzähligen spitzen Giebel und Türme in kräftigem Orange feierlich erglühen. Die Domkirche St. Stephan zu Wien überragte die Szenerie.
Weniger feierlich wirkten die Behausungen und Buden vor der Stadt, die sich in alle Richtungen bogen und neigten, als wären sie von Krankheit gebeutelt und vom Alter geschwächt. Ihre Dächer bestanden im besten Fall aus morschen Holzschindeln. Zwischen ihnen stapften ihre Bewohner wortkarg durch den Morast zu jenem Ort, an dem sie sich heute zu verdingen hofften.
Vor einer dieser Behausungen stand ein Schindelwagen mit halbrundem Dach, gleich einem Zirkuswagen, mit buntbemalten Seiten, die die magischen Möglichkeiten der neuartigen Kunst der spirituellen Fotografie bildgewaltig anpriesen. Daneben graste ein Pferd, das an eines der Wagenräder angebunden war.
Unweit davon stand ein Brunnen, aus dem ein älterer Mann mittels einer Winde Wasser heraufholte. Seine Hände ähnelten Schaufelblättern, sein Körper war eigenartig verdreht und sein Buckel überragte beinahe seinen Kopf, auf dem nur mehr spärlich schwarze Haare wuchsen. Seine Kleidung, die aus einer dunkelbraunen Hose und einer nahezu gleichfarbigen Weste bestand, wirkte abgetragen, aber sauber.
Franziskus Maria Rudolphi schnaubte vor Anstrengung. Seine ungelenken Bewegungen zeugten davon, dass sein Körper nicht mehr willens war zu tun, wie er sollte. Er hielt inne, wischte sich den Schweiß von der Stirn. Langsam kam er wieder zu Atem. Dann drehte er erneut die schwergängige, quietschende Kurbel.
Schließlich konnte er den Kübel Wasser greifen, stellte ihn am Rand des Brunnens ab und goss seinen Inhalt in den hölzernen Bottich, der zu seinen Füßen stand.
Franz bemerkte nicht, wie sich jemand von hinten an ihn heranschlich. Ein Knabe, kaum sieben Lenze alt, die Haare kurz geschoren, die Kleidung zerschlissen, Füße, Hände und Gesicht strotzend vor Schmutz. Trotzdem funkelten seine Augen voll diebischer Freude. Er beschleunigte seinen Schritt und schlug dem Buckligen auf den linken Oberschenkel. Als sich der Mann schwerfällig umdrehte, um zu sehen, wer oder was ihn da geschlagen hatte, war der Wicht laut lachend schon wieder auf und davon.
Franz stieß ein verärgertes Grunzen aus und wandte sich wieder der Kurbel zu. Während er den Kübel in den Brunnenschacht hinabließ, näherte sich ein weiterer Knabe, kaum jünger als der Erste. Er schlug Franz auf den rechten Schenkel. Wieder drehte sich dieser schwerfällig und schnaubend um, doch der Kleine lief nicht weg, sondern blieb mit großen Augen wie angewurzelt stehen, den Kopf nach oben gerichtet. Franz’ Blick traf den des Buben, keiner von beiden wagte es, ein Wort zu sagen. Dann stieß der Mann einen bellenden Laut aus. Der Knabe fuhr vor Schreck zusammen, löste sich aus seiner Erstarrung und lief aufgekratzt lachend zu dem anderen Jungen, der sich hinter dem Schindelwagen verschanzt hatte.
Ein gutmütiges Lächeln machte sich auf Franz’ Gesicht breit. Warum die Buben nicht müde wurden, mit ihm tagtäglich das gleiche Spiel zu spielen, konnte er zwar nicht begreifen, aber es erheiterte ihn.
»Emil! Jaroslav!« Die Stimme der Frau, die vor der Tür der maroden Behausung stand, duldete keinen Widerspruch. Als Mutter von sechs Kindern war Anezka Svoboda es gewohnt zu kommandieren. Die beiden Knaben liefen zu ihr, und beide erhielten einen Klaps auf den Hinterkopf.
»Hört’s auf, den buckligen Franz zu häkeln!« Nicht nur ihr Name verriet, dass sie aus dem Osten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie kam, sondern im Besonderen ihr harter Akzent.
Sie sah den Älteren ihrer Söhne an. »Du, geh Feuerholz hacken!« Der Knabe lief los. »Und du, hol Eier, wenn’s denn welche gibt«, befahl sie dem Jüngeren. Auch er tat, wie ihm geheißen.
Die Frau sah zu Franz, der sie beobachtet hatte. Ihre braunen, verfilzten Haare hatte sie zu einem Knoten geflochten. Ihre schlechten Zähne und die tiefen Falten im Gesicht wiesen sie als alte Frau aus, auch wenn sie gerade einmal zweiunddreißig war. Und ihr schmutziger und zu oft geflickter Kittel bezeugte, dass sie ihr Leben mehr schlecht als recht bestritt. Sie warf dem verkrüppelten Mann einen argwöhnischen Blick zu. Dann verschwand sie wieder im Haus.
Franz stieß einen grummeligen Laut aus und goss einen weiteren Kübel Wasser in den Bottich. Dann packte er diesen, hob ihn mit scheinbarer Leichtigkeit hoch und trug ihn Richtung der Behausung. Sein humpelnder Gang ließ das Wasser hin- und her- und schließlich überschwappen, was ihn aber nicht zu kümmern schien.
Er hatte gerade den halben Weg über den Vorplatz zurückgelegt, als ihn ein Pfiff innehalten ließ. Er blickte sich um, sah eine Gestalt im Schatten des Schindelwagens kauern. Franz runzelte die Stirn, schien langsam zu begreifen. Er machte kehrt, humpelte zu dem Fuhrwerk und stellte den Bottich ab.
»W-was ist geschehen?«, brachte Franz stockend hervor.
Die Gestalt kam auf allen vieren hervorgekrochen. »Ich weiß es noch nicht, Franz, aber diesmal hat man mich so richtig angeschmiert«, antwortete Hieronymus, während er mit prüfendem Blick sicherstellte, dass niemand sonst in der Nähe war. Er tauchte seine mit getrocknetem Blut verschmierten Hände in den Bottich, wusch sie notdürftig. Dann tauchte er den Kopf unter Wasser und verharrte so eine gefühlte Ewigkeit.
Franz pochte ihm auf den Rücken. Hieronymus richtete sich auf.
»Du sch-schaust f-furchtbar aus.« Der Ausdruck im Gesicht des verkrüppelten Mannes ließ keinen Zweifel daran, dass er sich große Sorgen machte.
»Sag mir etwas, was ich noch nicht weiß.«
Franz deutete auf das blutbefleckte Hemd. Der andere verstand, zog sich Jacke und Hemd aus. »Ich muss erst mal einen klaren Kopf bekommen. Später reden wir über alles, einverstanden?«
Franz nickte knapp. Dann blickte er in den Bottich, seine Miene verfinsterte sich. Das Wasser darin hatte sich rot gefärbt. Hieronymus erkannte, dass er seinen Freund zum erneuten Wasserholen verdammt hatte. Er klopfte ihm auf die Schulter. »Entschuldige.«
Franz stieß ein verärgertes Grunzen aus.
IV
Hieronymus stand vor einer zerschundenen Kommode, auf der ein kleiner trüber Spiegel an der Wand lehnte. Mit geübter Bewegung ließ er die Messerklinge über seinen Hals gleiten, bis auch das letzte bisschen Rasierschaum entfernt war, und rieb danach prüfend mit der Rückseite der Hand über Kehle und Wangen. Zufrieden legte er das Messer weg. Er zwirbelte die kurzen Enden seines Schnurrbartes, strich seinen dreieckigen Kinnbart glatt. Dann nahm er einen Hornkamm und frisierte seine halblangen, hellbraunen Haare nach hinten, die noch feucht vom Untertauchen im Bottich waren.
Hieronymus sah prüfend in den Spiegel – zumindest äußerlich hatte er kaum noch Ähnlichkeit mit dem Mann, der vor wenigen Stunden neben einer zerstückelten Frau aufgewacht war. Er begutachtete erneut seine Fingernägel, aber auch hier waren keine Reste getrockneten Blutes mehr zu sehen.
Franz kam in die spärlich eingerichtete Stube. Zwei Säcke voll Stroh am Boden, eine ramponierte Truhe an einer Wand, die Kommode an einer anderen, zwei Stühle und ein gebrechlich wirkender kleiner Tisch in einer Ecke. Eine weitere Tür auf der anderen Seite wies den Raum als Durchgangszimmer aus.
Hieronymus wandte sich um. »Ich fühle mich wie neugeboren.«
»A-alles Einb-bildung.«
Ohne ein weiteres Wort zu wechseln, setzten sich die beiden Männer an den Tisch.
Franz’ Miene war noch immer voll Sorge. Der andere holte tief Luft, schien mit sich zu ringen, wo er anfangen sollte zu erzählen.
Da wurde die Tür aufgerissen. Anezka kam herein und sah Hieronymus scharf an. »Herr Holstein, Sie haben heut Nacht aber nicht hier geschlafen. Hat Anezka recht?«
Der setzte ein mildes Lächeln auf. »Ihnen entgeht nichts, Frau Svoboda.«
»Geht Anezka ja nichts an. Aber das hier ist ein anständiges Haus, lassen Sie sich das sagen!«
»Deshalb fühlen sich Franz und ich hier auch so wohl.«
Die Vermieterin überlegte augenscheinlich, ob die Worte ehrlich oder als Hohn gemeint waren, enthielt sich schließlich jedoch einer Entgegnung. Sie strich sich den schmutzigen Kittel glatt, dann ging sie quer durch das Zimmer zur gegenüberliegenden Tür und schlug diese hinter sich zu.
Franz sah Hieronymus herausfordernd an. Der zuckte mit den Schultern.
»Ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll, mein Lieber. Gestern Nachmittag, vielleicht. Im Café Central habe ich eine wunderbare Bekanntschaft gemacht: Maria, Witwe eines Großindustriellen und eine äußerst interessante Frau – du weißt schon, eine mit Stil und was im Kopf, nicht so eine dümmliche Probiermamsell.«
Franz grinste feist.
»Wir haben zwei oder drei Achterl Weiß getrunken und uns köstlich dabei unterhalten. In bester Laune haben wir uns danach von einem Fiaker in den Prater bringen lassen, weil die Dame gemeint hat, dort spiele eine ihrer liebsten Musikkapellen, die Strauss-Kapelle.«
Hieronymus runzelte nachdenklich die Stirn. »Das war im Zweiten Kaffeehaus in der Prater-Allee, und die Musiker waren richtig gut.« Bei dem Gedanken daran schwenkte er leicht mit dem Kopf hin und her, als hörte er noch die Musik von Eduard Strauss’ älterem Bruder Johann. »Wie auch immer, wir haben auch dort noch ein paar Achterl getrunken, und dann … ja, dann …« Er brach ab.
»W-was w-ar dann?« Franz kratzte sich den Nacken.
Hieronymus atmete tief ein und aus, als könnte er die Erinnerung mit der Luft einsaugen. Vergebens. Sein Blick ging ins Leere.
»Was dann geschehen ist, will mir einfach nicht mehr in den Sinn kommen. Aber das wäre alles noch kein Malheur gewesen. Irgendwann bin ich aufgewacht.« Er sah Franz beschwörend an, begann zu flüstern. »Auf irgendeinem Zimmer, in einem Haus am Spittelberg. Mein Gewand war blutig, meine Hände auch, hast du ja gesehen. Und in einer Ecke des Zimmers lag eine junge Frau. Tot.«
Franz klappte der Mund auf.
»Zerstückelt.«
Ungläubiges Schweigen.
»W-war es diese –«
»Nein, Maria war es nicht, ich habe die junge Frau noch nie zuvor gesehen. Und genau in dem Augenblick kommt die Sicherheitswache hereingestürmt.«
»W-was f-für ein Zuf-fall!«
»Du sagst es, mein Freund, du sagst es.«
»Hat m-man dich gesehen?«
Hieronymus zuckte mit den Schultern. »Es war dunkel, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht.« Er betrachtete seine Arme, die frische Schnittverletzungen aufwiesen. »Ich bin durchs geschlossene Fenster abgepascht. Sie haben mich verfolgt, bis ich in einer finsteren Gasse mit dem Rücken zu einer Bretterwand stand. Ich hab gedacht, jetzt ist es aus. Da hat eines der Bretter nachgegeben, ich bin gerade so hindurchgeschlüpft. Dahinter lagerte ein Stapel Bauholz, dem hab ich einen Tritt gegeben, und damit war der Durchschlupf versperrt.« Hieronymus strich sich fahrig übers Gesicht. »Das war buchstäblich Flucht in allerletzter Sekunde.«
»Ist n-noch einm-mal gut gegangen.« Franz tätschelte Hieronymus väterlich die Hand.
Der teilte die Einschätzung seines Freundes nicht ganz. »Nichts ist gut gegangen, verstehst du nicht? Irgendjemand versucht, mir einen abscheulichen Mord anzuhängen, Franz. Und ich muss herausfinden, wer das ist, und warum.«
»W-warum?«
»Ganz einfach. Spätestens übermorgen werde ich wohl als Phantombild in allen Gazetten erscheinen. Das heißt, wir müssen hier unsere Zelte abreißen und erneut weiterziehen. Und selbst dann wären wir nirgends sicher. Zerstückelte Jungfrauen lassen die Auflagen in die Höhe schnalzen, das heißt, die Presse wird das so schnell nicht auf sich beruhen lassen.«
»W-wer w-war sie?«
Hieronymus seufzte, während ihm Bilder von der Toten in den Sinn kamen … die süßen Sommersprossen, das freche Stupsnäschen. »Auch das weiß ich noch nicht. Aber eins ist sicher: Das war keine Tat im Affekt, kein Streitmord oder ein ausgeufertes Liebesdrama. Das hatte etwas Rituelles. Und du weißt, was das heißt.«
Franz nickte holprig. »N-nicht dumm.«
»Ganz genau«, bekräftigte Hieronymus. »Der Täter wusste genau, was er tat. Und das macht ihn umso gefährlicher.«
V
An der Ecke eines zweistöckigen Hauses in der Spittelberggasse setzte ein großer steinerner Löwe zum Sprung an. Er war der Namenspatron des Gasthauses darin, das gemeinhin nur das »Löberl« genannt wurde. Es galt als eines der verruchtesten Sauf- und Raubnester von ganz Wien, wo täglich Musikanten aufspielten und der Wirt kecke Mädchen dazu anhielt, die Gäste mit Tanz und frivolen Liebkosungen auf jede nur erdenkliche Art und Weise um ihr hart verdientes Geld zu prellen.
An diesem Vormittag war davon allerdings nichts zu bemerken. Denn in der Gasse, wo sonst der eine oder andere Tschecherant seinen Rausch vom Vortag ausschlief, hatten sich gut zwei Dutzend Menschen zusammengerottet, die im Flüsterton Vermutungen und Verleumdungen austauschten. Immer wieder blickten sie zu dem zersplitterten Fenster im zweiten Stock hoch oder zu dem maroden Holzgerüst darunter, und auch sonst ließen sie keine Gelegenheit aus, einen sensationslüsternen Blick ins Innere der Wirtsstube zu erhaschen.
Zwei Männer der Sicherheitswache standen breitbeinig vor dem Tor des Gasthauses »Zum weißen Löwen«. Sie wirkten in ihren dunkelgrünen Waffenröcken, die pompadourrot eingefasst waren, ernst und streng, die linke Hand auf den Knauf des Säbels gestützt, der an einer ledernen Kuppel an der Seite des Rocks hing. Ihre alleinige Aufgabe bestand darin, zu verhindern, dass sich niemand unbefugt Zutritt verschaffen konnte.
Ein dicklicher Mann mit struppigem Backenbart bahnte sich seinen Weg durch die Schaulustigen. Gekleidet in einen abgetragenen Frack trug er einen Zylinder auf dem Kopf. Hieronymus hatte sich, wie ihm Franz attestiert hatte, äußerst gekonnt verkleidet. Stark genug, um nicht erkannt zu werden, aber nicht so stark, dass er alle Blicke auf sich zog.
»Was soll denn der Batzen Bahö?«, fragte Hieronymus eine verlebt aussehende ältere Frau, die den Blick nicht von dem Fenster lassen konnte, durch das er selbst erst vor wenigen Stunden getürmt war.
»Ein arglistiger Mordbub ist da in der Nacht rausgesprungen, nachdem er so ein armes Tschopperl in Stücke gehauen hat. Jung soll sie gewesen sein, und hübsch obendrein.« Sie schüttelte traurig den Kopf. »Zerhackt … Wissen S’, einfach so.« Sie ahmte mit der Hand ein Hackbeil nach. »Grauslich«, ereiferte sich die Frau weiter. »So eine Bestie. Wer weiß, an welchem hübschen armen Dirndl er sich als Nächstes vergeht.«
»Keine Sorge. So, wie du ausschaust, fällst nicht in sein Beuteschema«, konstatierte der Mann neben ihr trocken.
Der Frau blieb vor Empörung der Mund offen. »Das ist ja wohl die Höhe!«, keifte sie zurück. Dann machte sie auf der Stelle kehrt und eilte davon.
»Hab ich nicht recht?«, polterte der Mann Hieronymus an. Sein Atem stank beißend nach Fusel, trotzdem nahm er einen Schluck aus seinem Flachmann.
Der nickte nur knapp, da er kein Aufsehen erregen wollte, und wandte sich an den Mann vor ihm, der ob seines gepflegten Äußeren einen höheren Stand zu bekleiden schien. »Hat jemand den Mörder erkannt?«
»Was man bisher gehört hat, nicht.« Der Mann deutete auf das Holzgerüst und den durchgebrochenen Boden. »Aber wenn das da nicht hier gestanden hätte, dann bräuchte man ihn jetzt nicht zu suchen. Der wär mit dem Kopf auf den Pflastersteinen aufgeschlagen wie ein Ei, und das wär es gewesen.«
Hieronymus lief bei dem Gedanken daran ein Schauer über den Rücken. Er drängte sich nach vorn, bis er vor den beiden Männern der Sicherheitswache stand.
»’tschuldigen S’, wann sperrt denn das ›Löberl‹ heute auf?«
Der linke Wachmann sah Hieronymus erst prüfend an, dann lächelte er freundlich. »Das ist leider unsere Schuld, dass es noch geschlossen ist. Die Kollegen haben sich vertratscht, wissen S’? Aber wenn S’ wollen, dann frag ich gleich nach, wann der Wirt wieder seinen gepantschten Fusel ausschenkt.«
Natürlich war Hieronymus klar, dass sich der Wachmann gerade einen Spaß auf seine Kosten erlaubte, aber er würde eben mitspielen.
»Danke, das wäre urfreundlich von Ihnen«, entgegnete er mit dreistem Grinsen.
Die anderen Schaulustigen lachten teils hell auf.
Die andere Wache zog am Knauf ihres kurzen gebogenen Säbels, dass er sich ein Stück weit aus der ledernen Scheide hob. »Aber jetzt ganz schnell wiederschaun, haben S’ gehört?«
Hieronymus wandte sich ab und begab sich wieder in die Menge der Schaulustigen. Langsam dämmerte ihm, in was er da hineingeraten war. Zeit, die Sache zu verarbeiten und darüber zu sinnieren, was das alles zu bedeuten hatte, hatte er allerdings noch nicht gehabt. Mit seiner Flucht hatte er instinktiv reagiert und sich heute direkt ins Getümmel gestürzt. Die Zeit der Besinnung würde kommen, das wusste Hieronymus, sie musste sogar kommen, aber zuvor wollte er zumindest eine seiner Fragen beantwortet wissen. Nur, hier war nicht der Ort dafür, das spürte er überdeutlich.
Was konnte er also tun?
Schlagartig erkannte Hieronymus, dass er gerade im Begriff war, das Pferd sprichwörtlich von hinten aufzuzäumen. Nicht das Ende des Abends galt es zu erkunden und auszuloten, sondern seinen Beginn. Denn alles, was geschehen war, führte schließlich in das Haus »Zum weißen Löwen«.
Zielstrebig schritt er die Gasse bergab, durch die er letzte Nacht noch verfolgt worden war, und nahm sich jene Lokalität als Ziel, von der alles seinen schicksalhaften Ausgang genommen hatte.
Das Café Central, gelegen an der Ecke Herrengasse und Strauchgasse, war erst in diesem Jahr von den Gebrüdern Pach feierlich eröffnet worden. Geplant von Architekt Heinrich von Ferstel, wirkte das hohe zweistöckige Gebäude, das auch die »k.k. privilegierte Nationalbank« beherbergte, wie eine Mischung aus königlichem Herrschaftssitz und steinerner Trutzburg. Repräsentativ war es allemal.
Hieronymus prüfte kurz, ob sein falscher Backenbart noch dort klebte, wo er sollte, dann öffnete er die zweiflügelige Tür des Cafés und trat in die prunkvolle Säulenhalle, über der ein imposantes Kreuzgewölbe thronte. Eine allgegenwärtige und sich doch immer verändernde Geräuschkulisse aus Gesprächen, Gelächter und dem Geschepper von Porzellan empfing ihn, Tabakschwaden und aromatischer Kaffeegeruch durchzogen die Luft und regten den Appetit an.
Hieronymus ging zu dem kleinen Tisch im Eck, an dem er auch gestern gesessen hatte, und nahm Platz. Er bestellte beim Ober, der die Nase höher zu tragen schien als seinen pomadisierten Scheitel, eine Melange und dazu einen Apfelstrudel.
Schließlich atmete er tief durch. Ja, hier hatte er gesessen. Hatte den Tag Revue passieren lassen. Hatte sich ein wenig darüber geärgert, dass er keinen neuen Kunden hatte gewinnen können, der entweder ein gewöhnliches Porträt haben wollte oder aber Hieronymus mit jener speziellen Anfertigung beauftragte, von der dessen Schindelwagen so farbenfroh kündete: das bildhafte Ablichten von Kunden und möglichen geisterhaften Seelen, die ja allgegenwärtig waren. Am Standort konnte es jedenfalls nicht liegen, da war sich Hieronymus sicher, denn er und Franz hatten sich vor das »Aquarium« gestellt, vor dem die lang gezogene und stark frequentierte Hauptallee des Praters verlief.
Hieronymus sah sich in dem Kaffeehaus um und fühlte sich zutiefst an den gestrigen Abend zurückerinnert. Mit einem Mal bemächtigte sich seiner eine eigenartige Ahnung, eine Irritation seines Zeitempfindens, als würde er zwischen gestern und dem Heute hin- und herspringen. Als wäre in der Zwischenzeit nichts geschehen, nur der Wechsel von Tag zu Nacht und umgekehrt. Hieronymus trat der Schweiß auf die Stirn. Ihm war, als säße er im Führerhaus einer Lokomotive, die unter vollem Dampf auf das Ende des Gleiskörpers zuraste, der direkt in eine Schlucht führte – und er war unfähig, die Bremsen zu betätigen.
»Bittschön, der Herr.« Die Worte des Obers und das Scheppern des Geschirrs auf dem silbernen Tablett, das dieser unsanft auf der steinernen Tischplatte abstellte, rissen Hieronymus wieder in die Wirklichkeit zurück.
Er nickte höflich.
Dann trank er einen großen Schluck des Milchkaffees und schob sich ein Stück Apfelstrudel in den Mund. Er schloss die Augen, genoss den säuerlichen Geschmack der Äpfel, der mit süßem Zimt gepaart war, und aß dann gierig den Rest.
So gestärkt blickte er zum Nebentisch, wo zwei Herren mit weißen Hemden und Gehrock saßen und über scheinbar wichtige Dinge konferierten. Gestern war das anders. Gestern saß da jene Dame, die ihm erst keck zugelächelt hatte und sich danach, auf Hieronymus’ höfliche Einladung hin, zu ihm begeben hatte. Maria hatte sie geheißen. Maria und noch etwas … Ihr Nachname wollte Hieronymus partout nicht in den Sinn kommen.
Er versuchte sich zu erinnern, was dann geschehen war, und schmunzelte unwillkürlich, als Maria vor seinem geistigen Auge auf einmal neben ihm saß und ihn anlächelte. Sie war von dem lieblichen, blumigen Duft ihres Parfüms umgeben, das in Hieronymus das Gefühl von Vertrautheit weckte und in ihm das Verlangen aufkommen ließ, sie in den Arm zu nehmen und an sich zu drücken, auch wenn sich das nicht geziemte. Daher hatte er den Ober hergewunken und zwei Achterl Weiß bestellt. Und zwei weitere, da die ersten beiden so schnell getrunken waren.
Dann waren sie aufgebrochen.
Hieronymus nippte den letzten Schluck Kaffee, legte neunzig Kronen auf den Tisch und verließ das Café Central.
Vor dem Kaffeehaus hatten er und Maria den nächstbesten freien Fiaker genommen, waren sich im Wageninneren sittlich gegenübergesessen und schließlich an ihrem Ziel angekommen – beim Zweiten Kaffeehaus, mitten auf der Prater-Allee.
Bei den Erinnerungen daran kam Hieronymus ein Funke des Zweifels, ob das, was er gerade vorhatte, auch Sinn ergab. Aber was hatte er schon zu verlieren?
Er tat, was er tags zuvor auch schon getan hatte, und ließ sich kurze Zeit später erneut in den Prater kutschieren.
Der Einspänner hielt vor der Lokalität. Hieronymus stieg aus, bezahlte für die Fuhre und wandte sich um. Wieder blitzten Erinnerungen des gestrigen Abends auf. Wieder sah er sich selbst, wie er mit der Dame, die sich bei ihm launig eingehängt hatte, durch das mit hölzernen Schnörkeln verzierte Eingangstor des Zweiten Kaffeehauses schritt. Das Tor und der Gastgarten dahinter waren mit Gaslaternen warm und einladend beleuchtet, der frühsommerliche Wind ließ die großen Kastanienbäume, die sich wie ein grünes Dach über die Tische spannten, sanft rauschen.
Dieses Mal bemerkte Hieronymus, dass es nicht der Zeitsprung war, der ihm zu schaffen machte wie eben im Café, sondern die Vorahnung dessen, was nach dem Betreten dieser Gaststätte geschehen war – und woran ihm gänzlich die Erinnerung fehlte. Wieder rangen Beklemmungen in ihm nach Aufmerksamkeit. Er sah sich selbst inmitten der offenen See, in einem kleinen Boot, das gnadenlos in einen Mahlstrom gesogen wurde …
Nun denn, machte er sich selbst Mut –, wenn er dem Weg in den Abgrund schon nichts entgegenzusetzen hatte, dann wollte er zumindest mit offenen Augen darauf zusteuern.