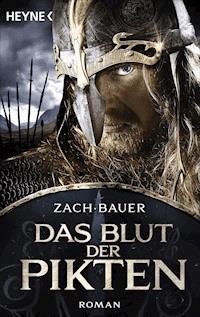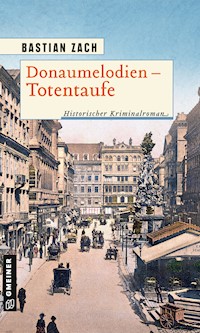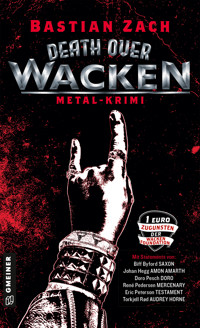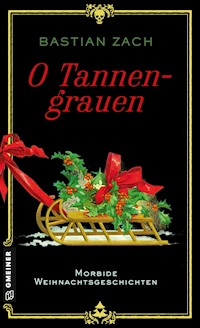9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Pikten-Saga
- Sprache: Deutsch
Der große Krieger Kineth und seine Pikten sind von Grönland nach Schottland aufgebrochen, um ihr Volk zu retten. Um eine alte Prophezeiung zu erfüllen, haben die alte Festung Burghead erobert. Als sie in den Krieg zwischen dem britannischen König Æthelstan und dem schottischen König Konstantin mit seinen Wikingerhorden hineingezogen werden, müssen sich die Mannen in Kampf und Hinterhalt, zwischen Intrigen und Täuschung bewähren. Das Schicksal der letzten Pikten entscheidet sich inmitten der größten Schlacht, die je auf britannischem Boden stattgefunden hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 725
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Der große Krieger Kineth und seine Pikten sind von Grönland nach Schottland aufgebrochen, um ihr Volk zu retten. Um eine alte Prophezeiung zu erfüllen, haben die alte Festung Burghead erobert. Als sie in den Krieg zwischen dem britannischen König Æthelstan und dem schottischen König Konstantin mit seinen Wikingerhorden hineingezogen werden, müssen sich die Mannen in Kampf und Hinterhalt, zwischen Intrigen und Täuschung bewähren. Das Schicksal der letzten Pikten entscheidet sich inmitten der größten Schlacht, die je auf britannischem Boden stattgefunden hat …
Die Autoren
Bastian Zach wurde 1973 in Leoben geboren. Er arbeitete für verschiedene Werbe- & Multimedia-Agenturen und ist seit 1999 in Wien selbstständig. Matthias Bauer wurde 1973 in Lienz geboren, arbeitete nach dem Studium der Geschichte im Verlagsbereich und ist in der Tiroler Erwachsenenbildung tätig. Zusammen schreiben sie als Zach/Bauer Romane (unter anderem die Bestsellertrilogie Morbus Dei) und Drehbücher, zuletzt zum Wikinger-Blockbuster Northmen – A Viking Saga. Mehr Informationen über die Autoren unter www.zach-bauer.com
BASTIAN ZACH · MATTHIAS BAUER
DAS BLUT
DER
PIKTEN
FEUERSTURM
HISTORISCHER ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Bastian Zach und Matthias Bauer
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Thomas Brill
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA International GmbH
Autoren- und Verlagsagentur, München
www.ava-international.de
Umschlaggestaltung: Nele Schütz design, München,
unter Verwendung eines Motivs von
© shutterstock/Stefano Termanini und Arcangel/Collaboration JS
Grafiken: Copyright © 2017 by Bastian Zach
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-21822-5V003
www.heyne.de
Bastian Zach – für meine Kriegerin
Matthias Bauer – für meine Familie
VORWORT
»Das Blut der Pikten – Feuersturm« ist wie sein Vorgänger ein historischer Roman. Wie viele andere Autoren in diesem Genre erschaffen wir beim Schreiben zunächst einen geschichtlichen Bilderrahmen, in dem reale Persönlichkeiten und Länder vorkommen. Das ist aber nur der Rahmen; das Bild selbst malen wir mit erdachten Farben aus. Reale Personen treffen somit auf fiktionale, wahre historische Begebenheiten erhalten einen neuen Dreh. Im besten Fall gelingt die Mischung aus Fakten und Erfundenem so überzeugend, dass die Leser das Gefühl haben, dass wirklich alles so geschehen sein könnte.
Viele unserer Leser haben sich nach dem ersten Teil der »Pikten-Saga« gefragt, ob die letzten der Pikten wirklich in Grönland gestrandet sind. Das sind sie nicht – aber solche Fragen freuen und ehren uns, weil wir unser Bild dann offenbar sehr überzeugend gemalt haben. Fakt ist: Die Pikten gab es, und sie beherrschten im Altertum und dem frühen Mittelalter den Norden des heutigen Schottlands. Wir wissen einiges über sie, aber nicht sehr viel, da sie uns keine direkten schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben. Deshalb ranken sich um die »Bemalten«, wie die Römer sie wegen ihrer Tätowierungen genannt haben, eine Vielzahl von Rätseln und Legenden, die vornehmlich von fremden Eroberern oder späteren Chronisten gesponnen wurden. Die Geschichte dieses Volkes ist damit in vielerlei Hinsicht »unentdecktes Land« und natürlich eine wunderbare Grundlage für Autoren.
Es hat uns unglaubliche Freude bereitet, uns mit dem zweiten Teil der »Pikten-Saga« erneut in dieses unentdeckte Land zu begeben und Kineth, Ailean, Egill und ihre tapferen Mitstreiter ein weiteres großes Abenteuer erleben zu lassen. Wir sind uns sicher, dass Sie, liebe Leser, etwas von dieser Freude spüren werden und wünschen Ihnen nun spannende Unterhaltung!
Bastian Zach/Matthias Bauer
DIE HAUPTCHARAKTERE
Einige der Pikten, die von Grönland nach Schottland aufgebrochen sind, auch genannt die »Neunundvierzig«:
Caitt, ältester Sohn von Brude
Ailean, Caitts Schwester
Kineth, Ziehkind von Brude, von diesem wie sein eigener Sohn aufgezogen
Flòraidh, Kriegerin
Unen, Krieger, Spitzname Mathan (Bär)
Elpin, Krieger
Bree, Kriegerin, ältere Schwester von Moirrey
Moirrey, Kriegerin, Spitzname Mally, Schwester von Bree
Die Pikten in Grönland:
Brude, Sohn des Wredech, der verbannte Herrscher
Iona, Brudes Weib
Eibhlin, Brudes Schwester
Beacán, Priester
Keiran und Kane, Brüder und Beacáns Schergen
Gràinne, Beacáns Vertraute
Brion und Tyree, Gràinnes Söhne
England:
Æthelstan, König von Britannien
Oda, Bischof von Ramsbury
Edmund, Bruder von König Æthelstan
Alfgeir, Aldermann (Earl) von Nordumbrien
Egill Skallagrimsson, Wikinger-Söldner und Freund der Pikten
Thorolf Skallagrimsson, Wikinger-Söldner, Bruder von Egill
Die »Allianz des Nordens«:
Wikinger:
Olaf Guthfrithsson, Wikingerkönig von Dublin und Jorvik
Ivar »der Gütige« Starkadsson, Anführer der Elitetruppe der »Finngaill«
Alba (Schottland):
Konstantin, Sohn des Áed, König von Alba (Schottland)
Cellach, Konstantins bevorzugter Sohn
Indulf, jüngster Sohn Konstantins
Kenneth, ältester Sohn Konstantins
Strathclyde:
Eòghann (Owen), Sohn des Donald, König von Strathclyde
Hring, Jarl (Earl), Vetter von Athils
Athils, Jarl (Earl), Vetter von Hring
ANNO DOMINI 937
Die schwarzen Knopfaugen des Baummarders visierten die Beute an. Lautlos lag er auf dem Ast, schien mit ihm zu verschmelzen.
Das Eichhörnchen verharrte in einiger Entfernung des Loches, das sich im Baumstamm auftat und seine Behausung war.
Seine Behausung, über der der Tod in Gestalt des Marders lauerte.
Das Eichhörnchen hielt eine Nuss in seinen Pfoten, doch es zögerte noch, sie in das Loch zu bringen. Wie die anderen Tiere des Waldes war es von dem gewaltigen Schein des Feuers, das jenseits der Bäume die ganze Nacht in den Himmel loderte, in Unruhe versetzt worden. Aber im gleichen Maße wie das Feuer herunterbrannte, hatte sich auch die Aufregung unter den Tieren des Waldes gelegt. Das Eichhörnchen hatte eine Nuss gesammelt und sie eben in seinen Unterschlupf bringen wollen, als es auf einmal innehielt. Es konnte die Bedrohung nicht sehen, spürte nur einen unbestimmten Instinkt, aber der genügte.
Deshalb saß das Eichhörnchen immer noch auf dem Ast, wie erstarrt.
Und deshalb verharrte auch der Marder immer noch. Nur sein Fell hob und senkte sich unmerklich, weil er seine Gier kaum bezähmen konnte und heftiger zu atmen begann.
So verging eine Weile. Dann bewegte sich das Eichhörnchen, machte einen Schritt auf das Loch zu. Als nichts geschah, folgten weitere Schritte.
Einen Herzschlag später sprang der Marder auf seine Beute herab, bohrte seine scharfen Zähne in den Nacken des Eichhörnchens. Er schüttelte es in seinem Maul, bis das jämmerliche Fiepen verstummte und das kleine Tier starb.
Der Marder begann seine Beute noch an Ort und Stelle gierig zu fressen, er war blind für seine Umwelt, für den unmerklichen Feuerschein im Himmel. Und für die Gestalten, die sich weit unter ihm lautlos über den Boden des uralten Waldes bewegten …
FEUER UND EIS
Das rhythmische Stampfen der Hufe ließ Harold wie in Trance dahinreiten.
Er liebte dieses Gefühl, wenn er eins war mit seinem Pferd, eins war mit dem Wald, durch den er ritt, eins mit der Welt, die ihn umgab – und die während seiner dreißig Lenze besser zu ihm gewesen war als zu den meisten seiner Landsleute. Er hatte eigentlich immer genug zu essen gehabt, sein Weib war eine arbeitsame, gottesfürchtige Schönheit, und von seinen sechs Kindern hatten immerhin vier die ersten zehn Winter überlebt. Und so wusste Harold, dass der Herr zeit seines Lebens seine schützende Hand über ihn gelegt hatte.
Was er nicht wusste, war, dass der Herr am heutigen Tag anderweitig beschäftigt war und keine Zeit haben würde, ihn zu beschützen. Aber Harold würde dies in Kürze schmerzlich erfahren.
Sein Ziel war die Festung von Torridun, hoch oben im Norden Albas, jenem unwegsamen Gebiet, das einst von den Völkern mit den blauen Bemalungen in der Haut beherrscht wurde und in dem erst seit knapp einhundert Jahren Frieden und Recht herrschten. Harolds Aufgabe als Kurier war das Überbringen einer Nachricht von König Konstantin, Herrscher über Alba, an dessen Neffen Máel Coluim. Dieser residierte wie jedes Jahr kurz vor Einbruch des Winters in dieser Festung, um dem dortigen Fürsten die Macht und Präsenz seines Onkels zu vergegenwärtigen. Denn sonst vergaßen die Grafen und Aldermannen1 allzu schnell, wo ihre Gefolgschaft lag, das wusste Harold.
1 Englisch: Ealdorman, Earl. Adelstitel. Die »Earldormen« oder »Aldermannen« standen im angelsächsischen Britannien an der Spitze einer Grafschaft und verfügten über persönliche, in ihrem Sold stehende Kämpfer.
Doch dies bedeutete nicht, dass er die Strecke im wilden Galopp nahm. In der Ruhe lag die Kraft, da war er sich sicher, und daher war Harold dafür bekannt, nicht der schnellste Bote, aber der zuverlässigste zu sein. Denn von dieser Zuverlässigkeit hing sein Leben ab. Also mied er Straßen ob der hiesigen Wegelagerer, und er wusste, wann es besser war, eine Münze springen zu lassen, statt mit dem Siegel des Königs zu drohen. So ritt er seit Jahren durchs Land, hatte in dem einen Dorf Freunde, mit denen er sich betrank, in dem anderen Dorf ein Liebchen, das ihn verwöhnte. Das Leben meinte es gut mit ihm.
Das Knacken eines Astes riss den Kurier aus seinen Gedanken. War da ein Tier? Ein Bauer, der Holz sammelte?
Mit einem Mal stieg Harold der stechende Geruch von verkohltem Holz in die Nase, als ob er von Dutzenden Lagerfeuern umgeben war. Nun war der Kurier hellwach. Kein Lagerfeuer der Welt würde so einen alles durchdringenden Gestank erzeugen – hier brannte etwas Größeres …
Harold zügelte sein Pferd, bis es stand, legte die Hand auf den Griff seines Schwerts und sah sich um. Rings um ihn ragten braunrote Waldkiefern empor. Ihre Wurzeln versanken in dem mit Moos bedeckten Boden, der ob des morgendlichen Regens, der erst vor Kurzem aufgehört hatte, immer noch dampfte. Alles schien friedlich zu sein.
Trotzdem keimte in Harold ein beklemmendes Gefühl auf, bemächtigte sich rasch seines gesamten Körpers. Sein Atem beschleunigte sich, Schweiß trat ihm auf die Stirn. Sein Blick schnellte hektisch zwischen den Bäumen hin und her.
Mit festem Griff nahm Harold die Zügel in die Hand und wollte seinem Pferd gerade in die Flanken schlagen, als er aus dem Augenwinkel wahrnahm, wie eine absonderliche, mit Laub und Ästen bestückte Gestalt auf ihn zusprang.
Er wurde vom Pferd gerissen, schlug hart auf dem weichen Boden auf. Wirre Eindrücke prasselten auf ihn ein.
Das Geschrei von Kriegern –
Eine Gestalt – eine Frau? –, die sich über ihn beugte –
Ein Schwertgriff, der rasch näher kam –
Ein dumpfer Schlag.
Eine kleine Flamme züngelte auf der verkohlten Oberfläche eines Holzbalkens, reckte sich in den grauen Himmel. Erst in der Nacht zuvor war sie zum Leben erweckt worden, als die Männer und Frauen, die von weithergekommen waren, die Festung angegriffen und das Feuer entfesselt hatten. Gierig hatten die Flammen damit begonnen, alles zu verschlingen, was in greifbarer Nähe gewesen war, hatten sich über Gebälk und Firste, über Dächer und Palisaden gefressen und für einige Zeit den Eindruck erweckt, als könnte nichts und niemand auf der Welt sie aufhalten. Dann fielen die ersten Regentropfen. Abseits des Kampfes zwischen den Angreifern und den Verteidigern der Festung hatte auch im Feuer ein verbissenes Ringen um Leben und Tod begonnen. Doch je mehr Wassertropfen die Flammen verdampften, umso mehr schienen aus der Wolkendecke zu fallen – und der Gegner hatte den Sieg davongetragen.
Ein letztes Mal loderte die Flamme an diesem Morgen empor, dann erlosch sie, zischend und endgültig.
Unweit des verkohlten Balkens verharrten Gestalten, schattige Umrisse im morgendlichen Regen, Statuen gleich. Sie hatten gekämpft und obsiegt, haltlos gefeiert und besannen sich nun wieder derer, die nicht mehr unter ihnen weilten. Denn zu ihren Füßen lagen die schwelenden Überreste der im Feuer bestatteten Gefallenen. Krieger einer fernen Insel, die gekommen waren, um zurückzuerobern, was ihren Vorfahren einst geraubt worden war.
Krieger, die in einem Land bestehen wollten, das sie weder kannten noch verstanden, nur um es irgendwann Heimat nennen zu können.
Krieger, die alles gegeben hatten.
Ihr Anführer Kineth, Sohn des Brude, stand noch immer an der Brüstung der Festungsmauer und blickte aufs Meer hinaus. Selbst als Ailean ihn aufforderte, mit ihr und den anderen den Sieg gebührend zu feiern, war er geblieben und seine Stiefschwester alleine gegangen.
Zu viel war in den letzten Tagen geschehen. Dem Krieger war, als wäre er schneller gereist, als seine Seele ihm hatte folgen können, als wäre mehr passiert, als sein Geist zu begreifen vermochte.
Das listreiche Einschleichen in diese Festung.
Die schmachvolle Gefangennahme.
Der Kampf um sein Leben, um ihrer aller Leben, gekrönt vom Verrat seines Stiefbruders Caitt.
Die Euphorie am Ende der Schlacht war schnell verflogen. Zurück blieb eine innere Leere, die mit dem Gefühl einherging, dass womöglich alles umsonst gewesen war. Ja, sie hatten sich in diesem fremden Land behauptet. Ja, sie hatten den Beweis ob ihres rechtmäßigen Anspruchs auf dieses Land gefunden, wie auch den Ring des Königs. Aber sie hatten auch erkennen müssen, dass Papier und Schmuck keinen Anspruch begründen, kein Schwert schlagen und keine Festung halten konnten.
Wofür bist du dann gekommen?
Kineth wischte sich energisch über das regennasse Gesicht, als könnte er damit nicht nur den Ruß und das getrocknete Blut seiner Gegner abwaschen, sondern auch die düsteren Gedanken vertreiben. Einen Moment später zuckte er schmerzverzerrt zusammen – er hatte mit seinem Ringfinger, der nur noch an wenigen Sehnen hing und dick einbandagiert war, sein Ohr berührt, dem seit dieser Nacht ein Stück fehlte. Sein Körper schien innerlich darum zu wetteifern, welche Verletzung schwerer wog – und entschied sich dann stattdessen, einen allumfassenden Schmerz auszustoßen, der durch den gesamten Körper des Kriegers schoss. Nach einer schier endlosen Zeitspanne richtete sich Kineth wieder auf, denn er wollte vor seinen Kameraden keine Schwäche zeigen. Es gab kaum einen unter ihnen, der ohne Verletzung aus der Schlacht um die Festung ihrer Vorfahren hervorgegangen war.
Wofür bist du in dieses Land gekommen?
Erneut die Stimme in seinem Inneren. Seine Gelenke schmerzten vom stundenlangen Ausharren in ein und derselben Position. Kineth wandte sich vom Meer ab. Im kalten Licht des Morgens sah er die Männer und Frauen seines Volkes um die mittlerweile niedergebrannten Scheiterhaufen stehen, die inmitten eines weitläufigen Platzes lagen.
Dessen Ende säumten die Überreste der Befestigungsmauern und der Palisaden, der Ställe und Häuser. Ihre Wände voll Ruß, ihre Dächer nicht viel mehr als rauchendes Sparrenwerk, das wie der dampfende Brustkorb eines ausgeweideten Tieres wirkte. Und überall lagen die Leiber der dahingeschlachteten Feinde, manche scheinbar unversehrt, andere grausam gebrochen, verkohlt wie Holzscheite oder in Stücke gehackt.
Hinter dem Eingangstor der Festung begann der schmale Küstenstreifen, der durch drei Erdwälle gesichert war und das Bollwerk mit dem Festland verband. Diesen Landsteg hatte die Flut nun völlig in Besitz genommen und knietief überspült, sodass jeder, der in die Festung Torridun hinein- oder wieder hinauswollte, warten musste, bis der Weg wieder begehbar war.
Zu Kineth’ linker Hand erstreckte sich das tiefer gelegene Plateau, das die Handwerker und Bauern der Festung beheimatete. Kein Laut drang mehr zu ihm herauf – vermutlich hatten sich die Überlebenden vor dem Feuer und den bemalten Kriegern in die Wälder in Sicherheit gebracht, mutmaßte Kineth und musste sogleich schmunzeln. Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, sich am Gesinde zu vergehen. Immerhin waren sie alle bis vor Kurzem noch selbst kaum mehr als Bauern gewesen.
Langsam bemerkte Kineth, wie sich die Blicke seiner Leute ihm zuwandten, wie ihre Gespräche verstummten. Er war es, von dem sie zu erfahren hofften, was sie als Nächstes tun würden – jetzt, da sie scheinbar erreicht hatten, wofür sie losgezogen waren.
Nichts haben wir erreicht. Aber das werden sie nicht hören wollen.
Zu neunundvierzigst waren sie aufgebrochen. Éimhin und Gaeth hatten sie an die See verloren, Heulfryn bei der Schlacht um den Turm. Gair starb bei dem Versuch, Caitt zu töten, und Caitt hatte Dànaidh auf dem Gewissen, bevor er sich davonstahl. Sechs Verluste unter so vielen. Kineth sah zur Scheune, in deren Schutz eine Handvoll Krieger schwer verwundet lagen. Und weitere würden hinzukommen. Von neunundvierzig Mann standen nur noch neunundzwanzig auf eigenen Füßen.
Neunundzwanzig, verdammt noch mal.
Der Krieger atmete einmal tief durch, füllte seine Lunge mit der rauchigen Luft.
»Ich weiß, ihr seid erschöpft«, begann Kineth mit ruhiger Stimme. »Denn ich bin es auch. Doch bevor wir daran denken, was morgen sein wird, müssen wir uns das Heute sichern.« Kineth blickte zu Unen, der von der Größe her neben den anderen Kriegern wie ein Bär wirkte. »Mathan, nimm dir fünf Mann, teilt euch in drei Gruppen, und sichert Wald und Weg vor der Festung. Gebt Zeichen, wenn Gefahr droht.« Unen brummte zustimmend.
»Flòraidh …« Kineth wandte sich der Kriegerin zu, die mit ihren blonden, kurz geschnittenen Haaren und der Bemalung in der Haut über Schläfe, Hals und Arm weniger wie eine Frau als vielmehr wie eine Furie wirkte, die nur darauf harrte, entfesselt zu werden. »… nimm dir ein Dutzend Mann und verstärkt die Posten auf der Ringmauer, Pfeil und Bogen bereit. Und schießt auf jeden, der nicht nach einmaliger Warnung umkehrt.«
Flòraidh nickte.
Kineth wandte sich schließlich seiner Stiefschwester zu. Sie sah ihn erwartungsvoll an. »Ailean. Sieh nach, wie viele Tiere das Feuer überlebt haben, und lasse sie hier in der Mitte des Platzes in Sicherheit bringen. Dann durchkämme mit sechs Mann die Ruinen. Holt alles heraus, was uns noch von Nutzen sein kann. Waffen, Kleidung, Werkzeug, Essen, Schmuck.« Ailean nickte ebenfalls, doch Kineth konnte in ihrem Gesicht deutlich die Enttäuschung lesen. Offenbar hatte sie sich mehr erwartet. »Die anderen«, fuhr Kineth unbeirrt fort, »legen sich zum Ausruhen ins Trockene. Ihr müsst später die Wachen ablösen. Also dann –«
»Was ist mit Caitt geschehen?« Es war Elpin, der die Frage stellte.
Jene Frage, die Kineth zu vermeiden gehofft hatte. Er tauschte einen kurzen, wissenden Blick mit Ailean, die ihm mit einem knappen Kopfschütteln zu verstehen gab, dass auch sie es nicht für den richtigen Zeitpunkt hielt, die anderen zu informieren.
»Caitt ist nicht mehr bei uns«, begann Kineth.
»Das haben wir auch bemerkt«, rief Moirrey, die von allen Mally genannt wurde, frech in die Runde. Bree, ihre Schwester, sah sie unwillig an, wie so oft, wenn Mally über das Ziel hinausschoss.
»Und ich werde euch auch sagen, warum.« Kineth war bemüht, seinen aufkeimenden Ärger zu unterdrücken. »Aber zuerst gilt es, den Boden zu sichern, auf dem wir stehen. Sonst brauchen wir uns alsbald über nichts und niemand mehr Fragen zu stellen.« Er funkelte Moirrey an. »Einverstanden?«
Die junge Kriegerin wollte etwas entgegnen. Doch dann verstand sie, dass Kineth ihr keine Frage gestellt, sondern einen Befehl erteilt hatte.
»Also los!«
Die Gruppe löste sich auf. Nur Ailean kam auf Kineth zu.
»Wann wirst du ihnen sagen, was unser Bruder getan hat?«, sagte sie bedacht leise.
»Bald.«
Ailean verzog das Gesicht. Kineths Antwort war für sie alles andere als befriedigend. »Und wann wirst du mir sagen, wie es mit uns weitergehen soll?«, setzte sie nach. »Nun, da wir alles und doch nichts erreicht haben?«
»Was willst du von mir, verdammt noch mal?«
Ailean stellte sich unwillkürlich auf die Zehen. »Ich will, dass du handelst, wie unser Vater es von dir wollte und wie du es Dànaidh versprochen hast.«
»Ich habe gar nichts versprochen«, entgegnete Kineth zornig.
»Ach nein? Du hattest die ganze Nacht lang Zeit, dir zu überlegen, wie es mit uns weitergeht. Und die einzige Entscheidung, die du getroffen hast, ist, dass du keine treffen wirst?«
Kineth starrte die junge Frau an. Ihr Gesicht war mit Ruß und Blut verschmiert, die schulterlangen dunkelblonden Locken waren verklebt und noch immer für den Kampf mit einer Spange zusammengebunden. Ihr ganzer Körper war von der Schlacht gezeichnet, und ihr Blick wirkte erschöpft und abgestumpft. Und doch sah Kineth niemand anders vor sich als jene lebenslustige Frau, die in der alten Heimat jeden Unfug mitmachte, die für jeden Streich zu haben war und die er seit seiner Kindheit –
»Habe ich recht?« Ailean ballte die Fäuste.
»Morgen. Nach Tagesanbruch in der Kapelle. Sag es den anderen.«
Ailean rempelte Kineth im Losgehen unsanft an. »Zu Befehl«, sagte sie spöttisch und ließ den Krieger allein zurück.
Kineth stieß ein tiefes Seufzen aus. Dann ging er in Richtung der Ställe, wo die Verwundeten lagen.
Mit einem spitzen Schrei, der wie der eines Kindes klang, stürzte das Pferd zu Boden. Es schlug hart mit Schulter und Kopf auf der steinigen Wiese auf, während seine Vorderhufe in einer Grube stecken blieben. Nach einem kurzen Moment der Benommenheit versuchte es wieder auf die Beine zu kommen, rollte sich widerspenstig von einer Seite auf die andere, schnaubend, als wollte es das Unabwendbare nicht anerkennen.
Dann, langsam, aber stetig, wurde das Schnauben leiser.
Da beide Fesseln gebrochen waren, kniete sich das Pferd schließlich auf die Vorderfüße senkte den Kopf und blickte ermattet zu dem Reiter, der regungslos neben ihm am Boden lag.
Zwei Tage waren seit jener Nacht vergangen, in der Caitt auf einen Schlag alles verloren hatte, wofür er gelebt und gekämpft hatte. Ailean, seine Schwester. Kineth, seinen Stiefbruder. Seine Gefährten.
Und am schlimmsten: seine Ehre.
Noch immer konnte der hünenhafte Krieger nicht verstehen, wie man Egill, den dreckigen Nordmann, ihm hatte vorziehen können. Caitt hatte doch nur gewollt, dass er selbst und seine Krieger etwas in der Hand hatten, ein Pfand, das ihnen einen Vorteil verschaffen könnte. Was war dagegen schon ein flüchtig ausgesprochenes Versprechen, noch dazu, wenn man es einem Nordmann gegeben hatte, der selbst keine Ehre besaß?
Für Caitt war der Bruch des Versprechens Mittel zum Zweck gewesen – für Kineth galt dieses Versprechen scheinbar mehr als die Familie.
Damit hatte er sich in Caitts Augen selbst gerichtet, es nicht verdient, weiter an seiner Seite zu kämpfen. Hinterlistig hatte sein Stiefbruder ihm die Worte im Mund umgedreht, ihn so hingestellt, als würde er nicht für die Seinen einstehen. Kineth hatte den Tod verdient, und doch starb ein anderer – Dànaidh, der Schmied, den alle nur Òrd, den Hammer, nannten. Ein Freund und Beschützer, von Kindestagen an, und einer, mit dem Caitt keinen Disput hatte.
Als Caitts Dolch in Dànaidhs Leib steckte, wurde ihm bewusst, dass es von nun an kein Zurück mehr gab. Es schien, als hätte dieser Dolch auch das Band zwischen ihm und seinem Volk durchtrennt. Er war das Beiboot, dessen Tau sich auf stürmischer See durchgescheuert hatte und das nur noch zusehen konnte, wie das Schiff, an das es eben noch gebunden war, davonsegelte. Und das ab sofort nur noch für sich selbst verantwortlich war, wollte es nicht gegen die nächstbesten Klippen geschmettert werden und zerschellen.
Noch während der Schmied zusammensackte, rannte Caitt blindlings davon, ließ die Festung und seine Kampfgefährten hinter sich. Kurz darauf traf er auf ein erblindetes Häufchen Elend, das sich nur Stunden zuvor noch Parthalán, Herr der Festung, genannt hatte. Trotz seiner Aufgewühltheit war Caitt geistesgegenwärtig genug gewesen, Parthalán den Gnadentod zu schenken und ihn auch von jedem irdischen Ballast in Form seiner fünf goldenen Ringe zu befreien.
Die darauffolgenden Stunden war der Krieger umhergeirrt und hatte sich im angrenzenden Wald immer wieder hinter Bäumen versteckt. Denn wer konnte schon wissen, was die Tölpel von Bauern mit ihm gemacht hätten, wären sie seiner habhaft geworden? Immerhin war es ihr Zuhause, das gerade von einer Feuersbrunst verzehrt wurde, für die Caitt und sein Volk verantwortlich waren.
Irgendwann hatte er sich erschöpft hinter einen Baum gesetzt und einfach nur dagesessen, während die Gedanken an das, was geschehen war, immer noch wild und ungeordnet durch seinen Kopf wirbelten.
Ein Schnauben hatte Caitt schließlich aus seiner Starre gerissen – von hinten hatte sich ein Pferd angeschlichen und ihn mit den Nüstern angestupst. Es war eine edle dunkelbraune Stute, zu Caitts Überraschung war sie aufgezäumt und gesattelt. Vermutlich war ihr Besitzer verwundet oder tot von ihr heruntergefallen. Caitt hatte dem Tier über den Nasenrücken gestreichelt, es am Hals getätschelt und dann entschieden, dass er auf dem Pferd das Inferno aus Flammen und Enttäuschung schneller hinter sich lassen konnte, als wenn er zu Fuß weiterging. Zwar hatte er noch nie ein Pferd geritten, genauer gesagt noch überhaupt kein Tier, aber nachdem er sich auf den Sattel geschwungen und unsicher die Zügel gegriffen hatte, trabte das Pferd von alleine los, ohne dass der Krieger Angst hatte, dass es mit ihm durchgehen würde.
So waren er und sein neuer tierischer Begleiter die Nacht über durchgeritten, hatten sich am Morgen einige Stunden Rast gegönnt und waren dann weiter nach Süden gezogen. Caitt wusste nicht, wohin er sollte, aber das Pferd schien ein Ziel vor Augen zu haben – und alles war besser als das, was hinter ihnen lag. Auch wenn dem Krieger am Ende des Tages sein Hintern so schmerzte, als wäre er stundenlang mit einem Lederriemen geschlagen worden, und sich sein Rücken anfühlte, als hätte er Gesteinsbrocken geschleppt, so ermutigte ihn zumindest die Gewissheit, dass ihm keiner seiner ehemaligen Gefährten folgen konnte – zu schnell war er unterwegs gewesen.
Als sich der gegenwärtige Tag dem Ende zugeneigt hatte, als die Schatten größer und die Farben weniger wurden, wollte Caitt einen Unterschlupf finden, da die Wolken am Himmel Regen versprachen. Schon bald waren sie zu einer Lichtung gekommen, an der der Krieger überrascht festgestellt hatte, dass der Wald hier endete, als würde man ihn schnurgerade abholzen, in einer Linie von Osten nach Westen, so weit das Auge reichte. Von Caitts Standort verlief eine Wiese leicht ansteigend, bis sie in der Ferne in einem Erdwall mündete, in dem vereinzelte Palisaden steckten. Der Krieger hatte angenommen, dass man von dem Erdwall aus einen guten Überblick über das angrenzende Gelände haben musste, und ließ dem Pferd die Zügel locker, sodass es selbst bestimmen konnte, wie schnell es den Weg zurücklegen mochte.
Das Tier begann im gemächlichen Trab, steigerte sich immer mehr, bis es schließlich schneller dahingaloppierte, als es Caitt recht war. Er wollte gerade an den Zügeln ziehen, als plötzlich der Horizont verrutschte, die Erde sich eigentümlich drehte und es nach einem Aufprall still und schwarz um ihn herum geworden war.
Caitt riss die Augen auf. Der Kopf des Kriegers schmerzte, als hätte ihm jemand mit einem Prügel eins übergezogen. Er setzte sich auf, sah sein Pferd neben sich verkrümmt knien. Seine Umgebung nahm er nur verschwommen wahr.
Was war geschehen? Warum lag er hier? Und was waren das für Gestalten, die aus dem Unterholz schreiend auf ihn zuliefen?
Er stand auf, machte schwankend einen Schritt auf das Pferd zu, stützte sich ab. Das Tier war wie ein Schutzwall vor jenen, die mit gezückten Schwertern lautstark über die Wiese gerannt kamen.
Drei Mann und eine Frau.
Caitt zog ebenfalls sein Schwert und wartete ab. Auch wenn sich immer noch alles um ihn herum drehte, so glaubte er, dass die Bande von Wegelagerern kaum eine ernsthafte Gefahr für ihn darstellte. Zu laut waren sie, zu unorganisiert.
Augenblicke später hatten die vier ihn erreicht, bildeten einen Halbkreis. Caitt drückte sich mit dem Rücken an sein Pferd. Erst jetzt konnte er die Fremden besser sehen, ihre zerschlissenen Lumpen, ihre schmutzigen und verkrätzten Gesichter, ihre rostigen und verbogenen Schwerter und Messer.
»Deinen Besitz und dein Pferd«, lispelte der Älteste von ihnen, »dann lassen wir dich vielleicht am Leben.«
Caitt zog die Brauen zusammen. »Vielleicht?«
Ein anderer gluckste. »Wir würden es uns zumindest überlegen.«
»Dann überlegt nicht zu lange.« Der Krieger ging in eine breitbeinige Stellung, schob den linken Fuß nach vorn, die rechte Schulter nach hinten und sah die Diebe herausfordernd an. Die versuchten offenbar einzuschätzen, welchen Gegner dieser seltsam bemalte Mann vor ihnen wohl abgeben würde.
Eine Überlegung, die Caitt ihnen abnahm.
Er machte einen schnellen Schritt auf den Dieb rechts von ihm zu, schnitt ihm mit einem schnellen Hieb den Hals durch, drehte sich und packte den Mann neben ihm. Der Dritte im Bunde wollte Caitt zuvorkommen und stieß seine Waffe in dessen Richtung, nur um einen Moment später entsetzt zu erkennen, dass die Klinge im Bauch seines Kameraden steckte, den Caitt in seine Richtung gestoßen hatte. Der Krieger wirbelte herum, schlug dem Wegelagerer, der das Schwert geführt hatte, die Hand ab und spaltete ihm mit einem weiteren Hieb den Schädel. Er ließ das Schwert im Kopf des Diebes stecken, während der zu Boden sackte, und wandte sich nun mit gezücktem Dolch der Frau zu.
Diese stand wie gelähmt da. Schließlich ließ sie das Kurzschwert, das wie eines der beiden Gladii2 aussah, mit denen seine Schwester Ailean kämpfte, ins Gras fallen. An der Innenseite ihrer Beine lief es nass herunter.
22 Standardwaffe der römischen Infanterie.
Caitt starrte die Diebin abwartend an. Ihr Alter war schwer zu schätzen, aber wie alt sie auch immer sein mochte, das Leben hatte es offensichtlich nie gut mit ihr gemeint.
»Wie viele von euch sind noch im Wald?«, wollte Caitt wissen.
»Niemand.« Die Frau schüttelte ruckartig den Kopf. »Nur meine Brüder und ich.«
»Und ihr habt gedacht, es sei eine redliche Idee, für Vorbeireisende eine Grube auszuheben, und …«
»Die Gruben waren schon immer da, ehrlich!«, unterbrach sie ihn schrill. »Sieh nur, sie sind hier überall.«
Caitt blickte über das Gelände und erkannte, dass die Frau zumindest teilweise die Wahrheit sprach. Die Wiese war mit einer Vielzahl von Fallgruben übersät, in einem seltsam gleichmäßig angeordneten Muster aus fünf Punkten. Viele der fünf Fuß breiten und drei Fuß langen Löcher waren behelfsmäßig zugeschüttet worden, aber einige waren noch intakt.
»Die Besatzer, die früher hier waren, diese Römer, haben sie ausgehoben. Wir haben sie nur benutzt … bitte –« Die Frau brach ab.
Caitt senkte seinen Dolch. »Wo ist das nächste Dorf?«
Die Frau deutete nach Südwesten. »Nicht mehr weit, bis zu der steinernen Straße und dann immer geradeaus. Bitte …« Sie griff mit beiden Händen den abgewetzten Kragen ihres zerlumpten Obergewandes und riss es mit einem Ruck bis zum Bauch auf. Ihre schlaffen Brüste hingen heraus, die weiße Haut mit roten Flecken und Schmutz bedeckt.
Sie packte ihren Busen, drückte ihn zusammen, um ihn üppiger und vermeintlich begehrenswerter erscheinen zu lassen. »Wenn du mich verschonst, tue ich alles, was du willst. Alles.« Sie fiel auf die Knie in den Matsch, rang ihren Lippen ein bitteres Lächeln ab.
»Gut«, sagte Caitt. Er dachte einen Augenblick nach, strich sich dabei über seinen geflochtenen Kinnbart. Plötzlich stieß er der Frau den Dolch in die Kehle. »Dann stirb.« Ruckartig zog er die Klinge wieder heraus.
Die Diebin blickte ihn ungläubig an, während Blut und damit ihr Leben aus dem Hals pulsierte. Röchelnd sackte sie zusammen, kam neben dem Maul des Pferdes und der Grube zu liegen. Das Tier stupste sie an, als wollte es ihr aufhelfen, aber Caitt gab dem noch zuckenden Körper der Frau einen Tritt, der sie in die Grube rutschen ließ.
Der Krieger wischte den Dolch im Gras sauber und steckte ihn in seinen Gürtel zurück, dann kniete er sich neben das Pferd, strich ihm sanft über den Nasenrücken. Er spürte das warme Fell, wusste, was er zu tun hatte. Das Tier hatte sich beide Vorderläufe beim Sturz in die Grube gebrochen und würde nie mehr laufen können.
»Es tut mir leid«, sagte er leise, »aber ich kann dir nicht helfen.« Er drückte seinen Kopf gegen den des Pferdes, verharrte, während er das warme Fell des Tieres an seiner Stirn spürte. Das Pferd ließ sich schließlich zur Seite fallen, atmete kurz und stoßartig. Caitt stand auf, ging zu dem toten Wegelagerer und zog sein Schwert aus dessen Schädel.
Dann erlöste er das Tier von seinen Schmerzen.
Die Wolken hatten den Mond und die Sterne verschlungen, die darauffolgende Dunkelheit war allumfassend. Einzig der kaum wahrnehmbare Glanz, der von den zerklüfteten Eismassen ausging, wies zwei einsamen Gestalten den Weg.
Die Frau, die voranging, orientierte sich an dem fahlen Schimmer, stolperte allerdings immer wieder über Steine und Büsche, die sich am Boden verbargen.
Ein Keuchen hinter ihr.
Sie blieb stehen, blickte halb über ihre Schulter zurück. Dann streckte sie ihre Hand aus. Dahin, wo ihr Mann sein sollte.
Doch ihre Hand fuhr ins Leere.
»Brude?«
Es war nur ein Wort, aber selbst das schien ihren Mund nicht verlassen zu wollen, verfing sich zwischen blauen, steif gefrorenen Lippen, quälte sich dann doch heraus, nur um vom heulenden Wind davongetragen zu werden.
Langsam drehte sich die Frau ganz um. Der Wind schlug ihr jetzt mit voller Wucht ins Gesicht, biss und zerrte an ihr, ließ ihre Augen brennen und tränen, obwohl sie sie zu schmalen Schlitzen zusammengekniffen hatte. Seit sie denken konnte, hatte der Wind ihr Volk begleitet, tauchte über das Jahr auf und verschwand wieder. Aber so stark wie jetzt war er noch nie gewesen. Die Frau fragte sich mittlerweile, ob sie es mit einem lebendigen, bösartigen Wesen zu tun hatten, das sie nicht nur daran hindern wollte, weiterzukommen, sondern daran weiterzuleben.
Lass es. Denk an das Ziel.
Sie wusste, dass die Stimme in ihrem Inneren recht hatte. Hier und jetzt zählte nur eines: diese Nacht überleben, den nächsten Tag erreichen.
Auf einmal gab die Dunkelheit eine Gestalt frei, die mit jedem Schritt eine vertrautere Form annahm. Die Form wurde zum Körper, den die Frau in ihre Arme nahm. Er war eiskalt.
»Iona …« Mehr ein Krächzen als eine Stimme.
»Sprich nicht. Ruh dich aus.«
Sie umarmte ihn fester, hätte ihm ohne zu zögern jedes bisschen Wärme geschenkt, das sie noch im Leibe hatte, denn er war Brude, Sohn des Wredech, ihr Gemahl – und sie liebte ihn mehr als alles auf dieser grausamen Welt.
Zitternd strich sie über sein langes, verfilztes Haar. Ihre Hände wanderten hinunter, das abgewetzte Wolfsfell entlang, das er über den Kleidern trug. Sie spürte, wie mager ihr Gemahl geworden war, und dachte sogleich an den kraftstrotzenden Mann, der er gewesen war – bevor die Krankheit ihn ereilt hatte, bevor sie beide verbannt worden waren.
Als alles noch gut gewesen war.
Erinnerungen blitzten vor Iona auf, sie sah ihre beiden Körper, in Leidenschaft vereint, die prasselnde Feuerstelle in der Halle, Platten mit gebratenem Fleisch, Trinkhörner voll O¸l3. So lebhaft waren die Bilder, dass Iona für einen Augenblick wirklich dort war, in einer glücklicheren Zeit. Sie aß, trank und liebte, alles in diesem einen Augenblick, bevor die Erinnerung wieder in Kälte und Dunkelheit zerfloss.
3 Bier, sprich: Öl
Bevor sie wieder hier war, in Nacht und Eis.
»Iona, ich kann nicht mehr.« Kraftlos sank Brude auf die Knie.
Sie beugte sich zu ihm hinab, nahm seinen Kopf in beide Hände und kniff energisch in den struppigen Bart, der seine Wangen und seinen Hals bedeckte. »Du kannst, und du wirst. Ich lasse dich nicht sterben, heute nicht und morgen auch nicht. Die Nacht wird nicht ewig dauern, und in der Morgendämmerung werden wir einen Weg finden.«
Täuschte sie sich, oder blitzte so etwas wie ein Lächeln im Gesicht ihres Gemahls auf?
»Sturköpfiges Weib.«
Jetzt lächelte auch sie. »Ja, und zwar dein sturköpfiges Weib. Und jetzt hoch mit dir.«
Brude erhob sich ächzend und stützte sich wieder auf den Stab, der ihm als Gehhilfe diente. Er brauchte ihn, seit ihn die Krankheit, die die versprengten Nordmänner auf das Eiland gebracht hatten, in ihren Krallen gehabt hatte. Es sprach für Brudes Kraft und seinen unbeugsamen Willen, dass er die nässenden Pusteln und das glühende Fieber überhaupt überlebt hatte. Doch er war immer noch geschwächt, und die Tage und Nächte unter freiem Himmel forderten ihren Tribut.
In den ersten Nächten nach ihrer Verbannung aus Dùn Tìle4 hatten Iona und Brude versucht, Unterschlupf zwischen den niedrigen Felsformationen zu finden, die sie auf ihrem Weg durch die Hügel gelegentlich passierten. Aber der Wind schien immer zwischen dem Gestein hindurchzufinden.
4 Name des Dorfes, in etwa »Eisfestung«
Die beiden Gestalten, die in der Nacht am Boden kauerten und in den Böen zitterten, hatten keine Decken, nur die Kleidung, die sie am Leib trugen. Es war die Kleidung eines Herrschers und einer Herrscherin, das Untergewand aus dickem Leinen, die Mäntel aus Leder, mit Symbolen ihres Volkes verziert. Die Pelzumhänge von Robbe und Wolf wurden von prächtigen goldenen Spangen zusammengehalten. Doch all das konnte gegen die Kälte der Nacht wenig ausrichten.
Nach drei Tagen beschlossen Brude und Iona, in der Dunkelheit zu gehen und sich am Tag, wenn es wärmer war, auszuruhen und nur kleinere Strecken zurückzulegen. Sie hofften, dass sie auf diese Weise den weiten Weg, der noch vor ihnen lag, bewältigen konnten. Wenn sie das nicht schafften, würde man sie aufgreifen und töten.
Doch der Wind hatte zwei Gefährten, die genauso hartnäckig waren, aber um vieles tödlicher – Hunger und Durst.
Als Brude und Iona nach einigen Nächten die riesige Woge aus Eis erreichten, die das Innere von Innis Bàn5 bedeckte, war die wenige Nahrung aufgebraucht, auch der Trinkschlauch war leer. Danach versuchten sie, aus den kleinen Bächen zu trinken, die in unregelmäßigen Abständen aus den hohen Eiswänden heraustraten und mancherorts sogar kleine Seen bildeten. Das Wasser stillte ihren Durst jedoch nicht. Im Gegensatz zu der Quelle im Dorf schmeckte es unangenehm schal, und es entzog den beiden nur die Kraft, indem sie sich dauernd erleichtern mussten. Also vermieden sie, es zu trinken, benetzten damit nur Lippen und Mundhöhle, um es sofort wieder auszuspucken. Der Mangel an Wasser ließ ihre Köpfe schmerzen und die Welt um sie herum immer wieder in Schwindel versinken.
5 Der Name, den die Pikten Grönland gegeben hatten, in etwa »Weißes Eiland«.
Der Hunger war beinahe genauso schlimm.
Er riss und grollte in ihren Eingeweiden wie ein wildes Tier, das eingesperrt und kurz vor dem Ausbrechen war. Die Beeren, Pilze und Flechten, die sie dann und wann fanden, machten es nur noch wütender und führten zu stechenden Bauchschmerzen. Das Tier wollte richtige Beute, und angesichts dieses Mangels stieg sein Zorn ins Unermessliche.
Natürlich hatten sie versucht zu jagen, zumindest Iona, denn Brude war zu schwach dafür. Doch sie hatten keine Waffen, und der Weg, den sie nehmen mussten, bot auch keine Materialien dafür. Iona stellte schon bald fest, dass lose Steine zu wenig waren, um die flinken Hasen oder Schneehühner zu erlegen. Wenn sie überhaupt welche zu Gesicht bekamen; denn je näher sie dem Eis gekommen waren, desto einsamer war es geworden. Nur die Seeadler am Himmel und das Heulen der Wölfe begleiteten den verbannten Herrscher und sein Weib auf ihrem Weg.
Wann immer sie die Rufe der Raubtiere in der Ferne hörte, spürte Iona Furcht in sich aufsteigen, ein urtümliches Gefühl, das jeden überkam, der sich schutzlos durch eine fremde Landschaft schlagen musste. Keine Waffen zu haben bedeutete nicht nur, dass sie nicht jagen konnten, es bedeutete auch, dass sie sich nicht verteidigen konnten. Iona mochte gar nicht daran denken, was geschehen würde, wenn sie auf einen Bären oder ein Rudel Wölfe treffen würden. Ihre einzige Hoffnung war, dass auch diese Tiere die Eismassen mieden und sich eher an die Küstengebiete hielten, wo es nicht so unwirtlich war und es mehr Beute für sie gab.
Und doch – trotz ihrer hoffnungslos scheinenden Lage glaubte die Frau des Brude fest daran, dass noch nicht alles verloren war. Wenn sie erst einmal den Einflussbereich des verhassten Priesters hinter sich gelassen hatten, würden sie versuchen, sich Werkzeuge herzustellen und eine Kule in der harten Erde zu graben, die sie die Nacht zumindest überstehen ließ. Dann irgendeine Waffe, Jagd, Nahrung. Aber um dies alles zu erreichen, mussten sie noch eine Zeit lang durchhalten, und Iona hoffte, dass ihr Gemahl dazu in der Lage war.
Er ist immer noch Brude, und er wird wieder über das Eiland herrschen.
Es war allein dieser Gedanke, der sie weitertrieb, besonders in den dunkelsten Stunden, so wie jetzt.
»Lass mich noch einen Augenblick ausruhen.« Brudes Stimme war brüchig.
Iona schüttelte den Kopf. »Du wirst noch mehr ausfrieren. Wenn wir gehen, dann leben wir. Zum Ruhen ist noch genug Zeit im Grab.«
»Das klingt wie ein Versprechen.«
Sie trat näher zu ihm. »Denk nicht einmal daran. Wer sonst soll meine Bettstatt wärmen, wenn ich Beacán verjagt habe und unser Volk regiere?«
Brude nahm sie in die Arme und drückte sie fest an sich. Dann legte er seine Wange an die ihre. Es war nur ein kleiner, inniglicher Moment, aber er reichte aus, um Iona schmerzhaft bewusst zu machen, wie sehr sie ihren Gemahl, ihren Mann, vermisste.
»Deine Worte in aller Götter Ohren.«
Die beiden lösten sich aus der Umarmung. Der Moment der Verbundenheit war so schnell verflogen, als wäre er nie da gewesen. Iona drehte sich um und ging wieder voran.
Sie versuchte, sich erneut nur auf das heutige Ziel zu konzentrieren, aber ihre Gedanken kreisten stattdessen unablässig um den Mann, der sie in diese Lage gebracht hatte. Beacáns Urteil war eindeutig gewesen: Verbannung in das Innere von Innis Bàn, zwei mal sieben Tage vom Dorf entfernt. Seine Männer würden immer wieder die Gegenden zwischen Küste und Eis durchstreifen, das hatte er vor versammelter Dorfgemeinschaft verkündet. So wollte er sichergehen, dass der frühere Herrscher und sein Weib nicht in der näheren Umgebung Unterschlupf suchten. Wenn sie sich diesem Gottesurteil, und dafür hielt der Priester sein Wort, widersetzten, verdienten sie nur eine Strafe – den Tod.
Aber dazu würde es nicht kommen, das schwor sich Iona.
Die Wolken stoben auseinander, der Mond warf sein bleiches Licht auf die Eismassen. Der Wind wehte über sie hinweg, bildete in der Luft Schneewirbel und zerstörte diese wieder. Die Kälte nahm er mit und trug sie weiter, in den Mann und die Frau hinein, die unweit des Eises mit eingezogenen Köpfen dahinstolperten.
Er ließ sie hinter sich, strich über Hügel, schwarze Grasflächen und verwitterte kleine Steinformationen.
Und er zerrte an den beiden Gestalten, die zwischen den Hügeln schliefen, in dicke Felle gehüllt, die Griffe ihrer Schwerter fest in den Händen.
Bree, Moirrey und Flòraidh standen auf der Ringmauer der Festung von Torridun und wärmten sich zitternd die Hände über den Flammen, die aus einer Feuerschale loderten. Doch so sehr sie es auch versuchten, die Kälte, die ihnen während der letzten Nacht im Freien in die Knochen gezogen war, ließ sich nicht vertreiben.
Trotzdem verließ Flòraidh immer wieder das Feuer und ging ans östliche Ende der Mauer, um in dem tiefer gelegenen Teil der Festungsanlage, der vom Feuer verschont geblieben war, nach den Handwerkern und Bauern Ausschau zu halten, die hier lebten – vergebens. Offenbar war die Furcht vor den Bezwingern der Feste größer als der Wunsch nach einem Dach über dem Kopf.
»Wir werden doch hierbleiben, oder, Bree?«, fragte Moirrey zögerlich und unterbrach damit die Stille, die seit Beginn ihrer Wache zwischen ihnen geherrscht hatte.
Ihre Schwester zuckte mit den Schultern. »Torridun mit einer List einzunehmen war eine Sache. Die Festung zu halten ist eine andere.«
»Ich nehme an, der König von Alba wird nicht tatenlos zusehen, wie man ihm sein Gebiet streitig macht«, warf Flòraidh ein. »Ich würde es jedenfalls nicht dulden.«
Moirrey verzog das Gesicht. »Dann ziehen wir also wieder weiter, und es war alles umsonst?«
»Umsonst ist es nur, wenn man nichts daraus macht.« Flòraidh blickte in den Wolkenhimmel, der wie eine bleierne Decke über ihnen hing. Die Kriegerin musste daran denken, wie Kineth ihr am Morgen den Befehl für die Wache erteilt hatte, und wie erleichtert sie darüber gewesen war. Bis gestern hätte sie wohl mit todesverachtendem Grinsen nur darauf gewartet, dass sie ihre Kampfkunst unter Beweis stellen konnte. Aber nach letzter Nacht hoffte sie, dass niemand sie heute herausfordern würde. Sie wollte nach Hause. »Wir haben nicht nur Kineth und Ailean befreit, wir haben auch Waffen, Proviant und Gold erbeutet. Damit könnten wir nach Innis Bàn zurücksegeln.«
»Lass das nicht Ailean hören«, sagte Bree müde. Auch sie fühlte sich innerlich leer, seitdem die Aufregung des Kampfes abgeklungen war.
»Ihr wollt also beide aufgeben?« Moirrey spuckte abschätzig über die Brüstung.
»Sieh uns doch an«, entgegnete Bree. »Keiner von uns ist unversehrt geblieben, auch wenn es nur kleine Wunden sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich uns ein Heer aus Kriegern entgegenstellt, denen wir unterlegen sind.« Sie machte eine kurze Pause und fuhr daraufhin sanft fort. »Der Herr über diese Festung hat sich auch überschätzt, und jetzt sind alle seine Leute so tot wie er selbst. Und er hatte eine Festung zum Schutz und saß nicht zwischen rauchenden Ruinen so wie wir.«
»Weil er töricht war!« Moirrey spie die Worte geradezu aus. Sie hasste es, wenn ihre ältere Schwester sie belehrte – und recht dabei hatte.
»Also lass uns nicht ebenfalls töricht sein.« Bree legte ihrer Schwester die Hand auf die Schulter. Moirrey erstarrte. Dann riss sie sich los und schritt demonstrativ die Mauer entlang.
Nachdem Kineth nach den Verwundeten gesehen und auch in ihren Blicken die bedingungslose Hoffnung erkannt hatte, die sie in seine Führung legten, wusste er, dass er seinen Leuten aus dem Weg gehen wollte. Zumindest bis zum nächsten Morgen. Er ging zu einem der toten Pferde, die es nicht mehr aus den brennenden Stallungen geschafft hatten und jetzt dalagen, als wären sie stundenlang über einem riesigen Lagerfeuer gebraten worden. Er stach in die verkohlte, spröde Haut, schnitt einige Stücke Fleisch ab und steckte diese in seinen Lederbeutel. Dann griff er sich eine Decke aus Filz, füllte einen Krug mit Wasser und stapfte an den nördlichsten Punkt der Verteidigungsanlage, wo ein kleiner hölzerner Turm emporragte.
Kineth kletterte hinauf, stellte den Krug ab und legte den Beutel mit Proviant daneben.
Er sah sich um; rings um ihn erhoben sich fünf Fuß hohe Palisaden. Hinter der einen Seite tobte die raue See, vor der anderen erstreckte sich die Festung, oder was von ihr übrig geblieben war. Das Haupttor und die Befestigungsanlagen aus Holz davor waren völlig niedergebrannt, ebenso die meisten Gebäude, die sich dicht aneinandergedrängt hatten. Die Waffenkammer mit dem Kerker, das Haupthaus und die angrenzenden Ställe – nichts davon war vom Feuer verschont geblieben. Einzig die Kapelle, in der er, Ailean, Caitt und Egill die Belehrungen von Máel Coluim, dem Neffen des Königs, über sich hatten ergehen lassen, war wie durch ein Wunder unversehrt geblieben.
Der Herr beschützt die Seinen.
Beacáns Worte. Dumpfer Ärger beschlich Kineth, als er an den Priester in seiner alten Heimat dachte. Seine Predigten darüber, wie gütig und doch zornig der eine wahre Gott sei. Hier hat der Herr jedenfalls die Seinen nicht beschützt, nur die Behausung, die sie zu Seinen Ehren errichtet hatten, sagte der Krieger grimmig zu sich selbst.
Wie alle Götter.
Kineth setzte sich. Der Turm, der gerade einmal zwei Mann stehend Platz bot, würde bis morgen Früh sein Zuhause darstellen. Er nahm aus dem Beutel ein Stück Pferdefleisch, das noch immer warm war, und biss kräftig ab. Während er das faserige Fleisch kaute, war ihm, als würden seine Lebensgeister langsam, aber sicher wieder in ihn zurückkehren. Nachdem er fertig gegessen hatte, zog er sich die Decke bis zum Hals hoch, lehnte den Kopf an die grob behauenen Palisaden und war einen Augenblick später eingeschlafen.
Unen trat hinter Elpin, der im Vergleich zu ihm wie ein kleiner Junge neben einem aufgerichteten Bären wirkte. Er steckte ihm ein Büschel purpurfarbenes Heidekraut in den Gürtel, dann machte er einen Schritt zurück und begutachtete sein Werk: Der schmächtige Krieger war so mit Zweigen und Büschen ausgestattet, als habe die Natur selbst ihn vereinnahmt und sei über ihn gewachsen. Unen nickte zufrieden. Auch aus ihm ragten vielerlei Zweige und Büschel.
In stillem Einvernehmen legten sich die Männer auf den kühlen, mit Moos überwucherten Waldboden und blickten auf einen schmalen Pfad, der sich durch das Gehölz schlängelte. Beide waren sich sicher, dass sie sogar ein Reiter nicht erspähen würde, denn sie sahen aus, als wären sie eins mit dem Wald. Unen wurde warm ums Herz bei der Erinnerung daran, wie sie sich das letzte Mal so getarnt hatten – es war in ihrer alten Heimat gewesen, als sie die Nordmänner, die furchtlos, aber dumm durchs offene Gras gestampft waren wie eine Herde Schafe, einen nach dem anderen abgestochen hatten. Die List ist eben der stärkste Waffenschmied, dachte Unen und genoss die Stille, das Zwitschern der Vögel und das sanfte Knacken der Bäume, die sich im Wind bogen.
»Brude wäre gestern stolz auf uns gewesen«, sagte Elpin.
Und schon war es mit der Stille wieder vorbei.
Unen verzog griesgrämig das Gesicht, aber das schien den anderen nicht zu beeindrucken.
»Wir«, fuhr Elpin fort, »die wir bis vor Kurzem noch nie mehr als einen handfesten Streit ausgetragen haben, haben jene besiegt, die den Kampf von Kindesbeinen an gewohnt waren.«
Unen brummte zustimmend.
»Kurz bevor es losgeht, hat man natürlich Todesangst«, fuhr Elpin unbeirrt fort. »Aber dann verfällt man in einen Rausch, in eine Begeisterung, von der man hofft, dass sie niemals enden wird.«
Wieder brummte Unen zustimmend.
»Natürlich würgt einen zwischendurch immer wieder die Todesangst, gewaltig sogar, das gebe ich zu …« Elpin verstummte, schien auf eine Reaktion zu warten. »Ergeht es dir auch so?«
Unen schloss die Augen und schnaubte. Dann blickte er zu Elpin, der ihn mit wachen Augen erwartungsvoll anstarrte. »Natürlich ergeht es mir auch so«, sagte der alte Krieger. »Jedem geht es so, der nicht wie ein Feigling flieht oder bereits tot ist.«
»Als der Kampf jedoch vorbei war, da war mir, als hinge ich über einem bodenlosen Abgrund, in den ich augenblicklich hineinzufallen drohte.«
Unen zog die Augenbrauen nach oben und hoffte, dass diese Reaktion ausreichend war.
War sie nicht.
»Daher frage ich mich, ob es das alles wert ist. Der Schweiß, das Blut, die Schmerzen. Weißt du, was ich meine?«
Unen schüttelte den Kopf.
»Ob dieser Rausch, der einen ja auch das Leben kosten kann, die Leere aufwiegt, die man danach spürt.«
Unen hatte genug. »Weißt du, was ich glaube? Dass man es sich nicht aussuchen kann, ob man kämpfen will oder nicht. Jeder, der bei Verstand ist, würde ein Leben in Frieden und den sanften Tod im Schoß eines Weibes vorziehen, als irgendwo im Dreck liegend in Stücke gehackt zu werden.«
Elpin überlegte kurz. »Tod im Feuer. So hat Egill es genannt, und dass es nichts Schöneres für Nordmänner –«
»Egill und seine Krieger sind ja nicht bei Verstand. Das sind Berserker, die sich selbst nur den Tod wünschen«, knurrte Unen. »Und wenn du auch alt werden und im Schoß einer Dirne das Zeitliche segnen willst, dann schlage ich vor, du schweigst jetzt, und wir beide tun, wofür wir hier sind. Nämlich den verdammten Pfad nach Feinden auszuspähen, einverstanden?«
Elpin sah Unen mit prüfendem Blick an, ob der wirklich meinte, was er sagte. Er entschied für sich, dass der alte Brummbär wohl eher einen Scherz gemacht hatte, hielt aber gehorsam den Mund. Die Wache war lang, und sie hatten noch genug Zeit, sich über Gott und die Welt zu unterhalten.
Kineth schreckte hoch, als hätte man ihm einen Schlag gegen den Kopf versetzt. Orientierungslos sah er um sich, die Augen weit aufgerissen. War er nicht eben noch in einem Kampf auf Leben und Tod gewesen? Die Bilder des Traums verschwammen, machten der Wirklichkeit Platz. Die Wolken hatten sich gelichtet, die Sonne erreichte den Horizont.
Der Krieger stand auf, blickte über die Mauer. Ein Dutzend Pferde standen angebunden in der Mitte des ringförmigen Platzes der Festung, neben ihnen waren Ziegen, Schafe und Schweine zusammengetrieben worden – alle, die nicht verbrannt waren oder sich losreißen und durch das Haupttor in die Wildnis retten konnten. Unter einem Vordach lag ein Berg aus Waffen und Rüstungsteilen, manche schwarz vom Ruß, andere blank poliert.
Dànaidh hätte seine wahre Freude daran gehabt, kam Kineth in den Sinn. Der Gedanke an den gefallenen Schmied, der sein Freund gewesen war, versetzte ihm einen Stich in die Brust. Unwillkürlich suchte der Krieger nach dem Platz, an dem Dànaidh gestern verbrannt worden war, aber bis auf einen geschwärzten Flecken Erde zeugte nichts mehr von der Feuerbestattung.
Er hat dir das Leben gerettet. Du solltest an seiner statt sein.
Der Krieger spähte zu den Mauern, auf denen seine Leute Wache standen. Eine Handvoll von ihnen marschierte gerade Richtung Wald, wohl um die Posten dort abzulösen. Kineth spürte, dass es Zeit war, nach den anderen zu sehen. Sich zu zeigen.
Der Wind trug die sanfte Melodie einer Knochenflöte zu ihm. Unen, der seine Wache wohl beendet hatte, spielte für die Verwundeten. Oder für sich selbst.
Steh auf und gehe eine Runde.
Aber je mehr ihn seine innere Stimme drängte, desto weniger schaffte er es, sich aufzuraffen. Kineth schloss für einen kurzen Moment die Augen, aber die Erschöpfung nahm ihn erneut gefangen.
Die Nacht war hereingebrochen, die Sterne wurden immer wieder von Wolken verdeckt.
Nachdem Caitt das Zaumzeug abgenommen sowie den Sattel abgeschnallt und geschultert hatte, war er vorbei an den Gruben bis zum Erdwall gestiegen und hatte diesen erklommen. Die Waffen der Diebe hatte er liegen lassen, da sie seiner Einschätzung nach kaum zu gebrauchen waren.
Auf der Kuppe des Erdwalls stehend sah Caitt sich jetzt um.
Warum sich der Wall so geradlinig durch die Landschaft schnitt, oder wer ihn zu welchem Zwecke erbaut hatte, konnte der Krieger nicht erkennen. Doch er vermutete, dass dies ebenfalls die Romani gewesen waren, oder Römer, wie man sie in diesem Land anscheinend nannte. Das Dorf, von dem die Diebin gesprochen hatte, musste hier irgendwo liegen. Im fahlen Licht des Mondes erkannte Caitt zumindest den Steinweg, der parallel zum Erdwall verlief.
Der Krieger rückte noch einmal den schweren Sattel auf seiner Schulter zurecht, dann marschierte er los.
Ebenso schnurgerade wie der Wall verlief auch die Straße von Osten nach Westen. Aber im Gegensatz zu allen anderen Wegen und Pfaden, auf denen Caitt in seinem Leben marschiert war, war dieser mit behauenen Steinen gepflastert und in der Mitte leicht aufgewölbt, sodass der Regen, der nun fiel, abfließen konnte und in Spurrinnen zu beiden Seiten versickerte. Bei der Breite von knapp drei Mann wunderte sich Caitt allerdings, wer solch eine Straße überhaupt brauchte und wofür.
Richtung Westen konnte er bereits erahnen, wo das Dorf lag, da ein Lichtschein zwischen den Wipfeln glomm. Er beschleunigte seinen Schritt.
Die gepflasterte Straße führte an einem übel riechenden Haufen Abfall vorbei, der sich bis weit in den angrenzenden Wald erstreckte und aus verwesendem Fleisch, Eingeweiden, Tierknochen und Exkrementen bestand. Trotz der klaren Regenluft hielt Caitt kurzzeitig den Atem an, so stechend war der Gestank.
Wenig später sah er, dass die Straße in der Öffnung eines Walls endete, dessen Palisaden nur noch vereinzelt dastanden und an einen Hornkamm erinnerten, bei dem die meisten Zinken abgebrochen waren. Von dem hölzernen Turm, der einst die Wallöffnung bewacht haben musste, waren nicht mehr als drei verfaulte Steher übrig. Hinter dem Wall reihten sich gemauerte Häuser zu beiden Seiten des Wegs.
Während Caitt näher kam, erwartete er die mahnenden Worte einer Wache oder zumindest das Läuten einer Glocke als Zeichen, dass sich ein Fremder näherte, aber nichts dergleichen geschah.
So schritt der Krieger zwischen den beiden Seiten des Walls hindurch und sah sich um. Das Dorf war menschenleer. Die Häuser waren mit Holzschindeln oder Stroh gedeckt, die meisten Mauern aus Holz, manche aus Stein, die Oberfläche stellenweise seltsam glatt verputzt. Bei genauerer Betrachtung gab es jedoch kaum eine Stelle, die nicht ausgebessert war, und so wirkten die Gebäude wie ein merkwürdiges Flickwerk.
Vor dem Eingang des größten Hauses brannte ein Feuer in einem eisernen Käfig, darüber hing ein hölzernes Schild. Mit verblassten Farben war ein Strauß aus Zweigen und Blattwerk darauf gemalt, in dessen Mitte ein gelber Helm prangte.
Caitt hörte Stimmen, Gelächter und Musik aus dem Haus dringen. Er vermutete, dass es das Versammlungshaus des Clans sein musste, der in dem Dorf lebte. Ohne zu zögern, trat der Krieger vor die schwere Eingangstür aus dunklem Eichenholz mit Eisenbeschlägen und drückte sie auf.
Innerhalb eines Augenblicks verstummten Gäste und Musikanten, alle sahen den durchnässten Mann mit den seltsamen Bemalungen auf den Armen an, der mit einem Sattel auf der Schulter und einem Zaumzeug in der Hand in der Tür stand.
Der Wirt, ein grobschrötiger Mann mit dünnem braunem Haar und geröteter Nase, stellte den Tonbecher ab, den er eben mit einem schmutzigen Lappen ausgewischt hatte. Er trocknete sich die wulstigen Hände an seinem rostbraunen Hemd ab und trat dann hinter dem Schank hervor.
»Willkommen im Haus zum goldenen Helm«, rief er mit heiserer Stimme. »Der Platz zum Übernachten des Gesindes ist am Ende der Straße in der Scheune mit dem löchrigen Dach. Wenn du es dir leisten kannst!«
Ein Dutzend Gäste, die rund um grob gezimmerte Tische hockten, auf denen sich Krüge und Essensreste stapelten, lachten auf, woraufhin die Musikanten wieder Fidel, Flöte und Trommel zu traktieren begannen.
Caitt bemühte sich, ein Lächeln hervorzupressen. Er ließ den Sattel auf den geschwärzten Steinboden fallen, der mit losen Binsen bedeckt war, legte das Zaumzeug darauf und schloss ruhig die Tür hinter sich. Dann wandte er sich um. Erst jetzt wurde ihm bewusst, wie schwer die Luft in der Schenke war, wie durchdringend es nach Feuerholz und Schweiß roch, nach ranzigem Essen und abgestandenem Ale.
Mit festen Schritten ging Caitt auf den Wirt zu. »Ich suche einen trockenen Schlafplatz.«
Der Wirt wollte etwas entgegnen, doch der starre Blick des Kriegers ließ ihn zögern. »Das – das kostet aber eine Kleinigkeit.«
»Ach ja?«
Der dicke Wirt blinzelte nervös, dann streckte er drei Finger aus. »Drei Silberpennys für eine Nacht.«
Caitt blickte zur Decke, als würde er den gesamten Betrag abwägen. Das Zucken in den Augenwinkeln des Mannes hatte ihm jedoch verraten, dass dieser mehr Geld rauszuschlagen versuchte als üblich.
»Zwei Pennys, wenn du länger als drei Nächte bleiben willst«, setzte der Wirt hastig nach und zog einen Finger wieder ein.
Caitt schwieg. Der Wirt wusste nicht, was er aus dem Gesicht des Fremden lesen sollte, der nur dastand und ihm mit seinen Kleidern den Boden nass machte. Missmutig ging er wieder hinter den Tresen.
»Nur dass ich keine Pennys besitze«, sagte Caitt schließlich und legte seine rechte Hand auf die Theke, einen Goldring am Ringfinger. Als der Wirt den Ring erblickte, erhellte sich seine Miene wie bei einem Jungen, der einen Topf voll Honig erspäht.
»Dafür kannst du – äh, könntet Ihr dieses Haus beinahe kaufen«, scherzte er und stellte Caitt schnell einen Becher hin. »Wenn ich denn verkaufen würde.«
Caitt nahm den Becher und trank einen großen Schluck. Es war Ale, aber keins, wie sie es an Comgalls Hof bekommen hatten. Das hier war lauwarm und bitter, doch Caitt war durstig und leerte den Becher mit zwei weiteren Schlucken.
Der Wirt schielte zu Boden. »Ich würde auch das Zaumzeug als Bezahlung annehmen.« Er überlegte kurz. »Für zwei Nächte sowie Speis und Trank. Was sagt Ihr?«
Caitt nickte zustimmend. Er hatte im Moment sowieso keine Verwendung dafür. »Und der Sattel?«
»Lasst uns das morgen besprechen, Herr. Ihr seht hungrig aus, wollt Ihr zu essen? Wir hätten noch zart geschmorten Lammbraten mit Nierchen und sämigen Gerstenbrei.«
Caitt nickte erneut. Er legte dem Wirt das Zaumzeug auf die Theke, nahm den Sattel und schleifte ihn an einen der Tische, an denen niemand saß. Er öffnete den Nadelring seines Überwurfs, der trotz des dicken Filzes aus Schafwolle völlig durchnässt war, und breitete ihn über einen Hocker. Dann nahm er mit dem Rücken zur Wand auf der Holzbank Platz.
Der Krieger sah sich um und stellte zufrieden fest, dass er es weitaus schlechter hätte erwischen können. Die Gäste, die zu einem Großteil aus Frauen und alten Männern bestanden, machten einen ausgelassenen, aber friedfertigen Eindruck, auch wenn sie ihm verstohlene Blicke zuwarfen, die eine Mischung aus Furcht und Respekt verrieten. Vermutlich hat König Konstantin auch hier alle waffenfähigen Männer für seinen Krieg im Süden abgezogen, mutmaßte Caitt.
Die Wände dieses Hauses waren mit einem verschmutzten Belag glatt geputzt, hüfthoch waren sie mit verblasster blauer Farbe vollflächig bemalt, darüber rankte sich handbreit ein Muster, das wie die Wellen des Meeres aussah. Über den Raum spannte sich eine Konstruktion aus Dachsparren, die sich zwar bereits stark verbogen hatte, aber trotzdem noch meisterlich gefertigt wirkte. Im Gegensatz dazu stand an der gegenüberliegenden Wand ein Kamin aus groben Steinen, in dem ein Feuer prasselte und der so windschief aussah, als hätte ihn ein Kind gemauert. Auf manchen der Tische brannten Talgkerzen.
Der Wirt kam, einen vollen Becher in der einen, einen Holzteller mit einem wässrigen Brei in der anderen Hand. Beides stellte er vor Caitt ab, sichtlich darauf bedacht, nichts zu verschütten. Er ging zur Theke zurück und kam gleich darauf wieder, legte einen hölzernen Löffel und ein Stück dunkles Roggenbrot neben Teller und Becher.
»Mein Name ist Floin. Ruft einfach, wenn Ihr etwas begehrt«, sagte er in leicht gebeugter Haltung und deutete auf die Seite. »Eure Kammer ist durch diese Tür hindurch, den Gang entlang die letzte Tür. Ich lasse gleich Líadáin, mein Weib, alles Nötige herrichten.«
»Danke.« Caitts Stimme klang gelangweilt.
Der Wirt entfernte sich wieder.