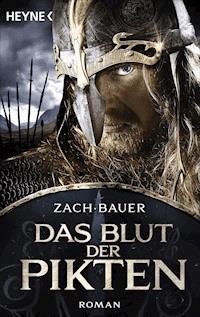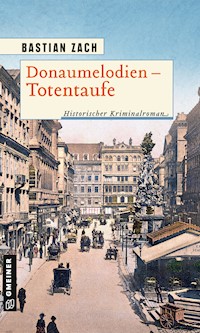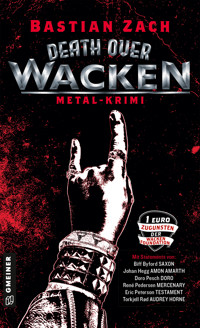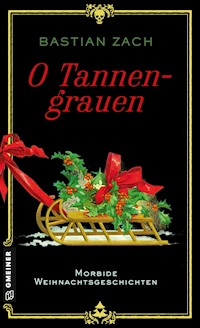Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Geisterfotograf Hieronymus Holstein
- Sprache: Deutsch
Vor dem Stephansdom hängt ein grotesk zugerichteter Toter, zur Schau gestellt für die Bewohner der Stadt. Wer steckt hinter der grausamen Tat? Der Geisterfotograf Hieronymus Holstein soll den Mörder finden, doch nichts ist, wie es scheint. Ein weiteres Opfer mehrt die Gerüchte, ein Jäger der Untoten ginge um! Gemeinsam mit seinem Freund, dem „buckligen Franz“, hastet Hieronymus von einem Hinweis zum nächsten, während sich die Gewissheit, es wird noch mehr Opfer geben, wie ein Leichentuch über die Kaiserstadt legt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bastian Zach
Donaumelodien – Leichenschmaus
Historischer Kriminalroman
Zum Buch
Der Tod ist ein Wiener Als die Gläubigen nach der Heiligen Messe den Stephansdom verlassen, machen sie eine grausige Entdeckung – an einem Laternenpfahl hängt ein geschändeter Toter. Die Witwe des Opfers beauftragt den Geisterfotografen Hieronymus Holstein damit, den Mörder ihres Gemahls zu finden. Doch nichts ist so, wie es zunächst scheint. Ein weiteres Opfer macht jede Hoffnung zunichte, es würde sich um eine Einzeltat handeln. Schnell mehren sich Gerüchte, ein Jäger der Untoten ginge um! Ein Fluch läge über der Stadt! Deshalb nehmen manche Bürger ihr Schicksal in die eigenen Hände und exhumieren ihre Toten in der Hoffnung, sie würden so nicht von ihnen heimgesucht. Gemeinsam mit seinem Freund, dem „buckligen Franz“, versucht Hieronymus Holstein, das Rätsel zu lösen, während eine schreckliche Gewissheit die Kaiserstadt fest im Griff hat: Es wird weitere Tote geben …
Bastian Zach wurde 1973 in Leoben geboren und verbrachte seine Jugend in Salzburg. Das Studium an der Graphischen zog ihn nach Wien, als selbstständiger Schriftsteller und Drehbuchautor lebt und arbeitet er seither in der Hauptstadt. 2020 wurde sein Krimi-Debüt „Donaumelodien – Praterblut“ für den Leo-Perutz-Preis nominiert. Wiens morbider Flair ist es auch, der ihn zu seinen Kriminalromanen inspiriert, und seine Liebe, Historie mit Fiktion zu verweben, lässt das Wien um die Jahrhundertwende wieder lebendig werden.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Donaumelodien – Leichenschmaus (2022)
Donaumelodien – Totentaufe (2021)
Donaumelodien – morbide Geschichten (2020)
Donaumelodien – Praterblut (2020)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernst_Graner_Stephansdom.jpg
ISBN 978-3-8392-7076-9
Widmung
Für Daniela, Salomea, Valerie, Lukas und Maximilian.
Karte: Wien, 1876
Wien, 1876 Prolog
Wie Daunen, die aus einer dicken Decke geschüttelt wurden, fielen unzählige Schneeflocken dicht an dicht aus den Wolken und taumelten zur Erde. Die nächtliche Stadt unter ihnen war an diesem 29. November bereits in dickes Weiß gekleidet, vereinzelte Gaslaternen heuchelten ein wenig Wärme in der klirrenden Kälte. Über die schneebedeckten Dächer reckte sich ein steinerner Monolith in den eisigen Nachthimmel, einem titanischen Fingerzeig gleich, über dreihundertfünfzig Fuß hoch – die Domkirche zu St. Stephan.
Das Innere des geweihten Hauses erstrahlte von Kerzen hell erleuchtet. Die Stimmen der Gläubigen sangen im seligen Einklang mit der Chororgel, die der kaiserliche Orgelbauer Ferdinand Josef Römer vor über hundert Jahren auf dem hölzernen Musikantenchor errichtet hatte.
Beinahe hätten die gefälligen Melodien, die der Organist gekonnt auf der Klaviatur spielte, über das Grauen hinweggetäuscht, das sich vor dem Dom in all seiner ungeahnten Grässlichkeit offenbarte. Nur die tiefen Register, die er mit den Füßen betätigte, erschütterten ab und an Mark und Bein, gleich einer Warnung vor dem, was sich nach dem Ende der Heiligen Messe zutragen würde.
Auch der nicht enden wollende Strom aus Schneeflocken vermochte das groteske Bild nicht zu verbergen, dessen Zeugen die Gläubigen alsbald werden würden. So standen zwischen der seligen Andacht, die die Vorweihnachtszeit einläutete, und dem blanken Entsetzen, das folgen würde, nur mehr wenige liebliche Melodien, wenige andächtige Worte – und ein »Amen«.
Die Klänge verhallten, das Wort wurde gesprochen.
Mit flehendem Ächzen wurden die Flügeltüren des Riesentors geöffnet, ebneten einer Lichtschneise aus dem Kircheninneren den Weg, die immer breiter wurde und schließlich das erhellte, was jegliche Freude auf die heiligste Zeit im Jahr und das Fest von Christi Geburt zunichtemachen sollte …
An einem Laternenpfahl gegenüber dem Stephansdom hing ein älterer Mann, schaukelte reglos im Wind, der ihm eisige Flocken auf die fahle Haut brannte. Seine Augen waren mit Nägeln durchstochen, sein Mund mit grobem Garn zugenäht worden. Seine Hände hielt er vor seinem Schoß gefaltet, einen Rosenkranz darum geflochten.
Mit ungläubigem Entsetzen bemerkten die frommen Bürger den Toten, der wie eine bizarre Statue wirkte, die sich nur ein zutiefst verworrener Geist hätte ausdenken können. Erste Schreie des Entsetzens schallten durch die schneegedämpfte Nacht. Manch zart besaitete Frau verließ das Bewusstsein und sie sank ohnmächtig zur Erde. Manch zart besaiteter Mann stärkte sich mit einem Schluck Hochprozentigem aus seiner Taschenflasche. Viele der Gläubigen brachen in Tränen aus oder sprachen sich Mut zu.
Als geraume Zeit später endlich die Polizei eintraf, hatte sich rund um den entstellten Toten bereits eine Menschentraube gebildet, zu der sich auch Bürger der umliegenden Häuser gesellt hatten, ungeachtet der schneidenden Kälte.
Doch sosehr sie auch den Toten bedauerten oder für seine Seele beteten, so schmerzte die Bürger wohl am meisten die Gewissheit, dass mit dem heutigen Abend ein unsagbares Grauen in der Donaumetropole Einzug gehalten hatte.
Ein Grauen, das so schnell nicht wieder verschwinden würde …
22. November 1876 Sieben Tage zuvor
I
Mit schwerem Kopf schleppte sich Franziskus Maria Rudolphi humpelnd über den Hof auf den Brunnen zu, während seine Schritte im Schnee knirschten, als würde er auf Mehl laufen. Sein Mund war völlig ausgetrocknet, schmeckte entfernt nach Zwetschke. Sein Atem bildete dichte Qualmwölkchen in der eisigen Morgenluft, seine Lunge rasselte bei jedem Zug. Ihm war, als wäre er eine Dampflokomotive, die auf den Wasserkran eines Bahnhofs zusteuerte.
Am Brunnen angekommen hielt er inne, gebeugt und zittrig. Sein Blick fiel auf den hölzernen Eimer, der neben der Mauer stand und der zur Hälfte mit bereits gefrorenem Wasser gefüllt war.
Franz fluchte innerlich. Eigentlich war der ehemalige Mönch ein gelassener Zeitgenosse. Dass er von allen der bucklige Franz genannt wurde, hatte ihn beispielsweise nie gestört, denn er hatte schließlich einen Buckel und mit seinem vollen Namen hatte ihn schon seit einer gefühlten Ewigkeit niemand mehr gerufen. Was ihn jedoch unsäglich störte, war, dass er nun zusehen musste, wie er das Eis aus dem Eimer bekam, bevor er frisches Wasser aus dem Brunnen heraufholen konnte. Irgendjemand hatte wohl in der Nacht vergessen, den Rest des Wassers auszuleeren.
Franz’ Blick fiel auf den Schindelwagen, auf dessen halbrundem Dach sich gut drei Fuß hoch Schnee häufte und in dem eben jener lautstark schnarchte, der mutmaßlich den Eisblock im Eimer verschuldet hatte. Die Miene des buckligen Mannes verfinsterte sich.
Mit ohrenbetäubendem Krachen zerbarst der Eisblock auf den Brettern des Wagenbodens. Hieronymus Holstein schnellte aus seinem Nachtlager, einen zu Tode erschrockenen Ausdruck im Gesicht.
»Was zur Hölle?« Er erkannte seinen Weggefährten, der mit dreistem Grinsen und umgedrehtem Eimer in der Hand mitten im Wagen stand. »Franz?«
»Guten Morgen, Prinzessin!«, bellte der zurück. »Wenn du ab sofort nicht jeden Morgen so geweckt werden willst, dreh gefälligst den Eimer um, bevor du dich wieder in die Harpfn1 haust, verflucht noch einmal!«
Hieronymus wischte sich übers Gesicht, unfähig, den verdatterten Ausdruck loszuwerden. »Ist ja gut. Ich war halt durstig in der Nacht und – wie spät ist es eigentlich?«
»Zeit, den Kübel umzudrehen«, antwortete Franz ruppig und schlurfte humpelnd aus dem Schindelwagen zurück in die eisige Morgenkälte, aus der er gekommen war.
Hieronymus’ Blick sprang zwischen den Eisbrocken am Boden und der offenen Tür, durch die es vereinzelte Schneeflocken ins Wageninnere trieb, hin und her. Erst jetzt merkte er, wie sehr die Nacht seinen Körper abgekühlt hatte. Warum er allerdings hier im Wagen und nicht in der Stube geschlafen hatte, deren Ofen in der Nacht zumindest ein wenig Wärme abgab, entzog sich seiner Erinnerung. Vermutlich hätte er schlafen gehen sollen, bevor seine Vermieterin die zweite Flasche Sliwowitz geöffnet hatte …
War er aber nicht.
Hastig zog sich Hieronymus Socken aus Biberhaar an, schlüpfte in Hemd, Hose, Joppe und Schuhe und prüfte sein Antlitz in dem kleinen gefleckten Spiegel, der an der Wand hing. Seine halblangen hellbraunen Haare standen wirr in alle Richtungen ab, sein ansonsten gezwirbelter Schnurrbart war eben dies nicht mehr und sein dreieckiger Kinnbart wies mehr eine struppige Trapezform auf. Seine braunen Augen waren blutunterlaufen.
Kein schöner Anblick, kam Hieronymus in den Sinn, aber ich werde dich trotzdem pflegen. Er rieb die Finger über die steinharte Pomade, bis sie weich wurde, strich sich die Haare zurück, zwirbelte die Enden seines Schnurrbarts und formte ein Dreieck aus seinem Kinnbart. Für alles Weitere musste er wohl oder übel den Wagen verlassen.
Mit einem sich selbst bemitleidenden Seufzen folgte er seinem grummeligen Freund hinaus in den bleiernen Morgen.
Nachdem sich die beiden Männer mit dem eiskalten Brunnenwasser Hände und Gesichter gewaschen hatten, nahm jeder von ihnen noch einen guten Schluck gegen das brandige Gefühl im Mund. Hieronymus blickte über den schneebedeckten Hof, die verschneiten schiefwinkeligen Hütten und weiter, durch blattloses Geäst in den aschgrauen Wolkenhimmel.
»Erst zwei Wochen Schnee und ich wünschte bereits, der Frühling stünde vor der Tür«, sagte er mit rauer Stimme.
Franz sah seinen Freund herausfordernd an. »Jetzt stell dich nicht so an. Sind eh nur mehr fünf weitere Monate.«
Hieronymus schloss die Augen und atmete tief die schneidende Luft ein. »Eh.«
Dann sah er zum Haus ihrer Unterkunftgeberin, aus dessen Schornstein kein Rauch aufstieg. »Ich werde mir einen Hafermehlbrei richten. In die Innere Stadt möchte ich nicht mit leerem Magen gehen. Kommst du mit?«
Franz schüttelte den Kopf. »Ich werde nach Roswitha sehen.«
In dem Augenblick flog die Tür der Unterkunft auf und Anezka Svoboda trat auf den Hof, immer noch in das Schwarz einer Witwe gekleidet, das sie seit dem tragischen Tod ihres Mannes trug.
»Franz!«, rief sie mit krächzender Stimme und hartem böhmischen Akzent. »Anezka ist kalt!«
Der Angesprochene zuckte mit den Schultern und war gerade im Begriff, etwas zu entgegnen, als ihn der erhobene Zeigefinger seines Freundes verstummen ließ.
»Wenn du jetzt sagst, sie soll sich einfach wärmer anziehen, kannst du in den nächsten Wochen den Beischlaf vergessen.«
Franz zog argwöhnisch die Brauen zusammen.
Hieronymus grinste schief. »Sie will damit sagen: hol Holz und heiz ein.«
1 Wienerisch: Bett.
II
»Der Baulärm ist wahrhaft grässlich«, ereiferte sich Leopoldine Jellouschek, ohne den Blick von dem monströsen Bauwerk abzuwenden, das sie durch das Fenster ihrer Wohnung erblickte. »Und erst der Dreck die ganze Zeit. Meiner Seel!«
Hieronymus nickte wohlwollend, auch wenn sich sein Mitleid in Grenzen hielt. Die Pläne für die Gestaltung der neuen Ringstraße waren bereits seit 1858 hinlänglich bekannt, genauso wie die Tatsache, dass auf dem freien Platz vor Leopoldine Jellouscheks vierstöckigem Haus zwei Museen errichtet werden sollten. Eines der Kunst, das andere der Natur verschrieben.
»Nur weil Seine Hoheit der Kaiser Platz für Seine Waffen- und Münzsammlung haben will«, fuhr Leopoldine unbeirrt fort, »kann unsereins tagsüber kein Auge mehr zutun.«
»Und für Seine Gemälde«, ergänzte Hieronymus, bereits ein wenig ob der Exzentrik der Dame genervt, die ihn in ihre Wohnung bestellt hatte. Sie wollte einen Auftrag an ihn vergeben, mehr war ihm bisher nicht bekannt. Dass die Dame an seiner Profession als Geisterfotograf, als der er sich in Wien einen Namen gemacht hatte, interessiert war, wagte er allerdings zu bezweifeln.
Leopoldine winkte ab. »Wenn man keinen Platz hat, kann man sich halt nicht so viel zulegen. Kann unsereins ja auch nicht.« Sie schloss die feinen Vorhänge und wandte sich Hieronymus zu, der neben einem ovalen Tisch stand und immer noch darauf wartete, sich setzen zu dürfen.
»Wo sind meine Manieren? Bitte entschuldigen S’ vielmals.«
Die Dame wies ihrem Gast einen Platz zu und setzte sich ebenfalls an den Tisch, auf dem neben einer Vase aus Porzellan eine silberne Schatulle stand.
Die braunen Haare hatte die Frau streng hochgesteckt, das weiße Kleid, das sie trug, besaß zu viele Rüschen. Eine hakenförmige Nase dominierte ihr Gesicht. Die knapp über vierzig Lebensjahre hatten ihre Stirn faltig und den Mund spitz werden lassen, zudem umfing sie ein Hauch von Traurigkeit.
»Also, ich hab Sie kontaktieren lassen, weil –«
In dem Moment betrat das Dienstmädchen den Raum, ein silbernes Tablett in Händen mit einem Kännchen und zwei Tassen darauf, aus denen es dampfte, und näherte sich mit scheppernden Geräuschen.
»Meiner Seel«, entfuhr es Leopoldine. »Jetzt erst kommt das Mensch mit unserem Kaffee daher. Ich bitt’ erneut um Entschuldigung.«
Hieronymus wiegelte ab, während die junge Magd das Gedeck auf den Tisch stellte, den Blick geziemlich gesenkt. Fahrig eilte sie wieder aus dem Zimmer.
»Es ist so schwer heutzutage, gutes Personal zu bekommen«, beklagte sich Leopoldine. »Das können S’ mir glauben.«
Hieronymus lag es auf der Zunge zu entgegnen, dass gute Dienstherren wohl ebenso rar gesät waren, aber er verkniff sich den Seitenhieb. Er wollte endlich wissen, warum die Dame ihn hatte kommen lassen.
»Sie fragen sich sicher, warum ich Sie hab kommen lassen?« Leopoldine schien die Gedanken ihres Gastes lesen zu können. »Nun, mir ist so manch Gutes über Sie zu Ohren gekommen. Dass Sie den Dirndlhacker haben dingfest machen können und auch die Sache mit der armen Seele aus dem Narrenturm.«
Hieronymus zollte der Dame mit einem Kopfnicken Respekt. Dass sie von seinen Erfolgen als Ermittler gehört hatte, schmeichelte ihm. »Sie sind gut informiert, Frau Jellouschek.«
»Mein Gatte ist es«, entgegnete sie mit näselnder Stimme. »Er ist mindestens ebenso gut vernetzt, wie er allem hinterherjagt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aber soll er nur. Hat er sich erst an den jungen Dingern abgegriffen, kommt er immer wieder zurückgekrochen.«
Oder die »jungen Dinger« hören dem Mann einfach zu und beklagen sich nicht in einem fort über Gott und die Welt, kam Hieronymus in den Sinn. Doch auch diesen Gedanken behielt er für sich.
»Also«, begann Leopoldine erneut, gefolgt von einem tiefen Seufzen. Sie hob die silberne Schatulle, die auf dem Tisch stand, zog ein Lichtbild darunter hervor und schob es dem Geisterfotografen hin. Ein Jüngling von vielleicht zwanzig Lenzen starrte dem Betrachter entgegen, die Haltung vornehm angespannt, den Blick ernst – und aufgrund der Hakennase seiner Frau Mama wie aus dem Gesicht geschnitten.
Hieronymus sah von dem Foto auf.
»Das ist der Severin, mein kleiner –« Leopoldine brach ab, die Stimme brüchig. Sie trank einen Schluck Kaffee, der ihr sichtlich wohltat. »Der Severin ist mein einziges Kind. Er ist ein lieber Bub. Manchmal vielleicht zu leichtgläubig und zu verträumt. Aber dafür hat er ein großes Herz.«
Nach dieser Vorstellung war Hieronymus tatsächlich gespannt darauf, was es mit dem Sprössling auf sich hatte. Ein uneheliches Kind? Diebstahl? Mord?
»Er hat sich unglücklich verscharmiert2 und ist seit mehreren Tagen nicht mehr nach Hause gekommen.« Nun lief Leopoldine eine Träne über die Wange.
Hieronymus atmete tief durch. Doch etwas so »Dramatisches«, dachte er mit einem inneren Schmunzeln. Vermutlich ertränkte der Jüngling irgendwo seinen Liebeskummer. Oder ließ sich von Bierhäuslmenschern3 vorgaukeln, was für ein Don Juan er nicht sei. Letzteres würde zwar um einiges kostspieliger werden, sofern sich der Bub jedoch nicht mit der Franzosenkrankheit ansteckte, sollte es ebenso harmlos sein wie die erste Möglichkeit.
»Ich traue keinem anderen zu, ihn ausfindig zu machen.«
»Sie schmeicheln mir«, gab Hieronymus zu verstehen. »Aber ich bin weder ein Polizeiagent noch ein Detektiv.«
Leopoldine gab sich unbeirrt. »Das macht nichts.«
Sie öffnete die Schatulle, holte ein ledernes Säckchen hervor und legte es neben das Lichtbild. »Einhundert Gulden jetzt, noch einmal so viel, wenn Sie mir Severin gesund wiederbringen.«
Die Dame schien Hieronymus’ Überraschung bemerkt zu haben und fügte erklärend hinzu: »Mein Gemahl wird es verschmerzen. So trägt er zumindest auch einmal etwas zum Familienglück bei.«
Hieronymus haderte für einen Augenblick mit sich, ob er den Auftrag annehmen sollte, fragte sich jedoch beinahe im selben Atemzug, ob er noch bei Sinnen war – ein solch lukratives und vor allen Dingen ungefährliches Angebot lehnte man nicht ohne Weiteres ab.
»Ich werde mein Möglichstes tun, um Ihren Filius zu finden, gnä’ Frau«, gab er sich galant und ließ dabei das Säckchen in die Tasche seines dunkelbraunen Raglanmantels verschwinden. »Die Fotografie darf ich doch mitnehmen?«
Zum ersten Mal umspielte ein Lächeln das ansonsten stets mürrische Gesicht der Dame. »Natürlich, Herr Holstein. Ich dank Ihnen von ganzem Herzen.« Dann wurde sie todernst. »Es fehlt zudem etwas vom silbernen Besteck. Ich hatte zuerst unser Serviermensch in Verdacht, aber so dumm ist sie wohl doch nicht. Sie verstehen?«
Hieronymus verstand. Wilde Zeiten wollten finanziert werden – und insbesondere die Nächte konnten teuer werden. »Seien Sie meiner Diskretion versichert. Haben Sie einen Anhaltspunkt für mich, wo ich beginnen könnte? Eine favorisierte Restauration? Ein Lokal?«
»In den Sabelkeller ging der Severin gern. Kennen S’ den?«
Hieronymus lächelte wissend.
2 Verliebt.
3 Wienerisch: Sexarbeiterin.
III
Der Fotograf stand vor dem vierstöckigen Haus in der Babenbergerstraße und sah auf seine Taschenuhr. Zwei Uhr Nachmittag. Der Sabelkeller hatte mit Sicherheit bereits geöffnet.
Die Baustelle des neuen Museums hinter sich lassend machte sich Hieronymus auf den Weg. Er durchschritt das Burgtor und überquerte den Neuen Paradeplatz, wo einst die Stadtbefestigung emporgeragt hatte, die jedoch von Napoleons Truppen 1809 gesprengt worden war. Sein Weg führte ihn an der k.k. Hofzuckerbäckerei Demel vorbei, die diesen Titel erst zwei Jahre zuvor verliehen bekommen hatte, und am Café Central, das ihm beim Gedanken daran, was hier erst vor wenigen Monaten seinen Ausgang genommen hatte, einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ.
Schließlich bog er in die Färbergasse ein, ein dunkles, schmales Gässchen, in dem das Haus »Zum roten Säbel« lag. Dessen Innereien beherbergten in tiefen Gewölben die Kellerschenke, die nicht nur wegen ihrer Wandmalereien bekannt war, sondern auch weil sie vorgab, dass der liebe Augustin dereinst regelmäßig dort aufgetreten war.
Je weiter Hieronymus die Stufen in den Keller hinabstieg, desto stärker wurde der Geruch nach feuchtem Moder, nach Tabakschwaden und abgestandenem Wein. Auch das Lachen und Grölen der Gäste wurde mit jedem Schritt lauter, manch herzhaft geschmetterter Satz bestand jedoch nur mehr aus einer Aneinanderreihung von Vokalen.
Hinter der Schank stand ein grobschlächtiger Mann, das Antlitz verschwitzt, die Nase grobporig und gerötet. Den Fetzen, mit dem er die Theke reinigte, verwendete er auch zum Auswischen der Krüge sowie zum Abwischen seiner schweißnassen Stirn.
Hieronymus legte das Lichtbild auf die Theke, daneben eine silberne Zehn-Kreuzer-Münze. Der Wirt blähte die Nüstern, als hätte er die Witterung aufgenommen.
»Was darf’s denn sein, der Herr?«, raunte er höflichkeitshalber, den Blick nicht von dem Geldstück abwendend.
»Nur eine schnelle Auskunft, bittschön«, gab sich Hieronymus jovial. »Kennen S’ den Jungen auf der Fotografie?«
Der Wirt nahm das Bild, besah sich abwechselnd die Abbildung darauf und Hieronymus, zu guter Letzt noch einmal die Münze. »Klar kenn ich den. Ist der Severin. Was wollen S’ denn von ihm? Hat er was angestellt?«
»Ich will gar nichts«, antwortete der andere. »Aber seine Frau Mama sehr wohl.«
Der Wirt grinste schmierig, wurde jedoch gleich wieder ernst. »Der ist aber heute noch nicht hier gewesen. Auch die letzten Tage nicht.« Er tauschte Foto gegen Münze, ließ diese in einer Tasche seiner fleckigen Schürze verschwinden. »Tut mir aufrichtig leid.«
Hieronymus maß den Mann, dann legte er eine weitere Zehn-Kreuzer-Münze auf die Schank. »Muss es nicht. Wissen S’ vielleicht, wo der Jüngling sonst noch gern tschechert4?«
Der Wirt nahm die zweite Münze. »Ich würd mal im ›Roten Hahn‹ nachfragen, draußen im Dritten.« Er hob einen Becher. »Darf’s doch ein Roter oder ein Weißer sein?«
Hieronymus winkte ab. »Danke. Beim nächsten Mal.«
Hieronymus entlohnte den Fiaker für seine Fuhre, dann wandte er sich dem mächtigen Gebäude zu, das die Straßenzeile dominierte: »Zum roten Hahn«, eins der ältesten Einkehrwirtshäuser der Kaiserstadt, über dessen Eingang ein großer, rot gestrichener Gockel aus Metall prangte. Das einst an derselben Stelle errichtete Gebäude war 1683 bis auf die Grundmauern abgebrannt, als die verängstigten Bürger der Vorstädte alle Häuser in Brand gesteckt hatten, um den anrückenden Osmanen keine Möglichkeit zum Verschanzen zu bieten. Nach dem Sieg über Großwesir Kara Mustafas Armee wurde das Haus wieder aufgebaut und die Landstraße als dritter Gemeindebezirk eingemeindet. Seither erfreute sich die Einkehr größter Beliebtheit. Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven sollen hier sogar genächtigt haben.
Aus den Schornsteinen des Gebäudes quoll dicker Rauch, die Fenster der Gastwirtschaft waren teils mit Fetzen aus Loden zum Schutz vor der Witterung verhängt. Hieronymus’ Stirn und Wangen brannten vor Kälte, die kurze Fahrt in der Kutsche hatte sich als ungewöhnlich eisig erwiesen. Nun freute er sich zumindest auf eine Suppe und ein Glas Bier.
Im Inneren des »Roten Hahns« spielte es sich gesitteter ab als im Sabelkeller – die Gäste schienen sich weniger ausufernd zu betrinken und die Gaststube machte einen wesentlich saubereren Eindruck. Der Geruch war jedoch ähnlich, abgesehen vom Moder.
Hieronymus setzte sich an einen freien Tisch, bestellte eine Leberknödelsuppe und ein untergäriges Sankt Marxer Abzugbier und genoss beides in vollen Zügen. Sein Körper wärmte sich von innen auf und so ließ er sich ein weiteres zart gehopftes Bier schmecken. Wer wusste schon, was der restliche Tag noch für Unbilden mit sich bringen würde, rechtfertigte er sich vor sich selbst.
Nachdem er die Zeche bezahlt hatte, befragte er die Schankfrau nach Severin Jellouschek. Im Gegensatz zum Wirt vom Sabelkeller zeigte sich die Frau deutlich gesprächiger. Sie berichtete, dass der junge Mann mindestens zweimal die Woche in ihr Wirtshaus komme, entweder um hier einen feuchtfröhlichen Abend zu beginnen oder, dann jedoch meist schon wankend, um ihn ausklingen zu lassen. Ab und an gebe sich der Jüngling sogar spendabel, in Raufhändel sei er bisher noch nie verstrickt gewesen. Manchmal suche er auch nur eine Schulter zum Ausweinen oder einfach jemanden, der ihm zuhörte, und hin und wieder sei sie das eben, meinte die Wirtin weiter.
»Zumeist ist er einfach unglücklich verliebt, raunzt einer verschmähten Liebe nach. Er ist kein unansehnlicher Kerl«, konstatierte die Schankfrau, »aber er hat einen weichen Kern, der wirkt auf das meiste Weibsvolk wenig anziehend. Wir sind ja selbst von Gemütsschwankungen geplagt«, sagte sie belustigt. »Was brauch ich da ein Mannsbild, bei dem ich mich nicht anlehnen kann?«
Hieronymus zuckte mit den Schultern, auch wenn es sich wohl um eine rhetorische Frage gehandelt hatte. »Wo könnt ich sonst noch nach dem Severin suchen?«
Die Wirtin überlegte. »In den Sabelkeller geht er glaub ich hin und wieder.«
Hieronymus nickte wissend.
»Und in irgendwelche Tschocherl im Wurstel-Prater, glaub ich, mich zu erinnern.«
Noch bevor ihr Hieronymus eine Zehn-Kreuzer-Münze geben konnte, war die Wirtin auch schon wieder aufgestanden und widmete sich den Wünschen anderer Gäste. Ein feines Lokal, stellte er fest und beschloss, den »Roten Hahn« irgendwann mit Franz aufzusuchen.
Mit lang gezogenen Bewegungen und einer Kardätsche in der Hand striegelte Franz Roswithas Fell in Wuchsrichtung. Er und Hieronymus hatten beschlossen, den fuchsfarbenen Haflinger, der ihren Schindelwagen zog, die Wintermonate über in einem benachbarten Stall unterzustellen.
Dabei genoss Franz nicht nur die Ruhe, die Pferd und Stall ausstrahlten, sondern auch die vermeintliche Aufmerksamkeit, die die Stute ihm schenkte.
»Ich weiß, ich wiederhole mich«, sprach er mit sanfter Stimme. »Aber vielleicht war es ja doch ein Fehler, mich mit Anezka einzulassen. Was meinst du?«
Erst zeigte Roswitha keine Reaktion. Dann schüttelte sie den Kopf.
»Hast auch wieder recht«, fuhr Franz fort. »Ich will nur einfach nicht als Lückenbüßer für ihren Mann herhalten, der Herr habe ihn selig. Aber womöglich ist es schlicht meine Unschlüssigkeit, die sie spürt. Weißt du, auch wenn die Frau zäh wie Leder und hart wie Eisen wirkt, so sehnt sie sich letzten Endes wie wir anderen auch nur nach jemandem, der für sie da ist. Einen, der ihr zuhört, sie als Mensch ernst nimmt. Und jemanden, der ihr ab und an mal das Fell striegelt. Verstehst du?«
Franz tauschte die Kardätsche gegen eine Mähnenbürste, kämmte Roswithas strohfarbenes Haar. Die schnaubte genüsslich.
»Gute Frage«, meinte Franz. »Aber die Kinder mögen mich, das kann ich spüren. Im Gegensatz zu erwachsenen Menschen und Gäulen verstellen sich Kinder nicht. ›Kindermund tut Wahrheit kund‹, heißt es bei uns.« Er dachte nach. »Das müsste dann bei dir heißen: ›Fohlenmaul spricht niemals faul‹, oder so.«
Der Bucklige stieß ein glucksendes Lachen aus. Roswitha ein kurzes Wiehern.
»Wir werden ja sehen, wie es mit Anezka und mir weitergeht.« Franz hielt inne, den Blick verklärt. »Aber irgendwie hat mich die Kratzbürste verzaubert. Komme, was wolle, ich werde dich selbstverständlich auf dem Laufenden halten.«
Ein Lied pfeifend pflegte er die Haflingerstute weiter, die dies sichtlich genoss.
Die meisten Attraktionen des Wurstel-Praters wie Schaukeln oder Ringelspiele waren aufgrund der Witterung geschlossen und würden erst im Frühjahr des nächsten Jahres wieder ihre Pforten öffnen. Doch die Gaststätten hatten geöffnet und der Anbruch der Dämmerung verstärkte den Zulauf an Feierwilligen, die den Arbeitstag im alkoholgeschwängerten Dunstkreis Gleichgesinnter ausklingen lassen wollten.
Hieronymus bahnte sich seinen Weg zwischen geschlossenen Schaubuden und geöffneten Wirtshäusern, immer darauf bedacht, nicht auf den zusammengetrampelten Schneewegen auszurutschen, und erreichte schließlich ein Gasthaus, das unweit des Vélocipède-Museums lag. Die Fenster waren mit Vorhängen verdunkelt, an der Tür hing ein Schild mit der Aufschrift »geschlossen«. Trotzdem drang von innen Musik und Gelächter nach draußen.
Hieronymus klopfte in einem eigenen Rhythmus gegen die Tür, die nur Augenblicke später von einem muskelbepackten Mann mit mächtigem Schnauzbart und grimmigem Blick geöffnet wurde.
»Servus, Loisl«, grüßte Hieronymus und tippte mit dem Zeigefinger gegen seinen Zylinderhut.
»Ah, der Hieronymus!«, schmetterte der Türsteher zurück. »Welch seltener Gast.«
»Ich weiß«, gestand der andere und betrat die Gaststätte. »Ich werd’ mich bessern, versprochen.«
Loisl klopfte Hieronymus zustimmend auf die Schulter, was sich mehr wie Schläge denn ein Willkommensgruß anfühlte. Dann schloss er die schwere Eingangstür wieder, nicht ohne vorher noch einen argwöhnischen Blick nach draußen zu werfen.
Hier drin wirkte es, als würde eine geheime Loge tagen, dachte Hieronymus belustigt, während er sich umsah. Dabei war dies nur der Treffpunkt der Kleinwüchsigen, der Verunstalteten, der Sonderlinge – sprich: all jener, die im Prater für das Gaudium des gemeinen Volkes sorgten und dafür deren sensationslüsterne Blicke und Kommentare ertragen mussten. Aber hier war man unter sich und genau genommen war Hieronymus der Sonderling, der nicht der »Norm« entsprach.
»Herr Holstein!«, trällerte eine glockenhelle Stimme von einem der Tische herüber. »Sein S’ ned so gschamig5 und setzen S’ sich zu uns!«
Hieronymus wandte den Kopf, erkannte Maria Goldziher, die von allen »Mitzi« genannt wurde und die ihn mit einem warmherzigen Lächeln zu sich winkte. Die kleinwüchsige Frau strahlte eine Herzlichkeit aus, wie man sie nur selten erlebte. Während sich der Gerufene an ihren Tisch gesellte, bestellte sie ein Krügel Bier für ihn.
Hieronymus drückte ihr die Hand, was wirkte, als würde ein Riese eine Puppenhand ergreifen.
»Ich freu mich, dich wiederzusehen, Mitzi«, sagte Hieronymus. »Dich natürlich auch, mein lieber Toni«, setzte er sogleich nach, als er den gespielt tadelnden Blick des ebenfalls kleinwüchsigen Mannes an Mitzis Seite bemerkte. Jeder hier wusste, dass die beiden als unzertrennlich galten seitdem sie einst dem Tod in Gestalt eines Trophäenjägers von der Schippe gesprungen waren, der sie auszustopfen gedacht hatte.
Der Wirt brachte das bestellte Bier, die drei stießen die Krüge zusammen und tranken.
»Jetzt red schon«, forderte Toni und wischte sich dabei mit dem Handrücken den Bierschaum vom Mund. »Was führt dich her? Bist schon wieder in was verwickelt, für das du Prügel kassieren wirst?«
Hieronymus schmunzelte. »Verwickelt: ja. Prügel: nein. Zumindest noch nicht. Einen Jüngling namens Severin Jellouschek such ich.«
Mitzi und Toni zuckten mit den Schultern.
»Schaut’s, vielleicht könntet’s einfach Ohren und Augen offenhalten.« Hieronymus legte das Lichtbild auf den Tisch, das ihm Severins Mutter gegeben hatte. »So schaut er aus, der Hagestolz6.«
Toni grinste breit. »Und wer sucht den Buben?« Sein Ton wurde spöttisch. »Etwa seine Mama?«
»Genau die«, antwortete Hieronymus todernst. »Und sie ist deswegen krank vor Sorge.«
Der andere blickte betroffen.
»Mein Mann hat zuweilen ein Feingefühl wie ein Fleischhackerhund«, meinte Mitzi mit tadelndem Blick auf ihren Angetrauten. Dann wandte sie sich an Hieronymus. »Wir machen uns schlau, versprochen. Aber dafür geht das nächste Bier auf dich.«
Hieronymus nickte zusichernd und stieß mit Mitzi und Toni erneut an.
4 Wienerisch: sich einen antrinken.
5 Verschämt.
6 Eingefleischter Junggeselle.
23. November 1876 Sechs Tage zuvor
IV
Blass quälte sich die Sonne über ihren Zenit, verdeckt von Wolken, die den Strahlen des Sterns jegliche Wärme raubten. Weit unterhalb der bleiernen Decke begrüßte Hieronymus Mitzi und Toni. Sie trug ihren purpurroten Mantel mit weißem Pelzkragen, er war in einen dicken Mantel aus dunkelblauem Loden gekleidet.
»Dadrin ist er, dein Jüngling«, gab Mitzi ohne Umschweife zum Besten. Ihr Atem gefror an der Luft. »Und zwar schon seit der Früh.«
»Ist halt durstig, der Bub«, kommentierte Toni launig.
»Was du immer redest! Der ist dermaßen verzweifelt liebeshungrig, dass es schon wehtut. So was steht keinem Mannsbild.«
»Damit ist jetzt Schluss.« Hieronymus fegte sich den Schnee von den Schultern. »Kommt ihr mit?«
Mitzi winkte ab. »Wir gehen zum Loisl, auf ein gutes Supperl. Im ›Holländerschiff‹ schaut man unsereins nur deppat an.«
»Dann dank ich euch recht herzlich für eure Bemühungen«, sagte der Geisterfotograf. »Ich werd’ mich revanchieren.«
Mitzi machte eine Geste, als würde sie auf Hieronymus schießen, und zwinkerte dabei keck. Dann gingen die beiden in die entgegengesetzte Richtung davon.
Entschlossen schritt Hieronymus auf die Gaststätte zu. Neben dieser schloss eine Bolzschießstätte an, in der an lauschigen Tagen junge Recken ihrer Herzensdame beweisen konnten, wie sehr sie sie liebten, indem sie auf Pfeifen oder Scheiben aus Ton schossen, auf gemalte Szenerien oder auf bewegliche Ziele in Form von närrischen Figuren. Warum dies die Angebetete als Liebesbeweis verstand und nicht als Drohung, dass es ihr im Streit ebenso ergehen könnte wie den Zielscheiben, erschloss sich Hieronymus jedoch nicht.
»Zum Holländerschiff«, prangte in großen gemalten Lettern über dem Eingang der Restauration. Im Gastgarten standen zwei Hutschmaschinen – Schiffsschaukeln für erwachsene Gäste –, die eisig erstarrt ihrer Erweckung durch das Frühjahr harrten.
Hieronymus öffnete die Tür und betrat die Gaststätte. Die Luft war zum Schneiden dick, stank nach Schnaps, Schweiß und Reue. Die Tische waren nur spärlich mit Gästen besetzt, von denen einige in sich zusammengesunken schliefen, noch halbvolle Becher vor sich. An der Schank saßen zwei Frauen um die dreißig, die Hieronymus begehrlich ansahen – und deren viel zu starke Schminke sie zweifelsohne dem ältesten Gewerbe der Welt zuordnete.
Hieronymus ließ den Blick durch die Stube wandern, suchte nach dem lebenden Ebenbild des Fotos in seiner Tasche. Vergeblich. Übertriebenes Kichern, das aus einem dunklen Eck schallte, erregte seine Aufmerksamkeit und er ging darauf zu.
Langsam schälten sich aus den wabernden Tabakschwaden die Umrisse eines Tisches, voll mit leeren Krügen und Gläsern, sowie dreier Gestalten – ein Mann und zwei Frauen, die ungeniert miteinander kokettierten, sich neckten und dort berührten, wo es sich in der Öffentlichkeit kaum geziemte.
Hieronymus kniff die Augen zusammen. »Severin Jellouschek?«
Der junge Mann blickte auf. »Wer zur Hölle will das wissen?«
Der Geisterfotograf setzte ein reserviertes Lächeln auf. Sein Gegenüber war dem Lichtbild nicht nur wie aus dem Gesicht geschnitten, es befand sich auch in genau jenem Zustand, den Hieronymus bereits im Gespräch mit Leopoldine Jellouschek prognostiziert hatte.
»Deine geschätzte Frau Mutter will das wissen. Sie hat Angst, es könnte dir etwas zugestoßen sein.«
Severin stieß ein verächtliches Prusten aus. Dann drückte er die beiden Frauen an sich, die offensichtlich Kolleginnen der Damen an der Theke waren. »Sehe ich so aus, als wäre mir etwas zugestoßen?« Sein lallender Zungenschlag war unüberhörbar. »Und jetzt wiederschaun, der Herr.«
Hieronymus seufzte. Weder wollte er eine Szene machen noch den Jüngling vor allen brüskieren. »Schau, mir ist wurscht, wo du deine Zeit verbringst, auch mit wem. Aber ab und zu sollte man sich eine Ruhepause gönnen, meinst du nicht? Und heute ist deine Ruhepause.«
Severin machte keine Anstalten einzulenken.
»Geh, komm, Burschi!«, sagte Hieronymus etwas schärfer. »Mach keine Fisimatenten und komm einfach mit.«
Severin kniff die geröteten Augen zusammen. »Wen schimpfen S’ da Burschi?«
»Na, die beiden Schwalben neben dir sicher nicht.«
Wie von der Tarantel gestochen sprang Severin auf, stieß gegen den Tisch und baute sich herausfordernd vor Hieronymus auf, auch wenn er einen halben Kopf kleiner war als der Fotograf. Ein olfaktorischer Schwall aus Schweiß und Alkohol prallte gegen Hieronymus wie eine unsichtbare Wand.
Einen Augenblick später kippten zwei Krüge auf dem wankenden Tisch um, deren roter Inhalt sich über die Schöße der beiden Damen ergoss. Diese sprangen nun ebenfalls erbost auf.
»Heast7, anschütten kannst wen anders!«, keifte die eine.
Die zweite versetzte Severin einen Stoß, dass es diesen wieder auf die Sitzbank zurückwarf. »Ich glaub auch, dass du heim gehörst, zu deiner Mama. Komm wieder, wennst weniger besoffen bist!« Einen Augenblick später schien sie sich jedoch zu besinnen und setzte nach: »Aber komm wieder, hörst?«
Damit ließen die zwei Bierhäuslmenscher die beiden Männer allein.
»War das jetzt wirklich notwendig?« Hieronymus stemmte die Hände in die Hüften.
Severin sah um sich, den Blick verwirrt, wie jemand, der gerade aus einem Albtraum erwacht war. »Was … was ist da grad geschehn?«
»Nichts«, sagte Hieronymus milde.
»Ich wollte doch nur –«
Der Blick des jungen Mannes verklärte sich. Mit einem Mal sprach tiefe Trauer aus seiner Mimik, Tränen liefen ihm über die Wangen. »Was sollte ich denn sonst tun, als mir die Erinnerung zu vernebeln? Verlassen hat sie mich, meine Liane. Einfach so verlassen. Das Herz herausgerissen hat sie mir.« Nun schluchzte er bitterlich. »Ich bin so allein.«
Von dem aufsässigen Recken, den er eben noch gemimt hatte, fehlte jede Spur.
»Na, na«, versuchte sich Hieronymus in tröstenden Worten. »Mit einer Familie, die einen liebt, ist niemand allein.«
Dann griff er dem jungen Mann unter die Arme und zog ihn hoch.
»Aber … ich brauch doch noch ein Schluckerl Wein.«
»Was du brauchst, sind ein Bad und ein Bett«, bestimmte Hieronymus und packte Severin eisern am linken Oberarm. »Komm, ich bring dich jetzt heim.«
7 Wienerisch: Na hör mal!
V
»Er schlaft jetzt, der arme Bub.«
Behutsam schloss Leopoldine die Flügeltür in den Salon, in dem Hieronymus geduldig wartete, seit er Severin zurückgebracht hatte. In welcher Begleitung sich der junge Mann befunden hatte, verschwieg er der Mutter jedoch. Zu naheliegend war die Annahme, dass Leopoldine dies ihrem Jüngling sonst bis an sein Lebensende vorhalten würde. Oder zumindest bis zu dem ihren.
Sie öffnete die silberne Schatulle, wie sie es bereits bei ihrem ersten Gespräch getan hatte, holte erneut ein ledernes Säckchen hervor und legte es vor Hieronymus auf den Tisch.
»Die zweiten einhundert Gulden, wie vereinbart.« Dann nahm sie ebenfalls Platz und atmete so tief aus, wie man es nur tat, wenn einem ein Stein vom Herzen gefallen war. »Ich hätte ja nicht gedacht, dass Ihnen das so schnell gelingen würde«, sagte sie schließlich, wobei Hieronymus zunächst nicht heraushören konnte, ob dies als Kompliment oder als Vorwurf gedacht war. »Von Ihrer Sorte gibt’s leider viel zu wenige, Herr Holstein.«
»Privatdetektive?«
»Verlässliche Männer. Herren, die zu ihrem Wort stehen. Schnell sind sie alle, wenn es darum geht, die Hand aufzuhalten oder zu delegieren. Aber wenn sie selbst gemessen werden, sind die meisten sogar mit Hut sehr klein.«
»Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Und schauen Sie vielleicht, dass der Junge ein wenig Anschluss findet, in, wie soll ich sagen, gleichaltrigen Kreisen.«
»Also bisher hat sich der Severin nicht über die Skatabende unserer Kartenspielrunde beklagt.«
»Ach, wer gehört denn der Runde an?« Hieronymus bereute schon die Frage, kaum dass er sie ausgesprochen hatte. Weder ging es ihn etwas an, noch interessierte es ihn sonderlich.
»Meine Schwester Bertha und ihre Freundin, die Leonie. Eine gescheite Frau, auch wenn sie ein bisserl viel bipperlt8.« Leopoldine machte eine anschauliche Schluckspechtgeste.
»Wie gesagt«, rang sich Hieronymus abschließend ab. »Vielleicht täte dem Severin ein gleichaltriger Umgang nicht schlecht.«
Leopoldine verzog despektierlich den Mund. Dann schien sie jedoch eine Idee zu haben. »Wissen Sie was, Herr Holstein. Kommen S’ doch übermorgen mit uns mit. Wir wollen am Belvedere-Teich Schlittschuhlaufen gehen. Meine Schwester kommt auch. Sie werden sehen, das ist immer eine Riesenhetz!«
Hieronymus war gerade im Begriff abzulehnen, als ihn Leopoldine mit einer Kraft an der Hand fasste, die er ihr niemals zugetraut hätte.
»Herr Holstein, ich besteh darauf und dulde keinen Widerspruch.«
Und obwohl sich jede Faser seines Körpers gegen die »Einladung« sträubte, sagte er nur: »Ich freue mich darauf, Frau Jellouschek.«
8 Trinkt.
25. November 1876 Vier Tage zuvor
VI
Eine eisige Witterung hatte Hieronymus sich gewünscht, einen Schneesturm, bei dem man keinen Hund vor die Tür jagen würde. Denn dann wäre das Schlittschuhlaufen unmöglich gewesen. Petrus jedoch schien andere Pläne zu haben. Von einem blitzblauen Himmel strahlte eine herrliche Wintersonne, ließ die schneebedeckten Dächer der Donaumetropole glitzern und funkeln, als wären sie mit Diamanten bestäubt worden. Die Luft war kalt und doch wohltuend frisch, Straßen, Plätze und Trottoirs waren mit Jung und Alt bevölkert, die gleichermaßen das Kaiserwetter genossen.
Doch bevor Hieronymus sein Versprechen einlösen wollte, völlig sinnentleert im Kreis fahrend Furchen in die Eisdecke des belebten Belvedere-Teichs zu schneiden, musste er einer anderen Urgenz nachkommen. Einer Urgenz, die ihn schon seit Monaten quälte.
Ende September hatte man ihm eine Depesche überbracht, in der ihn František Skorkovský um ein Treffen gebeten hatte. Jener Mann, der ihn nur Tage zuvor bei seinem letzten Besuch noch mit Fäusten traktiert und ihm mit dem Tod gedroht hatte, würde er Hieronymus jemals wiedersehen. Als diesen nun vor einiger Zeit die überraschende Nachricht erreicht hatte, hatte er sich in den nächstbesten Fiaker gesetzt und sich in die Salvatorgasse 7 in der Inneren Stadt kutschieren lassen – hatte er doch die Hoffnung gehabt, dass ihm František Neues über seine Schwester Karolína zu berichten wusste, Hieronymus’ große Liebe.
Diese Liebe hatte dereinst damit geendet, dass man dem Fotografen den kleinen rechten Finger abschnitt und Karolína sich, in der Annahme, dass Hieronymus tot sei, das Leben mit dem Strick nahm. Das hatte der Geisterfotograf zumindest lange Zeit geglaubt – und würde dies immer noch tun, hätte er nicht im Juli dieses Jahres eine Frau erspäht, die Karolína wie aus dem Gesicht geschnitten war und in ihm die unbegründete Hoffnung aufkeimen ließ, sie sei doch nicht tot.
Mit der Depesche in der Tasche hatte Hieronymus nach einer schier endlos langen Fahrt mit dem Fiaker schließlich Františeks Wohnung erreicht. Doch dessen Lakai hatte ihm nichts weiter mitteilen können, als dass sein Herr nur wenige Minuten zuvor völlig überstürzt abgereist sei und er nicht wisse, wann er wiederkomme.
Seither versuchte sich Hieronymus in einer Disziplin, die ihm so überhaupt nicht lag, ja, nie gelegen hatte – Geduld. Aber heute war Samstag und wie jeden Samstag würde Hieronymus auch heute sein Glück versuchen – vielleicht war František ja bereits wieder zurückgekommen.
Er betätigte den Türklopfer, einen Ring im Maul eines Löwen, wartete vor der großen braunen Doppelflügeltür in der Beletage9. Wie jeden Samstag wunderte er sich, dass ihm dabei das Herz bis zum Hals schlug.
Gemäßigte Schritte näherten sich von jenseits der Tür. Das Klacken des Türschlosses, gefolgt vom Aufschwingen eines Flügels.
»Der Herr wünschen?«, fragte der gedrungene Diener im dunklen Rock, ebenfalls wie jeden Samstag mit gelangweilter Miene.
»Herrgottnochmal, Anton!«, ging es plötzlich mit Hieronymus durch. »Was glauben Sie wohl, was ich wünsche? Ich wünsche das Gleiche wie jede Woche! Ist Herr Skorkovský schon zurückgekehrt?«
Der Diener zog eine Schnute, die offenbarte, wie lästig ihm die Frage war. »Ich fürchte, mein Herr ist nach wie vor auf Reisen. Und nein, ich weiß auch nicht, wann er wiederkommt.«
Das gekünstelte Lächeln, das er seinen Worten folgen ließ, hätte Hieronymus dem Diener am liebsten mit der Faust aus dem Antlitz geschlagen, aber dies musste wohl warten, bis František wieder im Lande war. Einen neuerlichen Eklat wegen eines Lakaien zu provozieren, wäre einfach zu töricht.
Mit einer höflichen Verbeugung verabschiedete sich Hieronymus. »Dann wünsche ich Ihnen Wohlbefinden und dass wir uns nächste Woche bei bester Gesundheit wiedersehen mögen.«
Wortlos schloss der Diener die Tür.
Wortlos klemmte Hieronymus seinen Daumen zwischen Zeige- und Mittelfinger und streckte ihm als Zeichen der Missachtung die Feigenhand nach.
9 Erster Stock.
VII
Gleich einem Fächer erstreckte sich die Schlossanlage rund um das k.k. Belvedere, im Norden begrenzt durch den Rennweg, im Süden durch die projektierte Gürtelstraße. Erst 1714 hatte Prinz Eugen den Baumeister Johann Lucas von Hildebrandt beauftragt, für ihn ein Gartenpalais zu errichten, das inmitten weitläufiger Gärten und außerhalb der Stadtbefestigung liegen sollte. Außerdem sollte es eine Orangerie für Zitrusbäume und seltene Pflanzen beheimaten, einen Prunkstall sowie eine halbkreisförmige Menagerie mit über hundert teils exotischen Tieren wie Strauße, Löwen und Affen. Eugens Erbin jedoch wusste nichts Besseres, als den gesamten Tierbestand zu verschachern, bis auf einen Weißkopfgeier, der erst 1823 verstarb.
Auch wenn die Menagerie daher längst aufgelassen war, entwickelte sich der Platz vor dem Oberen Belvedere in der kalten Jahreszeit zu einem beliebten Treffpunkt, um auf dem dortigen zugefrorenen Bassin, das alle den »Großen Teich« nannten, einer noch jungen Winterunterhaltung zu frönen – dem Schlittschuhlaufen.
So auch an diesem herrlichen Novembertag, an dem sich Dutzende Bürger der gehobenen Gesellschaft einfanden, um mit dem eigenen Geschick zu prahlen oder sich am Ungeschick der anderen zu delektieren. Junge Männer glitten scheinbar schwerelos auf Eisenkufen über die spiegelglatte Eisfläche, vollführten gewagte Drehungen oder bremsten erst im letzten Augenblick vor gleichaltrigen Damen ab, die dies offenbar beeindruckte. Zumindest applaudierten sie frenetisch oder mimten die erregt-eingeschüchterte Jungfer. Ältere Herrschaften frönten gemächlicheren Bewegungen, liefen Arm in Arm mit ihrer Angetrauten übers Eis, wogten von einer Seite zur anderen, als würden sie sich im Dreiviertel eines Walzertakts bewegen. Selbst Kinder versuchten sich im Dahinschlittern, oftmals nur auf den Sohlen ihrer Schuhe.
Eigentlich ein wunderschönes Bild friedlicher Eintracht. Doch schon als Hieronymus auf die Menschenmassen, die um den Teich herumstanden, zuschritt, verkrampfte sich jede Faser seines Körpers. Da standen sie, einer wie der andere, gekleidet in die neueste Mode, gepudert, parfümiert und bepelzt. Nicht dass er etwas gegen eine fidele Gesellschaft hatte – aber das Gefühl, etwas vermeintlich Besseres zu sein als andere, weniger Begüterte, würde er nie teilen können.
»Herr Holstein!«, rief ihm Leopoldine Jellouschek freudestrahlend zu und winkte ihm mit ihrer behandschuhten Hand. Als sie erkannte, dass sie der Herbeigerufene bemerkt hatte, steckte sie ihre Hand jedoch schnell wieder in einen befremdlich aussenden Muff aus Opossumfell. Es war jedoch nicht der röhrenförmige Handwärmer aus Pelz, der irritierte, sondern dass auf ihn ein ausgestopftes Opossumjunges aufgenäht war, die Pfoten ausgestreckt. So wirkte es, als hätte sich das Junge gänzlich überfressen, damit man die Hände in seinen Leib hineinstecken und sie dort wärmen konnte.
Neben Leopoldine stand Severin, das Antlitz fahl, die Schultern hängend, den Blick träge. Zur Überraschung des Fotografen fiel diesem erst jetzt auf, dass das linke Ohr des Jünglings eigenartig geschwollen wirkte und wie ein Karfiol10 aussah. Da es jedoch nicht gerötet war, musste es sich wohl um eine eigenartige Form der Verwachsung handeln. Vielleicht auch ein Grund, warum der junge Mann keine Freunde zu haben schien.
Neben ihm stand eine Frau in Leopoldines Alter, mit ähnlich dominantem Gesichtserker. Vermutlich die angekündigte Schwester. Sowie eine dritte Dame bar jeder Ähnlichkeit – Leonie, die Vierte in der Skatrunde, kombinierte Hieronymus.
»Meine hochverehrten Damen«, gab sich der Fotograf galant und zwinkerte dem jungen Mann zu. »Geschätzter Severin. Du siehst, das Leben geht weiter, in all seinem unerträglichen Reichtum.«
Der Jüngling jedoch verdrehte nur die Augen, was ihm einen tadelnden Blick der Frau Mama einbrachte.