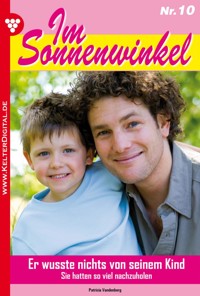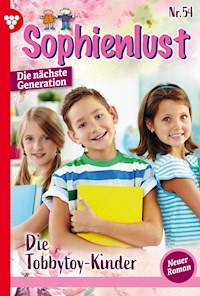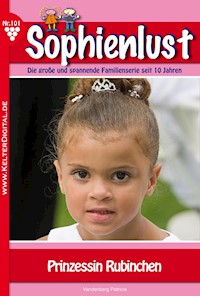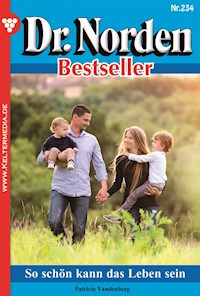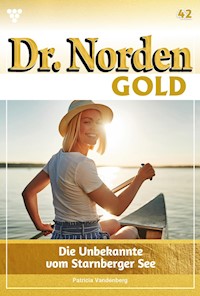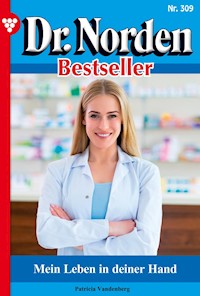8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dr. Norden Bestseller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Deutlich über 200 Millionen Exemplare verkauft! Die Serie von Patricia Vandenberg befindet sich inzwischen in der zweiten Autoren- und auch Arztgeneration. Patricia Vandenberg ist die Begründerin von "Dr. Norden", der erfolgreichsten Arztromanserie deutscher Sprache, von "Dr. Laurin", "Sophienlust" und "Im Sonnenwinkel". Sie hat allein im Martin Kelter Verlag fast 1.300 Romane veröffentlicht, Hunderte Millionen Exemplare wurden bereits verkauft. In allen Romangenres ist sie zu Hause, ob es um Arzt, Adel, Familie oder auch Romantic Thriller geht. Ihre breitgefächerten, virtuosen Einfälle begeistern ihre Leser. Geniales Einfühlungsvermögen, der Blick in die Herzen der Menschen zeichnet Patricia Vandenberg aus. Sie kennt die Sorgen und Sehnsüchte ihrer Leser und beeindruckt immer wieder mit ihrer unnachahmlichen Erzählweise. Ohne ihre Pionierarbeit wäre der Roman nicht das geworden, was er heute ist. Sichern Sie sich jetzt die Jubiläumsbox - 6 Romane erhalten, nur 5 bezahlen! 6er Jubiläumsbox 5 Nr. 23: Schwester Claudia – eine tapfere Frau Nr. 24: Ein schlimmer Tag für Manuela Nr. 25: Ein Stunde wird zur Ewigkeit Nr. 26: Ein falscher Kollege Nr. 27: Fee Norden in höchster Gefahr Nr. 28: Dieser Fall macht uns Sorgen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 893
Ähnliche
Inhalt
Schwester Claudia – eine tapfere Frau
Ein schlimmer Tag für Manuela
Ein Stunde wird zur Ewigkeit
Ein falscher Kollege
Fee Norden in höchster Gefahr
Dieser Fall macht uns Sorgen
Dr. Norden Bestseller – Jubiläumsbox 5–
6er Jubiläumsbox
E-Book: 23-28
Patricia Vandenberg
Schwester Claudia – eine tapfere Frau
Wann ist ihr Leidensweg endlich zu Ende?
Roman von Patricia Vandenberg
Ein heftiger Sturm peitschte Regen und Hagelkörner durch die Straßen, an die Fenster, auf die Autos herab, die sich vorsichtig einen Weg durch die Wasserlachen bahnten.
Auch Dr. Daniel Norden gehörte zu diesen geplagten Fahrern, denn er musste seine Krankenbesuche machen. Bei diesem Wetter wird wieder allerhand passieren, ging es ihm durch den Sinn. Kaum hatte er das gedacht, stieg er auch schon auf die Bremse, denn ein Junge, der sich die Kapuze seines Anoraks über das Gesicht gezogen hatte, lief direkt auf die Fahrbahn. Es war ein Glück, dass kein anderes Fahrzeug entgegenkam, denn trotz der Bremsung hatte Dr. Norden den jungen Mann noch gestreift, der daraufhin in eine Wasserlache gerutscht war.
Dr. Norden war Arzt. Er dachte im Augenblick nicht daran, in welche Gefahr auch er gebracht worden war. Er stieg aus, konnte aber mit einem Aufatmen feststellen, dass sich der Bursche bereits aufrappelte.
Hinter seinem Wagen hielten ein paar andere, doch bei solchem Wetter hupte keiner ungeduldig. Passanten waren nicht auf der Straße.
Dr. Norden half dem nassen Jungen auf die Beine.
Der hatte einen Schock bekommen und stammelte immer wieder: »Entschuldigung, Entschuldigung.«
»Marsch ins Auto«, sagte Daniel Norden. »Kannst du gehen?«
Ein kurzes Nicken war die Antwort, kaum wahrnehmbar, da der Regen dicht herabprasselte.
Daniel packte den Jungen am Arm, schob ihn dann in seinen Wagen und war froh, als er, nun auch durchnässt, wieder die Tür schließen konnte.
»Das hätte schiefgehen können, mein Lieber«, meinte er energisch.
»Entschuldigung«, stammelte der Junge jetzt wieder, dem die Kapuze bei dem Sturz vom Kopf gerutscht war.
»Wollen wir beide froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist«, sagte Daniel und dachte an seine junge Frau, die kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes stand. Heiß und kalt wurde es ihm bei dem Gedanken, was es für Fee für ein Schock gewesen wäre, wenn es einen schweren Unfall gegeben hätte. Aber immerhin blutete der Junge aus einer Stirnwunde, und es konnte möglich sein, dass er auch andere Verletzungen, die nicht sichtbar waren, davongetragen hatte.
Dr. Norden war auf dem Wege zur Behnisch-Klinik gewesen und nicht mehr weit davon entfernt. Dort, so meinte er, konnte man den Verletzten besser untersuchen als im Wagen.
»Es tut mir so leid«, murmelte der Junge.
»Was meinst du, wie mir zumute wäre, wenn ich dich überfahren hätte«, sagte Daniel. »Hast du Schmerzen? Ich bin Arzt.«
»Jetzt mache ich auch noch Ihren Wagen schmutzig«, stotterte der Junge.
»Der wird auch wieder sauber«, sagte Daniel.
Er hielt vor der Klinik auf dem überdachten Parkplatz an. Nun konnte er sich ein paar Sekunden nehmen, den Jungen näher zu betrachten, der anscheinend gar nicht gemerkt hatte, dass ihm das Blut über die Wange lief.
Daniel griff nach seinem Koffer, der auf dem Rücksitz lag, und entnahm ihm Mulltupfer und blutstillende Tinktur.
»Das wird zu Hause nun erst recht Krach geben«, sagte der Junge, der doch nicht ganz so jung zu sein schien, wie Daniel ihn nach seiner schmächtigen Gestalt geschätzt hatte.
»Hast du Krach gehabt?«, fragte er. »Oder muss ich Sie sagen?« Er gab seiner Stimme einen aufmunternden Klang und lächelte.
»Noch nicht, aber den gibt es. Deswegen war ich ja so kopflos. Ich bleibe sitzen. Ich schaffe es einfach nicht, und das Abi erst recht nicht. Mir wäre es wurscht gewesen, wenn ich jetzt tot wäre.«
»Aber mir nicht, junger Mann«, sagte Daniel. »Nun hör mal zu, das ist die Behnisch-Klinik, und ich bin mit dem Chefarzt befreundet. Wir werden mal nachschauen, was du dir sonst noch getan hast.«
»Wir kennen Dr. Behnisch«, murmelte der Junge.
»Um so besser«, sagte Daniel.
»Mir ist schlecht.«
»Dann schnellstens hinein mit dir.«
*
Dr. Dieter Behnisch verabschiedete gerade einen Patienten, der nach längerem Klinikaufenthalt von seiner Frau abgeholt wurde.
»Wir werden nie vergessen, was Sie für mich getan haben«, hörte Dr. Norden den Mann sagen.
Das wurde oft gesagt, und doch vergaßen die meisten sehr schnell, wenn sie wieder gesund waren. In einer Klinik konnte man nicht auf ewige Dankbarkeit und Anhänglichkeit rechnen. In einer Allgemeinpraxis wie bei Dr. Norden war das anders. Da waren die Kontakte zu den Patienten enger.
»Nanu«, sagte Dr. Behnisch, den Jungen betrachtend, noch bevor er seinem Freund und Kollegen Daniel Norden die Hand reichte, »was ist denn mit dir passiert, Axel?«
»Er ist mir vors Auto gerutscht«, sagte Daniel.
»Ich habe nicht aufgepasst. Es hat so wahnsinnig gegossen, und dann der Sturm«, murmelte Axel. »Mir ist schlecht.«
Er war grün im Gesicht. Dr. Behnisch winkte Schwester Dora herbei, der der Junge anscheinend auch bekannt war, denn sie sprach ihn nach kurzem Zögern ebenfalls mit seinem Vornamen an.
»Ich möchte, dass er gründlich untersucht wird«, sagte Dr. Norden.
»Machen wir«, nickte Dr. Behnisch. »Wird eine leichte Gehirnerschütterung haben. Schwester Dora nimmt ihn jetzt unter ihre Fittiche. Was dir auch alles passiert, Daniel!«
»Heute wird noch mehr passieren, aber wenn ich an Fee denke, ist mir mulmig. Um ein Haar hätte es böse ausgehen können. Der Junge hat nicht rechts noch links geschaut und dazu seine Kapuze über das Gesicht gezogen.«
»Er ist unkonzentriert, überfordert außerdem. Sein Vater ist Studiendirektor. Kurz vor der Pensionierung. Dr. Hartwig, und hart ist er auch. Hat spät geheiratet und eine bedeutend jüngere Frau. Sie ist ihrem Mann untertan.«
Dr. Nordens Miene war immer nachdenklicher geworden. Den Schrecken hatte er überwunden. Was hätte geschehen können, war jetzt nicht mehr nachdenkenswert für ihn, da er schnell verstanden hatte, dass der Junge sich in einem seelischen Tief befand. Gedankenlos war er über die Straße gelaufen, und das entsetzliche Wetter hatte das Seine dazu beigetragen.
»Wie alt ist der Junge?«, fragte er.
»Müsste jetzt fast achtzehn sein und ist schon mal sitzen geblieben. Für seinen Vater ist das ein Tiefschlag. Er hatte vor acht Monaten eine schwere Magenoperation, ein sehr cholerischer Mann. Vom alten Schrot und Korn, mit wenig Verständnis für den Klinikbetrieb. Hat uns hübsch in Atem gehalten.«
»Das klingt alles nicht so gut«, sagte Daniel nachdenklich. »Der Junge hat Angst, und andererseits ist ihm sein Leben ziemlich gleichgültig.«
»Du meinst doch nicht, dass er dir mit Absicht ins Auto gelaufen ist?«, fragte Dr. Behnisch erschrocken.
»Nicht so direkt. Er war geistig weggetreten, aber er hat auch gesagt, es sei ihm wurscht, wenn er tot wäre. Dann sagte er noch, dass er in der Schule nicht zurechtkommt. Ich hätte ihn für jünger gehalten.«
»Er kann sich nicht frei entfalten«, sagte Dr. Behnisch. »Wir haben hier ein paarmal erlebt, wie er von seinem Vater angebrüllt wurde. Ich werde mit ihm sprechen.«
»Das möchte ich auch«, sagte Daniel.
»Eigentlich wollte ich mit dir über Martina Rittberg sprechen«, sagte Dr. Behnisch.
»Martina Rittberg? Ach, richtig, du meinst Schwester Claudias kleine Schwester?«
Schwester Claudia war erst ein paar Wochen an der Frauenklinik bei Dr. Leitner tätig, aber Georg Leitners Freunde kannten sie schon besser als jede andere der Krankenschwestern.
Von Schwester Claudia wusste man nun auch den Nachnamen. Es hatte überhaupt eine besondere Bewandtnis mit ihr, und nicht nur deshalb, weil Fee Norden sich schon ganz eigene Gedanken um sie gemacht hatte, als sie Schwester Claudia zum ersten Mal kennenlernte.
Eine sehr lange Freundschaft, schon seit der Universitätszeit, bestand zwischen Dr. Norden, Dr. Behnisch und Dr. Leitner. Grundverschieden im Naturell, waren sie doch ein Dreigespann, wie man es sich unter Ärzten besser nicht vorstellen konnte. Daniel, der Arzt für Allgemeinmedizin, Dieter Behnisch, der Chirurg und der Frauenarzt Dr. Georg Leitner, genannt Schorsch, konnten beispielgebend in ihrer Zusammenarbeit für ihren Berufsstand sein.
Sie hatten sich auf der Uni gesucht und gefunden, wie sie so manches Mal feststellten. Jetzt war jeder auf seinem Gebiet ein gestandener Arzt mit großer Erfahrung und doch nicht von jener Überheblichkeit, die so oft herber Kritik ausgesetzt wurde.
Sie halfen sich gegenseitig, wann immer Zweifel bei dem einen oder dem anderen aufkamen. Sie waren Freunde im besten Sinne des Wortes.
Daniel Norden und Dieter Behnisch waren mittlerweile glücklich verheiratet, Georg Leitner dagegen immer noch ein Einzelgänger. Er hätte kein Glück bei den Frauen, war seine Ansicht. Es wäre ihm einfach noch nicht die Richtige begegnet, meinte dagegen Fee Norden, die ihm gar zu gern auch zu privatem Glück verholfen hätte.
Sie hatte auch sofort die äußeren Vorzüge der jungen Schwester Claudia zur Kenntnis genommen. Dr. Leitner dagegen schätzte nur die berufliche Qualifikation Claudias, bis sie sich dann in einem sehr schwierigen Konflikt Hilfe suchend an ihn gewandt hatte.
Ihre um zehn Jahre jüngere Schwester Martina, die in einem Internat aufwuchs, war schwer krank. Man sah sich deswegen außerstande, Martina weiterhin in diesem Internat zu behalten, in das sie gebracht worden war, als ihre Eltern unter tragischen Umständen vor zwei Jahren verstorben waren.
Von diesen tragischen Umständen wusste noch niemand von den Freunden etwas, als Schwester Claudia ihren Chef um Hilfe ersuchte, aber Dr. Leitner hatte sofort dafür gesorgt, dass Martina in die Behnisch-Klinik gebracht wurde. Seit drei Tagen lag sie hier abgeschirmt auf der Intensivstation.
»Ich brauche deinen Rat, Daniel«, sagte Dr. Behnisch. »Selbst Jenny kann keine Diagnose stellen.«
Dass Jenny Lenz Dr. Dieter Behnischs Frau geworden war, war eigentlich auch Daniels und Fee Nordens Verdienst. Daniel hatte Dr. Jenny Lenz seinem Freund als Assistenzärztin vermittelt, Fee hatte diplomatisch dafür gesorgt, dass sie sich auch menschlich näherkamen. Auch sie hatten sich wohl gesucht und gefunden. Zwei Menschen wie Daniel und Fee, mit den gleichen Interessen und mit der Bereitschaft, helfen und heilen zu wollen. Jenny hatte ihre Erfahrungen in einem Urwaldlazarett gesammelt.
Daniel Norden blickte seinen Freund Dieter jetzt forschend an.
»Und wenn Jenny keinen Rat mehr weiß, meinst du, dass ich einen wüsste?«, fragte er.
»Ich bin Chirurg, Daniel«, sagte Dieter Behnisch. »Jeden Tag stehe ich am Operationstisch, aber du kennst die Patienten in- und auswendig. Das Mädchen ist sehr krank, aber es ist keinesfalls eine Infektionskrankheit. Der Ausschlag ist schlimm, aber es sind keine Pocken, wie sie in dem Internat gedacht hatten. Und aus ihr bringt man einfach nichts heraus. Ich habe Schorsch schon angerufen, damit er Claudia ausfragt, aber ich möchte unabhängig davon auch deine Diagnose hören.«
Es klopfte, Schwester Dora kam. »Axel ist jetzt wieder soweit okay«, sagte sie. »Er hat fürchterliche Angst, weil er Dr. Norden in eine so prekäre Situation gebracht hat.« Sie sah Dr. Norden flehend an.
»Werden Sie Ersatzansprüche geltend machen bei seinem Vater?«, fragte sie.
»Wofür denn?«, fragte Daniel.
Schwester Doras Gesicht entspannte sich. »Der Junge zittert vor Angst, weil er den Unfall verschuldet hat und Ihren Wagen beschmutzte.«
»Die Angst werde ich ihm schon ausreden«, erwiderte Daniel. »Kann man mit ihm reden?«
»Behutsam«, sagte Schwester Dora. »Er ist gut davongekommen. Mächtig übergeben hat er sich. Er hatte was getrunken. Aber halten Sie ihm das bitte nicht vor. Er hat in Latein wieder mal ’nen Sechser geschrieben und traute sich nicht nach Hause. – Diese Eltern«, fügte sie mit einem schweren Seufzer hinzu.
»Das Wetter, die Stimmung, wie leicht kann es da zu einer Kurzschlusshandlung kommen«, sagte Daniel.
»Und dann kein Verständnis im Elternhaus«, warf Dr. Behnisch ein. »Der Junge möchte so gern Kunsttischler werden.«
»Er schnitzt wunderschön«, sagte Schwester Dora. »Er brachte damals seinem Vater ein Relief in die Klinik, aber Anerkennung bekam er dafür nicht. Er solle lieber gute Noten schreiben, sagte der alte Hartwig. Da hat Axel mir das Relief geschenkt.«
Ihrem Tonfall war zu entnehmen, dass sie sehr viel für den Jungen übrig hatte, für seinen Vater aber gar nichts.
»Wir werden ihn jetzt mal untersuchen«, lenkte Dieter Behnisch ein.
»Vielleicht kannst du ihn ein paar Tage hierbehalten, bis sein seelisches Gleichgewicht wiederhergestellt ist«, schlug Daniel Norden vor.
»Was meinst du, was ich dann von seinem Vater zu hören kriege. Der jagt den Jungen auch noch mit Fieber in die Schule.«
»Mit diesem Herrn werde ich reden«, erklärte Daniel.
»Aber wenn du sagst, dass er dir vor das Auto gerannt ist …«
Daniel machte eine abwehrende Handbewegung und fiel ihm ins Wort.
»Ich lasse mir etwas einfallen, schreiten wir jetzt zu Taten.«
Bei allem Wohlwollen für Axel Hartwig mussten sie doch beide ihre Zeit einteilen. Auf Daniel warteten noch andere Patienten, und über Martina Rittberg wollten sie auch noch sprechen.
Axel hatte sich nur leicht verletzt.
Die Gehirnerschütterung war nicht bedenklich, aber man konnte sie als Vorwand benutzen, um ihn in der Klinik zu behalten, denn sein Seelenleben war so in Unordnung, dass man fürchten musste, dass es bei ihm tatsächlich doch noch zu einer Kurzschlusshandlung kommen könne. Als Daniel ihm sagte, dass er mit seinem Vater sprechen wolle, sah ihn der Junge ängstlich an.
»Sie haben mit mir schon genug Scherereien gehabt«, sagte er leise.
»So wollen wir es nicht bezeichnen«, sagte Daniel, »manche Patienten bereiten mir viel größere Sorgen.«
»Sie sind so menschlich«, sagte Axel leise. »Vielen Dank.«
Eigentlich schon erwachsen und doch noch ein Kind, befand er sich in einem schwierigen Stadium, in dem ihm geholfen werden musste. In seinem Elternhaus fand er diese Hilfe nicht. Daniel dachte darüber nach, wie viele junge Menschen an solchem Unverständnis scheiterten, und wie oft Eltern daran mitschuldig waren, ohne sich dessen bewusst zu werden. Axel hatte mit seinen knapp achtzehn Jahren seine Probleme, und es war nicht abzusehen, ob er sie bewältigen konnte.
Martina Rittberg mit ihren vierzehn Jahren blieb allerdings auch für Dr. Daniel Norden ein Rätsel, nachdem er sich eine Viertelstunde mit ihr unterhalten hatte. Es war eine recht einseitige Unterhaltung. Er versuchte, mit ihr in ein Gespräch zu kommen, aber ihre Antworten waren kurz und scheu. Sie war ein Mädchen voller Hemmungen, was allerdings nicht verwunderlich war. Ihr schmales Gesicht war von vielen Pickeln bedeckt, ihr aschblondes Haar strähnig, ihr schmächtiger Körper war der eines unentwickelten Kindes.
Mit ihrer aparten Schwester hatte sie nur eins gemeinsam, das waren die großen Augen von hellem durchsichtigem Grau und von langen dunklen Wimpern umrandet. Aber in diesen Augen stand aller Schmerz eines zerrissenen Kinderherzens zu lesen.
Ihre Seele konnte man nicht in einer Viertelstunde erforschen.
Dr. Behnisch sah seinen Freund forschend an, als er aus Martinas Zimmer kam.
»Nun?«, fragte er.
Daniel Norden zuckte die Schultern. »Im Augenblick kann ich nur bestätigen, dass die Mandeln herausmüssen. Sie sind ein Streuherd, aber ob sich ihr Allgemeinbefinden dadurch bessern wird, steht in den Sternen. Wann hat sie die Eltern verloren?«
»Vor zwei Jahren.«
»Wodurch?«
Nun zuckte Dr. Behnisch die Schultern. »Darüber hat auch Schwester Claudia sich nicht geäußert. Ich hoffe, dass sie uns mehr sagen wird, wenn man ihr klarmacht, wie wichtig es für eine erfolgversprechende Therapie ist. Ich habe mit der Internatsleiterin gesprochen. Eine sehr überhebliche Dame. Man könne ihren anderen Zöglingen nicht zumuten, eventuell von Martina angesteckt zu werden, hat sie gesagt.«
»Wenn ich schon ›Zögling‹ höre«, brummte Daniel. »Man wird dieses arme Kind wegen der Pickel gehänselt haben.«
»Ich fürchte, man hat sie wie eine Aussätzige behandelt«, sagte Dr. Behnisch ungehalten.
»Wahrscheinlich haben auch ihre schulischen Leistungen unter diesen Zwängen gelitten«, sagte Daniel.
»Nein, und das ist eigenartig, sie ist überaus intelligent. Man könnte sagen, einsame Klasse in dieser Altersstufe. Ein Extrem.«
*
Zur gleichen Zeit sprach Dr. Georg Leitner mit Schwester Claudia. Er hatte sich ein Herz gefasst, da Dr. Behnisch ihn so dringend gebeten hatte, sich einzuschalten.
Dr. Leitner, ein ausgezeichneter Gynäkologe, als Arzt selbstsicher und sehr beliebt, war als Mensch äußerst zurückhaltend und sogar schüchtern, zumindest wenn er privat mit weiblichen Wesen zu tun hatte.
Als Frauenarzt kam ihm das wohl zugute, denn schwärmerische Zuneigung wurde ihm von seinen Patientinnen nicht zuteil. Er war eher eine Vaterfigur ohne erotische Ausstrahlung.
Claudia hatte ihn in den wenigen Wochen, die sie nun an der Klinik tätig war, schätzen gelernt. Sie hatte zuvor in ihrem Beruf mit anderen Ärzten recht trübe Erfahrungen gemacht, denn in ihrer äußeren Erscheinung blieb sie selbst in der schlichten Krankenschwestertracht eine Dame.
Am Morgen hatte eine Geburt stattgefunden, die nicht ohne Komplikationen verlaufen war. Claudia war ihm gewissenhaft und umsichtig zur Hand gegangen. Das Personal, durch einige Krankheitsfälle sehr knapp, wurde von den Patientinnen in Atem gehalten, die bei solchem Wetter hektisch und überempfindlich waren. An solchen Tagen musste man schon sehr gute Nerven haben.
Dr. Leitner hatte nicht vorausgesetzt, dass Claudia sie besaß, da sie wahrhaftig genügend Sorgen hatte mit ihrer kleinen Schwester.
Ihr Pflichtbewusstsein lernte er heute besonders schätzen, und als am Ende doch alles gut ausging und eine glückliche Mutter ihr gesundes Baby in den Arm nehmen konnte, atmeten sie beide auf.
»Jetzt können wir uns eine kleine Verschnaufpause gönnen«, sagte Dr. Leitner. »Ich hätte auch etwas mit Ihnen zu besprechen, Schwester Claudia.«
Ganz flüchtige Röte stieg in ihre Wangen, aber sie folgte ihm in ihrer stolzen, anmutigen Haltung in sein Zimmer.
»Mögen Sie Tee?«, fragte er.
Claudia kannte Dr. Leitners Eigenheiten nun schon. Er bereitete seinen Tee immer selbst zu, und als sie zustimmend nickte, setzte er den Kocher in Betrieb.
Anfangs hatte sie gemeint, dass er schon ein richtig verknöcherter Junggeselle sei, denn ihre Meinung von den Männern war ohnehin nicht die beste, aber nun wusste sie, dass er sich nicht gern bedienen lassen wollte und er auch den Krankenschwestern gegenüber sehr rücksichtsvoll war.
Sie hatte sich so manche Gedanken über diesen seltsamen Mann gemacht, über den die Patientinnen nur mit größter Hochachtung sprachen. Nicht ein einziges Mal war eine zweideutige Bemerkung über ihn gefallen. Und auch nicht ein einziges Mal hatte sie erlebt, dass eine Patientin mit ihm flirten wollte.
Nein, dazu war er auch nicht der Mann, aber Vertrauen konnte man ihm entgegenbringen, und als sie sich nun gegenübersaßen und den köstlichen Tee tranken, der von einem Kenner zubereitet war, wich Claudia Dr. Leitners Blick nicht aus.
»Vielleicht ist es ein Thema, über das Sie nicht sprechen wollen, Schwester Claudia«, begann er stockend, »aber ohne Ihre Hilfe kommt auch Dr. Behnisch nicht weit bei Martina. Es würde gut sein, wenn Sie erzählen würden, was dieses Kind so sehr erschüttert hat. Mein Freund, Dieter Behnisch, hat mich gebeten, mit Ihnen zu sprechen, aber wenn Sie lieber mit ihm selbst sprechen wollen«, er unterbrach sich, aber als Claudia zu Boden blickte, fuhr er rasch fort: »Martina soll doch geholfen werden.«
Claudia nickte geistesabwesend. »Ja, ich möchte ihr so gern helfen, aber diese Geschehnisse habe ich auch noch nicht bewältigt. Es ist so schwer, darüber zu sprechen.«
»Ich will Sie nicht drängen«, sagte Dr. Leiter. »Ich bin auch kein mitteilsamer Mensch.«
Claudia hob den Kopf und sah ihn gedankenverloren an.
»Dr. Behnisch meint also auch, dass Martinas Leiden seelische Ursachen hat?«, fragte sie.
»Ja, es sind nicht nur die Mandeln schuld, obgleich die auch entfernt werden müssten.«
»Ich dachte, dass sie noch so jung gewesen wäre, um schneller zu vergessen«, flüsterte Claudia. »Sie war ein so fröhliches, lebensbejahendes Kind. Ein richtiger Sonnenschein.« Sie machte eine kleine Pause. »Ich dachte wirklich, dass die Pockenimpfung an allem schuld ist. Ich meine«, wieder geriet sie ins Stocken, »diesen Hautausschlag. Er belastet ein junges Mädchen doch sehr. Damals wurde sie sehr krank.«
»Nach der Impfung?«, fragte Dr. Leitner.
»Ja. Es war, als würde sie tatsächlich pockenkrank. Wir mussten sie in die Klinik bringen. Meine – unsere Eltern waren im Umzug begriffen. Sie hatten ein Haus gekauft. Die Heizung funktionierte nicht richtig. Martina bekam hohes Fieber, als sie eine Woche dort wohnten.«
Claudia legte ihre schmalen schönen Hände vor das Gesicht, das nun wie erstarrt wirkte.
»Es war zu schrecklich«, sagte sie mit bebender Stimme. »Auf der Baustelle wurde eine Gasleitung beschädigt. Das Haus meiner Eltern flog in die Luft. Sie kamen beide ums Leben.«
Sie kämpfte verzweifelt gegen die Tränen an, die dann aber doch über ihre Wangen rollten.
Spontan sprang Georg Leitner auf und ging schnell auf sie zu. Behutsam legte er die Hände auf ihre Schultern. Erschüttert und doch voller Wärme war seine Stimme, als er sagte: »Weinen Sie, Claudia, weinen Sie sich endlich alles von der Seele. Dann können Sie auch Martina helfen.«
Ganz unbewusst streichelte er dann ihr Haar, als sich das lautlose Schluchzen in leises Weinen löste. Seine rechte Hand legte sich an ihre Wange und drückte ihren Kopf an seine Brust. Er wollte nur trösten, und doch ergriff ein unbekanntes Gefühl von ihm Besitz, eine heiße, nie empfundene Zärtlichkeit. Er hatte schon manche Frau tröstend in den Armen gehalten. Eigentlich hatte er immer nur getröstet, wenn er auch manchmal geglaubt hatte, Liebe zu empfinden. Aber die große Liebe hatte er doch noch nicht kennengelernt, weil ihm immer nur Frauen nahestanden, die mit ihren eigenen Problemen nicht fertig wurden.
Jetzt dachte er gar nichts. Er fühlte nur, dass Claudia mit unendlicher Tapferkeit bemüht gewesen war, ihr Leid zu verbergen.
Er konnte geduldig warten, bis sie wieder sprach. Sie hatte ihre Tränen mit seinem Taschentuch getrocknet und ihr Gesicht abgewendet.
»Ich wollte dann nicht, dass Martina es erfährt«, sagte Claudia heiser, »aber sie lag nicht allein im Zimmer und bekam eine Zeitung in die Hände. Als ich es ihr dann erklären wollte, sah sie mich nur starr an. ›Es ist nicht wahr. Es kann nicht wahr sein‹, sagte sie. ›Mutti und Vati haben doch so lange für ein Haus gespart und sich so darauf gefreut.‹ – Ich habe mir später bittere Vorwürfe gemacht, dass ich sie in das Internat brachte, aber ich musste ja Geld verdienen. Die Versicherungen haben es nicht eilig.«
»Ja, ich weiß«, sagte Georg Leitner.
»Aber ich konnte nicht ahnen, dass es so schlimm für Tina ist«, schluchzte Claudia auf. »Ich meine jetzt, dass wir dann auch nicht mehr zusammen waren. Ich lebte ja schon länger nicht mehr bei meinen Eltern. Wir sahen uns nur einmal im Monat. Sie war das verwöhnte Nesthäkchen. – Sie dürfen jetzt nicht denken, dass ich es ihr neidete. Ich habe sie immer lieb gehabt, ich wusste nur nicht, dass sie mich auch so lieb hat. Sie hatte ja Mutti und Vati.«
»Und für Sie war alles zu viel«, sagte Dr. Leitner. »Sie waren zu jung und hätten selbst einer Stütze bedurft. Gab es niemanden in der Familie, der hätte einspringen können?«
»Unsere Familie bestand nur aus uns«, flüsterte Claudia. »Vati hatte noch einen Bruder, aber er lebt mit seiner Familie im Ausland. Er schickte fünfzig Euro für einen Kranz und eine vorgedruckte Karte. Dann haben wir nie mehr etwas von ihm gehört. Wir kannten ihn auch gar nicht. Die Versicherung hat inzwischen bezahlt. Martina bekommt eine Rente. Sie ist halbwegs gesichert. Aber sie muss doch gesund werden. Bitte, bitte, helfen Sie ihr, Herr Doktor. Ich möchte so gern alles tun, dass sie wieder so wird wie früher. Sagen Sie es bitte Dr. Behnisch.«
»Deshalb brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, Claudia. Nun weiß ich schon mehr, und wenn Sie mir Vertrauen schenken, werden noch manche seelischen Konflikte gelöst werden können. Ein heranwachsender junger Mensch zu Beginn der Pubertät ist in den meisten Fällen besonders empfindsam. Es gibt einige Raubeine, die mit allem fertig werden, aber zu denen gehörte ich auch nicht und Sie wohl ebenfalls nicht. Ich habe meinen Vater früh verloren und lebte lange mit meiner Mutter allein. Das hat sich auch nicht nur positiv für mich ausgewirkt, obgleich ich meine Mutter sehr liebe. Das aber habe ich erst begriffen, seit jeder sein eigenes Leben lebt. Ich fühlte mich eingeengt. Mütter können sehr besitzergreifend sein, ohne es zu spüren. Aber was rede ich von mir. Wir wollen, dass Martina gesund wird.«
»Werden Sie eines Tages auch etwas mehr von sich erzählen, Dr. Leitner?«, fragte Claudia leise. »Sie haben mir so sehr geholfen.« Sie schöpfte tief Atem. »Oder finden Sie es vermessen, dass ich mir wünsche, mehr von Ihnen zu wissen?«
»Nein, durchaus nicht. Vertrauen gegen Vertrauen, Schwester Claudia. Ich hoffe, dass wir noch sehr lange hier beisammen bleiben, und wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, ganz gleich in welcher Beziehung, können Sie jederzeit zu mir kommen.«
»Ganz gleich in welcher Beziehung?«, fragte sie nachdenklich. Dann aber entspannte sich ihr Gesicht. »Sie wissen jetzt schon recht viel von mir, und ich habe sehr viel Vertrauen zu Ihnen. An sich ist es aber gar nicht üblich, dass der Chefarzt einer schlichen Krankenschwester so viel Zeit opfert.«
»Das war nun gewiss kein Opfer«, sagte Dr. Leitner. »Übrigens werden wir das Zimmer für Frau Dr. Norden bereithalten müssen. Morgen ist zwar erst Samstag, aber es könnte immerhin möglich sein, dass das zweite Baby doch schon etwas früher dahergeschneit kommt. Meiner Berechnung nach soll es ja ein Sonntagskind werden.«
»Dann wird es auch ein Sonntagskind«, sagte Claudia. »Und schneien wird es doch wohl hoffentlich nicht auch noch nach diesem Sturm. Wir sind doch schon mitten im Frühling.«
»Sie schon«, sagte er mit einem flüchtigen Lächeln. »Wettermäßig sieht es nicht so aus. Kopf hoch, Claudia.«
Zum ersten Mal ließ er »Schwester« weg, aber es war nicht so, dass Claudia dies als Vertraulichkeit betrachtete. Es müsste schön sein, einen Bruder wie ihn zu haben, dachte sie, oder wenigstens solch einen Freund. Und ganz plötzlich durchflutete sie ein Glücksgefühl, weil es ihr bewusst wurde, dass er schon ein Freund für sie geworden war.
»Danke«, flüsterte sie. »Dank für alles.«
Und dann eilte sie rasch hinaus, weil ihre Augen wieder feucht wurden.
Dr. Leitner nahm sich dann noch Zeit, mit Dieter Behnisch zu telefonieren, bevor er wieder seinen Pflichten nachging.
Nun waren sie doch schon einen Schritt weitergekommen, wenn damit auch Martina noch nicht viel geholfen war. Mit aller Behutsamkeit musste dieses Mädchen behandelt werden, und die Freunde waren sich einig, dass eine chirurgische Klinik dafür nicht der richtige Platz war, wenn erst einmal die Mandeln entfernt waren. Aber schließlich wussten sie ein Fleckchen Erde, wo schon so mancher Verzweifelte und Hoffnungslose Genesung gefunden hatte. Die Insel der Hoffnung! Das Sanatorium, das von Fee Nordens Vater Dr. Johnnes Cornelius geleitet wurde. Es fragte sich jetzt nur, wie Martina sich dazu stellen würde, denn es würde wieder eine räumliche Trennung von ihrer Schwester Claudia bedeuten, die jetzt wenigstens ein paar Stunden täglich bei ihr sein konnte.
Man wollte sich darüber noch eingehend besprechen. An diesem Tage war nicht nur das Wetter stürmisch, sondern auch der Tagesablauf in der Behnisch-Klinik, ebenso wie für Dr. Norden und Dr. Leitner.
Daniel hatte seine junge Frau von unterwegs angerufen, damit Fee sich keine Sorgen um ihn machte. Er sagte ihr allerdings nicht, was passiert war, denn so kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes sollte Fee durch nichts aufgeregt werden.
Ihr ginge es gut, er brauche sich um sie nicht zu sorgen, sagte Fee zuversichtlichen Tones. Danny wäre sehr brav und rücksichtsvoll.
Seine geliebte Fee, heißes Glücksgefühl durchströmte ihn, wenn er ihre weiche Stimme vernahm. Nie kam sie ihm mit Nichtigkeiten, nie beklagte sie sich, wenn er lange ausblieb. Alles wurde leichter durch ihr Verständnis und ihre Anteilnahme an seinem Beruf, der auch der ihre gewesen war, bis sie seine Frau wurde.
Es war keine leichte Entscheidung für sie gewesen, ganz auf diesen Beruf zu verzichten, den sie mit dem gleichen Enthusiasmus gewählt hatte wie er auch. Aber eines Tages hatte sie sich dann doch nur für ihn, ihren Mann, und für ihren kleinen Sohn Danny entschieden. Nun, da die Familie noch größer werden sollte, blieb keine Zeit mehr, ihm in der Praxis zu helfen.
Gut, sie hatten die zuverlässige und resolute Lenni, die den Haushalt bestens führte, aber die Erziehung ihrer Kinder wollte Fee doch nicht aus der Hand geben.
Manchmal kamen Daniel gelinde Zweifel, ob es nicht doch besser gewesen wäre, wenn er mit seinem Schwiegervater gemeinsam die Leitung des Sanatoriums »Insel der Hoffnung« übernommen hätte. Schließlich war dieses Sanatorium von seinem Vater erträumt und geplant worden, und er hatte die Erfüllung dieses Traumes, die Verwirklichung seiner Pläne nicht mehr erlebt.
Dann aber hatte Daniel sich doch für seine Praxis entschieden, mit der er in den Jahren verwachsen war, an der er auch gewachsen und zu einem Arzt geworden war wie einst sein Vater. Der Mensch als Ganzes war ihm wichtig, nicht nur Teile seines Körpers, nicht nur Organe oder Symptome. Allwissend konnte niemand sein. Natürlich musste es Fachärzte geben, Chirurgen, Gynäkologen, Internisten und was es sonst noch an Spezialgebieten gab, aber wie würde denn die Zukunft der Menschheit aussehen, wenn man nicht mehr seinen Hausarzt hatte, den man rufen konnte?
Fee wusste, warum er so an seiner Praxis hing. Die meisten seiner Patienten kannte er seit Jahren, und all ihre großen und kleinen Sorgen kannte er auch. Von manchen hatte er Abschied nehmen müssen für immer, andere kamen neu hinzu, und jeder trug sein eigenes Schicksal mit sich, auch schon die jungen Menschen, wie Axel Hartwig und Martina Rittberg.
Mit sehr gemischten Gefühlen läutete Dr. Norden an der Wohnungstür des Studiendirektors Dr. Wilhelm Hartwig. Eine schlanke blasse Frau öffnete ihm.
»Frau Hartwig?«, fragte er.
Sie nickte. In ihren Augen war ein ängstlicher Ausdruck. Eine harte Stimme schallte durch die Diele: »Wer ist da?«
Frau Hartwig zuckte zusammen. »Mein Name ist Norden, Dr. Norden. Ich bin Arzt«, sagte Daniel rasch.
Sie griff an ihre Kehle. »Axel? Was ist mit ihm?«, stieß sie hervor, und da erschien der Hausherr auch schon persönlich. Er war mittelgroß und hager, hatte schütteres graues Haar und stahlblaue Augen, deren Blick ein Frösteln über Daniels Rücken kriechen ließ.
»Ihr Sohn hatte einen kleinen Unfall«, erklärte Daniel. »Er ist jetzt in der Behnisch-Klinik.«
»Hat er sich etwas angetan?«, fragte Frau Hartwig bebend.
»So ein Unsinn«, warf ihr Mann ein. »Warum sollte er sich etwas antun? Er wird mal wieder gedankenlos gewesen sein. Wann hat er schon seine Gedanken beisammen.«
»Er ist auf der Straße gestürzt«, sagte Daniel. »Bei diesem Sturm passiert so manches.«
Es fiel ihm schwer, überhaupt etwas zu sagen. Am liebsten wäre er auf dem Absatz umgekehrt, denn nun erging sich Dr. Hartwig in sarkastischen Bemerkungen über seinen lebensuntüchtigen Sohn, von dem er immer nur enttäuscht worden sei.
»Wilhelm, ich bitte dich«, versuchte seine Frau nun einzulenken, aber er warf ihr nur einen ganz vernichtenden Blick zu, der sie auch sogleich wieder verstummen ließ.
Diese Jugend tauge überhaupt nichts mehr, sagte Dr. Hartwig, ihr fehle es an Zucht und Ordnung, und zu seiner Zeit hatte es das überhaupt nicht gegeben, was heute so in den Schulen getrieben würde.
Ja, was sollte Daniel da noch sagen? Er machte wenigstens einen Versuch.
»Vielleicht sollten Sie auf die Interessen Ihres Sohnes etwas mehr eingehen. Immerhin könnte dies nur zu seinem Vorteil sein, wenn seine Fähigkeiten gefördert würden.«
Aber da kam er bei Dr. Hartwig schlecht an. »Ach, mein Herr Sohn hat sich wohl wieder mal beschwert«, ereiferte er sich. »Dieser dumme Junge. Faul ist er, und begreifen will er nicht, dass wir nur sein Bestes wollen. Seine Spinnereien bringen ihm doch nichts ein. Was wird man denn heutzutage schon ohne Studium? Hilfsarbeiter, nichts weiter.«
»Nun, ganz so ist es wohl auch nicht«, sagte Daniel energisch. »Viele junge Menschen bringen es auch ohne Studium zu etwas.«
»Mir als Studiendirektor muss das widerfahren«, sagte Dr. Hartwig zornig. »So blamiert werde ich von meinem eigenen Sohn. Hunderte von Schülern habe ich zum Abitur gebracht und …«
»Manch einer wird es auch nicht geschafft haben«, fiel ihm Daniel unwillig ins Wort. »Ich habe auch mal auf der Schulbank gesessen, und in manchen Fächern hatte ich durchaus keine überwältigenden Noten. Aber ich bin nicht gekommen, um darüber mit Ihnen zu diskutieren. Ich wollte Ihnen nur sagen, wo Sie Axel finden können, um Sie aller Sorgen zu entheben. Guten Abend.«
Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss, aber draußen hörte er noch, wie Dr. Hartwig wütend sagte: »Das ist wieder ein neuer Trick von deinem Sohn, sich vor der Schule drücken zu wollen, Luise.« Und dann hörte er Frau Hartwig laut aufweinen.
Aber was konnte er hier ausrichten? Mit diesem Mann konnte man nicht vernünftig sprechen, wenigstens jetzt nicht. Daniel wusste nur zu gut, dass es viele solcher Väter gab, die sich an ihre eigene Jugend nicht mehr erinnern konnten oder wollten, oder die nie richtig jung gewesen waren.
Daniel dachte auch an seinen Vater, diesen sehr gütigen, verständnisvollen Mann, der als einzige Mahnung nur gesagt hatte: Du weißt, welchen Beruf du ergreifen willst, Daniel, und wenn du dir dieses Ziel vor Augen hältst, wirst du es auch schaffen. Er hatte es geschafft, weil so manche schlechte Benotung mit einer Aufmunterung zur Kenntnis genommen wurde, weil zweimal die Bemerkung, dass seine Versetzung wegen Mathematik und Französisch gefährdet sei, von seinem Vater mit einem leichten Stirnrunzeln gelesen wurde. »Dann musst du eben länger die Schulbank drücken, wenn du Arzt werden willst«, hatte er gesagt. Aber hatte auch hinzugefügt, dass diese beiden Fächer wohl nicht ausschlaggebend dafür wären, dass aus ihm doch ein guter Arzt werden könne.
Nein, ein Genie war er nicht gerade gewesen in den schwierigen Jahren zwischen vierzehn und sechzehn, aber dann hatte es bei ihm plötzlich geschnackelt, wie auch sein Vater wohlwollend feststellte. Aber unter dem ständigen Zwang, hinter dem Axel Hartwig die Schulzeit verbringen musste und in dauernder Angst gerügt zu werden, konnte sich ein junger Mensch nicht entfalten.
Guter Gott, wie viele Kinder brachten sich um, wie viele liefen von daheim weg, weil sie den Anforderungen nicht gewachsen waren, die an sie gestellt wurden. Junge, gesunde Menschen, die mit Güte und Verständnis wohl doch ihren Weg gefunden hätten, wenn sie sich in dem Augenblick allertiefster Verzweiflung nicht allein gelassen gefühlt hätten. Gab es denn etwas Schlimmeres als die Einsamkeit in tiefster Herzensnot? Wie wenige Menschen hatten denn schon die Kraft, mit allen Nöten fertig zu werden?
Nichts an Leid war Dr. Daniel Norden unbekannt geblieben, und manches Mal gab es auch Situationen, in denen er deprimiert war, weil er nicht mehr und nicht besser zu helfen vermochte. Aber er hatte seine Frau, die ihm alles war, Geliebte, Freundin, Gefährtin in allen Lebenslagen. Er war glücklich, als er Fee wieder in die Arme nehmen konnte.
»Es war ein langer Tag, Liebster«, sagte sie und küsste ihn zärtlich.
»Ein stürmischer«, sagte er.
»Man konnte es schon ein bisschen mit der Angst kriegen.« Wie viel Angst sie insgeheim wirklich um ihn gehabt hatte, zeigte sie nicht. Jetzt war er bei ihr. Der Sturm hatte sich gelegt. Der Regen klatschte noch immer an die Fenster, aber wohlige Wärme umfing sie und ein einladend gedeckter Tisch erwartete den geplagten Doktor.
Fee aß so spät nicht mehr. Es bekam ihr nicht. Sie musste nun ohnehin ein ganz hübsches Gewicht mit sich herumtragen. Doch ihr Gesicht hatte sich nicht verändert. Zart und schön war es wie das einer Madonna, von dem seidigen silberblonden Haar umflossen, durch das Daniel so gerne seine Finger gleiten ließ.
»Paps hat angerufen«, sagte sie. »Sie haben herrliches Wetter.«
»Herrliches Wetter?«, wiederholte Daniel staunend.
»Ja, an der Insel gehen wohl alle Stürme vorbei.« Fee lachte leise. »Dennoch kommt Paps morgen mit Anne. Ich habe ihn gewarnt, aber sie wollen es sich nicht entgehen lassen, ihren zweiten Enkel in der ersten Lebensstunde zu sehen.«
»Dann wird er sich aber ranhalten müssen«, sagte Daniel viel forscher, als ihm innerlich zumute war.
»Er wird schon pünktlich sein«, lächelte Fee.
»Dass du so gelassen bist«, stellte er kopfschüttelnd fest.
Ihr Lächeln vertiefte sich. »Es ist ja nicht das erste Mal, mein Schatz. Du wirst hoffentlich nicht enttäuscht sein, wenn es wieder ein Junge wird.«
Er beugte sich zu ihr und küsste sie. »Ich hätte wirklich lieber eine kleine Fee«, sagte er zärtlich.
»Die kann ja immer noch kommen. – Was hat sich denn heute getan?«, lenkte Fee ab.
Sie wollte an allem teilnehmen, was ihn tagsüber bewegte, und sie merkte auch sofort, dass er ihr etwas verschweigen wollte.
»Was ist passiert?«, fragte sie direkt, als er nach Ausflüchten suchte.
Er sprach von Martina, aber Fee winkte ab. »Das weiß ich alles. Ich habe vorhin mit Jenny telefoniert. Sie wollte wissen, ob Martina nach der Mandeloperation auf die Insel gebracht werden könnte.«
»Sonst hat sie nichts gesagt?«, fragte Daniel etwas skeptisch.
»Nein, sonst nichts. Aber das wirst du mir sagen. Ich spüre doch, dass dich etwas beschäftigt.«
Daniel seufzte tief. »Du kannst in mich hineinschauen«, sagte er.
»Das wird auch gut sein.«
Und so erfuhr sie es dann doch, was geschehen war, wenn auch ganz undramatisch. »Es hätte gar nichts Ernstliches passieren können«, sagte Daniel. »Man musste ja so langsam fahren.«
Fee blickte ihn nachdenklich an. »Aber nun hast du mal wieder ein
Problem«, meinte sie. »Du überlegst, wie dem Jungen geholfen werden könnte.«
»Dir brauche ich gar nichts zu sagen. Du weißt sowieso alles.« Er nahm ihre Hand und drückte seine Lippen in ihre Handfläche.
»Natürlich muss ihm geholfen werden«, sagte sie. »Genauso wie der kleinen Martina. Aber wir werden uns schon etwas einfallen lassen. Ich habe ja nächste Woche viel Zeit zum Nachdenken.«
Daniel legte einen Arm um sie und vergrub die Lippen in ihrem Haar. »Wann denkst du mal an dich, Feelein?«, fragte er.
»Liebe Güte, warum sollte ich das, wenn es so viel anderes zu denken gibt?«, fragte sie zurück. »Wenn es erst mal so weit ist, dass ich über mich nachdenke …«
»Du sollst an dich denken«, fiel er ihr ins Wort.
»Das ist doch fast das Gleiche. Wenn’s mal so weit ist, stelle ich nur fest, dass ich älter und älter werde, und wie schnell die Zeit vergeht. Und
das will ich nicht. Ich würde mich womöglich im Spiegel betrachten und meine Falten zählen und die grauen Haare, die sich mehr und mehr bemerkbar machen, und dann würden die Sorgen kommen, ob ich dir auch noch gefalle.«
»Dummerchen«, sagte er zärtlich.
Sie lachte ihn an. »Und ein Dummerchen möchte ich schon gar nicht sein, Daniel. Wir werden bald Eltern von zwei Kindern sein«, fuhr sie ernsthaft fort. »Wir können nur aus den Fehlern anderer lernen. Unsere Kinder sollen uns immer als ihre besten Freunde betrachten und immer Vertrauen zu uns haben.« Nachdenklich schwieg sie eine Weile. »Ich meine, dass ein Mann wie Dr. Hartwig seinem Beruf nicht gerecht wird. Ein Pädagoge muss Verständnis für die Jugend haben. Ich hatte Lehrer, die ich sehr mochte und andere, die mir zuwider waren.«
»Ich auch, Feelein.«
»Und es war doch so, dass wir die besten Leistungen brachten, wenn wir einen Lehrer mochten«, stellte sie fest.
»Genau. Und die schlechtesten Noten bekamen wie von denen, die wir nicht mochten.«
»An wem liegt es denn dann am meisten, wenn Kinder in der Schule versagen?«
»Schlimm, ja, am schlimmsten ist es, wenn der Vater ein schlechter Pädagoge ist. Aber wir wollen nicht wegreden, dass auch oft die Eltern schuld sind.«
»Wir wollen aber auch einräumen, dass Kinder manchmal ganz aus der Art schlagen können, was wir von unseren ja nicht erwarten wollen.«
»Bei der Mutter bestimmt nicht.«
»Bei dem Vater auch nicht«, sagte Fee innig.
Dann zuckte sie plötzlich zusammen, und gleich war Daniel ganz gegenwärtig und besorgt. »Ist es doch schon so weit?«, fragte er heiser.
»I wo, er strampelt nur so ungestüm«, erwiderte Fee beruhigend. »Er ist noch lebhafter als Danny. Da können wir uns auf was gefasst machen.«
»Sollten wir doch nicht besser in die Klinik fahren?«, erkundigte sich Daniel besorgt.
»Kommt gar nicht infrage. Ich möchte so lange wie möglich in meinem Bett schlafen.«
Und sie schlief in seinem Arm, an seiner Schulter ganz ruhig, während er auf jeden Atemzug lauschte und darüber nachdachte, was sein Leben ohne Fee ihm bedeuten würde.
Genauso wie Schorsch wäre es ihm wohl ergangen. Eine andere Frau hätte ihm nie das geben können, was Fee ihm gab. Es waren kaum Erinnerungen geblieben an jene Frauen, die seinen Weg gekreuzt hatten. Isabel war ihm eine gute Freundin gewesen, daran gab es nichts zu deuteln, aber das war sie auch heute noch als Frau von Jürgen Schoeller. Es war eine sehr distanzierte Freundschaft gewesen zwischen zwei Menschen, die miteinander reden konnten und sich nichts vorzuwerfen hatten. Aber die anderen flüchtigen Affären – du lieber Himmel, was bedeuteten die schon. Mit Liebe hatte dies doch alles nichts zu tun. Seine ganze unverbrauchte Liebe gehörte Fee. Nur ihr.
Mein Liebstes, mein Allerliebstes, dachte er, als ihm die Augen zufielen. Seine Lippen lagen an ihrer Stirn, und so müde er auch war, wurde ihm doch bewusst, dass er zwei Leben in seinem Arm hielt.
*
Geweckt wurden sie von Danny, bevor der Wecker läutete. Der Kleine kam hereingetrippelt und kletterte zu ihnen ins Bett.
»Auslafen«, verkündete er laut.
Fee war auf der Stelle munter, doch ein bisschen verwirrt blickte sie auf die Uhr.
Es war noch nicht mal sechs Uhr. »Du bist aber früh dran«, sagte sie leise. »Lass Papi schlafen.«
»Warum denn?«, fragte Danny.
Manche Worte konnte er schon ganz deutlich sagen, manche weniger.
Daniel gähnte. »Wie spät ist es?«, fragte er.
»Spät is es?«, wiederholte Danny.
»Jetzt ist es genau sechs Uhr«, erwiderte Fee.
»Warum bist du schon munter, Sohn?«, fragte Daniel.
»Warum munter?«, fragte Danny. »Hat kracht.«
»Was hat gekracht?«, fragte Daniel und richtete sich auf. Fee hatte das Licht angeknipst.
»Was hat kracht? Weiß nicht«, sagte Danny.
»Ich habe nichts gehört«, murmelte Fee, »aber ich schaue gleich mal nach.«
»Nichts da, du bleibst liegen. Ich schaue nach«, sagte Daniel.
»Betti hat kracht«, sagte Danny.
Wenig später konnte sich Daniel überzeugen, dass Dannys Bett sich als nicht sehr widerstandsfähig erwiesen hatte. Die Matratze hing schräg.
»Bein hat auch wehtan«, sagte Danny.
Sein Vater raufte sich die Haare. »Das ist doch das Letzte«, sagte er. »Da gibt man einen Haufen Geld aus für die Kindermöbel, und so ein Mist wird gebaut.«
»Mist«, echote Danny.
Besorgt untersuchte Fee indessen sein Bein, während Daniel schimpfte: »Die können was erleben. Was sind denn das für Idioten, die solche Betten herstellen!« Aber dann kam er schnell zu sich. »Reg du dich jetzt bloß nicht auf, Feelein.«
»Danny hat einen Bluterguss«, flüsterte sie beklommen. »Schau es dir an, Daniel.«
»Is nich slim«, sagte Danny und kuschelte sich in Fees Arm.
Er wiederholte es, als Daniel sein kleines Bein abtastete.
»Schlimm ist es, Gott sei gedankt, nicht«, sagte Daniel, »aber man kann doch so was nicht einfach hinnehmen. Was da alles passieren kann.« Er schimpfte immer noch vor sich hin, während er Dannys Bein mit einer Salbe leicht massierte, was dem Kleinen sehr gefiel.
»Kein wehweh«, sagte er, »Mist.«
So was merkte er sich gleich, aber weder Fee noch Daniel konnten darüber lachen. Gut, Danny wusste sich schon zu helfen, aber es gab auch kleinere Kinder, die noch nicht klettern konnten und vielleicht unglücklicher eingeklemmt wurden. Babys, deren Mütter notwendige Besorgungen machten, während sie ihre Kleinen schlafend glaubten, und über solches mussten sie jetzt nachdenken. Sie waren jedenfalls schnell munter geworden, und später tat Dannys Bein doch weh und war auch angeschwollen.
»Paps und Anne werden sich schön aufregen«, sagte Fee.
»Aber du darfst dich nicht aufregen, Liebes«, sagte Daniel. »Danny hat es bald wieder vergessen. Und ich werde mich mal mit den Fabrikanten von Kindermöbeln in Verbindung setzen. Mit den Wagen ist es doch dasselbe. Alles wird auf Schau gebaut.«
Er konnte sich nicht so schnell darüber beruhigen, als er dann das neugekaufte Bett eingehend untersuchte. Es hatte schon stabil ausgesehen, aber es wies viele, nicht ins Auge fallende Mängel auf, obgleich es gewiss kein billiges Bett gewesen war.
Lenni regte sich dann auch noch auf, weil ihr kleiner Liebling humpelte. Da wurde natürlich das Beinchen gestreichelt und gepustet und Heile-heile-Kätzchen gemacht. Und Danny hatte es furchtbar wichtig, immer wieder zu zeigen, an welcher Stelle sein Bein eingeklemmt worden war.
Er begriff noch nicht, warum sein Papi erregte Telefongespräche führte, nur darum, dass es um ihn ging.
»Danny hat nichts macht«, sagte er.
»Nein du hast daran keine Schuld, Schatzilein«, sagte Fee.
»Satzilein«, echote er und kuschelte sich in ihre Arme.
Dann hatte es Daniel mit massiven Drohungen erreicht, die man gar nicht von ihm gewohnt war, dass ein Mann von der Firma geschickt wurde, bei der sie das Bett gekauft hatten. Obgleich Samstag war und man ihm zuerst erklärt hatte, dass er sich gedulden müsse, hatte er das erreicht.
Fee zog sich mit dem Kleinen ins Spielzimmer zurück, als ein erregter Disput entbrannte, der sich aber rasch legte, denn Daniel erwies sich als der Stärkere und Logischere.
Und er hatte es mit einem jungen Mann zu tun, der auch Vater war, und der sich schnell seinen Argumenten beugte. Immerhin blieb die Tatsache, dass Danny sein immerhin schon recht kleines altes Bettchen für die nächsten Tage als Schlafstelle nehmen musste.
»Ich werde mal einen saftigen Artikel schreiben, wie Kindermöbel konstruiert sein müssen, dass sie nicht gleich auseinanderfallen«, sagte Daniel erzürnt.
»Erkundige dich aber lieber vorher bei einem Fachmann«, warf Fee mit sanfter Stimme ein. »Vom Schreinerhandwerk verstehen wir beide nicht viel.«
»Nur, dass man dauernd Ärger hat«, brummte er. »Es sind ja nicht nur die Kindermöbel. Schubladen klemmen, Türen schließen nicht richtig, na ja, ich will nicht den ganzen Tag schimpfen, aber ich werde mich mal mit Axel Hartwig unterhalten, für den Holz etwas Lebendiges ist.«
»Es ist ja auch lebendig«, sagte Fee. »Es arbeitet in sich, auch wenn es bereits verarbeitet ist. Das wird wohl nicht bedacht. Es ist der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, zieht sich zusammen und dehnt sich aus.«
»Und die Holzwürmer nicht zu vergessen«, sagte Daniel. »Aber du denkst noch viel mehr nach als ich. Was bist du doch gescheit.«
»So wild ist das nun auch wieder nicht. Ich habe mir nur auch meine Gedanken gemacht. Und ich habe auch wieder dazugelernt. Ich werde nicht mehr danach gehen, was hübsch ausschaut. Ich werde jedes Möbelstück, das ich für die Kinder kaufe, Kraftproben unterziehen.«
»Du kannst dich nicht in ein Kinderbett legen und strampeln«, sagte Daniel scherzend.
»Man wird sich noch wundern, was ich alles tun werde«, lächelte Fee.
Aber dann lösten sich ihre Probleme in Wohlgefallen, als Dr. Cornelius und seine Frau Anne kamen. Sie hatten nämlich für ihren geliebten Enkel Danny ein besonderes Geschenk mitgebracht.
Ahnungslos waren sie gewesen, dass Fee bereits ein Bett für Danny gekauft hatte. Über solche Dinge unterhielten sie sich am Telefon nicht, da es für sie Wichtigeres gab, was sie weit voneinander getrennt zu erörtern hatten. Und so kam dann ein neues Kinderbett ins Haus, von einem ländlichen Schreiner handgearbeitet und doch noch viel hübscher anzusehen als jenes, mit dem so viel Ärger bereitet worden war.
Wie stabil es war, wurde gleich ausprobiert, denn Daniel hockte sich persönlich hinein, zum Spaß für seinen Sohn.
Erst danach brachte man den Großeltern schonend bei, was sich am heutigen Morgen getan hatte.
»So was wird nicht wieder geschehen«, sagte Anne Cornelius, die in zweiter Ehe mit Fees Vater verheiratet war, aber sich ganz als Dannys Omi fühlte. »Bei uns gibt es noch richtige Handwerker, und die bauen keinen Mist.«
Danny sah seine heißgeliebte Omi staunend an.
Zärtlich nahm sie den Kleinen in ihre Arme. »Omi sagt auch manchmal solche Ausdrücke«, lächelte sie.
»Papi auch«, bestätigte Danny strahlend. »Mist, Mist. Bein nich’ mehr wehtut.«
»Und wie hast du den Schrecken in der Morgenstunde überstanden, Fee?«, fragte Dr. Cornelius.
»Ich bin ganz okay, Paps. Bis morgen werdet ihr euch bestimmt noch gedulden müssen.«
»Um so besser, dann können wir endlich mal wieder eine Partie Bridge mit euch spielen«, sagte Johannes Cornelius. »Schlafen wirst du heute Nacht sicher nicht mehr können, mein Mädchen.«
*
So war es denn auch. Danny allerdings schlief in seinem neuen Bett, nachdem er die Familie damit eine halbe Stunde in Atem gehalten hatte. Darin herumsprang, als wäre es ein Trampolin. Es hielt allen Versuchen stand, es zum Zusammenbrechen zu bringen, und die Erwachsenen waren dann sehr beruhigt.
Es wurde noch einige Zeit beim Abendessen diskutiert, und dann wurden die Karten geholt. Immer wieder wurde Fee allerdings gefragt, ob es ihr auch nicht zu viel würde, aber sie zeigte sich standhaft bis kurz nach Mitternacht.
»Ich hätte ja riesigen Appetit auf den Geflügelsalat«, sagte sie dann, »aber ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt doch in die Klinik fahren.«
»Du hast Nerven«, sagte Dr. Cornelius, während sein Schwiegersohn schon in Aufregung geriet.
»Vorhin hast du den Geflügelsalat verschmäht«, sagte Anne. »Ich habe ja nur ein Kind zur Welt gebracht, aber ganz gewiss hätte ich nicht die Nerven gehabt, so raffiniert Bridge zu spielen, wenn ich noch ein zweites bekommen hätte.« Mit diesen Worten wollte sie ihre innere Erregung überspielen, aber Fee lächelte nur gelassen.
»Es wird ein Junge«, sagte sie. »Ich habe mir gedacht, wenn wir verlieren, dann wird es doch ein Mädchen, aber wir haben gewonnen.« Ihr war wenig anzumerken. Sie ging noch einmal zu Danny und streichelte ihm zärtlich das Haar.
»Passt gut auf ihn auf«, sagte sie leise, eine jähe Welle aufsteigenden Wehenschmerzes unterdrückend. »Und passt auch auf, dass Daniel richtig isst.«
»Denk doch endlich mal an dich«, sagte Daniel. »Komm, mein Liebes.«
»Wie viel würde ich entbehren, wenn ich nur an mich denken würde«, sagte Fee. »Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich wieder daheim bin.«
Sie küsste Anne, sie küsste ihren Vater und dann legte ihr Daniel den Mantel um die Schultern und führte sie hinaus.
Anne standen Tränen in den Augen. »Sie ist so tapfer, Hannes«, flüsterte sie. »Und dabei ist sie doch so zerbrechlich.«
»Das scheint nur so«, sagte Johannes Cornelius heiser. »Es wird nun doch ein Sonntagskind. Du hast die Wette verloren, Anne.«
Noch nicht, dachte Anne, aber wie gern würde sie diese Wette, die in fröhlicher Stimmung mit ihrem Mann, Katja und David abgeschlossen worden war, verlieren, wenn nur alles ohne Komplikationen abging. Was bedeuteten fünf Flaschen Champagner, wenn man einem Ereignis entgegensah, dessen glückliches Ende immer im Ungewissen lag. Allzu viel konnte geschehen, was nicht vorauszusehen war.
»Du hast Angst, Anne«, sagte Johannes Cornelius.
»Ich kann es nicht leugnen«, gab sie zu. »Fee bedeutet mir so viel, Hannes. Es klingt vielleicht theatralisch, aber sie steht mir näher als Katja.«
»Aber warum?«, fragte er.
»Es ist schwer zu erklären. Vielleicht deshalb, weil Katja nur auf David eingestellt ist.«
»Sie sind doch öfter bei uns als Daniel und Fee«, wandte Johannes Cornelius ein. »Und du hast lange um Katja bangen müssen.«
Katja, Annes Tochter aus ihrer ersten Ehe, war durch ein Lawinenunglück Monate an den Rollstuhl gefesselt gewesen. Durch ihre Liebe zu dem berühmten jungen Pianisten David Delorme war sie geheilt worden von dem Schock, den sie erlitten hatte. Diese Liebe erwies sich allen gegenteiligen Prognosen zum Trotz als dauerhaft, und seit Monaten waren David und Katja ein glückliches Ehepaar. Öfter als Daniel und Fee weilten sie auf der Insel der Hoffnung, auf der sie sich kennen- und liebengelernt hatten, aber ihr Leben verlief doch in ganz anderen Bahnen als das von Daniel und Fee. Sie waren zum glanzvollen Mittelpunkt einer Gesellschaft geworden, mit der weder Johannes Cornelius und Anne, noch Daniel und Fee Norden etwas gemein hatten.
»Ich habe um Katja gebangt, solange sie mich brauchte, Hannes«, sagte Anne, »aber jetzt braucht sie mich nicht mehr.«
»Sie ist glücklich in ihrer Welt«, sagte Johannes Cornelius. »Gönnen wir ihr dieses Glück. Fee ist in ihrer Welt auch glücklich.«
»Aber diese Welt steht uns näher, Hannes. Und sie ist deine Tochter. Ich liebe sie so sehr, weil sie dir so ähnlich ist.«
Es war wohl die schönste Liebeserklärung, die ein Mann in reifen Jahren gesagt bekommen konnte, und dennoch empfand Johannes Cornelius dabei kein überströmendes Glück.
»Ich liebe Katja genauso wie Fee«, erwiderte er. »Deshalb, weil sie so unbeschwert jung und froh sein kann, Anne. Wir werden, wenn sie ein Baby bekommt, um sie genauso zittern, wie jetzt um Fee. Wir werden die gleichen Ängste haben, glaube es mir.«
»Meinst du nicht, dass sie sich mit der Zeit nicht immer weiter von uns entfernen werden, Hannes?«
Ein flüchtiges Lächeln legte sich um seinen Mund. »Wir wollen doch nicht so vermessen sein, nur Ärzte in der Familie zu haben, Anne. Für einen Künstler ist es wichtig, wenn er im Licht der Öffentlichkeit steht, für einen Arzt finde ich das nicht so gut. Ein Künstler braucht den Applaus, für einen Arzt darf solcher nicht wichtig oder erstrebenswert sein. Womit ich nicht sagen will, dass überragende medizinische Erfolge stillschweigend übergangen werden dürfen.«
Er dachte zurück an den Tag, als Anne, damals war sie noch nicht seine Frau, ihre Tochter Katja im Rollstuhl zur Insel der Hoffnung gebracht hatte.
Fast aussichtslos schien eine Heilung, um die sich schon berühmte Ärzte bemüht hatten. Anfangs war er auch manchmal nahe der Resignation gewesen, weil sie kaum Fortschritte machte, bis dann David Delorme auf die Insel kam. David hatte Katja mit seinem Klavierspiel verzaubert, und die Liebe zu ihm hatte ihr dann ungeahnte Willenskräfte verliehen. Wo ärztliche Kunst zu versagen drohte, hatte diese Liebe geholfen.
»Haben wir nicht gebangt, dass Katja von David enttäuscht werden könnte?«, fragte Johannes Cornelius leise, »fürchteten wir nicht, dass sein Erfolg ihn die kleine Katja vergessen lässt? Was machst du dir nur für Gedanken, Anne? Sie werden uns innerlich immer verbunden bleiben.«
Schlafen konnten sie jetzt ohnehin nicht, also redeten sie, um das bange Warten zu verkürzen. Dass Daniel in der Klinik bleiben würde, wussten sie.
*
Schwester Claudia hatte Nachtdienst, und Dr. Leitner war rasch zur Stelle, als ihm telefonisch Bescheid gegeben wurde, dass Daniel seine Frau brachte.
Fee zeigte noch immer eine fröhliche Miene, obwohl es ihr schon recht mulmig war. Es war alles in allem doch ganz anders als bei Dannys Geburt. Vielleicht kam es ihr nur so vor, dass die Wehen viel schmerzhafter waren.
Die Hebammenschwester Rosi, die auch bei Dannys Geburt geholfen hatte, war auch aus dem Schlaf geholt worden.
»Diesmal dauert es länger«, sagte Fee zu ihr, als sie ein paar Minuten allein waren.
»Es ist nicht immer so, dass das zweite Kind schneller kommt«, meinte Rosi, »aber allzu lange werden wir wohl nicht warten müssen. Pünktlich am Sonntag wird es auf jeden Fall sein.«
Rosi war eine resolute Person, aber mit Fee Norden ging sie doch recht sanft um, aber diesmal brauchte Daniel nicht in die Sprechstunde. Er erlebte die Stunden der Geburt mit, in der die Wehen kamen und manchmal auch minutenlang, was ihm wie Ewigkeiten dünkte, ausblieben.
»Das wird schon so ein Langweiler sein«, murmelte Fee erschöpft, als der Uhrzeiger auf die Sechs rückte. Daniel wurde es bewusst, dass sie nun bereits durch Dannys Missgeschick mit dem Bett seit vierundzwanzig Stunden nicht mehr geschlafen hatten.
Aber er konnte sich nicht mehr lange den Kopf zerbrechen, dass dies für Fee einfach zu viel sein könnte, denn nun ging alles plötzlich sehr schnell, und schon eine Viertelstunde später meldete sich sein zweiter Sohn mit kräftigem Gebrüll.
»Jesses, der hat vielleicht eine Stimme, so was habe ich noch nicht gehört«, sagte Schwester Rosi.
Claudia, immer zur Hilfe bereit, war im Geburtszimmer geblieben. Aber sie hatte sich ganz schweigend verhalten und sagte andächtig:
»Lieber Gott, ist der niedlich. Es ist das erste Mal, dass ich bei einer Geburt dabei war.«
»Dafür haben Sie sich aber tapfer gehalten«, stellte Dr. Leitner fest.
Daniel brachte kein Wort über die Lippen. Er küsste die Hände seiner Frau, tupfte ihr Gesicht mit einem feuchten Tuch ab und küsste dann auch ihre blassen Lippen.
»Du bist vielleicht ein Brocken«, flüsterte sie, als sie ihren zweiten Sohn betrachtete, dann fielen ihr die Augen zu. Es war doch ein bisschen viel für sie gewesen.
Mehr als sieben Pfund brachte Felix auf die Waage, und mit seinen dreiundfünfzig Zentimetern war er auch einen Zentimeter länger als sein »großer« Bruder gewesen war.
»Hoffentlich wächst er Danny nicht sobald über den Kopf«, sagte Daniel, als er sich halbwegs erholt hatte. »Jetzt muss ich aber daheim anrufen. Hannes und Anne können bestimmt auch nicht schlafen.«
»Wie wäre es denn, wenn du heimfahren und dich richtig ausschlafen würdest?«, fragte Schorsch.
»Wie wäre es denn, wenn du mir ein Lager zur Verfügung stellen würdest, damit ich halbwegs fit bin, wenn Fee erwacht?«
»Das kannst du auch haben, aber was wird Danny sagen, wenn weder Mami noch Papi zu Hause sind?«
»Omi und Opi werden es ihm schon erklären«, erwiderte Daniel. »Ich möchte bei Fee sein, wenn sie aufwacht.«
Der kleine Felix schlief längst dem werdenden Tag entgegen, als auch seinem Vater die brennenden Augen endlich zufielen. Jetzt langt es erst mal für die nächsten paar Jahre, dachte Daniel noch.
»Wollen Sie sich nicht auch noch ein paar Stunden niederlegen, Herr Doktor?«, fragte Schwester Claudia ihn.
Dr. Leitner schüttelte verneinend den Kopf.
»Ich möchte Fees Kreislauf kontrollieren«, sagte er. »Manches hat mir gar nicht gefallen.«
Erschrocken sah Claudia ihn an. »Es bestand doch keine Gefahr«, flüsterte sie.
»Nicht direkt, aber ihre erste Geburt war sehr viel leichter, und wenn sie so vergnügt daherkommt, meint man eben nicht, dass Komplikationen auftreten können.«
»Vielleicht hat sich Frau Norden wegen des Bettchens doch mehr aufgeregt, als sie zugeben wollte«, sagte Claudia nachdenklich.
»Wegen welchen Bettchens?«, fragte Dr. Leitner erstaunt.
»Sie hat es mir erzählt, während Sie sich draußen mit Dr. Norden unterhielten.« Nun erfuhr es Dr. Leitner auch aus ihrem Munde.
»Das musste auch noch passieren«, sagte er. »Ja, ganz gewiss hat ihr das einen Schrecken eingejagt, und ich kann mir vorstellen, wie Daniel geschimpft hat. Fee besitzt fast zu viel Selbstbeherrschung. In solchen Fällen ist es immer besser, wenn man auch mal wütend wird.«
»Sie habe ich auch noch nicht wütend gesehen«, sagte Claudia. »Und wahrhaftig hat es doch manche Anlässe gegeben, wo ein anderer aus der Haut gefahren wäre.«
Recht hatte sie, aber er gehörte halt auch zu denen, die alles hinunterschluckten.
Nun hielten sie gemeinsam Wache bei Fee, und sie konnten sich dabei unterhalten, denn der Morgenbetrieb in der Klinik hatte begonnen und Claudias Ablösung war längst zur Stelle.
Gedankenverloren erzählte Dr. Leitner von seiner langen Freundschaft mit Daniel Norden und Dieter Behnisch, wie die Jahre nach dem Studium sie auseinandergetrieben und dann wieder zueinandergeführt hatte, nachdem jeder von ihnen schon seine eigenen Erfahrungen gesammelt hatte. Und er erzählte von der Insel der Hoffnung.
»Wir möchten Martina dorthin bringen, wenn die Mandeln heraus sind«, sagte er.
»Es klingt vielversprechend«, sagte Claudia leise, »aber sie müsste sich wieder an Fremde gewöhnen. Ich weiß nicht …«
Sie unterbrach sich und ließ ihren Blick in die Ferne schweifen.
»Dr. Cornelius und seine Frau Anne sind hier, und sie würden bestimmt nichts dagegen einwenden, hier mit Martina zu sprechen, wie ich sie kenne. Es gibt noch wahre Menschenfreunde, Claudia.«
»Ich habe jetzt schon einen kennengelernt«, erwiderte sie voller Wärme und schenkte ihm einen dankbaren Blick.
»Was tue ich denn schon? Das ist doch selbstverständlich«, sagte Dr. Leitner verlegen.
»Selbstverständlich? O nein, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht.«
»Sie haben zu bittere Erfahrungen gemacht in sehr jungen Jahren. Sie haben Ihre Sorgen mit sich allein herumgeschleppt, das brauchen Sie nun nicht mehr. Ich hoffe, dass Sie mir auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken, auch wenn wir bei Martina nicht zu einem raschen Erfolg kommen.«
»Ich kann doch jetzt wirklich nur hoffen«, sagte Claudia. »Darauf hoffen, dass sie sich doch einmal im Leben zurechtfinden kann. Ich bin so dankbar für die Hilfe.«
»Sie dürfen nicht immer von Dank sprechen. Ich bin auch dankbar für Ihre tüchtige Hilfe. Sie machen nun schon zwei Stunden über die Zeit Dienst. Das darf ich gar nicht zulassen.«
»Das tue ich doch freiwillig und sehr gern.« Sie warf einen langen Blick auf Fee. »Und ich glaube, der jungen Mutter geht es nun schon wieder etwas besser.«
Fee blinzelte. »Wo ist mein Baby«, murmelte sie im Halbschlummer.
Dr. Leitner trat an ihr Bett. »Du wirst es bald sehen, Fee«, sagte er weich.
»Ist es gesund? Ich habe gar nichts mehr richtig mitbekommen.«
»Pumperlgesund ist er«, sagte Dr. Leitner, »und Daniel wird auch gleich bei dir sein.«
»Wie spät ist es denn?«, fragte Fee.
»Bald neun Uhr, und dein Sohn ist fast drei Stunden alt.«
»Neun Uhr?«, fragte sie ungläubig.
»Und es ist ein Sonntagskind«, sagte Schorsch lächelnd und küsste ihr die Hand. »Nochmals alles Glück für euch, Fee.«
Ob er sie liebt, fragte sich Claudia. Niemals hatte sie seine Stimme so weich und zärtlich gehört, und sie hatte sich manches Mal den Kopf zerbrochen, ob Dr. Leitner, Hans-Georg Leitner, wie er mit vollem Namen hieß, an einer unglücklichen Liebe litt.
Wenn diese Fee Norden gehörte, musste man ihn bewundern wegen seiner Selbstlosigkeit, zu der gewiss wenig Männer fähig waren.