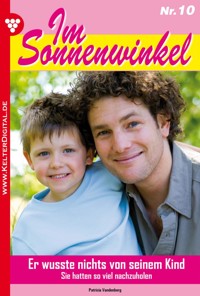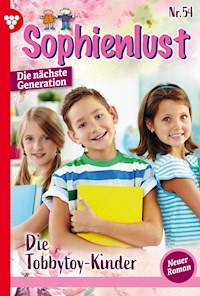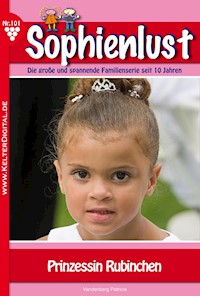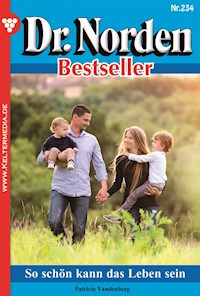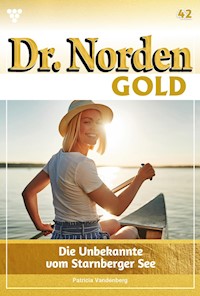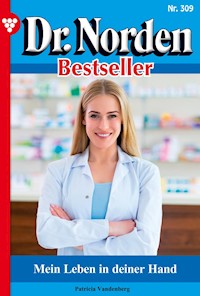Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dr. Norden Digital
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
"Du hast schon wieder den Schlüssel stecken gelassen", beschwerte sich Roger Feldmann ohne Umwege bei seiner Frau, als sie ihm die Tür öffnete. "So kann ich natürlich nicht aufschließen", fügte er statt einer Begrüßung schlecht gelaunt hinzu. "Tut mir leid. Im Haus war das anders. Da sperrte das Schloß trotz steckendem Schlüssel", verteidigte sich Debora halbherzig und wartete auf den Begrüßungskuß ihres Mannes. Doch Roger war schon an ihr vorbeigegangen und bückte sich eben, um die Siamkatze Cleopatra zärtlich zu begrüßen. "Na, meine schöne Cleo, wie geht es dir heute? Hast du was Schönes zu fressen bekommen, wenn du hier schon keine Mäuse jagen kannst?" sprach er mit dem schnurrenden Tier, als hätte er es mit einem Menschen zu tun. "Als ob dieses verwöhnte Biest in Solln jemals eine Maus gejagt geschweige denn gefressen hätte", erwähnte Debora beiläufig. "Was ist eigentlich mit meiner Begrüßung?" Noch immer stand sie an der Tür und sah gelinde enttäuscht auf ihren Mann hinab. Als hätte er sie nicht gehört, überging Roger diese Bemerkung. "War das ein anstrengender Tag heute", seufzte er, stupste die Katze auf die samtweiche Nase und erhob sich. Versöhnlich gestimmte kam Debora auf ihren Mann zu und legte die Arme um seinen Hals.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Norden Digital – 1 –
Versöhnung auf Raten
Was hält Debora an diesem Mann?
Patricia Vandenberg
»Du hast schon wieder den Schlüssel stecken gelassen«, beschwerte sich Roger Feldmann ohne Umwege bei seiner Frau, als sie ihm die Tür öffnete. »So kann ich natürlich nicht aufschließen«, fügte er statt einer Begrüßung schlecht gelaunt hinzu.
»Tut mir leid. Im Haus war das anders. Da sperrte das Schloß trotz steckendem Schlüssel«, verteidigte sich Debora halbherzig und wartete auf den Begrüßungskuß ihres Mannes. Doch Roger war schon an ihr vorbeigegangen und bückte sich eben, um die Siamkatze Cleopatra zärtlich zu begrüßen.
»Na, meine schöne Cleo, wie geht es dir heute? Hast du was Schönes zu fressen bekommen, wenn du hier schon keine Mäuse jagen kannst?« sprach er mit dem schnurrenden Tier, als hätte er es mit einem Menschen zu tun.
»Als ob dieses verwöhnte Biest in Solln jemals eine Maus gejagt geschweige denn gefressen hätte«, erwähnte Debora beiläufig. »Was ist eigentlich mit meiner Begrüßung?«
Noch immer stand sie an der Tür und sah gelinde enttäuscht auf ihren Mann hinab.
Als hätte er sie nicht gehört, überging Roger diese Bemerkung.
»War das ein anstrengender Tag heute«, seufzte er, stupste die Katze auf die samtweiche Nase und erhob sich. Versöhnlich gestimmte kam Debora auf ihren Mann zu und legte die Arme um seinen Hals.
»Möchtest du etwas essen? Ich habe Schmorbraten gemacht, dein Leibgericht.«
»Tut mir leid, ich muß gleich wieder fort, Lagebesprechung in der Firma«, entschuldigte sich Roger und drängte sich an Debora vorbei in das winzige Schlafzimmer, um sich umzuziehen. »Ein Elend, wie eng es hier ist«, schimpfte er ungehalten, als er dabei einen Blumentopf vom Fensterbrett wischte, der klirrend auf dem Boden zerbrach.
»Jetzt sieh dir diesen Dreck an!« entfuhr es Debora vorwurfsvoll. Sie warf einen verzweifelten Blick auf den feuchten Erdfleck, der sich auf dem hellen Boden ausbreitete. »Wie soll ich das jemals wieder herausbekommen?«
»Du hast doch sonst den ganzen Tag nichts zu tun«, tönte Rogers Stimme aus dem Nebenzimmer. »Das wirst du gerade noch schaffen.«
Deprimiert stand Debora mit gesenktem Kopf vor den Scherben. Eine blonde Strähne fiel ihr ins Gesicht, die sie traurig nach hinten strich.
»Als wir noch im Haus wohnten, hatte ich wirklich genug zu tun damit, es in Ordnung zu halten. Und der große Garten war ja auch viel Arbeit.«
Roger hatte sich inzwischen umgezogen und erschien in der Schiebetür, die das Schlafzimmer vom Wohn- und Eßbereich mit der Küchennische trennte. Er band sich die Krawatte, während er seine Frau prüfend ansah.
»Wann begreifst du endlich, daß das Haus nach dem Wasserschaden abbruchreif ist? Diese Zeiten sind erstmal vorbei. Bis die Versicherung den Schaden beglichen und ich genügend Geld verdient habe, bis wir uns ein neues Anwesen leisten können, wird noch einige Zeit ins Land gehen. So lange wirst du dich mit dieser Situation arrangieren müssen«, erklärte er ihr mit einer unterdrückten Ungeduld in der Stimme, während er seine Frau mißbilligend musterte. »Du solltest dir wirklich überlegen, ob du dir nicht einen Job suchen willst. Erstens bist du dann nicht mehr so unzufrieden und gehst mir mit deinem ständigen Gemecker auf die Nerven, und zweitens könnten wir unsere Träume mit einem zweiten Gehalt schneller erfüllen.«
Debora meinte, nicht richtig gehört zu haben. Sie starrte ihren Mann fassungslos an.
»Aber du warst es doch immer, der behauptet hat, seine Frau müsse nicht arbeiten gehen!« erklärte sie überrascht. »Du hast darauf bestanden, daß ich mich um Haus und Garten kümmere und ausschließlich für dein Wohlbefinden zuständig bin.«
Als er das hörte, machte Roger eine wegwerfende Handbewegung und zog sein Sakko über.
»Daß du immer so unbeweglich sein mußt. Das ist doch nicht zeitgerecht, mein Schatz. Flexibilität heißt das Zauberwort. Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder in den Modellen verharrt, die für eine bestimmte Zeit gültig waren? Das würde Stillstand in jeder Hinsicht bedeuten. Und, wie sehe ich aus?« ließ er das Thema jedoch fallen, noch ehe Debora sich gegen diese Anschuldigung wehren konnte.
»Sehr gut, wie immer«, antwortete sie wahrheitsgemäß und wollte sich an ihn schmiegen, als das Telefon klingelte.
»Tust du mir einen Gefallen und gehst ran?« bat Roger, der sich aufs Bett setzte, um die Schuhe anzuziehen.
Obwohl sie große Sehnsucht nach Wärme, Geborgenheit hatte, erfüllte Debora selbstverständlich diesen Wunsch.
»Schon wieder diese Evelyn Schuster«, erklärte sie gleich darauf irritiert und reichte ihm den Hörer. »Hast du sie nicht noch vor einer halben Stunde im Büro gesehen?«
Doch Roger achtete gar nicht auf den Kommentar seiner Frau. Ein strahlendes Lächeln verzog seine vollen Lippen.
»Evi, gut, daß du anrufst. Ich brauche unbedingt deine Meinung zu den Plänen für das Bürogebäude in der..., bevor ich sie Karlsen heute abend präsentiere.«
Debora hielt die Luft an, als sie das hörte. Sie konnte ihren Mann nicht aus den Augen lassen, während ein tiefer Schmerz durch ihr Herz schnitt. Gleichzeitig beobachtete sie, wie sich Rogers Miene entspannte. »Wunderbar, daß du derselben Meinung bist wie ich. Wir sind wirklich ein hervorragendes Team. Bis später dann. Ich freue mich!« erklärte er noch und beendete das Telefonat zufrieden.
Ohne Debora eines Blickes zu würdigen, gab er ihr den Hörer zurück, um seine Schuhe weiterzubinden.
»Früher hast du mir die Pläne für die neuen Gebäude gezeigt und mich um meine Meinung gebeten«, wagte Debbie eine leise Bemerkung.
Roger sah noch nicht einmal auf sondern lachte nur rauh.
»Herzchen, Evelyn ist Hochbauingenieurin wie ich und ein absoluter Profi auf ihrem Gebiet. Du wirst doch verstehen, daß sie erheblich kompetenter ist als du als gelernte Hotelfachfrau.«
»Früher warst du stolz auf meine Fähigkeiten. Immerhin habe ich die Schule mit Auszeichnung abgeschlossen. Damals waren wir auch noch ein gutes Team«, beharrte Debora trotzig.
»Daß du immer in der Vergangenheit leben mußt, Schätzchen«, kritisierte Roger noch einmal milde lächelnd und erhob sich. Als er sich diesmal an Debora vorbeidrängte, drückte er ihr einen Kuß auf die Stirn. »Warte nicht auf mich, es wird spät heute.«
Debora sah ihren Mann fragend an. Dieser Blick verunsicherte Roger.
»Was ist? Warum schaust du mich so an? Stimmt was nicht mit meiner Frisur?« Unsicher fuhr er sich mit der Hand durch das hellbraune Haar.
»Hast du was mit ihr?« kam statt einer Antwort eine überraschende Frage.
Roger zuckte zusammen und sah seine Frau an. Als er die Unsicherheit in ihren blauen Augen entdeckte, lachte er spöttisch.
»Wie bitte? Wir sind Arbeitskollegen und bearbeiten gemeinsam ein wichtiges Projekt. Jetzt erzähl mir bloß nicht, du bist eifersüchtig.«
»Warum ruft sie so oft an, wenn es nur ums Geschäft geht? Ihr seht euch doch den ganzen Tag. Und war nicht erst gestern eine Präsentation?«
»Glaubst du, wir haben nur ein einziges Projekt zu besprechen?« fragte Roger etwas ungehalten. »Herzchen, du solltest dir wirklich eine Arbeit suchen. Du hast viel zuviel Zeit, dir Gedanken und Sorgen zu machen.« Damit winkte er ihr zu, drehte sich um und stieß sich den Kopf an der Garderobe. »So ein Mist!« fluchte Roger. »Es wird Zeit, daß wir uns endlich wieder eine größere Bleibe leisten können.«
Mit der einen Hand rieb er sich die Stirn, während er sich mit der anderen ein paar Rollen unter den Arm klemmte und die Wohnung ohne ein Wort des Abschieds verließ. Laut krachend fiel die Tür ins Schloß und Debora zuckte zusammen, als die Katze schnurrend um ihre Beine strich.
»Tja, Cleo, so schnell landet man auf dem Abstellgleis. Das hättest du nicht gedacht, was?« Doch alles, was sie von der Katze bekam, war ein mißtrauischer Blick aus den hellblauen Augen. Sie hatten sich noch nie leiden können, und so verzog sich jede der beiden wie nach einer stillschweigenden Vereinbarung in eine andere Ecke der kleinen Wohnung, um sich nur ja aus dem Weg zu gehen.
In sich gekehrt wanderte Dr. Jenny Behnisch an der Seite ihres langjährigen Freundes und Kollegen Dr. Daniel Norden einen der langen, freundlichen Flure der Behnisch-Klinik hinunter.
»Auch wenn ein Leben erfüllt und womöglich glücklich war, ist es doch immer wieder berührend, wenn es zu Ende geht«, teilte sie schließlich ihre Gedanken mit dem Freund.
»Kann man glücklich sein, wenn man so einsam sterben muß wie Martin Kowatsch?« stellte Daniel eine berechtigte Frage.
»Manche Menschen sind anders strukturiert als du und ich. Sie lieben die Einsamkeit und Unabhängigkeit«, bemerkte Jenny schlicht.
Während Daniel sich an seinen Patienten Martin Kowatsch erinnerte, nickte er beifällig. Wenn er es recht bedachte, mußte er Jenny recht geben.
»Er war auch in der Praxis stets einsilbig und schweigsam. Deshalb war es auch nicht einfach, eine Diagnose zu stellen, um ihn überhaupt behandeln zu können«, seufzte er.
Jenny Behnisch sah ihren Freund von der Seite an.
»Du machst dir doch nicht etwa Vorwürfe, daß du ihn so spät in die Klinik geschickt hast?« fragte sie besorgt. »Solche Gedanken kannst du dir wirklich sparen. Dieser Mann war einfach alt und erschöpft. Seine Lebensuhr war abgelaufen. Der Tumor hat diesen Vorgang nur beschleunigt. Und ehrlich gesagt bin ich froh, daß wir nicht dazu gekommen sind, lebensverlängernde Maßnahmen einzuleiten. Das hätte ihm nur eine unnötige Verlängerung seines Leidens verschafft«, beruhigte sie Daniel.
»Ich weiß ja, daß du recht hast. Und es ist eine schöne Art zu sterben, wenn man ganz ruhig und friedlich einschlafen darf.« Eine Weile hing er seinen Gedanken noch nach. »Hat Herr Kowatsch denn gar keine Verwandten gehabt?« erkundigte sich Dr. Norden schließlich.
Jenny Behnisch zuckte mit den Schultern.
»Offenbar nicht. In der ganzen Zeit, die er hier in der Klinik war, hat er nur ein einziges Mal Besuch bekommen. Und das war der Notar, dem er seinen letzten Willen aufgetragen hat.«
»Wie so viele Leute ohne Familie wird Martin Kowatsch seinen Besitz vermutlich der Stadt oder irgendeiner Stiftung vererben. Wenn er denn überhaupt etwas besessen hat«, dachte Daniel Norden laut nach. »Einen Vorteil hat die Sache aber doch: zumindest ist keine Verwandtschaft da, die sich um den Nachlaß streiten kann. Solche Auseinandersetzungen gehören für mein Empfinden zu den geschmacklosesten Dingen, die sich nicht wenige unserer Mitmenschen zuschulden kommen lassen«, fügte er kritisch hinzu.
Und auch dazu konnte Jenny Behnisch etwas sagen.
»Fest steht auf jeden Fall, daß Martin Kowatsch nicht mittellos war. Den Schwestern hat er immer ein großzügiges Trinkgeld gegeben. Deshalb war er trotz seiner Schweigsamkeit äußerst beliebt«, erzählte sie, als die beiden Ärzte eilige Schritte hinter sich hörten. Inzwischen waren sie an Jennys Büro angelangt und sahen sich gleichzeitig interessiert um, wer ihnen da so aufgeregt folgte.
Es war ein kleiner, schmächtiger Herr mit grauem, schütterem Haar, einer Nickelbrille vor den flinken Augen und einem altmodischen Spitzbart. Sein ebenfalls grauer Mantel flatterte hinter ihm her, und Schweißperlen standen ihm auf der Stirn, als er atemlos vor Jenny Behnisch und Daniel Norden innehielt. Bevor er etwas sagte, zog er ein blütenweißes Stofftaschentuch aus seiner Tasche und betupfte sich damit die Stirn.
»Frau Dr. Behnisch, die Schwestern haben mir gesagt, Sie wären gerade auf dem Weg in Ihr Büro«, begrüßte er die Klinikchefin schließlich noch immer ein wenig atemlos von der ungewohnten Anstrengung.
Jenny hatte den Verfolger längst erkannt und streckte bedauernd die Hand aus.
»Herr Dr. Schwan, ich grüße Sie. Bitte kommen Sie doch herein«, ließ sie dem Notar den Vortritt in ihre Räume. »Ich wollte Sie eben telefonisch vom Ableben Ihres Mandanten in Kenntnis setzen.«
Nachdem sie die Tür geschlossen und allen einen Platz angeboten hatte, zögerte Jenny nicht lange, diese traurige, aber nicht überraschende Neuigkeit mitzuteilen. Doch Wolfgang Schwan war bereits im Bilde.
Er räusperte sich umständlich.
»Die Schwestern haben mich bereits unterrichtet«, erklärte er dann. Seine flinken, hellwachen Augen wanderten von Jenny Behnisch hinüber zu Dr. Daniel Norden. »Bitte machen Sie keine so traurigen Gesichter. Mein Mandant Martin Kowatsch fürchtete den Tod nicht. Er hat in seinem Leben viele Abenteuer bestanden und war der Erlebnisse überdrüssig.«
Daniel Norden zögerte nicht, dem Notar den Grund für seine Betroffenheit mitzuteilen, erntete dafür aber nur ein feines Lächeln.
»Obwohl er die Einsamkeit schon immer liebte, war Herr Kowatsch schon immer ein Menschenfreund. Deshalb wußte er die außerordentliche Zuwendung zu schätzen, die ihm durch die Ärzte und besonders durch Dr. Daniel Norden, in dessen Behandlung er sich längere Zeit befand, widerfahren ist«, erklärte er, ohne zu ahnen, daß eben dieser Dr. Norden vor ihm saß.
Jenny Behnisch kam nicht umhin, das Geheimnis zu lüften.
»Das hier ist Dr. Daniel Norden. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, Sie bekannt zu machen«, klärte sie den Notar auf.
Der nahm daraufhin seine Nickelbrille ab, putzte sie umständlich, setzte sie wieder auf und musterte Daniel schließlich wohlgefällig.
»Schade, daß ich seit langer Zeit einen Hausarzt habe. Aufgrund der Schilderungen meines Mandanten müßte ich eigentlich gleich zu Ihnen wechseln«, erklärte er dann schmunzelnd. »Herr Kowatsch hat sich selten so freundlich und aufmerksam behandelt und gut betreut gefühlt wie in Ihrer Praxis.« Doch beinahe sofort wandte sich Dr. Schwan an Jenny. »Keine Sorge, auch mit dem Service der Klinik war er überaus zufrieden. Das ist auch der Grund, warum er mich vor ein paar Tagen noch einmal herbestellt hat. Er hatte noch einige Änderungen im Testament zu machen.« Dr. Wolfgang Schwan hüstelte, ehe er fortfuhr. »Vor der offiziellen Testamentseröffnung muß ich selbstverständlich Stillschweigen bewahren. Damit mein Besuch in der Klinik aber nicht ganz umsonst ist, dachte ich mir, Sie könnten mir schon einmal Ihre Postanschrift mitteilen, damit ich die Ladungen ohne Umstände direkt verschicken kann.«
Diese Neuigkeit war nun doch eine echte Überraschung. Jenny und Daniel wechselten verwunderte Blicke, ehe sie dem Notar ihre jeweiligen Anschriften gaben. Als er mit den Notizen fertig war, klappte er sein Notizbuch zu und lächelte verschmitzt.
»Sie sind verwundert, das sehe ich Ihnen an. Und ich denke, Sie haben auch allen Grund dazu. Kennen Sie das Sprichwort ›Stille Wasser sind tief‹?« Nun, genau diese Eigenschaft traf auf meinen Mandanten zu, den ich mit Fug und Recht als meinen Freund bezeichnen darf.« Mit diesen rätselhaften Worten erhob sich Dr. Wolfgang Schwan und machte eine knappe Verbeugung, während er sich verabschiedete.