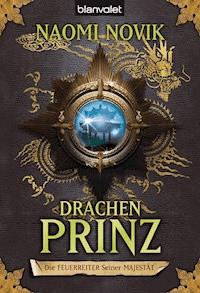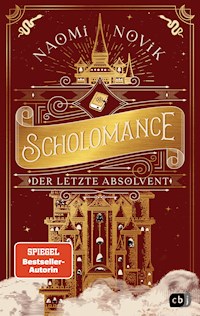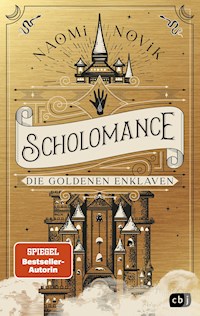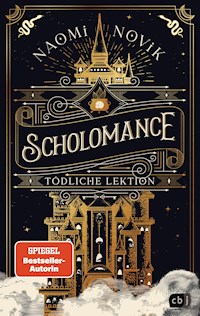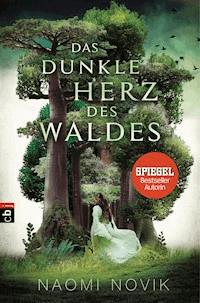8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Feuerreiter-Serie
- Sprache: Deutsch
Er vergaß den Freund, doch niemals ihre Freundschaft.
Nach einem Schiffsunglück hat Kapitän Will Laurence alles verloren. Doch sein größter Verlust ist ihm nicht einmal bewusst. Denn durch den Unfall hat er keine Erinnerung mehr an seine Zeit als Feuerreiter oder an seinen Drachen Temeraire. Allein muss er sich den Intrigen und Machtkämpfen der mächtigen Familien Japans stellen. Währenddessen reist Temeraire ohne seinen Kapitän nach Moskau, um die Stadt gegen das größte Heer, das die Welt je gesehen hat, zu verteidigen. Im Schatten des Kremls werden sich der Kapitän und sein Drache wiedersehen – und es wird sich herausstellen, ob es tiefere Bande gibt als bloße Erinnerungen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 820
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Naomi Novik
Drachenfeind
Die Feuerreiter Seiner Majestät 8
Roman
Deutsch von Marianne Schmidt
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel»Blood of Tyrants« bei Ballantine Books, an imprint of Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2013 by Naomi Novik
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by Penhaligon Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Redaktion: Werner Bauer
Lektorat: Holger Kappel
Herstellung: Sabine Müller
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-11792-4www.penhaligon.de
Für Cynthia Manson, meine wunderbare Agentin und Freundin, in großer Liebe und Dankbarkeit.
I
1
Wasser leckte am Salz auf den Wangen des Mannes …
Ein frisches, kühles Rinnsal hatte sich seinen Weg in die Sandkuhle gebahnt, in der ER mit dem Gesicht nach unten lag, und weckte allmählich SEINE Lebensgeister. Mit einiger Mühe rappelte ER sich auf Hände und Knie auf, erhob sich schwankend und taumelte am Ufer entlang, bis ER am Fuße einiger knorriger Kiefern, die den Rand des Strandes säumten, wieder zusammenbrach.
SEIN Mund war trocken und rissig, die Zunge geschwollen. Sand klebte überall an SEINEN Händen. Der Wind schnitt scharf durch die vollgesogene Wolle SEINES Mantels, den das viele Wasser schwarz wirken ließ. ER war barfuß. Langsam löste ER die Überreste eines Ledergeschirrs, das um SEINE Taille gebunden war: Die Schnallen und Schließen waren aus solidem Stahl, der noch immer glänzte, doch das Wasser hatte dem Rest schlimm zugesetzt, und ER ließ das Zeug achtlos in den Sand fallen. Den Waffengurt behielt ER jedoch um. Als ER die Klinge zog, sah ER, dass sie aus glänzendem Damaszenerstahl gefertigt war. Das Heft war mit schwarzer Rochenhaut umwickelt, und anstelle der Klingenzwinge prangte der goldene Kopf eines Drachen. Ohne dass bei IHM auch nur die geringste Erinnerung dämmerte, starrte ER den Degen an.
ER legte sich die Klinge über die Knie, lehnte sich gegen einen Baumstamm und dämmerte vor sich hin. Vor IHM breitete sich ein öder Ozean aus: Das Wasser war von kaltem Blau, der Himmel hellgrau. Dunkle Wolken verschwanden am östlichen Horizont. Es war, als wäre ER soeben hier im Sand neugeboren worden, denn ER fühlte sich leer und gottverlassen wie das Ufer vor IHM und konnte in sich keine Spur von Kraft oder eigener Geschichte entdecken; nicht einmal an SEINEN Namen konnte ER sich erinnern.
Irgendwann brachte IHN der Durst dazu, sich in Bewegung zu setzen; ansonsten hätte wohl kaum etwas die Macht gehabt, IHN wieder auf die Beine zu treiben. Hinter den wenigen Bäumen entdeckte ER eine gut ausgebaute Straße, die allen Anzeichen nach viel genutzt wurde, denn ER sah frische Wagenspuren und aufgeworfene Erde. Langsam und mechanisch setzte ER einen Fuß vor den anderen, bis ER ganz in der Nähe der Straße einen kleinen Bach entdeckte, der in Richtung Meer floss. Hier machte ER Halt. ER ließ sich auf alle viere sinken und schöpfte mit der einen Hand Wasser, führte sie zum Mund und trank gierig, bis ER allen Salzgeschmack fortgespült hatte, dann ließ ER das restliche kühle Nass von SEINEM Gesicht zurück in den Bach tropfen. Am Ufer spross bereits das erste Grün, obwohl der Boden noch kalt war. In der Luft hing der Geruch von Kiefernnadeln, und der Bach schoss gleichmäßig gurgelnd über die Steine – ein Klang, der sich mit dem Meeresrauschen in einiger Entfernung vereinte. Der Wind brachte salzigen Geruch mit sich …
Tief in seinem Innern verspürte ER ein quälendes, unbestimmtes Drängen, das ER nicht zu fassen bekam, das aber da war wie eine Last auf SEINEN Schultern. Langsam gab SEIN zitternder Arm, auf den ER sich stützte, nach, und ER sank an Ort und Stelle ins spärliche Gras und zurück in einen tiefen Dämmerzustand. In SEINEM Kopf dröhnte ein dumpfer Schmerz …
Als die Sonne höher stieg, wärmte sie SEINEN Mantel. Reisende zogen auf der nahe gelegenen Straße vorüber. Vage vernahm ER das Klirren von Pferdegeschirren und den Klang von Schritten, hin und wieder auch das Quietschen von Wagenrädern, doch niemand hielt an und kümmerte sich um IHN oder machte Rast am Bachufer. Eine kleine Gruppe von Männern passierte IHN, die fröhlich und laut in einer Sprache sangen, die ER nicht kannte. Schließlich näherte sich eine größere Reisegesellschaft, die vom vertrauten Knarzen einer altmodischen Sänfte begleitet wurde. Irgendwo in einem versteckten Winkel SEINES Geistes stieg das Bild einer älteren Frau auf, die von Bediensteten durch die Straßen – von London? – getragen wurde, doch kaum dass ER sich des Bildes bewusst wurde, war IHM klar, dass es nicht hierhergehörte.
Das Knarzen versiegte abrupt, und eine Stimme ertönte von der Sänfte: ein klarer, befehlsgewohnter Tenor. Normalerweise hätte IHN die Vorsicht dazu getrieben aufzuspringen, doch ER verfügte über keinerlei Kraftreserven mehr, und schon war jemand bei IHM, der IHN genauer in Augenschein nahm – vielleicht irgendein Diener? ER hatte flüchtig den Eindruck, dass es das Gesicht eines jungen Mannes war, der sich über IHN beugte, doch nicht so tief, dass ER es deutlicher hätte erkennen können.
Der Diener verharrte kurz, dann zog er sich rasch zu seinem Herrn zurück und sagte etwas mit einer klaren, jungen Stimme. Eine weitere Pause folgte, bis der Meister schließlich in einer wieder anderen Sprache antwortete, die ER zwar nicht benennen, aber trotzdem aus irgendeinem Grund verstehen konnte. Der sich hebende und senkende, musikalisch klingende Tonfall war IHM vertraut.
»Ich werde mich dem Willen des Himmels nicht verschließen. Reden Sie weiter.«
»Er ist Holländer«, erwiderte der Diener in derselben Sprache, und in jedem seiner Worte schwangen Vorbehalte mit.
Der, über den sie da sprachen, hätte den Kopf heben und etwas erwidern sollen – ER war kein Holländer, immerhin so viel war IHM klar –, aber ER fror, und SEINE Glieder wurden von Minute zu Minute schwerer.
»Meister, lassen Sie uns unseren Weg fortsetzen …«
»Genug«, unterbrach ihn die Tenorstimme zwar leise, doch keinen Widerspruch duldend.
ER hörte, wie in der IHM unvertrauten Sprache Befehle erteilt wurden, während sich SEIN Bewusstsein immer mehr trübte; Hände griffen nach IHM, und ER hieß ihre Wärme willkommen. Dann wurde ER vom Boden aufgehoben und in eine Decke oder ein Netz gewickelt, damit man IHN transportieren konnte. ER schaffte es nicht, die Augen zu öffnen, um sich umzuschauen. Die Reisegruppe setzte ihren Weg fort … ER selbst hing in der Luft und schwang sanft hin und her. Beinahe fühlte ER sich, als läge ER an Bord eines Schiffes in einer Hängematte und schaukelte im Takt der Wellen. Diese Bewegung lullte IHN ein, und SEIN Schmerz wurde schwächer; irgendwann bekam ER dann überhaupt nichts mehr mit.
Als ER endlich aus einem verworrenen Traum voller brennender Segel, einem sinkenden Schiff und einem unerklärlichen Gefühl tiefer Verzweiflung hochschreckte, schoss IHM unvermittelt, aber mit großer Gewissheit, SEIN eigener Name durch den Kopf, und ER sprach ihn laut aus: »William Laurence.«
Während ER, WILLIAM LAURENCE, sich mühsam aufsetzte, begann die Erinnerung jedoch bereits wieder zu verblassen …
… Er lag auf einer dünnen Decke, die man auf einem Fußboden ausgebreitet hatte, der mit geflochtenen Strohmatten ausgelegt war. Der Raum sah anders aus als alle, die Laurence je betreten hatte: Nur eine einzige der vier Wände bestand aus festem Holz; die anderen wurden von durchscheinendem weißen Papier gebildet, das in Holzrahmen eingespannt war. Es gab keine Anzeichen für eine Tür oder ein Fenster. Man hatte ihn, Laurence, offenkundig gebadet und ihm einen Umhang aus leichter Baumwolle übergestreift. Seine eigenen Kleidungsstücke waren verschwunden, ebenso sein Degen. Letzteres kam ihm eigentümlicherweise wie der größere Verlust vor.
Jeder Zeitvorstellung und jedes Ortsgefühls beraubt, war er ohne irgendeinen Bezugspunkt. Die Kammer mochte ebenso gut eine einsam gelegene Hütte wie ein Zimmer in der Mitte eines großen Hauses sein. Vielleicht befand er sich auf der Spitze eines Berges oder aber am Ufer eines Ozeans. Er hatte keine Ahnung, ob er eine Stunde, einen Tag oder eine ganze Woche dahingedämmert war.
Mit einem Mal zeichnete sich ein Schatten gegenüber seinem Lager auf der Wand ab, und als diese auf einer Schiene beiseitegeschoben wurde, fiel Laurence’ Blick für einen kurzen Moment in einen Flur und in einen anderen Raum dahinter, der gleichermaßen halb geöffnet war und sich von seinem eigenen Aufenthaltsort lediglich dadurch unterschied, dass ein Fenster den Blick auf einen dürren Kirschbaum mit kahlen, dunklen Ästen freigab. Ein junger, vielleicht sechzehnjähriger Mann, nicht sehr groß, aber schlaksig, als habe er in der letzten Zeit einen Schuss in die Höhe gemacht, schob sich durch die Öffnung und zwängte sich in den kleinen Raum mit der niedrigen Decke. Laurence starrte ihn mit ausdrucksloser Miene an. Der Bursche sah orientalisch aus. Sein langes, sorgfältig rasiertes Gesicht wirkte durch die letzten Überbleibsel von Babyspeck noch weich, zeigte jedoch bereits ein scharf geschnittenes Kinn. Die dunklen Haare hatte der junge Mann zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden, und er war in aufwendig arrangierte Umhänge gekleidet, deren Falten messerscharf hervorstachen.
Er ließ sich auf seine Fersen nieder und erwiderte Laurence’ Blick nicht weniger durchdringend, aber mit einem Gesichtsausdruck, der so düster wirkte, als sähe er sich einem Pestkranken gegenüber. Nach einem kurzen Moment setzte er zu sprechen an, und Laurence glaubte, die Stimme wiederzuerkennen. Dies war der junge Mann, der gewollt hatte, dass man ihn auf der Straße zurückließe.
»Ich habe nicht die geringste Ahnung, was Sie gerade zu mir sagen«, unterbrach ihn Laurence, und seine Stimme klang selbst in seinen eigenen Ohren heiser. Als er sich eilig räusperte, schoss ihm neuerlicher Schmerz durch den Schädel. »Sprechen Sie Englisch? Oder Französisch? Wo bin ich?« Er versuchte sein Glück mit den beiden genannten Sprachen, dann wiederholte er zögernd die letzte Frage in der anderen Sprache, die die beiden Männer auf der Straße verwendet hatten.
»Sie sind in der Provinz Chikuzen«, antwortete der Mann in gleicher Sprache, »und weit weg von Nagasaki, wie Sie nur zu gut wissen dürften.«
In seiner Stimme lag ein scharfer, bitterer Unterton, doch trotzdem hakte Laurence bei dem ersten vertraut klingenden Namen nach: »Nagasaki?« Er verspürte Erleichterung, aber das kurze Gefühl der Dankbarkeit verblasste rasch: Es gefiel ihm ganz und gar nicht, sich in Japan wiederzufinden, am anderen Ende der Welt, und nicht dort, wo er eigentlich gerade sein sollte.
Der junge Mann erwiderte nichts, und Laurence betrachtete ihn genauer. Er war zu alt für einen Pagen und trug außerdem ein Schwert an seinem Gürtel. Laurence konnte nur Vermutungen anstellen, ob es sich bei ihm vielleicht um irgendeine Art von Stallmeister oder um einen Edelknaben handelte. Auf jeden Fall gab er ihm, Laurence, nun mit einem knappen Wink zu verstehen, dass er sich von der Matte zu erheben habe.
Schwerfällig und unter einigen Schmerzen hievte Laurence sich von seinem Lager hoch. Die Decke war zu niedrig, als dass er sich hätte aufrichten können, und so war er gezwungen, wie eine Kröte den Rücken zu krümmen, was ihm Schmerzen in jedem nur denkbaren Muskel bereitete. Auf einen lauten Befehl des jungen Mannes hin erschienen zwei Diener, die die Matte, auf der er gelegen hatte, in ein Schränkchen räumten und Laurence frische Kleidung hinhielten, deren diverse Schichten und Lagen verwirrend für ihn waren. Obwohl ihm die beiden Dienstboten beim Anziehen halfen, fühlte er sich wie ein kleines Kind, dessen Arme und Beine hierhin und dorthin geschoben wurden, da sie ständig im Weg zu sein schienen. Anschließend brachte man Laurence ein Tablett mit Speisen: Reis, getrockneten Fisch, scharfe Brühe und eine beträchtliche Auswahl an ungewöhnlichem, eingelegtem Gemüse. Das war keinesfalls das Frühstück, das er sich für seinen angegriffenen Magen gewünscht hätte, doch kaum hatte man es vor ihm abgestellt, gewann der unbezwingbare Hunger in ihm die Oberhand. Laurence hatte schon beinahe die Hälfte seines Essens verschlungen, als er kurz innehielt und erstaunt die Essstäbchen begutachtete, die er, ohne nachzudenken, zur Hand genommen und benutzt hatte. Er zwang sich, langsamer weiterzukauen, als ihm eigentlich der Sinn danach stand, denn ihm war immer noch flau im Magen, außerdem störte es ihn, dass er beobachtet wurde. Der junge Mann ließ ihn während seiner gesamten Mahlzeit nicht aus den Augen und hielt seinen kalten Blick unverwandt auf ihn gerichtet. »Vielen Dank«, sagte Laurence endlich, als er fertig war und das Geschirr schweigend und flink fortgeschafft wurde. »Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie Ihrem Herrn meinen Dank für seine Gastfreundschaft ausrichten könnten und ihm sagen würden, wie froh ich über eine Gelegenheit wäre, ihm seine Großzügigkeit zu vergelten.«
Der junge Mann erwiderte nichts, sondern presste lediglich seine Lippen aufeinander. »Hier entlang«, sagte er dann kurz angebunden. Laurence vermutete, dass er selbst wie ein gewöhnlicher Landstreicher ausgesehen hatte, als man ihn fand.
Die Flurdecken des Hauses hingen nicht ganz so niedrig wie die in den Kammern. Laurence folgte dem jungen Mann zu einem Hinterzimmer, in dem eine Art niedriges Schreibpult auf dem Boden stand. Dahinter saß ein weiterer Mann, der geschickt mit Pinsel und Tinte zugange war. Seine Stirn und der Rest seines Schädels waren kahl geschoren, abgesehen von einer dicken Haarsträhne am Hinterkopf, die doppelt gelegt und fest zusammengebunden auf der rasierten Haut auflag. Seine Kleidung war reicher bestickt als die des jungen Mannes, ähnelte ihr aber im Stil. Der junge Bursche verbeugte sich von der Taille ab und sprach einige Sätze auf Japanisch, während er mit ausladenden Gesten auf Laurence deutete.
»Junichiro berichtet mir, dass Sie sich erholt haben, Holländer«, begann der Mann und legte seinen Pinsel beiseite. Über sein Pult hinweg musterte er Laurence mit einem Ausdruck förmlicher Zurückhaltung, aber ohne die Ablehnung, die der junge Mann – Junichiro? – an den Tag legte.
»Sir«, erwiderte Laurence. »Ich muss Sie berichtigen: Ich bin Engländer, Kapitän William Laurence von der …« Er stockte. An der Wand hinter dem Kopf des Mannes hing ein großer und polierter Bronzespiegel. Das Gesicht, das ihn daraus anblickte, war nicht nur ausgezehrt von den zurückliegenden Strapazen, sondern gänzlich unvertraut. Die Haare waren lang geworden, und quer über Laurence’ Wange lief eine weiße Narbe von einer längst verheilten Verwundung, an die er sich nicht mehr erinnerte. Die Furchen und die Zeichen der vergangenen Anstrengung summierten sich, und es hatte den Anschein, als sei er um Jahre gealtert, seitdem er sich das letzte Mal betrachtet hatte.
»Vielleicht wären Sie so freundlich, mir die genauen Umstände zu erläutern, die Sie in diesen Teil des Landes verschlagen haben«, half ihm der Mann.
Wie auswendig gelernt, schaffte es Laurence abzuspulen: »Ich bin Kapitän William Laurence von der Reliant, in der Königlichen Marine im Dienste Seiner Majestät. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich hierhergekommen sein könnte; es ist jedoch möglich, dass mein Schiff in Schwierigkeiten geraten ist; allerdings bete ich zu Gott, dass er etwas Derartiges verhütet hat.«
Laurence konnte sich kaum mehr daran erinnern, was er danach noch gesagt hatte. Er ging davon aus, dass den Männern seine Verwirrung und seine Verzweiflung nicht entgangen waren, denn die Befragung wurde abgebrochen, und man rief einen Diener, der eine Flasche und kleine Porzellantassen brachte, von denen Laurence’ Gastgeber eine füllte und ihm reichte. Laurence nahm sie entgegen, und als er mit geschlossenen Augen trank, war er dankbar für den intensiven Geschmack, der stark wie der von Brandy und dennoch leicht auf der Zunge war. Ihm wurde sofort nachgeschenkt, und wieder schüttete er das Getränk hinunter; das Gefäß war klein genug, um in einem Zug geleert zu werden. Danach jedoch stellte er die Tasse ab. »Ich muss um Verzeihung bitten«, setzte er an, und hatte das beschämende Gefühl, die Kontrolle über sich selbst verloren zu haben. Die Tatsache, dass die Männer mit ausgesuchter Höflichkeit vorgaben, es nicht zu bemerken, machte die Sache nicht besser. »Ich bitte um Verzeihung, Sir«, wiederholte er mit festerer Stimme. »Um auf Ihre Frage zu antworten: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich hierhergekommen bin. Die einzig logische Erklärung ist, dass ich über Bord gespült worden bin. Ansonsten gäbe es für mich keinen plausiblen Grund, hier zu sein. Ich habe weder einen Auftrag noch Freunde in diesem Teil der Welt.«
Er zögerte, denn auch wenn ihm nichts anderes übrig blieb, so fühlte er sich doch als Bittsteller. Aber er musste seinen Stolz hinunterschlucken. »Ich bedauere, dass ich so kühn bin, Ihre Großzügigkeit noch weiterzustrapazieren«, sagte er, »und das, obwohl Sie sich mir gegenüber bereits mehr als freundlich gezeigt haben. Aber ich wäre froh, sogar außerordentlich froh, wenn Sie mir dabei behilflich sein könnten, nach Nagasaki zu gelangen, um dort mein Schiff wiederzufinden oder bei einem anderen an Bord zu gehen, das mich zurück nach England bringen könnte.«
Doch sein Gastgeber blieb ihm eine Antwort lange schuldig. Endlich sagte er: »Sie sind noch zu krank für die Härte und Unbilden einer langen Reise, denke ich. Für den Augenblick gestatten Sie mir, Sie einzuladen, die Gastfreundschaft meines Hauses zu genießen. Wenn Sie irgendetwas für Ihr Wohlbefinden benötigen, wird Junichiro alles Nötige veranlassen.«
So höflich und freundlich dieses Angebot auch war, es war eindeutig eine abschlägige Antwort auf Laurence’ Ansinnen. Schweigend trat Junichiro hinter ihn und wartete in Griffweite seines Ellbogens darauf, dass Laurence sich zurückzog. Dieser zögerte zwar, doch fehlte ihm die Kraft für weitere Diskussionen. In seinem Kopf dröhnte ein tiefes, dumpfes Klopfen wie der Klang von bloßen Füßen, die auf einem höher gelegenen Deck herumliefen, und der Alkohol hatte seine Sicht bereits zusätzlich vernebelt.
Er folgte Junichiro hinaus und den Gang hinunter zurück zu der kleinen Kammer, in der er aufgewacht war. Der junge Mann öffnete den Durchgang und blieb abwartend und mit einem harten, unfreundlichen Ausdruck auf dem Gesicht stehen. Den Blick hielt er starr auf eine Stelle hinter Laurence gerichtet wie eine Grande Dame, die sich entschieden hatte, ihr Gegenüber mit Nichtachtung zu strafen. Als Laurence sich jedoch mit eingezogenem Kopf in den kleinen Raum geschoben hatte, sagte er mit kaltem Hochmut in der Stimme: »Schicken Sie nach mir, wenn Sie irgendwelche Wünsche haben.« Laurence schaute sich im Raum um. Der Boden war mit Strohmatten ausgelegt, die Wände waren vollkommen nackt und schmucklos, doch eine große Ruhe ging von dieser Kammer aus, die gleichermaßen verlockend wie der Ruf der Sirenen und bedrückend wie ein Gefängnis wirkte. »Ich wünsche mir meine Freiheit«, sagte er grimmig und fast zu leise, um gehört zu werden. Junichiro jedoch fuhr ihn mit plötzlich aufwallendem Zorn an: »Seien Sie dankbar für Ihr Leben, das Sie nur dem guten Willen meines Meisters verdanken. Vielleicht überlegt er es sich ja doch noch anders.«
Energisch zog er die Tür hinter sich zu; der Rahmen ratterte in der Schiene, und Laurence konnte nur noch dem Schatten hinterherstarren, der auf der anderen Seite der durchscheinenden Wand verschwand.
Die grüne, glasig schimmernde Welle brandete gegen die Untiefen und drängte danach weiter, obwohl sie bereits in sich zusammengefallen war. Die kalte Gischt überspülte Temeraires Hinterbeine in einem kräftigen Guss und hinterließ, als sich das Wasser endlich wieder zurückgezogen hatte, eine frische Spur von Seetang und Holzsplittern, die an seiner Haut festklebten. Ein dumpfes Ächzen ging vom Schiffsrumpf der Potentate aus, die zwischen den Felsen eingezwängt war und mühevoll auf und ab schaukelte. Rings um sie herum breitete sich grau und leer der Ozean aus, und die weit entfernt liegende Bucht war kaum mehr als ein Fleck am Horizont.
»Ihr könnt sagen, was ihr wollt«, brummte Temeraire kaum verständlich, »aber es interessiert mich nicht im Geringsten. Ich werde auch alleine aufbrechen, wenn es sein muss, ganz egal, ob jemand von euch mitkommt, um mir zu helfen, oder nicht.«
»O Herr im Himmel«, murmelte Granby halblaut vor sich hin. Kapitän Berkley, der sich an eine Relingstütze klammerte, um auf dem arg schräg geneigten Deck nicht die Balance zu verlieren, machte sich nicht die Mühe, seine Stimme zu dämpfen. Stattdessen polterte er: »Jetzt hör mir mal zu, du verrücktes Biest! Du glaubst doch wohl nicht, dass die ganze Sache irgendeinem von uns besser gefällt als dir?«
»Ich bin mir sogar ganz sicher, dass ich es am schrecklichsten fände, wenn Laurence tot wäre«, erwiderte Temeraire, »aber das ist er nicht. Er ist ganz bestimmt nicht tot. Natürlich mache ich mich auf die Suche nach ihm. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn ihr versucht, mich davon abzubringen.«
Seine Stimme klang unüberhörbar vorwurfsvoll und zornig. »Und ich verstehe nicht, warum ihr eure Zeit damit verschwendet, mit mir herumzustreiten, wo ihr mir doch viel eher dabei helfen solltet, die Suche zu organisieren. Laurence kann nicht zu uns zurückkommen, solange wir hier draußen in dieser nutzlosen Position festsitzen.«
Er selbst befand sich in keiner angenehmeren Lage: In unbequemer Haltung hockte er auf der langen Reihe zerklüfteter, schwarzer Felsen, mit den Hinterläufen halb ins Meer hängend, während er zu den Fliegern auf dem Drachendeck hinüberspähte. Die Potentate war während des Sturmes auf Grund gelaufen. Es war ein entsetzlicher Aufprall gewesen, der beinahe sämtliche Drachen vom Deck in den Ozean hatte rutschen lassen und das Schiff schiefgelegt hatte.
Es war keine Zeit geblieben, an irgendetwas anderes zu denken als daran, sich selbst rechtzeitig von den Sturmketten zu befreien. Laurence hatte sich zu der Stelle vorgekämpft, an der der kleine Nitidus mit drei schweren Knoten festgehalten wurde. Diese hatte Laurence in Windeseile aufgeschnitten und so dafür gesorgt, dass Nitidus sich freistrampeln konnte, sodass der Rest von ihnen genug Platz hatte, sich ebenfalls aller Halterungen zu entledigen. Kurz darauf waren die Ketten und Segeltuchplanen über den Bug ins tosende Meer gerutscht.
»Wenn ihr frei seid, klammert euch an den Ankerketten an Heck und Bug fest!«, hatte Laurence ihnen noch zugebrüllt, ehe er wieder hinaufgeklettert war. »Ihr müsst das Schiff halten und dafür sorgen, dass es in der Waagerechten bleibt, ansonsten wird es von den Wellen gegen die Felsen geschleudert werden.« Temeraire hatte sich an die Arbeit gemacht, kaum, dass er seine Sturmketten losgeworden war. Er, Maximus und Kulingile hatten mit vereinten Kräften gekämpft und an den Ankerketten und jedem Seil gezerrt, das Nitidus und Dulcia in ihre Reichweite hatten befördern können, um das Schiff im Gleichgewicht zu halten, während der Wind kreischte und versuchte, die Potentate – und sie alle mit ihr – an den Felsen zu zerschmettern. Die Hauptlast hatte auf Temeraire geruht, denn er konnte besser in der Luft manövrieren als alle anderen. Auch wenn es unmöglich war, in diesem Sturm ruhig in der Luft zu stehen, war es ihm immerhin gelungen, seine Position mehr oder weniger zu halten, ohne in die Wellen hinabzustürzen.
Während dieser ganzen Zeit hatte niemand auch nur ein einziges Wort zu ihm gesagt – niemand hatte erwähnt, dass Laurence nirgendwo mehr zu sehen und vermutlich mitsamt den Ketten über Bord gegangen war, bis Temeraire schließlich erschöpft auf dem Deck gelandet war und Zeit gehabt hatte, sich umzuschauen. Da erst war Roland zögernd zu ihm gekommen und hatte ihm vorsichtig zu verstehen gegeben, dass Laurence vermisst wurde.
Temeraire gab unumwunden zu, dass es ein entsetzlicher Moment gewesen war, und er hatte sich ebenso schreckliche Konsequenzen wie jeder andere ausgemalt. Sofort war er losgeflogen und hatte hektisch das Meer rings um sie herum abgesucht, und jeder einzelne Augenblick, in dem er nicht das geringste Anzeichen von den Segeltuchplanen oder von Laurence gefunden hatte, war eine einzige Qual gewesen. Schließlich jedoch, nach mehreren Stunden, hatte er sich selbst dazu gezwungen, die Suche einzustellen. Ganz sicher war Laurence nicht im Wasser geblieben, sondern hatte vernünftigerweise versucht, das Land zu erreichen. So war Temeraire zum Schiff zurückgekehrt und hatte die Karten zurate gezogen, um herauszufinden, wo Laurence am ehesten zu vermuten wäre, und seine Rettung entsprechend vorzubereiten.
Ihm war es überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass irgendjemand so albern sein könnte, ihm Steine in den Weg zu legen, indem er ihn auf die prekäre politische Situation hinwies: Es ging um diesen Unsinn, dass Japan für ausländische Schiffe geschlossen war und sich Besuchern gegenüber unverhältnismäßig intolerant zeigte. Von Hammond war nichts anderes zu erwarten gewesen, als dass er auf so fadenscheinige Einwände zurückgriff, aber dass der ausgerechnet von Granby oder Kapitänin Harcourt oder irgendeinem Kapitän der anderen Drachen Schützenhilfe bekommen würde, hätte Temeraire nicht erwartet.
Er versuchte, fair zu bleiben: Er machte niemandem einen großen Vorwurf, weil es in all der Aufregung unbemerkt geblieben sein musste, dass Laurence über Bord gegangen war. Allerdings war er selbst damit beschäftigt gewesen, das gesamte Schiff zu retten, und andere hatten weitaus weniger entscheidende Aufgaben gehabt und hätten viel früher nach Laurence Ausschau halten können. »Ich finde es deshalb nicht besonders egoistisch von mir«, erklärte er, »dass nun die anderen ohne mich auskommen müssen, bis ich Laurence gefunden habe. Ich werde gleich aufbrechen.«
Der Sturm und die Winde aus allen Richtungen hatten sich gelegt, und Maximus und Kulingile konnten abwechselnd dafür sorgen, dass das Schiff nicht an den Klippen zerschellte. Im Augenblick war Kulingile sogar allein in der Luft und erledigte diese Aufgabe ohne jede Hilfe, und mit dem Schiff war alles vollkommen in Ordnung. Es spielte keine Rolle, dass einige Wellen über die Seiten spülten; Seeleute mussten stets darauf vorbereitet sein, von Zeit zu Zeit ein wenig nass zu werden.
»Ich habe nicht vor, lange wegzubleiben«, sagte Temeraire. »Und ich will nicht mehr als vielleicht zwanzig oder dreißig Mann mitnehmen, zur nächsten Küste fliegen und mit der Suche beginnen: Ganz sicher werden wir ihn sehr bald gefunden haben. Vor allem, wenn wir uns unter der Bevölkerung umhören.«
»Auf gar keinen Fall dürfen wir Derartiges auch nur in Betracht ziehen«, hielt Hammond dagegen, der über die Reling gebeugt dastand und sich die Stirn mit einem Taschentuch abwischte. In der Sonne, die sie mehrere Tage lang nicht zu Gesicht bekommen hatten, war es jetzt angenehm warm. »Nagasaki ist der einzige Hafen Japans, der für westliche Handelsschiffe geöffnet ist: Jedem Ausländer ist es per Gesetz strengstens untersagt, sich anderswo im Land aufzuhalten. Wenn Kapitän Laurence an ihrer Küste gestrandet ist und aufgegriffen wurde …« Mit einem heiseren Husten brach er ab, gerade als Granby von einer Welle auf dem bebenden Deck ins Straucheln gebracht wurde und einen kräftigen Schlag in die Seite bekam.
»Wenn sie keine Ausländer bei sich haben wollen, dann werden sie nur umso erfreuter sein, sobald wir Laurence gefunden haben und verschwinden«, erklärte Temeraire, der sich absolut im Recht wähnte. »Wir können ihnen außerdem sagen, dass wir gar nicht hier sein wollten, denn schließlich sind wir eigentlich auf dem Weg nach China, und wenn wir nicht in diesen entsetzlichen Sturm geraten wären, hätten wir sie schließlich überhaupt nicht belästigt.«
»Wie wäre es, wenn Sie sofort nach Nagasaki aufbrechen würden«, schlug Gong Su vor. Als Temeraire zu ihm herumfuhr und ihn mit einem kalten, funkelnden Blick bedachte, zuckte er zwar nicht zusammen, fügte allerdings hinzu: »Ich bitte um Verzeihung, dass ich etwas vorschlage, das für Sie verabscheuungswürdig ist, aber es führt zu nichts Gutem, wenn man die angemessene Form des Umgangs miteinander missachtet. Ich bin mir sicher, dass eine offizielle Anfrage beim Hafenmeister, vorgetragen mit allem nötigen Respekt, viel wahrscheinlicher zu dem Ausgang führt, den wir alle herbeisehnen, nämlich der gesunden Rückkehr des Prinzen.«
»Die Chancen darauf stehen allerdings schlecht, so viel ist sicher«, murmelte O’Dea, der, dick in Ölzeug gewickelt und wärmesuchend dicht an Iskierka geschmiegt, ganz in der Nähe hockte und so tat, als würde er ein Seil entwirren, obwohl er in Wahrheit einfach nur lauschte. »Ich nenne das grausam, ihm Hoffnungen zu machen: Was der Ozean einmal hat, das gibt er nicht wieder her.«
»Vielen Dank, O’Dea, das reicht«, herrschte Granby ihn an.
»Es reicht tatsächlich«, sagte Temeraire. »Du musst ihm nicht den Mund verbieten, wenn er nur das ausspricht, was ihr alle denkt. Nun, mir ist das egal. Ich breche nach Nagasaki auf und komme nicht mit nach China. Ohne Laurence werde ich überhaupt nirgends hingehen, und ganz sicher werde ich auch nicht untätig hier herumsitzen und abwarten.«
»Nein, das hätte ich mir denken können«, sagte Granby leise.
»Oh, aber natürlich tust du das«, mischte sich Iskierka ein, die ausgerechnet in diesem Moment ein Auge aufgemacht hatte. Sie hatte beinahe den gesamten Sturm verschlafen, festgebunden an dem bequemsten Ort zwischen Maximus und Kulingile, während sich Temeraire um sie herumgewunden hatte und Lily, Messoria und Immortalis über ihr lagerten. In den Augenblicken höchster Gefahr hatte sie nichts anderes getan, als sich auf einem aus dem Meer aufragenden Felsen niederzulassen und schlecht gelaunt zuzusehen, wie die anderen schufteten. Und nun, wo das Schiff halbwegs in Sicherheit gebracht war, hatte sie sich unten um den Kreuzmast gerollt – völlig ungeachtet der Tatsache, dass sie dort allen anderen im Weg war –, um dort den ganzen Tag lang zu schlafen.
»Nein, das werde ich nicht!«, beharrte Temeraire empört; wenn sie ihm jetzt auch noch sagen würde, dass Laurence tot sei, würde er ihr eins auf die Nase geben. »Laurence ist nicht tot.«
»Weshalb sollte er tot sein?«, fragte Iskierka. »Und was tut das überhaupt zur Sache? Aber du wirst nicht irgendwo im Landesinneren verschwinden, während wir hier auf diesen Felsen festsitzen und dem Schiff Gott weiß was zustoßen könnte.«
Temeraire fand das ausgesprochen lächerlich. Der Sturm war vorbei, und wenn die Potentate bis jetzt nicht gesunken war, würde sie nun auch nicht mehr untergehen. »Warum sollte ich hierbleiben, wenn Laurence irgendwo in Japan verschollen ist?«
»Weil ich morgen mein Ei bekommen werde«, sagte Iskierka, machte eine bedeutungsschwangere Pause und legte nachdenklich den Kopf schräg. »Vielleicht sogar schon heute. Ich will etwas zu essen haben, und dann sehen wir weiter.«
»Das Ei?«, fragte Granby und starrte sie an. »Welches Ei? Was zum … Willst du mir etwa sagen, dass ihr beide …, obwohl ihr euch doch spinnefeind seid …«
»Natürlich«, antwortete Iskierka. »Wie hätten wir wohl sonst ein Ei bekommen können? Allerdings«, fuhr sie in Temeraires Richtung fort, »war es bislang für mich viel mühsamer. Es ist nur fair, wenn du dich darum kümmerst, sobald es draußen ist. Jedenfalls gehst du nirgendwohin, bis das Ei da ist.«
2
Nachdem Laurence den gesamten folgenden Tag mit Schlafen und Essen zugebracht hatte, machte er äußerlich den Eindruck, sich allmählich zu erholen. Innerlich jedoch wurde er immer unruhiger: Beim besten Willen wollte ihm nicht einfallen, was ihn so grundlos auf die Straßen Japans verschlagen haben sollte, ja, er konnte sich nicht einmal zu einem Gefühl der Dankbarkeit dafür durchringen, dass er offensichtlich durch eine gnädige göttliche Fügung der chinesischen Sprache mächtig war. Er hätte es vorgezogen, stumm zu sein, wenn er dafür im Geiste hätte sicher sein können, woher er stammte, selbst wenn er das seinen Gefängniswärtern dann nicht hätte mitteilen können. Und Wärter waren sie ganz offensichtlich: Seine Bitte, nach Nagasaki gebracht zu werden, war merkwürdigerweise abgelehnt worden. Von Junichiro hatte er ein bisschen mehr über seine augenblickliche Situation erfahren. Obwohl dieser zuvor so offen ablehnend ihm gegenüber gewesen war, behandelte er ihn nun mit pedantischer Höflichkeit. Der Name des Mannes, in dessen Haus er wohnte, lautete Kaneko Hiromasa; sein genauer Rang war Laurence nicht klar, aber der Größe seines Hauses und der Anzahl seiner Bediensteten nach zu urteilen war er ein wohlhabender Mann in gewichtiger Position. Die Papierberge in seinem Arbeitszimmer sprachen zudem dafür, dass er mit Aufgaben von einiger Tragweite betraut war. Vielleicht handelte es sich bei ihm um einen Landadeligen, der seine Güter selbst verwaltete, oder sogar um irgendeinen Staatsbeamten. Ungeachtet seiner Stellung hingegen, wurde immer offenkundiger, dass er Laurence nicht nur aus purer Nächstenliebe aufgenommen hatte, um ihm etwas zu essen zu geben, ihm zu helfen, sich zu reinigen, und ihn dann seiner Wege ziehen zu lassen.
Am gestrigen Tag hatte Laurence sich noch nicht kräftig genug gefühlt, um die Angelegenheit zu klären. Er war vollkommen durcheinander gewesen, und die Erschöpfung hatte ihn überwältigt, sodass er beinahe ununterbrochen geschlafen hatte. Auf den bloßen Matten auf dem Fußboden ausgestreckt, hatte er den ganzen Tag herumgelegen und sich nur aufgesetzt, um etwas zum Abendbrot zu essen. Doch beim Aufwachen an diesem Morgen fühlte er sich wieder wie der Alte, zumindest in körperlicher Hinsicht. Als ihm Bedienstete sein Frühstück brachten, teilte er ihnen mit, dass er sofort noch einmal Kaneko zu sprechen wünsche. Die einfachen Mägde verstanden kein Chinesisch, aber nachdem er den Namen ihres Herrn mehrfach wiederholt hatte, eilten sie davon und kehrten kurz darauf mit Junichiro im Schlepptau zurück.
Der junge Mann trat an die Tür zu Laurence’ Kammer, blieb jedoch mit kühlem und unbeteiligtem Gesichtsausdruck draußen stehen. »Mein Herr ist momentan beschäftigt«, sagte er. »Gestatten Sie, dass ich mich um Ihre Belange kümmere.« Seine Stimme war ruhig, und er vermied es, Laurence ins Gesicht zu schauen. In seinem ganzen Auftreten lag eine seltsame Mischung aus Förmlichkeit und beinahe greifbarer Ablehnung, obwohl er sich nach außen hin höflich gab. Nichts ließ auf seine wahren Gefühle und das, was sie hervorgerufen hatte, schließen.
Laurence konnte sich auf all das keinen Reim machen. Wenn seine Anwesenheit eine echte Belastung für den Haushalt wäre, hätte er besser nachvollziehen können, dass Junichiro ihm mit Vorbehalten begegnete. Allerdings hatte für Kaneko keinerlei Notwendigkeit bestanden, ihn vom Wegesrand aufzulesen. Auf jeden Fall schien die Freigebigkeit, mit der er bislang behandelt worden war, die finanziellen Mittel eines solch herrschaftlichen Hauses mitnichten überstrapaziert zu haben.
Aber im Augenblick ging es Laurence gar nicht darum, der ganzen Angelegenheit auf den Grund zu gehen. Viel vordringlicher war die Tatsache, dass man augenscheinlich nicht vorhatte, ihm dabei behilflich zu sein, zu seinem Schiff zurückzukehren. Deshalb sagte Laurence: »Ich bin Ihrem Herrn zu großem Dank für seine Gastfreundschaft verpflichtet; doch da meine Gesundheit so weit wiederhergestellt ist, muss ich seine Großzügigkeit nicht länger in Anspruch nehmen. Ich möchte Sie bitten, mir meine Kleidung und meinen Degen zurückzugeben und mir den Weg zur Straße zu zeigen.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!