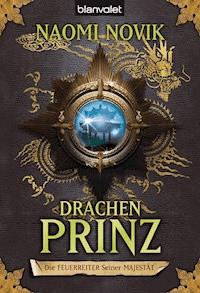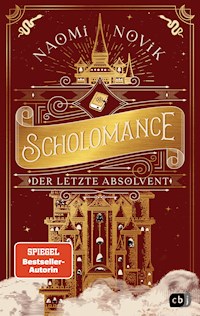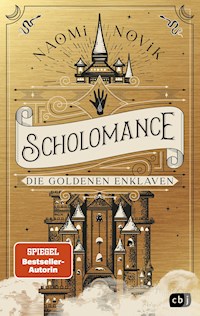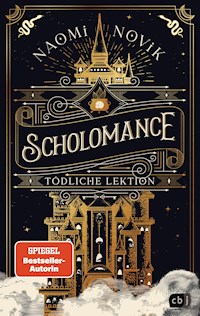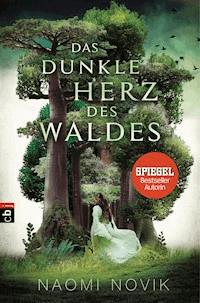8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Feuerreiter-Serie
- Sprache: Deutsch
Die heilige Pflicht eines Feuerreiters
Will Laurence und sein Drache Temeraire haben nicht nur die britischen Drachen von einer schrecklichen Seuche geheilt, sondern auch die französischen. Dafür wurden sie des Hochverrats für schuldig befunden. Doch wegen der überragenden Tapferkeit, die sie bei der Verteidigung Britanniens bewiesen, wurde die Todesstrafe für Laurence in Verbannung nach Australien umgewandelt. Als Verräter gebrandmarkt und von allen angefeindet, versuchen Temeraire und sein Reiter dennoch, ihre Pflicht zu erfüllen. Besonders drei ihnen anvertraute Dracheneier benötigen ihren Schutz. Da entdecken Laurence und sein Drache eine chinesische Ansiedlung, ein klarer Affront gegen das britische Empire. Doch Temeraire steht zwischen den Fronten. Soll er den Briten helfen, die ihm eine Heimat gaben, oder die Chinesen unterstützen, die ihn als Drachen ehren und respektieren …
Die Fortsetzung der faszinierenden »All-Age« Fantasy-Saga voll dramatischer Drachenkämpfe, Heldenmut und großer Gefühle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1
Es gab nur wenige Straßen innerhalb des eigentlichen Hafengebietes von Sydney, die diese Bezeichnung verdienten, wenn man vom Hauptverkehrsweg absah, und selbst der war schlecht befestigt und nur von einer Handvoll kleinerer, heruntergekommener Gebäude gesäumt, die das Herzstück der Kolonie bildeten. Tharkay verließ diese Straße und führte die Gruppe auf einen schmalen Trampelpfad zwischen zwei holzgedeckten Gebäuden, dem er folgte, bis er in einen Hof einbog und Halt machte. Dort, nicht etwa unter einem Dach, sondern lediglich unter einer aufgespannten Persenning, saßen allerlei grobschlächtige, raue Männer beisammen und taten sich an Hochprozentigem gütlich.
Auf der Hofseite, die am weitesten von der Küche entfernt war, drängten sich die Strafgefangenen mit ihren Segeltuchhosen in ausgeblichenem Graubraun, staubig von den Feldern und Steinbrüchen und müde und erschöpft. Gegenüber saßen kleine Gruppen von Männern aus dem Neusüdwales-Korps, die mit unverhohlen unfreundlichen Gesichtern beobachteten, wie sich Laurence und seine Begleiter an einem kleinen Tisch ganz am Rand der Anlage niederließen.
Abgesehen von der Tatsache, dass sie Fremde waren, zog Granbys Mantel die Aufmerksamkeit auf sich: Flaschengrün war hier eine ungewöhnliche Farbe, und auch wenn Granby die gröbsten Auswüchse an goldenen Borten und Knöpfen, mit denen ihn Iskierka so gerne ausstaffierte, abgetrennt hatte, war das bei der Stickerei auf den Ärmelaufschlägen und dem Kragen nicht so einfach gewesen. Laurence selbst trug schlichtes Braun. Selbstredend stand es überhaupt nicht zur Debatte, so zu tun, als gehöre er noch dem Fliegerkorps an. Falls seine Kleidung Fragen bezüglich seiner Stellung aufwerfen sollte, dann war das nur der Situation angemessen, denn weder ihm noch sonst irgendjemandem war es bislang gelungen, herauszufinden, wie sich seine Lage in praktischer Hinsicht gestalten sollte.
»Ich hoffe, dieser Bursche wird bald auftauchen«, bemerkte Granby missmutig. Er hatte darauf bestanden, mitzukommen, allerdings nicht, weil er den Plan guthieß.
»Ich habe die sechste Stunde ausgemacht«, antwortete Tharkay und wandte den Kopf zur Seite, denn einer der jüngeren Offiziere war von seinem Tisch aufgestanden und kam zu ihnen.
Acht Monate an Bord eines Schiffes, ohne eigene Pflichten und Aufgaben, stattdessen inmitten von Schiffskameraden, die sich weitgehend einig in ihrer Entschlossenheit waren, Laurence ihre Verachtung spüren zu lassen, hatten ihn auf die Szene vorbereitet, die sich nun mit beinahe ermüdender Ähnlichkeit erneut abzuzeichnen begann. Die Beleidigung selbst war vor allem deshalb lästig, weil sie, mehr als alles andere, einer Antwort bedurfte. Sie hatte jedoch nicht die Kraft zu verletzen – nicht aus dem Mund eines ungehobelten jungen Kerls, der nach Rum stank und es eigentlich nicht einmal wert war, in den armseligen Reihen einer Militäreinheit zu stehen, die man auch das Rum-Korps nannte. Laurence betrachtete Leutnant Agreuth voller Abscheu und sagte kurz und knapp: »Sir, Sie sind betrunken; gehen Sie zurück an Ihren Tisch und lassen Sie uns in Ruhe an unserem sitzen.«
Er hatte mit diesen beschwichtigenden Worten jedoch keinen Erfolg: »Ich sehe nicht ein, warum ich …«, erwiderte Agreuth, doch seine Zunge war so schwer, dass er den Satz abbrechen und noch einmal von vorne anfangen musste, wobei er einen Teil mit ausgesuchter Deutlichkeit wiederholte, »… warum ich auf irgendetwas hören sollte, das aus dem verfluchten Mund eines Pisspotts von einem Hurensohn und Verräter …«
Laurence erstarrte und lauschte der Tirade mit wachsender Ungläubigkeit. Er hätte diesen Gossenjargon vielleicht von einem aufgebrachten Taschendieb am Hafen erwartet, doch nie im Leben von einem Offizier. Granby fasste sich offenbar schneller, denn er sprang auf und knurrte: »Bei Gott, Sie werden sich entschuldigen, oder ich werde Sie durch die Straßen peitschen lassen, glauben Sie mir.«
»Ich würde zu gerne sehen, wie Sie das versuchen«, antwortete Agreuth und beugte sich vor, um in Granbys Glas zu spucken. Laurence erhob sich zu spät, um Granbys Arm noch festzuhalten, ehe dieser Agreuth das Glas ins Gesicht schmetterte.
Das bedeutete natürlich ein Ende für den letzten Rest Hoffnung auf einen zivilisierten Umgang miteinander, mochte es auch nur aufgesetzte Höflichkeit sein. Stattdessen zerrte Laurence Granby am Arm zurück, um Agreuths wild schwingender Faust zu entgehen, musste ihn jedoch wieder loslassen – nachdem er zum zweiten Mal selbst im Gesicht getroffen worden war –, um mit der geballten Hand zurückzuschlagen.
Er hielt sich keineswegs zurück. Eine Rauferei war zwar unschicklich und empörend, aber da sie unvermeidlich zu sein schien, war es am besten, die Sache so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. So mobilisierte er alle Kraft, die ihm eine Kindheit in der Schiffstakelage und das spätere Festhalten am Drachengeschirr beschert hatte, und hieb Agreuth die Faust direkt unter das Kinn. Der Leutnant hob einen guten Zentimeter vom Boden ab, und sein Kopf schnellte nach hinten, was ihn aus dem Gleichgewicht brachte. Er taumelte ein paar Schritte nach vorne, ehe er der Länge nach mit dem Gesicht voran zu Boden ging und dabei einige Nachbartische mit umriss, sodass mehrere Gläser neben ihm zerschellten und der Mief von billigem Rum aufstieg.
Dabei hätte man es belassen können, doch Agreuths Begleiter – obschon Offiziere und einige von ihnen älter und nüchterner als Agreuth – zeigten keinerlei Scheu, sich in den aufkommenden Tumult zu stürzen. Die Männer an dem umgeworfenen Tisch – Matrosen eines ostindischen Handelsschiffes – waren ebenso rasch dabei, die Unterbrechung bei ihrem Saufgelage persönlich zu nehmen. Dies war ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus Matrosen, Arbeitern und Soldaten, bei denen nur wenig zur Volltrunkenheit fehlte, und einigen wenigen Frauen, ähnlich dem, was sich in beinahe jedem anderen Gasthaus einer Hafenstadt überall auf der Welt finden ließ, wie Laurence wusste: ein Pulverfass, das nur auf ein Zündholz wartete. Der Rum war noch nicht zwischen den Steinen versickert, als sich die Männer rings um sie herum schon von ihren Stühlen erhoben hatten.
Ein anderer Offizier des Neusüdwales-Korps stürzte sich auf Laurence, und dieser Mann war größer als Agreuth, aber ebenfalls betrunken und schwerfällig vom Alkohol. Laurence wand sich aus seinem Griff, drückte den Gegner auf den Boden und schob ihn, so gut es ging, unter den Tisch. Tharkay hatte derweil mit einem Sinn fürs Praktische eine Rumflasche am Hals gepackt. Ein anderer Mann – der nicht das Geringste mit Agreuth zu tun hatte und ganz offenkundig erfreut darüber war, irgendjemanden in einen Kampf verwickeln zu können – machte einen Satz auf Tharkay zu, der ihm jedoch kurzerhand die Flasche an die Schläfe schmetterte.
Granby war in der Zwischenzeit von drei Männern gleichzeitig angegriffen worden. Zwei davon waren Agreuths Begleiter und von purer Boshaftigkeit getrieben, der dritte jedoch versuchte alles, um an das juwelenbesetzte Schwert und den Gürtel, den Granby um die Taille trug, zu gelangen. Laurence schlug dem Dieb aufs Handgelenk und packte ihn am Kragen, um ihm einen heftigen Stoß zu versetzen, der ihn rückwärts durch den Hof stolpern ließ. In diesem Augenblick schrie Granby auf, und als Laurence sich umdrehte, sah er, wie Granby sich unter einem schmutzigen, rostfleckigen Messer duckte, mit dem jemand nach seinen Augen stach.
»Bei Gott, haben Sie denn den Verstand verloren?«, schrie Laurence und umklammerte die Hand des Mannes, der mit dem Messer herumfuchtelte. Es gelang ihm, die Klinge wegzudrücken, während Granby erfolgreich den dritten Mann niederschlug und sich umdrehte, um Laurence zu Hilfe zu kommen. Das Durcheinander wurde nun rasch völlig unübersichtlich, wozu Tharkay einiges beitrug, indem er kaltblütig die umgestürzten Stühle durch den Raum schleuderte, weitere Tische umwarf und den Gästen, die empört aufsprangen, den Fuselinhalt ihrer Gläser ins Gesicht schüttete.
Laurence, Granby und Tharkay waren nur zu dritt, doch da sie ringsum von Offizieren des Neusüdwales-Korps umgeben waren, blieb den anderen aufgebrachten Männern kein anderes Ziel als ebenjene Offiziere: ein Ziel, auf das die Strafgefangenen in ihrem Zorn ohne jede Zurückhaltung losgingen. Die Empörung hatte jedoch keine berechenbare Stoßrichtung, und nachdem der Offizier vor Laurence mit einem schweren Stuhl niedergestreckt worden war, schwang der wutentbrannte Angreifer hinter ihm seine Waffe mit gleicher Vehemenz nun gegen Laurence.
Laurence glitt auf den nassen Bodenplanken aus und wehrte den Stuhl ab, ehe er im Gesicht getroffen werden konnte. Dann richtete er sich auf und kniete in einer Pfütze. Er zog dem Mann ein Bein unter dem Körper weg, was jedoch nur dazu führte, dass der Bursche mit seinem ganzen Gewicht samt Stuhl auf Laurence’ Schulter landete, sodass sie gemeinsam zu Boden stürzten.
Splitter bohrten sich Laurence in die Seite, wo sein Hemd aus der Kniebundhose gerutscht war. Der große Strafgefangene bedachte ihn mit wilden Flüchen und hieb ihm seine geballte Faust ans Kinn. Laurence schmeckte Blut, als seine Lippe von einem Zahn aufgerissen wurde, und seine Sicht wurde verschwommen. Sie rollten über den Fußboden; im Nachhinein hatte Laurence an diese nächsten Minuten keine klare Erinnerung mehr. Er ließ wilde Hiebe auf den Mann niederprasseln; bei jeder Drehung landete er einen Treffer, der den Kopf des Gegners auf die Bohlen krachen ließ. Es war ein bösartiger Kampf wie zwischen Tieren, der ohne Gefühle oder Gedanken ausgetragen wurde. Nur wie von Weitem bekam Laurence mit, wenn er versehentlich getreten wurde oder von der Wand oder umgestürztem Mobiliar aufgehalten wurde.
Erst als der Körper seines Gegners ohnmächtig erschlaffte, ließ die Raserei nach. Laurence öffnete mühsam die geballte Hand und ließ die Haare des Mannes los; dann rappelte er sich taumelnd vom Boden auf. Sie waren bis zum Holztresen vor der Küche gerollt. Laurence streckte den Arm aus, umklammerte die Tischkante und zog sich hoch. Stärker als ihm lieb war, wurde er sich mit einem Mal des stechenden Schmerzes in seiner Seite und der brennenden Schnitte an Wange und Händen bewusst. Als er sein Gesicht abtastete, bekam er eine lange Glasscherbe zu fassen, löste sie und warf sie auf den Tresen.
Die Schlägerei rings um ihn herum ließ bereits nach. Die Dauer dieser Auseinandersetzung war nicht mit einem Kampf an Deck eines Schiffes zu vergleichen, in dem es wirklich etwas zu gewinnen gab. Laurence humpelte an Granbys Seite: Agreuth und einer seiner Offizierskumpane waren ebenfalls wieder auf die Beine gekommen und hatten nun, obwohl sie stark geschwächt waren, Granby in einer Ecke erneut angegriffen, noch immer voller Bosheit, doch so erschöpft, dass sie eher hin und her schwankten, als dass sie wirklich miteinander rangen.
Laurence schob sich dazwischen und befreite Granby, dann stützten sie einander und stolperten aus dem Hof hinaus in eine enge, stinkende Gasse, in der die Luft trotz allem kühl und frisch erschien, nun, da sie endlich unter der behelfsmäßigen Überdachung hervorgekommen waren. Ein feiner Regen ging nieder. Dankbar lehnte sich Laurence an die gegenüberliegende Mauer. Der Sprühnebel, der sich auf sein Gesicht legte, kühlte ihn ab und machte seinen Kopf frei, während sein gut trainierter Magen den Mann ignorierte, der nur wenige Schritte von ihm entfernt seinen Mageninhalt in die Gosse erbrach. Einige Frauen, die die Gasse herunterkamen, rafften ihre Röcke und setzten ohne Zögern ihren Weg an ihnen vorbei fort. Die Aufregung im Hof der Taverne würdigten sie keines Blickes.
»Mein Gott, du siehst schrecklich aus«, bemerkte Granby bedrückt.
»Kann ich mir denken«, entgegnete Laurence und betastete vorsichtig sein Gesicht. »Und ich wage zu behaupten, dass ich mir auch zwei Rippen gebrochen habe. Es tut mir leid, das zu sagen, John, aber du siehst nicht so aus, als wärest du in besserer Verfassung.«
»Nein, vermutlich nicht«, antwortete Granby. »Wir müssen uns ein Zimmer suchen, falls sie uns überhaupt irgendwo durch die Tür lassen, um uns zu waschen. Ich habe keine Ahnung, was Iskierka veranstalten würde, wenn sie mich in diesem Zustand zu Gesicht bekäme.«
Laurence hatte eine sehr genaue Vorstellung davon, was Iskierka tun würde und Temeraire ebenfalls, und er war sich sicher, dass von der Kolonie nichts Nennenswertes mehr übrig sein würde, wenn die beiden fertig wären.
»Nun«, sagte Tharkay und gesellte sich zu ihnen, während er sich sein Halstuch um seine eigene blutende Hand wickelte, »ich glaube, ich habe unseren Mann vor einer Weile einen Blick in den Hof werfen sehen, aber ich fürchte, er hat es sich unter diesen Umständen doch noch mal anders überlegt. Ich werde Erkundigungen einholen, um ein weiteres Treffen mit ihm zu vereinbaren.«
»Nein«, sagte Laurence und betupfte Lippe und Wange mit seinem Taschentuch. »Nein danke. Ich glaube, wir können auf seine Informationen verzichten. Ich habe genug gesehen, um mir ein Bild von der Disziplin hier in der Kolonie und von seiner militärischen Stärke zu machen.«
Temeraire seufzte und spielte mit den letzten Bissen seines Känguru-Eintopfs herum. Das Fleisch hatte einen angenehmen Wildgeschmack, dem Hirschfleisch nicht unähnlich, und zunächst hatte er es nach der langen Seereise für eine sehr befriedigende Abwechslung zu den Fischen gehalten. Aber er fand es ausschließlich dann wirklich lecker, wenn es nur leicht angebraten war, was wenig Variationsmöglichkeiten zuließ. Im Eintopf wurde das Fleisch sehnig und fade, vor allem angesichts der Tatsache, dass der Vorrat an Gewürzen immer mehr zu wünschen übrig ließ. Von seinem erhöhten Sitz auf einem Felsvorsprung am Hafen aus konnte Temeraire verlockendes Vieh in einem Pferch erkennen, doch offensichtlich war es viel zu wertvoll, als dass es dem Korps zur Verfügung gestellt werden würde. Und natürlich konnte Temeraire Laurence eine solche Ausgabe nicht zumuten, nicht, wo er doch dafür verantwortlich war, dass Laurence sein gesamtes Vermögen verloren hatte. Stattdessen hatte Temeraire sofort all seine vorsichtigen Klagen über die mangelnde Abwechslung wieder eingestellt. Bedauerlicherweise hatte Gong Su das als Ermunterung aufgefasst, und so gab es seit vier Tagen in Folge morgens und abends nichts als Känguru – und nicht mal ein winziges Stückchen Thunfisch zur Abwechslung.
»Ich sehe gar nicht ein, warum wir nicht wenigstens zum Jagen weiter ins Landesinnere vorstoßen dürfen«, klagte Iskierka, während sie ihre eigene Schüssel ohne viel Federlesens ausleckte. Sie weigerte sich schlicht, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die auch nur im Entferntesten an gute Manieren erinnerten. »Dies ist ein riesiges Land, und es ist doch wohl klar, dass sich Besseres zum Essen finden ließe, wenn wir uns ein bisschen umsehen würden. Vielleicht gibt es hier irgendwo diese Elefanten, von denen du immer wieder erzählst. Ich würde zu gerne mal einen davon probieren.«
Temeraire hätte selbst eine Menge für einen schmackhaften Elefanten gegeben, mit einer großzügigen Prise Pfeffer und vielleicht etwas Salbei zubereitet. Man durfte Iskierka jedoch auf keinen Fall in diese Richtung ermutigen. »Du kannst gerne hinfliegen, wohin du willst«, sagte er, »und du wirst dich mit Sicherheit verirren. Niemand hat eine Ahnung, wie die Landschaft hinter diesen Bergen aussieht, und du wirst da auch niemanden treffen, den du nach dem Weg fragen kannst: weder Menschen noch Drachen.«
»Das ist albern«, bemerkte Iskierka. »Ich sage zwar nicht, dass Kängurus gute Mahlzeiten abgeben, denn das ist einfach nicht der Fall, und es gibt auch nicht genug von diesen Tieren. Aber es ist sicher auch nicht schlimmer als das, was wir während des letzten Feldzugs in Schottland bekommen haben. Nichtsdestoweniger ist es Unsinn zu behaupten, dass hier niemand lebt; warum denn nicht? Ich würde sagen, dass es hier jede Menge Drachen gibt. Die stecken nur einfach woanders und haben vermutlich viel besseres Essen als wir.«
Temeraire schien das in der Tat keine ganz unwahrscheinliche Möglichkeit, und er nahm sich vor, die Sache später mit Laurence unter vier Augen zu besprechen. Das wiederum erinnerte ihn an Laurence’ Abwesenheit und an die vorgerückte Stunde. »Roland«, rief er mit einem besorgten Unterton in der Stimme. Natürlich brauchte Laurence kein Kindermädchen, aber er hatte versprochen, vor dem Abendessen wieder zurück zu sein und ein bisschen weiter aus dem Roman vorzulesen, den er tags zuvor in der Stadt gekauft hatte. »Roland, ist die fünfte Stunde nicht schon vorbei?«
»Herr im Himmel, ja, es muss beinahe sechs sein«, antwortete Emily Roland und legte ihren Degen auf den Boden. Sie und Demane hatten draußen im Hof ein bisschen Fechten geübt. Mit einem lose gezupften Ende ihres Hemdes tupfte sie sich das Gesicht ab und rannte zum Rand des Felsvorsprungs, um den Matrosen unten etwas zuzurufen. Dann kam sie wieder zurück und sagte: »Nein, ich lag völlig falsch. Es ist schon Viertel nach sieben. Das ist ziemlich seltsam, dass die Tage so lang sind, obwohl es doch schon bald Weihnachten ist.«
»Das ist überhaupt nicht seltsam«, entgegnete Demane. »Es ist nur seltsam, wenn man darauf beharrt, dass es hier auch Winter sein muss, nur weil es das in England ist.«
»Aber wo steckt Granby, wenn es so spät ist?«, fuhr Iskierka auf, die gelauscht hatte. »Er hatte nichts Besonderes vor, wie er mir versichert hat, sonst hätte ich ihn doch nie so schäbig gekleidet losgehen lassen.«
Temeraire nahm sich diese Bemerkung zu Herzen und stellte kurz seine Halskrause auf. Es störte ihn nun doch sehr, dass Laurence nichts anderes als den schlichten Mantel eines Gentleman trug, ohne jede Borte und ohne goldene Knöpfe. Er hätte mit Freuden Laurence’ Erscheinungsbild verbessert, wenn er nur die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Laurence jedoch weigerte sich noch immer, Temeraires Krallenscheiden für ihn zu verkaufen, und selbst wenn er es getan hätte, hätte Temeraire in diesem Teil der Welt doch nichts entdeckt, was ihm auch nur annähernd als angemessene Kleidung für Laurence vorgekommen wäre.
»Vielleicht sollte ich besser aufbrechen und nach Laurence suchen«, sagte Temeraire. »Ich bin mir sicher, dass er nicht so lange unterwegs sein wollte.«
»Ich werde ebenfalls nach Granby suchen«, verkündete Iskierka.
»Tja, wir können aber nicht beide wegfliegen«, antwortete Temeraire verdrießlich. »Jemand muss bei den Eiern bleiben.« Er warf einen raschen, prüfenden Blick auf die drei Eier in ihrem schützenden Nest aus zusammengerollten Decken und unter dem schmalen Baldachin aus Segeltuch, der über ihnen aufgespannt worden war. Er war recht unzufrieden mit der Situation: Ein hübsches, kleines Kohlebecken, dachte er, könnte selbst bei diesem warmen Wetter nicht schaden, und vielleicht könnte man weicheren Stoff rings um die Schale drapieren. Es passte ihm auch überhaupt nicht, dass das Sonnensegel so niedrig gehängt war, wodurch er seinen Kopf nicht darunterstecken konnte, um an den Eiern zu schnüffeln und herauszufinden, wie hart die Schale schon geworden war.
Es hatte einige Schwierigkeiten mit ihnen gegeben, nachdem sie vom Schiff abgeladen worden waren. Einige der Offiziere des Korps, die mit ihnen mitgeschickt worden waren, hatten dagegen protestiert, dass Temeraire die Eier bei sich behalten wollte, weil sie angeblich selbst besser in der Lage wären, sie zu beschützen, was natürlich lächerlich war. Daraufhin hatten sie unter der Hand angefangen zu behaupten, dass Laurence versuchen würde, die Eier zu stehlen, was Temeraire mit einem Schnauben abgetan hatte.
»Laurence will keinen anderen Drachen, er hat doch mich«, hatte Temeraire erklärt. »Und was das Stehlen angeht: Ich möchte mal wissen, wessen Idee es war, mit diesen Eiern einmal halb um die Welt zu segeln, über die Meere mit all den Stürmen und Seeschlangen überall, um sie an diesen seltsamen Ort zu bringen, der nicht einmal ein richtiges Land ist und wo es keine anderen Drachen gibt. Mein Vorschlag war das ganz sicher nicht.«
»Mr. Laurence wird unverzüglich mit harter Arbeit beginnen wie die übrigen Strafgefangenen«, hatte Leutnant Forthing gesagt, was unbedacht gewesen war – als ob Temeraire etwas Derartiges zulassen würde!
»Das reicht, Mr. Forthing«, hatte sich Granby eingemischt, der das Gespräch mitgehört und sich daraufhin zu ihnen gesellt hatte. »Ich muss mich doch sehr wundern, dass Sie sich zu solch vorschnellen Äußerungen hinreißen lassen; ich bitte dich, Temeraire, schenk ihnen keinerlei Beachtung, überhaupt keine.«
»Oh, das mache ich nicht«, antwortete Temeraire, »und auch die anderen Vorwürfe interessieren mich nicht.« An Forthing und seine Männer gewandt, fügte er hinzu: »Wie dumm von Ihnen zu glauben, Sie könnten die Eier stattdessen selber behalten und die Drachen nach dem Schlüpfen sofort anschirren, als ob die jeden von Ihnen akzeptieren müssten, der sie durch Zufall gewonnen hat. Ich habe gestern gehört, wie Sie in der Messe darüber gesprochen haben, Lose zu ziehen, also müssen Sie gar nicht erst versuchen, die Sache abzustreiten. Ich werde das definitiv nicht zulassen, und ich bin mir völlig sicher, dass auch die Schlüpflinge von keinem von Ihnen etwas werden wissen wollen.«
Natürlich hatte er seinen Willen durchgesetzt und die Dracheneier mitgenommen, um sie an ihren momentanen, einigermaßen sicheren und behaglichen Aufbewahrungsort zu bringen. Doch Temeraire machte sich keine Illusionen darüber, was die Vertrauenswürdigkeit der Menschen anging, die solch gehässige, falsche Behauptungen von sich gegeben hatten. Keinen Augenblick zweifelte er daran, dass sie versuchen würden, sich heranzuschleichen und die Eier an sich zu bringen, sobald sie auch nur die geringste Chance witterten. Aus diesem Grund schlief er um das Zelt gerollt, und Laurence hatte Roland, Demane und Sipho als Wachen eingeteilt.
Ärgerlicherweise entpuppte sich diese Verantwortung als große Einschränkung, vor allem da man Iskierka die Eier keine Sekunde lang anvertrauen konnte. Zum Glück war die Stadt sehr klein, und der Felsvorsprung von beinahe jedem Punkt aus sichtbar, wenn man nur seinen Hals genug reckte, sodass Temeraire das Gefühl hatte, er könnte es wagen, aufzubrechen, nur um rasch Laurence zu finden und sicher zurückzubringen. Natürlich war Temeraire überzeugt davon, dass niemand töricht genug sein würde, Laurence in irgendeiner Form respektlos zu behandeln, aber es war nicht zu leugnen, dass Männer dazu neigten, von Zeit zu Zeit unvorhergesehene Dinge zu tun. Forthings Bemerkung nagte noch immer an Temeraire.
Wenn man die Sache sehr genau nehmen wollte, dann stimmte es, dass Laurence ein verurteilter Strafgefangener war: verurteilt wegen Hochverrats. Seine Strafe war nur auf Drängen von Lord Wellington nach der letzten Schlacht in England in Deportation umgewandelt worden. Und diese Strafe war in Temeraires Augen verbüßt, denn niemand konnte abstreiten, dass Laurence zwangsweise abtransportiert worden war, und diese Erfahrung war mehr als Strafe genug gewesen.
Die unglückselige Allegiance war bis zu den Bullaugen mit noch unglückseligeren Verurteilten vollgestopft gewesen, die den ganzen Tag an Handgelenken und Fußknöcheln angekettet waren und entsetzlich stanken, wann immer sie in klirrender Reihe an Deck gebracht worden waren, um Bewegung zu bekommen. Einige von ihnen hingen schlaff in ihren Ketten. Temeraire kam das wie Sklaverei vor, und er konnte nicht verstehen, warum es, wie Laurence steif und fest behauptete, einen solch riesigen Unterschied machen sollte, dass ein Gericht festgestellt zu haben glaubte, diese armen Gefangenen hätten etwas gestohlen. Schließlich konnte sich doch jeder ein Schaf oder eine Kuh holen, wenn sie von ihren Besitzern vernachlässigt oder nicht richtig bewacht wurden.
Fest stand, dass sich das Schiff nicht von irgendeinem Sklavenschiff unterschied: Der Gestank waberte durch die Deckplanken, und beinahe ständig trug der Wind ihn bis zum Drachendeck. Nicht einmal der Duft von brutzelndem Pökelfleisch aus der unten gelegenen Kombüse konnte die üblen Gerüche vertreiben. Als sie schon beinahe einen Monat lang auf Reisen waren, hatte Temeraire durch Zufall erfahren, dass Laurence unmittelbar neben dem Gefängnis untergebracht worden war, wo die Luft noch viel schlechter sein musste.
Laurence hatte sich jedoch geweigert, sich in irgendeiner Form darüber zu beschweren. »Mir geht es sehr gut, mein Lieber«, hatte er gesagt. »Es steht mir frei, den ganzen Tag und die milderen Nächte auf dem Drachendeck zu verbringen, was nicht einmal den Schiffsoffizieren möglich ist. Es wäre ausgesprochen unfair, für mich eine bessere Behandlung zu beanspruchen, wo ich doch nicht einmal ihre Arbeit erledige. Jemand anders würde sein Quartier räumen müssen, damit ich es beziehen könnte.«
So war es eine sehr unangenehme Überfahrt geworden. Und nun waren sie hier, wo es ebenfalls niemandem gefallen konnte. Zusätzlich zu den ständigen Känguru-Mahlzeiten kam die Tatsache, dass es hier sehr wenige Menschen gab und nichts, was einer richtigen Stadt ähnelte. Temeraire war daran gewöhnt, in England schlechte Unterbringungen für Drachen zu sehen, aber hier wohnten die Menschen nicht viel besser als auf den Lichtungen in jedem beliebigen Stützpunkt Englands. Viele von ihnen waren in Zelten oder behelfsmäßigen, kleinen Gebäuden untergebracht, die nicht einmal stehen blieben, wenn man – gar nicht unbedingt zu niedrig – über sie hinwegflog. Stattdessen brachen sie zusammen und spuckten aufgebrachte Bewohner aus, die einen riesigen Aufstand veranstalteten.
Und es gab auch keine Gelegenheit für einen Kampf. Während der Überfahrt hatten sie immer wieder Briefe und Zeitungen erreicht, wenn schnellere Fregatten an dem schwerfälligen Rumpf der Allegiance vorbeigeschossen waren. Für Temeraire war es sehr entmutigend zu hören, als Laurence ihm vorlas, dass Napoleon angeblich wieder in Kämpfe verwickelt war, dieses Mal in Spanien, und überall entlang der Küste Städte einnahm. Sicher war Lien bei ihm, während Temeraire und Laurence nutzlos am anderen Ende der Welt festsaßen. Das war alles andere als fair, dachte Temeraire missmutig, dass Lien, die der Überzeugung war, Himmelsdrachen sollten überhaupt nicht kämpfen, den ganzen Krieg für sich allein haben sollte, während er hier hockte und sich um Eier kümmern musste.
Auf der Überfahrt hatte es nicht einmal eine klitzekleine Schlacht zum Trost gegeben. Einmal hatten sie in der Ferne einen französischen Freibeuter gesehen, aber das kleinere Schiff hatte alle zur Verfügung stehenden Segel gesetzt und war mit Höchstgeschwindigkeit davongeeilt. Iskierka hatte es trotzdem verfolgt, aber Laurence hatte Temeraire darauf hingewiesen, dass er für ein so fruchtloses Abenteuer nicht die Eier allein lassen könne. Zu Temeraires Befriedigung war Iskierka nach wenigen Stunden gezwungen gewesen, mit leeren Klauen zurückzukehren.
Ganz sicher würden die Franzosen nicht auf die Idee kommen, Sydney anzugreifen; nicht, solange es nichts zu gewinnen gab als Kängurus und dürftige Behausungen. Temeraire verstand nicht, was sie hier überhaupt tun sollten. Es galt, sich bis zum Schlüpftermin, der – da war er sich sicher – nicht mehr weit entfernt sein konnte, um die Eier zu kümmern, und danach würde ihnen kaum noch etwas zu tun bleiben, als herumzusitzen und aufs Meer zu starren, soweit er das beurteilen konnte.
Die Menschen waren entweder mit Landarbeit beschäftigt, was nicht sehr interessant war, oder es handelte sich bei ihnen um Strafgefangene, die, so kam es Temeraire vor, ohne erkennbaren Grund am Morgen weggeführt und nachts wieder zurückgebracht wurden. Eines Tages war er einer solchen Gruppe aus Neugier hinterhergeflogen. Die Männer marschierten zu einem Steinbruch, wo sie kleine Brocken aus dem Fels schlugen und sie dann in Karren in die Stadt brachten, was ihm ziemlich absurd und ineffektiv vorkam. Er selbst hätte fünf Wagenladungen mit einem einzigen Flug von vielleicht zehn Minuten transportieren können, aber als er gelandet war, um seine Hilfe anzubieten, waren die Gefangenen schon in alle Richtungen weggerannt. Die Soldaten hatten sich später bei Laurence bitter darüber beklagt.
Sie mochten Laurence überhaupt nicht. Einer von ihnen war sehr grob gewesen und hatte gesagt: »Für fünf Pence würde ich Sie ebenfalls in den Steinbruch stecken«, woraufhin Temeraire den Kopf hinabgebeugt und erwidert hatte: »Und für zwei Pence werde ich Sie in den Ozean werfen. Was haben Sie denn geleistet, während Laurence mit mir zusammen viele Schlachten gewonnen und Napoleon vertrieben hat? Das würde ich ja gerne wissen. Sie haben einfach nur hier herumgesessen und es nicht mal geschafft, eine ansehnliche Menge an Kühen zu züchten.«
Inzwischen hatte Temeraire das Gefühl, dass die Abschweifung vielleicht ein wenig ungerecht gewesen sein mochte und dass er Laurence überhaupt nicht in die Stadt hätte gehen lassen dürfen, wo es Menschen gab, die ihn in die Steinbrüche schicken wollten. »Ich werde aufbrechen und nach Laurence und Granby suchen«, sagte er zu Iskierka, »und du bleibst hier. Wenn du auch fliegst, setzt du sowieso nur wieder etwas in Brand.«
»Ich werde überhaupt nichts in Brand setzen«, antwortete Iskierka. »Es sei denn, es ist nötig, etwas anzuzünden, um Granby zu befreien.«
»Das meinte ich«, sagte Temeraire. »Verrate mir doch bitte mal, was ein Feuer Gutes bewirken soll.«
»Falls mir niemand verrät, wo er ist«, erklärte Iskierka, »dann stecke ich einfach etwas in Brand und drohe damit, auch alles andere anzuzünden, und ich bin mir sicher, dann werden sie schon mit der Sprache rausrücken. So einfach ist das.«
»Ja«, sagte Temeraire, »und währenddessen hält sich Granby wahrscheinlich in einem der Häuser auf, die du angesteckt hast, und wird verletzt. Und wenn nicht, dann springt das Feuer auf die Gebäude in der Nähe über, ob dir das nun gefällt oder nicht, und er könnte schließlich auch in einem von diesen Häusern festsitzen. Ich dagegen werde einfach das Dach eines Gebäudes abnehmen, hineinsehen und Laurence und Granby herausheben, falls sie da drin sind, aber das werden mir die Leute ohnehin verraten.«
»Ich kann auch ein Dach abnehmen!«, kreischte Iskierka. »Du bist ja bloß neidisch, weil es viel wahrscheinlicher ist, dass jemand Granby entführt, weil er mehr Gold an sich trägt und viel prächtiger aussieht.«
Temeraire schnaufte vor Zorn, schwoll an und war kurz davor, seine Empörung und den angestauten Atem gleichermaßen auszustoßen, als Roland mit drängender Stimme unterbrach und sagte: »Oh, streitet doch nicht! Seht mal, da kommen sie alle drei gesund und munter zurück. Das da auf der Straße sind sie, da bin ich mir sicher.«
Temeraire ließ den Kopf herumschnellen: Drei kleine Gestalten hatten sich gerade aus den wenigen, zusammengedrängten Häusern gelöst, die die Stadt bildeten, und befanden sich nun auf dem engen Viehpfad, der zum Felsvorsprung heraufführte.
Temeraire und Iskierka reckten die Hälse und starrten zu ihnen hinunter. Laurence hatte eine Hand erhoben und winkte kräftig, trotz der Schmerzen in seinen Rippen, denen ein Bad und ein fester Verband nicht viel Erleichterung gebracht hatten. Diese Verletzung jedoch würde er vor Temeraire verbergen können. »Wenigstens haben wir die beiden nicht hier unten auf der Straße«, sagte Granby, als er seinen eigenen Arm sinken ließ und ein wenig zusammenzuckte. Vorsichtig befühlte er seine Schulter.
Die Sache wurde allerdings doch noch brenzlig, als sie den Felsvorsprung erreicht hatten. Sie waren nur langsam vorangekommen, und immer wieder drohten Laurence’ Beine nachzugeben, ehe sie die Spitze erreicht hatten und sich auf einer der grob gezimmerten Bänke niederlassen konnten. Temeraire schnüffelte, dann senkte er abrupt seinen Kopf, bis er mit Laurence auf Augenhöhe war, und sagte: »Du bist verletzt. Du blutest.« In seiner Stimme lag ein ängstlicher Unterton.
»Nichts, weswegen du dir Sorgen machen musst. Ich fürchte, ich hatte einen kleinen Unfall in der Stadt«, sagte Laurence, der zwar ein schlechtes Gewissen hatte, eine geringfügige Beschönigung der Ereignisse jedoch den unvermeidlichen Konsequenzen vorzog, die es haben würde, wenn Temeraire richtig wütend würde.
»Siehst du, mein Lieber, es ist nur gut, dass ich in der Stadt meinen alten Mantel trage«, sagte Granby zu Iskierka, einer plötzlichen Eingebung folgend. »Er ist schmutzig geworden und eingerissen, und es hätte dir doch bestimmt leidgetan, wenn ich etwas Hübscheres angezogen hätte.«
Auf diese Weise war Iskierka abgelenkt und sann über Kleidungsfragen nach, anstatt sich über blaue Flecken Gedanken zu machen. Sofort behauptete sie, das alles sei eine natürliche Folge der Umgebung. »Wenn du dich an einem heruntergekommenen, armseligen Ort wie dieser Stadt befindest, dann ist auch nichts anderes zu erwarten«, sagte sie, »und ich sehe auch nicht ein, warum wir überhaupt hierbleiben sollten. Ich denke, wir kehren lieber wieder direkt nach England zurück.«
2
»Das überrascht mich keineswegs«, sagte Bligh, »keineswegs. Da sehen Sie mal die augenblickliche Lage hier, Kapitän Laurence, mit diesen Schurken und Dummköpfen, diesen Hurensöhnen.«
Seine Sprache war nicht viel besser als die der Männer, auf die er anspielte, und Laurence zog Blighs Gesellschaft der ihren keineswegs vor. Es gefiel ihm gar nicht, dass er so vom Gouverneur des Königs und einem Marineoffizier dachte, und schon gar nicht von einem, der ein bemerkenswerter Seemann war. Die Tatsache, dass er 3600 Meilen übers offene Meer gesegelt war, und zwar in einer Schiffsbarkasse, nachdem er von der Bounty ausgesetzt worden war, war noch immer in aller Munde.
Laurence war dazu übergegangen, ihn wenigstens zu respektieren, wenn er ihn schon nicht mochte. Die Allegiance hatte in Van-Diemens-Land einen Zwischenstopp eingelegt, um Wasser aufzunehmen, und dort waren sie auf den Gouverneur gestoßen, den sie in Sydney zu treffen erwartet hatten, vom Rum-Korps abgesetzt und elendig im Exil lebend. Er hatte einen dünnen, säuerlich verzogenen Mund, was vielleicht seinen Schwierigkeiten zuzuschreiben war, und eine breite Stirn schimmerte unter schütter werdendem Haar hervor. Darunter waren empfindsame Gesichtszüge zu sehen, die nicht so recht passen wollten zu Blighs zügelloser Sprache, derer er sich befleißigte, wann immer er sich angegriffen fühlte – was häufig genug der Fall war.
Er wusste sich nicht anders zu helfen, als alle vorübersegelnden Marineoffiziere zu bedrängen, ihm doch wieder zu seinem alten Rang zu verhelfen. Doch bis zum heutigen Tage hatten alle besonnenen Gentlemen es vorgezogen, sich aus der Sache herauszuhalten, während die Nachricht die lange Seereise bis nach England angetreten hatte, von wo aus eine offizielle Lösung für das Problem ausgehen musste. Diese jedoch ließ auf sich warten, und Laurence nahm an, dass der Grund dafür in den Wirren durch die Invasion Napoleons und der darauf folgenden Zeit zu finden war. Eine andere Erklärung für eine derart zögerliche Reaktion gab es nicht. Keine neuen Befehle trafen ein und auch kein neuer Gouverneur. In Sydney fassten das Neusüdwales-Korps und die wohlhabenderen Männer, die dessen Bestrebungen unterstützt hatten, in der Zwischenzeit immer mehr Fuß.
Noch in derselben Nacht, in der die Allegiance in den Hafen einlief, hatte sich Bligh hinausrudern lassen, um sich mit Kapitän Riley zu besprechen. Er hatte sich praktisch selbst zum Abendessen eingeladen und die Unterhaltung bestritten, wobei er geflissentlich darüber hinwegsah, dass dieses Privileg eigentlich Riley zustand. Da er selber ein Mann der Marine war, musste ihm diese Gepflogenheit sehr wohl bekannt sein.
»Ein Jahr und noch immer keine Antwort«, hatte Bligh voller Verachtung und Zorn geklagt und mit einer Hand Rileys Stewart einen Wink gegeben, er solle ihn noch einmal die Flasche herumreichen lassen. »Ein ganzes Jahr ist vergangen, Kapitän, in dem diese aufrührerischen Würmer in Sydney mit ihrer Zügellosigkeit und durch Aufwiegelung den Pöbel für sich einnehmen konnten. Es bedeutet ihnen nichts, rein gar nichts, wenn aus jedem Kind, das je von einer Frau an dieser Küste zur Welt gebracht worden ist, ein Bastard, ein Hundsfott oder ein versoffenes Wrack wird, solange die Bevölkerung ihre kümmerliche Arbeit auf den Farmen erledigt und sich still dem Joch beugt. Lasst den Rum in Strömen fließen ist ihre einzige Devise, und Alkohol ist ihr Zahlungsmittel und das Maß aller Dinge.« Er selbst jedoch hielt sich keineswegs beim gewöhnlichen Wein zurück, obschon dieser beinahe sauer wie Essig war, oder bei Rileys letzten Vorräten an Portwein. Auch aß er gut, wie es üblich war bei einem Mann, der zumeist mit Zwieback und nur gelegentlich mit etwas Fleisch auskommen musste.
Laurence war schweigsam und rollte den Stiel seines Glases zwischen den Fingern hin und her, denn ob er wollte oder nicht: Er empfand ein wenig Mitgefühl. Wenn er selbst sich nur ein bisschen weniger unter Kontrolle gehabt hätte, hätte er genauso über die vereinte Feigheit und Dummheit gewettert, die dazu geführt hatten, dass man Temeraire ins Exil schickte. Auch er sehnte sich danach, rehabilitiert zu werden. Selbst wenn ihm das nicht seinen Rang wiederbringen oder ihm den Weg zurück in die Gesellschaft ermöglichen würde, sollte es ihn doch zumindest an einen Ort führen, wo er von Nutzen wäre. Stattdessen saß er hier am anderen Ende der Welt auf nacktem Fels herum und haderte mit seinem Schicksal.
Doch nun könnte Blighs Untergang ganz leicht zu seinem eigenen werden. Seine einzige Hoffnung auf eine Rückkehr bestand in einer Begnadigung für sich selbst und für Temeraire durch den Gouverneur der Kolonie – oder zumindest in einer guten Beurteilung –, um diejenigen in England zu beruhigen, deren Ängste und kleinliche Eigeninteressen dafür gesorgt hatten, dass sie fortgeschickt worden waren. Er hatte immer die leise Hoffnung gehabt, auch wenn sie noch so gering war, dass Jane Roland ganz sicher die Rückkehr von Englands einzigem Himmelsdrachen wünschte, wo sie sich doch Lien auf Seiten des Feindes stellen musste. Laurence hegte die Hoffnung, dass die beinahe abergläubische Furcht vor Himmelsdrachen, die sich nach den entsetzlichen Verlusten durch Liens Angriff auf die Marine während der Schlacht von Shoeburyness allerorts breitgemacht hatte, wieder etwas nachlassen würde und besonnenere Gemüter zu bereuen beginnen würden, dass eine so wertvolle Waffe weggeschickt worden war.
Wenigstens hatte Roland das Laurence ermutigend geschrieben und ihm den Rat gegeben: Ich bete, dass ich die Viceroy losschicken kann, euch abzuholen, sobald sie wieder instand gesetzt ist. Aber um Gottes willen, stell dich gut mit dem Gouverneur, wärst du wohl so freundlich? Ich wäre dir sehr verbunden, wenn es ruhig um dich wäre; es wäre auch günstig, wenn du im nächsten Bericht aus der Kolonie keinerlei Erwähnung finden würdest, ob im Guten oder im Schlechten, weil du dich lammfromm verhalten hast.
Was das anging, wurde jede Hoffnung in dem Augenblick zunichtegemacht, als Bligh seine Lippen abtupfte, seine Serviette auf den Tisch fallen ließ und sagte: »Ich will nicht lange drum herumreden, Kapitän Riley: Ich hoffe, unter den gegebenen Umständen ist Ihnen klar, worin Ihre Pflicht besteht, und Ihnen ebenfalls, Kapitän Granby«, fügte er hinzu.
Diese Pflicht bestand natürlich darin, Bligh zurück nach Sydney zu bringen und dort die Kolonie einzunehmen oder mit Beschuss zu bedrohen, um dann die Anführer MacArthur und Johnston der Gerichtsbarkeit zu übergeben. »Ich gehe davon aus, dass sie am Ende aufgeknüpft werden wie meuternde Hundesöhne, was sie ja schließlich auch sind«, sagte Bligh. »Das ist die einzige Möglichkeit, den Schaden wiedergutzumachen, den sie angerichtet haben. Bei Gott, ich würde ihre wurmzerfressenen Leichname ein Jahr und länger hängen lassen, damit es ihren Anhängern eine Lehre ist. Vielleicht haben wir dann wieder etwas mehr Disziplin.«
»Nein, eine solche Pflicht ist mir nicht klar«, entgegnete Granby unvorsichtigerweise ganz direkt. Später, als er mit Laurence und Riley allein war, fügte er hinzu: »Ich wüsste auch nicht, warum es unsere Aufgabe sein sollte, die Kolonie davon zu überzeugen, ihn wieder zurückzunehmen. Mir scheint, dass ein Bursche, gegen den drei oder vier Mal gemeutert wurde, nicht nur von Pech reden kann.«
»Dann sollten Sie mich an Bord nehmen«, knurrte Bligh, als Riley ihm ebenfalls – allerdings viel höflicher – seine Weigerung mitteilte, ihm in seinem Bestreben behilflich zu sein. »Ich werde mit Ihnen nach England zurückkehren und dort die Umstände persönlich zur Sprache bringen. Das zumindest können Sie mir nicht abschlagen«, betonte er, und er hatte recht. Ein Verwehren dieses Ansinnens könnte sich in politischer Hinsicht als ausgesprochen gefährlich für Riley erweisen, dessen Position weitaus weniger gesichert war als die von Granby. An ihm gab es keinerlei besonderes Interesse, das ihm Schutz geboten hätte. Blighs wirkliches Ziel war natürlich nicht die Rückkehr nach England, sondern er wollte in ihrer Begleitung und unter Rileys Schutz in der Kolonie ankommen, um so die Gelegenheit zu haben, seine Überredungsversuche weiterzuführen, solange sie ihm Hafen lagen.
Angesichts von Blighs Gemütszustand war nicht anzunehmen, dass Laurence sich in den Dienst dieses Gentleman stellen konnte, ohne sofort aufgefordert zu werden, ihm wieder zu seinem Amt zu verhelfen und Temeraire auf die Rebellen zu hetzen. Selbst wenn dies Laurence’ eigenen Interessen entgegengekommen wäre, so war es ihm doch ganz und gar zuwider. Er hatte einmal zugelassen, dass er und Temeraire in einem Krieg als Mittel zum Zweck missbraucht worden waren – von Wellington in Englands größter Not gegen die französischen Besatzer. Noch immer hatte er einen widerwärtigen Geschmack im Mund, und er würde sich nie wieder in dieser Art und Weise benutzen lassen.
Sollte sich Laurence allerdings in den Dienst des Neusüdwales-Korps stellen, würde er damit zum Unterstützer der Meuterei werden. Es bedurfte nicht viel politischen Verständnisses, um zu wissen, dass ausgerechnet dies eine Beschuldigung war, die er ganz und gar nicht gut gebrauchen konnte. Vermutlich wäre es ein solcher Vorwurf, der von seinen und Temeraires Gegnern am ehesten geglaubt und aufgegriffen werden würde, um jede Hoffnung auf eine Rückkehr zu vereiteln.
»Ich verstehe das Problem nicht. Es gibt doch gar keine Veranlassung, warum du dich irgendjemandem unterordnen musst«, beharrte Temeraire, als der besorgte Laurence ihm gegenüber das Thema anschnitt. Sie befanden sich auf dem Schiff und waren auf dem Weg von Van-Diemens-Land nach Sydney, der letzten Etappe ihrer Reise, die Laurence noch vor einiger Zeit herbeigesehnt hatte und nun nur allzu gerne ausgedehnt hätte. »Uns ging es doch all die Zeit auf See gut, und uns wird es auch in Zukunft gut gehen, selbst wenn einige lästige Leute mehr als unhöflich waren.«
»Vom Gesetz her unterstehe ich Kapitän Riley, und das kann auch noch eine kleine Weile so bleiben«, antwortete Laurence. »Aber nicht mehr lange. Eigentlich müsste er mich mit dem Rest der Gefangenen an die Behörden übergeben.«
»Warum sollte er das tun? Riley ist ein vernünftiger Mann«, wandte Temeraire ein, »und wenn du irgendjemandem unterstehen musst, dann doch wohl besser ihm als Bligh. Ich kann jemanden nicht leiden, der nicht aufhören will, uns beim Lesen zu stören, und das vier Mal, nur weil er sich noch einmal darüber beklagen will, wie schlimm die Kolonisten sind und wie viel Rum sie trinken. Ich wüsste zu gerne, warum das irgendeinen von uns interessieren sollte.«
»Mein Lieber, Riley wird nicht mehr lange bei uns sein«, sagte Laurence. »Ein Drachentransporter kann nicht einfach nur im Hafen herumliegen. Es ist das erste Mal, dass ein solches Schiff in diesen Teil der Welt geschickt wurde, und zwar nur, um uns hier abzusetzen. Wenn das Schiff geschrubbt und der Besanmast ersetzt worden ist, der in der Nähe des Kaps einen Schlag abbekommen hat, dann wird die Reise wieder losgehen. Ich bin mir sicher, dass Riley nur zu bald neue Befehle erwartet, vermutlich vom nächsten Schiff, das nach uns in den Hafen einläuft.«
»Oh«, stieß Temeraire niedergeschlagen aus. »Und ich schätze, wir bleiben hier.«
»Ja«, antwortete Laurence leise. »Es tut mir leid.«
Ohne Transporter würde Temeraire endgültig ein Gefangener der neuen Situation sein: Es gab hier nur sehr wenige Schiffe und keines der Handelsklasse, das einen Drachen von Temeraires Größe würde aufnehmen können. Und es gab auch keine Flugroute, die ihn sicher in irgendeinen anderen Teil der Welt würde bringen können. Ein leichter Kurierdrache, dessen Statur auf Ausdauer angelegt war, könnte es zwar möglicherweise mit einem ordentlich ausgebildeten Steuermann an Bord bei gutem Wetter und mit einer gehörigen Portion Glück schaffen, wenn er auf verlassenen, steinigen Atollen eine Pause einlegte. Doch das Flieger-Korps riskierte es nicht, diese Tiere auf der regulären Route zur Kolonie zu schicken. Temeraire würde einen solchen Flug nur unter den allergrößten Gefahren bewältigen können.
Wenn Granby darüber hinaus genügend Überzeugungsarbeit leistete, würden auch er und Iskierka zusammen mit Riley abreisen, um zu vermeiden, gleichermaßen festzusitzen. Dann wäre Temeraire völlig von seinen Artgenossen abgeschnitten, abgesehen von den drei Schlüpflingen, und was für eine Gesellschaft die abgeben würden, ließ sich im Voraus noch nicht sagen.
»Na ja, darüber muss man sich nicht grämen«, sagte Temeraire und beäugte Iskierka mürrisch. Diese schlief tief und fest und stieß riesige Mengen Dampf aus ihren Stacheln an den Flanken aus, der sich in dicken Tropfen sammelte, die vom Körper abperlten, sodass sie das Deck unter Temeraire durchweichten. »Nicht, dass ich etwas gegen Gesellschaft einzuwenden hätte«, fügte er hinzu. »Es wäre schön, Maximus wiederzusehen und Lily, und ich würde zu gerne wissen, wie Perscitia mit ihrem Pavillon vorankommt. Aber ich bin mir sicher, sie werden mir schreiben, sobald wir an unserem endgültigen Ziel angekommen sind. Was Iskierka angeht: Die kann verschwinden, wann immer ihr der Sinn danach steht.«
Laurence hatte das Gefühl, dass sich Temeraire der Schwere der Strafe, die sie getroffen hatte, noch nicht richtig bewusst war. Doch die Aussicht auf diese elende Zeit, die während der bisherigen Reise zumeist Laurence’ Gedanken beherrscht hatte, war noch gar nichts im Vergleich zu dem Desaster der Situation, in der sie sich nun befanden: Sie waren gleichzeitig in der Rolle von Verurteilten und Königsmachern gefangen, ohne Aussicht auf ein Entkommen, es sei denn, sie würden jeden gesellschaftlichen Umgang meiden und sich in die Wildnis zurückziehen.
»Bitte mach dir keine Sorgen, Laurence«, sagte Temeraire mit fester Stimme. »Ich bin mir sicher, wir werden einen spannenden Ort vorfinden.« Dann fügte er hinzu: »Und auf jeden Fall wird es etwas Besseres zu essen geben.«
Der Empfang bei ihrer Ankunft gab jedoch Blighs Sicht der Dinge und Laurence’ Sorgen nur neue Nahrung. Man konnte nicht behaupten, dass sich die Allegiance an die Kolonie herangeschlichen hätte. Um elf Uhr morgens an einem strahlend klaren Tag hatte sie die Hafenmündung passiert, und es wehte nur ein laues Lüftchen, das sie vorantrieb. Nach acht Monaten auf dem Meer hätte man es niemandem verübeln können, wenn er ungeduldig geworden wäre, aber keiner konnte sich der beinahe erschreckenden Schönheit des riesigen Hafens entziehen. Eine Bucht reihte sich entlang dem Hauptkanal an die nächste Biegung, und die dicht bewaldeten Hänge erstreckten sich bis zum Wasser, nur durchbrochen von goldenen Sandstränden.
Riley befahl daher nicht, die Boote herunterzulassen oder mehr Segel zu setzen; er ließ die Männer müßig an der Reling stehen und dem neuen Land entgegensehen, während die Allegiance gleichmäßig zwischen den kleineren Schiffen hindurchglitt wie ein großer Finnwal zwischen Schwärmen von Köderfischen. Beinahe drei Stunden lang segelten sie langsam dahin, ehe sie schließlich Anker warfen, doch bis dahin war noch niemand gekommen, um sie willkommen zu heißen.
»Ich denke, ich werde Salutschüsse abfeuern lassen«, verkündete Riley zögernd; und schon dröhnten die Kanonen. Viele der Kolonisten auf den staubigen Straßen drehten sich zu ihnen um, doch keine Antwort kam, sodass Riley nach zwei weiteren Stunden ein Boot zu Wasser ließ und Lord Purbeck, seinen ersten Leutnant, an Land schickte.
Kurze Zeit später kehrte dieser zurück und berichtete, er habe mit Major Johnston gesprochen, dem augenblicklichen Hauptmann des Neusüdwales-Korps, doch dieser Gentleman weigere sich, an Bord zu kommen, solange Bligh anwesend sei. Die Nachricht von Blighs Rückkehr hatte Sydney offenkundig vor ihnen erreicht, vermutlich dank eines kleineren, schnelleren Schiffes, das von Van-Diemens-Land aus die gleiche Route genommen hatte.
»Dann sollten wir ihm wohl besser selber einen Besuch abstatten«, sagte Granby, der vorgab, die entsetzten Blicke nicht zu bemerken, die Laurence und Riley ihm bei der Vorstellung zuwarfen, dass ein Marinekapitän sich herablassen sollte, bei einem Armeemajor vorzusprechen, der sich so empörend und ganz und gar nicht wie ein Gentleman verhalten hatte. Es machte die Sache nicht besser, als er hinzufügte: »Ich entschuldige ihn nicht, aber ich halte es durchaus für denkbar, dass dieser Bursche Bligh selbst eine Nachricht vorausgeschickt hat, dass wir kommen, um ihn wieder einzusetzen«, was traurigerweise recht wahrscheinlich war. Und vor allem schien es keine Alternative zu geben. Ihre Vorräte neigten sich dem Ende zu, und das war nicht zu unterschätzen angesichts der Tatsache, dass der gesamte Schiffsrumpf vor Strafgefangenen zu bersten drohte und sich das Deck unter dem Gewicht der Drachen bog.
Gezwungenermaßen machte sich Riley mit angemessener Marinebegleitung auf den Weg und bot Laurence und Granby an, ebenfalls mitzukommen. »Das mag vielleicht gegen das Protokoll verstoßen, aber das scheint in dieser verfluchten Angelegenheit ja der Normalfall zu sein«, sagte er zu Laurence. »Und ich fürchte, du musst diesen Burschen dringender als wir anderen kennenlernen.«
Das erste Zusammentreffen mit Johnston ließ nicht lange auf sich warten: »Wenn Sie versuchen wollen, diese falsche Schlange wieder über uns zu bringen, dann hoffe ich, Sie sind bereit, zu bleiben und mit uns seine Unverschämtheiten zu ertragen«, knurrte Johnston. »Und falls Sie mit Ihrem Schiff wieder auslaufen sollten, werden wir ihn im Handumdrehen erneut absetzen. Ich für meinen Teil verantworte mich vor jedem, der das Recht hat, einen Bericht einzufordern, wozu keiner von Ihnen gehört.«
Dies waren die ersten Worte, die er ausstieß, kaum dass sie zu ihm geführt und noch ehe sie einander vorgestellt worden waren. Das Gespräch fand nicht etwa in seinem Arbeitszimmer statt, sondern in einem Vorraum in dem einzigen, lang gestreckten Gebäude der Kolonie, das zugleich als Kaserne und Hauptquartier diente.
»Was hat das damit zu tun, das Schiff eines Königs nicht angemessen zu begrüßen, wenn es in den Hafen einfährt, das möchte ich ja gerne wissen«, bemerkte Granby in gleicher Art und Weise hitzig. »Und weder Sie noch Bligh interessieren mich im Geringsten, bis ich Verpflegung für meinen Drachen bekommen habe. Darum sollten sie sich besser schnell kümmern – es sei denn, Sie wollen, dass mein Drache die Sache selber regelt.«
Dieser Schlagabtausch hatte nicht eben zu einem wärmeren Willkommen geführt.
Abgesehen von der Verdächtigung, sie würden Bligh unterstützen, war Johnston trotz seines aufbrausenden Auftretens offenkundig beunruhigt wegen der augenblicklichen Verhältnisse, die er und seine Anhänger geschaffen hatten, und das keineswegs grundlos. Schließlich waren sie durch Englands langes Schweigen illegal und unbestätigt geblieben. Laurence hätte unter anderen Umständen Mitleid mit diesem Gefühl des Unbehagens gehabt: Die Allegianceund die mitreisenden Drachen kamen als schwer einzuschätzender Faktor in die Kolonie und hatten durchaus die Stärke, die bestehende Ordnung auf den Kopf zu stellen.
Aber der erste Eindruck, den Laurence von der Kolonie gewonnen hatte, hatte ihn bereits ziemlich schockiert. Er hatte nicht damit gerechnet, in dieser wunderschönen, üppigen Landschaft eine so grundsätzliche Atmosphäre von Verfall und Unordnung vorzufinden; Frauen und Männer, die schon vor Sonnenuntergang betrunken durch die Straßen taumelten, und für die meisten Bewohner der Kolonie enge, heruntergekommene Hütten oder Zelte als einziger Schutz. Und selbst diese dienten oft anderen Zwecken. Als sie auf dem Weg zu ihrem unbefriedigenden Treffen waren, passierten sie ein solches Etablissement, das keine Tür mehr hatte. Laurence warf einen Blick hinein und war entsetzt, als er einen Mann und eine Frau bei leidenschaftlichem Beischlaf entdeckte, er noch halb mit seiner Militäruniform bekleidet, während ein anderer Mann unbeeindruckt auf dem Fußboden schnarchte und ein vor Schmutz starrendes Kind schniefend in einer Ecke saß.
Noch verstörender war der Anblick von blutüberströmten Menschenkörpern, die im militärischen Hauptquartier zur Schau gestellt wurden, wo ein enthusiastischer Auspeitscher anscheinend kaum eine Pause machte zwischen den einzelnen Delinquenten. Eine Reihe von gefesselten, düster dreinblickenden Männern wartete auf fünfzig oder hundert Hiebe, was hier offenbar der Vorstellung einer milden Strafe entsprach.
»Wenn ich nicht bald selbst eine Meuterei an Bord hätte«, bemerkte Riley halblaut, als sie zur Allegiance zurückkehrten, »würde ich meine Männer hier nicht an Land gehen lassen; Sodom und Gomorrha ist ja nichts dagegen.«
Die nächsten drei Wochen in der Kolonie trugen wenig dazu bei, Laurence’ Meinung über die aktuelle oder die vorherige Führung zu heben. An Bligh selbst konnte er nichts Sympathisches entdecken: Seine Sprache und sein Verhalten blieben schroff und abweisend. Und dort, wo die Versuche, seine Autorität wiederzuerlangen, durchkreuzt wurden, verlegte er sich stattdessen auf ungeschicktes Zureden, wobei sich plumpe Schmeicheleien mit verärgerten Wutausbrüchen die Waage hielten. Er verhehlte jedoch kaum seine Überzeugung, von vollkommener Rechtschaffenheit angetrieben zu sein.
Aber diese Angelegenheit war schlimmer als jede gewöhnliche Meuterei: Bligh war ein königlicher Gouverneur gewesen, und ebenjene Soldaten, die dafür verantwortlich gewesen waren, seine Befehle auszuführen, hatten ihn verraten. Riley und Granby blieben unnachgiebig, und da zu vermuten stand, dass sie in absehbarer Zeit wieder mit dem Schiff ablegen würden, hatte sich Bligh auf Laurence versteift, den er für den vielversprechendsten Weg zurück in sein Amt hielt. Er ließ und ließ sich einfach nicht abschütteln. Inzwischen beklagte er sich täglich bei Laurence darüber, wie schlecht geführt die Kolonie war, und malte den Niedergang aus, in den ein derartig gesetzloses Treiben naturgemäß münden würde, wenn man ihm kein Ende setzte.
»Lass ihn doch von Temeraire über Bord werfen«, hatte Tharkay trocken vorgeschlagen, als Laurence in sein Quartier geflüchtet war, um trotz der beinahe erstickenden Hitze unter Deck ein wenig Ruhe zu finden und eine Runde Karten zu spielen. Die geöffneten Fenster ließen nur die noch heißere Brise herein. »Er kann ihn ja später wieder rausfischen«, fügte er nach kurzem Nachdenken hinzu.
»Ich bezweifle doch sehr, dass etwas so Mildes wie das Wasser des Ozeans ausreichen würde, um das fiebrige Gemüt dieses Gentleman für längere Zeit abzukühlen«, sagte Laurence, der sich in Sarkasmus flüchtete, um sich ein wenig zu beruhigen. Bligh war an diesem Tag so weit gegangen, ganz offen von seinem Recht zu sprechen, Männer zu begnadigen, sollte er wieder in sein Amt eingesetzt werden, und Laurence war gezwungen gewesen, ihn mitten im Satz zu unterbrechen, um sich nicht von diesem Bestechungsversuch beleidigen zu lassen. »Es wäre alles viel leichter«, fügte er müde hinzu, als sein aufgeflammter Zorn verebbt war, »wenn ich nicht der Meinung wäre, dass er mit seinen Klagen recht hat.«
Denn das Laster, das sich durch die augenblickliche Führung der Kolonie breitmachte, war unübersehbar, selbst wenn man es nur vom Schiff aus beobachtete. Laurence hatte im Vorfeld erfahren, dass die Strafgefangenen in der Regel zu harter Arbeit verurteilt worden waren, und wenn sie diese ohne weitere Vorfälle hinter sich gebracht hatten, ihre Freiheit und ein Stück Land erhalten würden. Dies war ein wohldurchdachter Plan, den der erste Gouverneur ersonnen hatte, um den Gefangenen einen Anreiz zu verschaffen und gleichzeitig das Land zu besiedeln. Doch im Laufe der folgenden zwei Jahrzehnte war dieser Plan kaum mehr als ein frommer Wunsch gewesen, während in Wahrheit die einzigen Männer mit Besitz die Offiziere des Neusüdwales-Korps oder ihre früheren Kameraden waren.
Im besten Fall wurden die Verurteilten als billige Arbeitskräfte benutzt, im schlimmsten Fall als Leibeigene. Die Sträflinge verfügten über keinerlei Beziehungen und hatten keine Perspektive, die sie entweder ein Interesse an der Zukunft entwickeln oder Scham über ihr augenblickliches Benehmen empfinden ließ. Noch dazu saßen sie in einem Land fest, das ein Gefängnis ohne Mauern war, was dazu führte, dass sich die Männer durch billigen Rum bestechen ließen und so leicht zur Arbeit angetrieben oder ruhig gestellt werden konnten. Mit dem Rum machten die Soldaten anständigen Profit, und auf diese Weise trugen jene, die eigentlich für Ordnung hätten sorgen sollen, selbst zum Verfall der Sitten in der Kolonie bei, ohne sich um die Zügellosigkeit und Selbstzerstörung, der sie Vorschub leisteten, zu kümmern.
»Das jedenfalls behauptet Bligh die ganze Zeit, und nach allem, was ich gesehen habe, muss ich ihm recht geben«, sagte Laurence. »Aber, Tenzing, ich trau mir selber nicht über den Weg. Ich fürchte, dass es eher mein Wunsch ist, dass Blighs Klagen der Wahrheit entsprechen, als dass ich es wirklich wüsste. Es tut mir leid, aber es würde so gelegen kommen, einen Grund dafür zu haben, ihm wieder ins Amt zu verhelfen.«
»Ich fürchte, ich habe alle Stiche gewonnen«, sagte Tharkay, als er seine letzte Karte bei ihrem Spiel auf den Tisch legte. »Wenn du wirklich nach Gerechtigkeit und nicht nur nach guter Führung trachtest, dann solltest du zunächst mehr in Erfahrung bringen und dich mit einem Einheimischen unterhalten, einem hier ansässigen Mann, der unbescholten und keiner Seite verpflichtet ist.«
»Wenn sich ein solcher Mann finden ließe, dann wüsste ich keinen Grund, warum er in einer so heiklen Angelegenheit bereit sein sollte, seine Meinung kundzutun.« Laurence warf seine restlichen Karten auf den Tisch und nahm dann alle auf, um sie neu zu mischen und auszuteilen.
»Ich habe Einladungen von einigen einflussreichen Einheimischen bekommen«, sagte Tharkay, was für Laurence eine unerwartet neue Information war, die ihn einigermaßen verwunderte. Soviel er wusste, war Tharkay nur deshalb nach Neusüdwales gereist, um seiner unstillbaren Ruhelosigkeit nachzugeben. Doch natürlich konnte Laurence nicht mit einer direkten Nachfrage in Tharkays Privatsphäre eindringen.
»Wenn du willst«, fuhr Tharkay fort, »dann könnte ich einige Erkundigungen einholen. Ich gehe davon aus, dass die Unzufriedenheit, wenn sie groß genug ist, um als Grundlage für deine Entscheidung zu dienen, auch groß genug ist, um die Männer zum Reden zu bringen.«
Da jedoch der Versuch, Tharkays ausgezeichnetem Rat nachzukommen, nun in öffentlichem Aufruhr geendet hatte, war Bligh nur noch mehr darauf bedacht, die Gunst der Stunde zu nutzen und Laurence weiter zum Handeln zu drängen. »Hunde, Kapitän Laurence, Hunde und feige Schafe, allesamt«, tönte Bligh und ignorierte einmal mehr Laurence’ Versuch, seine Anrede zu berichtigen und in ein Mr. Laurence zu verwandeln. Bligh erschien es vermutlich passender, dachte Laurence wütend, wenn er von einem Militäroffizier wiedereingesetzt würde und nicht von einer Privatperson.
Bligh fuhr fort: »Ich gehe davon aus, dass Sie nun völlig mit mir übereinstimmen. Es ist unvorstellbar, dass Sie anderer Meinung sind. Dieses Verhalten in der Kolonie ist die unmittelbare Konsequenz aus dem empörenden Versuch der Rebellen, die Autorität des Königs für sich zu beanspruchen. Welches Maß an Respekt und Disziplin könnte unter einer Führung schon aufrechterhalten werden, die jedes anständigen, gesetzmäßigen Fundaments entbehrt, die keinerlei Loyalität mehr kennt und …«
Hier machte Bligh eine Pause. Vielleicht überlegte er es sich noch einmal anders und erwähnte angesichts von Laurence’ Ruf an dieser Stelle die Tugend des Gehorsams besser nicht. Stattdessen schwenkte er um, und ohne viel Zeit zu verschwenden, fuhr er fort: »… und keine Anständigkeit. Erlauben Sie mir, Ihnen zu versichern, dass sich dieses unverzeihliche Verhalten in allen militärischen Rängen in der ganzen Kolonie finden lässt und von den Anführern geduldet, ja sogar gefördert wird.«
Eine gleichermaßen körperliche wie seelische Müdigkeit und ein Gefühl des Wundseins machten Laurence aufbrausend. Seine Rippen waren unter der behelfsmäßigen Bandage angeschwollen und empfindlich geworden, seine Hände taten weh. Was ihn am meisten schmerzte, war die Tatsache, dass außer dem wachsenden Gefühl von Abscheu nichts gewonnen worden war. Er war nur zu gern bereit, schlecht von den Führern der Kolonie, Johnston und MacArthur, zu denken, aber Bligh hatte sich ebenfalls nicht bei ihm beliebt gemacht, und seine nicht zu übersehende Zufriedenheit nach den Vorfällen in der Stadt war zu übertrieben und zu offenkundig eigennützig.
»Ich muss mich wundern, Sir«, sagte Laurence, »wie Sie hier regieren wollen, wenn Sie doch gezwungen sind, auf dieselben Soldaten zurückzugreifen, die Sie augenblicklich so verabscheuen. Wenn Sie sich erst mal der Anführer entledigt haben, die von den Männern so sehr geschätzt werden, weil sie ihnen so viel Freiheiten gewährt haben, wie wollen Sie sich danach ihre Loyalität sichern? Zumal dann, wenn Sie von einem Mann ins Amt zurückgebracht werden, den diese Burschen als Gesetzlosen betrachten?«
»Oh«, Bligh winkte ab, »Sie messen ihrer Loyalität zu viel und ihrem gesunden Menschenverstand zu wenig Bedeutung zu. Die Männer hier wissen natürlich, dass MacArthurs und Johnstons Tage gezählt sind. Die Länge der Seereise, die Schwierigkeiten in England, das allein hat sie bislang geschützt. Aber die Schlingen am Galgen warten bereits auf beide, und je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr verlieren die Vorteile ihrer Ernennung an Glanz. Ich werde einige Zugeständnisse machen und Versicherungen abgeben; natürlich sollen sie ihre Landansprüche behalten, und auch die Vereinbarungen, die nicht allzu schädlich sind, können bleiben…«
Er machte noch weitere Bemerkungen dieser Art, wobei er, soweit Laurence das beurteilen konnte, wenig mehr vorhatte, als einige neue Beschränkungen durchzusetzen, welche auf den äußeren Anschein ausgelegt waren und mit Sicherheit die Männer noch mehr aufbringen würden. Sie würden ohnehin schon durch die Tatsache verärgert sein, dass ein Außenstehender und ein Feind einen Umsturz ihrer Regierung bewirken würden, die sie zwar nicht notwendigerweise selbst gewählt, jedoch toleriert hatten.
»Ich kann mir auch nur schwer vorstellen«, sagte Laurence nicht sonderlich höflich, »wie genau Sie diese Laster, die Sie verurteilen, wieder eindämmen wollen, wo Ihnen das doch auch während Ihrer ersten Amtszeit nicht gelungen zu sein scheint. Außerdem ist Temeraire keineswegs eine magische Kanone, die man nach Belieben auf jeden hetzen kann, der Ihnen gerade so einfällt, auch wenn Sie das zu glauben scheinen.«
»Wenn diese Aneinanderreihung von heuchlerischen Einwänden dazu dienen soll, Sie davon zu entbinden, mir zu Diensten zu sein, Mr. Laurence«, antwortete Bligh, und seine eingefallenen Wangen liefen tiefrot an, »dann muss ich dies als eine weitere Enttäuschung verstehen und es als negative Aussage über ihren Charakter vermerken.« Diese Worte hatte er mit einem bitterbösen und äußerst unangenehmen Unterton ausgestoßen, ehe er mit zornig und fest zusammengepressten Lippen das Drachendeck verließ.
Wenn Bligh seinem bisherigen Muster treu blieb, dann würde er jedoch schon bald seine überhasteten Äußerungen bereuen und ein weiteres Gespräch suchen, das wusste Laurence nur zu gut. Er fühlte sich mittlerweile so aufgerieben, dass es ihm schon ganz gleich war, dass er dann eine vorgetäuschte Entschuldigung würde ertragen müssen, der unweigerlich eine Flut von ewig gleichen Argumenten folgen würde, die er bereits viele Male gehört und zurückgewiesen hatte.
Ursprünglich hatte er vorgehabt, an Bord des Schiffes zu schlafen, dessen Atmosphäre sich sehr verbessert hatte: Die Strafgefangenen waren in die zweifelhafte Obhut der Kolonie entlassen worden. Riley hatte jeden einzelnen seiner Männer dazu abgestellt, die unteren Decks zu schrubben und von dem ungesunden Dreck und Gestank zu befreien, den mehrere Hundert Männer und Frauen hervorgebracht hatten, denen man nur ein Minimum an Bewegung und Freiheit gewährt hatte, die so grundlegend für die Gesundheit waren. Alles war ausgeräuchert worden, und dann hatte das Wischen wieder von vorne begonnen.
Nachdem die sichtbaren Verunreinigungen ebenso entfernt worden waren wie die ständig über allem schwebende Aura des Elends, war Laurence’ schmales Quartier nun zwar noch immer keine luxuriöse, aber durchaus bequeme Unterkunft, gemessen an seinem eigenen Standard, den er in den früheren Jahren entwickelt hatte, als die Hängematte eines Offiziersanwärters hatte ausreichen müssen.
Der kleine Unterschlupf auf dem Felsvorsprung der Drachen hatte noch immer kein Dach, und die letzte Seitenwand fehlte ebenfalls, aber Laurence war in geistiger Hinsicht noch wunder und erschöpfter als in körperlicher, und das Wetter schien sich zu halten. So ging er nur kurz in sein Quartier, um ein paar Sachen zusammenzusuchen, und verließ dann das Schiff, um sich in Temeraires Gesellschaft zu flüchten.