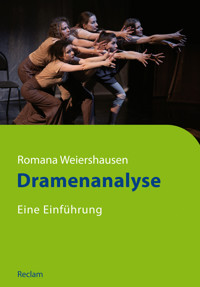
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Studienbuch Germanistik
- Sprache: Deutsch
Eine faszinierende Neubelebung der Rittermythen für unsere Zeit – die Geschichte des Artusritters Ségurant, der auf der Suche nach ewigem Ruhm einem imaginären Drachen nachjagt. Ségurant ist von allen Artusrittern vielleicht der heutigste. Auch wenn er im Lanzenstechen und Schwertfechten unbesiegt bleibt, ist er nicht zufrieden. Verzaubert von der Fee Morgane, jagt er einem imaginären Drachen nach, den er nicht finden kann. Auf der Suche nach ewigem Ruhm verschwindet er am Ende und wird daraufhin vergessen. So war auch der vorliegende Text über lange Zeit verschollen und wurde erst kürzlich von dem Mediävisten Emanuele Arioli aus 28 fragmentarischen Fundstücken rekonstruiert, die er bei einer zehnjährigen Recherche in ganz Europa zusammengetragen hat. Ségurant. Die Legende des Drachenritters ist ein mitreißender Ritterroman voller Abenteuer, Zauberei und der Suche nach dem Heiligen Gral, der Leser in die faszinierende Welt des Mittelalters entführt. »Ein Artusroman, der – seiner Zeit weit voraus – die vergebliche Suche in der entzauberten Welt eines Don Quijote ankündigt.« Le Figaro E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Romana Weiershausen
Dramenanalyse
Eine Einführung
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag Gmbhnach einem Konzept von zero-media.net
Coverabbildung: Schauspielerinnen spielen eine moderne lyrische Performance der Theaterbühne. © Kozlik/Shutterstock
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2024
RECLAM, ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962315-3
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011458-2
www.reclam.de
Inhalt
Zum Gebrauch des Studienbuchs
Einleitung: »Drama«? Charakteristik einer Gattung
Was unterscheidet Dramen von Gedichten und Erzähltexten?
1 Texte für das Theater: Voraussetzungen
1.1 Was ist Theater?
1.2 Die Bühne
1.3 Die Schauspieler
1.4 Checkliste: Fragen zur Theatersituation – für die Dramenanalyse
2 Kommunikationssituation Drama
2.1 Showing versus telling
2.2 Haupt- und Nebentext
2.3 Raum und Zeit
2.3.1 Raumuntersuchungen im Drama
2.3.2 Zeituntersuchungen im Drama
2.4 Wissensregime
2.5 Der ›performative Pakt‹ als Thema: Spiel-im-Spiel
2.6 Checkliste: Fragen zur Kommunikationssituation – für die Dramenanalyse
3 Formanalyse systematisch: Bauelemente des Dramas
3.1 Vor- und Zwischeninformationen im Nebentext
3.1.1 Titel und Personenregister
3.1.2 Regiebemerkungen
3.2 Handlung und ihre Sequenzierung
3.3 Figuren
3.4 Figurenrede
3.5 Szenenanalyse
3.6 Checkliste: Fragen zur Anlage dramenanalytischer Untersuchungen
4 Formanalyse historisch: ›aristotelisches‹ Drama und Positionen des Wandels
4.1 Aristoteles
4.2 Barock
4.3 18. Jahrhundert: Schlaglichter eines Jahrhunderts der Theaterreformen
4.3.1 Frühaufklärung: Gottsched
4.3.2 Empfindsamkeit: Lessing
4.3.3 Sturm und Drang: Lenz
4.4 Und heute? Schlaglichter des Wandels im 20. und 21. Jahrhundert
4.4.1 Brechts episches Theater
4.4.2 Dokumentartheater
4.4.3 Postdramatisches Theater
4.4.4 Interkulturalität und »postmigrantisches« Theater
4.5 Checkliste: Fragen zur historischen Kontextualisierung
5 Gattungen: Theorie und Praxis
5.1 Die Gattungsdichotomie Tragödie/Komödie – und die ›Tragikomödie‹
Und die Tragikomödie?
5.2 Gattungstheorie und Gattungsgeschichte: Probleme und Chancen
5.3 Gattungsanalyse in der Praxis
Ein Untersuchungsbeispiel
5.4 Checkliste: Fragen zum Gattungsbezug bei der Dramenanalyse
6 Dramenanalyse in der Literaturwissenschaft
6.1 Ein Blick zurück: Drei Analyse-Ansätze aus dem 19. und 20. Jahrhundert
6.1.1 Gustav Freytag: Die Technik des Dramas (1863)
6.1.2 Volker Klotz: Geschlossene und offene Form im Drama (1960)
6.1.3 Peter Szondi: Theorie des modernen Dramas (1956/1963)
6.2 Aktuelle Einführungsbände zur Dramenanalyse – im kommentierten Überblick (zusammengestellt von Christiane Dietrich)
6.3 Nützliche Nachschlagewerke
Allgemein
Dramen- und Theatergeschichte
7 Digitale Methoden der Dramenanalyse
7.1 Historische Motivierung
7.2 Digitale Textkorpora als Analysegrundlage
7.3 Digitale Methoden als Hilfsmittel
7.4 Netzwerkanalyse und Interpretation
7.5 Zusammenfassung
Software und Tools
Literaturverzeichnis
Zitierte Theatertexte
Zitierte Forschungsliteratur und Quellen zur Dramentheorie
Namenregister
Sachregister
Zu den Autoren
[7]Zum Gebrauch des Studienbuchs
Um es gleich vorweg zu sagen: Das vorliegende Studienbuch verfolgt im Ansatz einen etwas anderen Weg als gemeinhin üblich. Eine »Einführung in die Dramenanalyse« lässt Technisches erwarten, Fachterminologie und Systematik eines Werkzeugkastens. Darum wird es auch gehen. Der in langjähriger Studienpraxis erprobte nützliche Kern dramenanalytischer Kenntnisse soll vorgestellt und weitergegeben werden. Aber das darüber hinausgehende zentrale Anliegen ist es, ein Gespür dafür zu vermitteln, was ein dramatisches Kunstwerk ausmacht, welche ästhetischen Strategien in ihm liegen können und wie die historische Situation seiner Entstehung mit ihren jeweiligen medialen Bedingungen, mit kunsttheoretischen Debatten, mit Gattungsbezügen und Publikumserwartungen auf das Kunstwerk einwirkt und es mit prägt.
Die Darstellungsweise im Studienbuch ist darauf ausgerichtet: Dramenanalytische Kategorien sollen nicht als fixierter Katalog präsentiert werden, sondern als historisch entstanden und – im dynamischen Umfeld sich wandelnder Formvorstellungen – auch unterschiedlich in Dramen realisiert. Ausgehend von dramaturgischen Bezugsgrößen, wie sie sich in der Dramentradition herausgebildet und zwischenzeitlich konsolidiert haben, soll der Blick für ihre Variabilität offengehalten werden. Zu diesem Zweck werden sie, wo es sich anbietet, am Beispiel erläuternd entwickelt.
Prinzipiell liegt dem Band die Überzeugung zugrunde, dass sich eine Dramenanalyse nicht mit der schematischen Anwendung von Kategorien begnügen kann. Vielmehr gilt es, sich auf Spielregeln in einem beweglichen Kommunikationssystem einzulassen. Das Studienbuch soll neben der Weitergabe von terminologischem Fachwissen auch Geschichte erzählen, um ein tieferes Verständnis für Konstellationen zu eröffnen und im besten Fall Lust darauf zu machen, im wechselvollen und spannungsreichen Feld der dramatischen Kunst weiterzuforschen. Mit Blick auf diesen Horizont eines forschenden Lernens, denn das bedeutet ein Studium, werden immer wieder auch literaturwissenschaftliche Debatten angedeutet.
Dieses Vorgehen hat im Vergleich zu einem eher deduktiv an Definitionen orientierten Lehrbuchstil den Vorrang erhalten: Als Start in die literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit dramatischen Texten wird die stärker problemorientierte Perspektive vorgeschlagen. Entsprechend werden die Sachverhalte in Zusammenhängen entfaltet. Damit soll zugleich zum eigenständigen Transfer befähigt werden. Denn im Umgang mit experimentellen und neuen offenen dramatischen Formen ist der traditionelle Kriterienkatalog nur bedingt einsetzbar. Aussagekräftig bleibt er immerhin für die abgrenzende Beschreibung der jeweiligen Innovation.
[8]Dabei soll das Rad keineswegs neu erfunden werden. Im Gegenteil: Es ist ein unschätzbarer Vorteil, auf verdienter Grundlagenliteratur aufbauen zu können. Darstellungen, die sich in der eigenen Lehrerfahrung als besonders nützlich erwiesen haben, werden einbezogen und zitiert. Das Unterkapitel 6.2 bietet darüber hinaus einen von Christiane Dietrich erstellten Überblick über gängige Einführungswerke mit Hinweisen darauf, für welche Aspekte eines erweiternden Studiums sie geeignet sein könnten.
Die Einführungswerke unterscheiden sich grundsätzlich (1) darin, wo sie das Drama im Verhältnis zwischen der Literaturwissenschaft und der Theaterwissenschaft situieren, und (2) hinsichtlich ihrer theoretischen Voreinstellung: ob sie eine bestimmte theoretische Denktradition verfolgen (dialektisch, strukturalistisch, kommunikationstheoretisch) oder Kenntnisse poetologisch, historisierend, empirisch-kulturwissenschaftlich oder rein als Analysemethodik ordnen. Das Studienbuch bietet hier eine Metaebene an, um sich in diesem Wissen zurechtzufinden. Es stellt Bauelemente des Dramas für die Analyse vor, stellt Analysekategorien in ihren historischen Kontext und erklärt sie anhand von Beispielen im laufenden Text. Es leistet damit einen ersten Zugang zu anderen Problemfeldern, zur Vertiefung und Erweiterung von historischem Epochen- und Theoriewissen.
Gerade in jüngerer Zeit wurde das Feld durch Erkenntnisse aus der Theaterwissenschaft beeinflusst und bereichert. Dies ist zu berücksichtigen, zugleich aber sollte der Adressatenbezug nicht aus den Augen verloren werden: Das Studienbuch richtet sich als »Einführung in die Dramenanalyse« dezidiert an Studierende der Literaturwissenschaften und soll entsprechende Bedürfnisse bedienen. Die einbezogenen theaterwissenschaftlichen Aspekte werden also immer für die Textanalyse perspektiviert.
Das vorliegende Buch verdankt viel der unterstützenden Mithilfe meiner Arbeitsgruppe: Annika Guilpain, Johann Horras, Lena Mittermüller, Lars Schwindling, bei den wichtigen Sondierungen zu Beginn des Projekts Lena Scheid und sowieso immer Brigitte Braun. Einen besonderen Anteil an der Fertigstellung des Buchs hat Christiane Dietrich, meine ›Sparringspartnerin‹ in der entscheidenden Phase. Meinem Kollegen Johannes Birgfeld danke ich für das engagierte Korrekturlesen. Seine profunden Kenntnisse der speziellen Formen des Gegenwartstheaters hätten noch mal einen ganz eigenen Band verdient gehabt.
[9]Einleitung: »Drama«? Charakteristik einer Gattung
Als Einstieg lohnt sich die Überlegung, was eigentlich die Spezifik der dramatischen Gattung ausmacht. Man kann bei dem Befund ansetzen, dass das Kommunikationssystem im Fall des Dramas ein besonderes ist, denn in der Regel soll es auf einer Theaterbühne szenisch realisiert werden. Mit dem Medientransfer gehen spezifische Darstellungsbedingungen und Wirkungsmöglichkeiten einher.
Mit der Rezeptionsform der Theaterkunst hängt zusammen, dass man ihr gemeinhin eine größere Wirkung im Kontext gesellschaftlicher Prozesse zuschreibt als den meisten anderen Kunstformen. Denn bei einer öffentlichen Aufführung sind, anders als etwa beim Roman, die Rezipienten an einem Ort versammelt, so dass eine gemeinsame Reaktion möglich ist. Das Drama, das auf einer Bühne aufgeführt wird, lässt Kunst potentiell zu einem Gruppenereignis werden. Als solches kann es in sozialen Funktionszusammenhängen stehen. Man mag dabei an die antiken Ursprünge im Kontext religiöser Kulte denken, an theatrale Manifestationen höfischer Macht in der Frühen Neuzeit oder an die Nutzung des Theaters als didaktisches Mittel, sei es im barock-theologischen oder bürgerlich-aufklärerischen Sinn. Man kann sich auch vor Augen führen, wie das Theater für politische Agitation während der Französischen Revolution oder der Weimarer Republik eingesetzt wurde sowie als Propagandainstrument im Dritten Reich. Noch die Theaterprovokationen der 1970er Jahre machen deutlich: Das Theater mit den ihnen zugrundeliegenden Texten hat sich immer wieder als Indikator und Faktor sozialhistorischer Prozesse erwiesen.
Als Kunstform stehen Dramen (wie andere literarische Gattungen) zudem im Umfeld von ästhetischen Debatten und haben teil an literarhistorischem Wandel der Inhalte und Ausdrucksformen. Der Kunstbetrieb ist dabei als lebendiges System zu betrachten: Formkonventionen und Regeln ändern sich nicht nur in diachroner Perspektive, es kann auch in einer Zeit mit ihnen gespielt werden.
Die allgemeine Voraussetzung, sich bei der Interpretation eines Werks mit den gattungsspezifischen Formelementen auszukennen, gilt für alle Gattungen, womöglich aber für das Drama noch einmal in besonderem Maße. Denn in der Geschichte der Poetik sind gerade bei der dramatischen Gattung die Form-Debatten besonders intensiv geführt worden. Mit dem produktionsorientierten Argument, dass ein Drama bestimmte Regeln einhalten müsse, um auf der Bühne zu funktionieren (etwa aufgrund der notwendigen Verdichtung der Handlung auf einen bühnentauglichen Moment), wurde der Formgebung ein großes Gewicht beigemessen.
Festzuhalten ist, dass ein Drama ein sprachliches Kunstwerk mit spezifischer Gestaltungsweise ist, die sich vom Aufführungsgedanken herleitet und sich als [10]Gattungsform auch auf die Dramen auswirkt, die nie aufgeführt wurden oder sogar von vornherein als Lesedramen geschrieben wurden.
Was unterscheidet Dramen von Gedichten und Erzähltexten?
Seit früher Zeit hat man zu beschreiben versucht, was das Drama als Gattung ausmacht. Wenn Aristoteles das Wesen des Dramas mit der »Nachahmung von Handlung« beschreibt (Poetik, nach 335 v. Chr.) oder gut 2000 Jahre später August Wilhelm Schlegel in seinen Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur (1809–11) den »dialogischen Charakter« des Dramas betont und Johann Wolfgang Goethe in eigenwilliger Verbindung von strukturellen und stimmungsbezogenen Kriterien die »persönlich handelnde« Form des Dramas gegen die »klar erzählende« des Epos und die »enthusiastisch aufgeregte« der Lyrik abgrenzt (Naturformen der Dichtung, 1819), so zielen sie trotz unterschiedlicher Akzentsetzung doch alle auf einen gemeinsamen Kern: Das Besondere der dramatischen Gattung ist die szenische Präsentation des Geschehens, das sich in direkten Gesprächen zwischen den handelnden Figuren entwickelt. Darauf verweist auch die Herkunft des Wortes, denn das altgriechische Wort δρᾶμα (drāma) bedeutet ›Handlung‹, wobei die darbietende Aktion mitgemeint ist: über handelnde Personen.
In der heutigen Literaturwissenschaft werden im Blick auf die Gattungstrias (Lyrik, Epik und Dramatik) drei Abgrenzungskriterien angeführt, um zu charakterisieren, was die wesentlichen Unterschiede sind (Burdorf 1997, S. 18 f.): das Handlungskriterium (hier im Sinne von plot: Gibt es eine sich entwickelnde Geschichte?), das Medienkriterium (Wie ist die Art der Darbietung?) und das Redekriterium (Wer spricht?). Mit dem Handlungskriterium lassen sich Dramen und Erzähltexte von Gedichten abgrenzen, die in der Regel keinen plot haben. Mit dem Medienkriterium lassen sich Dramen vor allem von Erzähltexten abgrenzen, die nicht aufgeführt werden, nur bedingt auch von Gedichten, die immerhin aufgrund ihrer lautlichen Qualität die Rezitation vor einem Publikum nahelegen. Das Redekriterium unterscheidet alle drei Gattungen voneinander: Im Drama sprechen die Figuren selbst (unvermittelt), im Gedicht nur der Sprecher (abstrakt bleibend oder auch als »lyrisches Ich«, wenn es durch Personalpronomina der ersten Person präsent ist), im Erzähltext Figuren und Erzähler (wobei der Erzähler, personal greifbar, sogar Teil der erzählten Welt sein kann oder eine abstrakte Erzählinstanz).
Abb. 1: Abgrenzung des Dramas von Lyrik und Erzählprosa
Es versteht sich von selbst, dass diese Unterscheidung idealtypisch gemeint ist, also nur den Kern der jeweiligen Gattung adressiert. Denn es gibt zahllose Sonderfälle, bei denen die Abgrenzung fragwürdig wird. Das Rollengedicht etwa kennt [11]sowohl eine Handlung als auch sprechende Figuren, das epische Theater nach Brecht setzt bewusst distanzierende Erzählelemente ein.
Für die Dramenanalyse von besonderem Interesse ist das Medienkriterium, weil es deutlich macht, dass die Aufführung und damit die Existenz eines Publikums strukturell mitzudenken ist (Hinck 1980, S. 8), wobei dem Publikum unterschiedliche Funktionen zugewiesen sein können: Es kann als »passiver Beobachter« oder als »aktiver Partner« am Theatergeschehen teilhaben (Schößler 2012, S. 8 f.).
Wenn man einen Dramentext adäquat beschreiben will, kommt es neben der terminologisch sicheren Klassifizierung auch auf die historische Kontextualisierung an. So sollte man sich bewusst machen, für welche Präsentationsform und welche Adressatengruppe er geschrieben wurde und wann bzw. wo, also im Umfeld welcher Theaterkonventionen. Es gilt entsprechend, bei der Textanalyse auch eine medienbezogene und eine historische Komponente zu berücksichtigen.
Daraus ergibt sich die Gliederung des Studienbuchs:
Kapitel 1 liefert – sozusagen als Voraussetzung – einen Blick auf die Bedingungen der Theaterpraxis. Kapitel 2 schlägt die Brücke zum Text, indem die Kommunikationssituation beim Drama untersucht wird. Die folgenden beiden Kapitel richten sich auf Kernkompetenzen bei der dramenanalytischen Arbeit: Kapitel 3 widmet sich den allgemeinen Bauelementen eines Dramas, Kapitel 4 Beispielen der Dramaturgie und Dramenpoetik, um die historische Variabilität des Umgangs mit solchen Bauelementen aufzuzeigen. In Kapitel 5 geht es um Differenzierungen zwischen dramatischen Gattungen in Theorie und (literarischer) Praxis. [12]Kapitel 6 dient der Übersicht über literaturwissenschaftliche Beiträge zur Dramenanalyse. Den Abschluss des Bandes bildet ein Gastbeitrag zu einem neuen, aufstrebenden Feld: Benjamin Krautter stellt darin die aktuellen Entwicklungen der Digital Humanities im Bereich computergestützter Dramenanalyse vor.
Eine grundsätzliche Bemerkung zu Geschlechterverhältnissen sei noch vorausgeschickt: Wenn im Band das generische Maskulinum verwendet wird, dann mag man dabei durchaus eine kritische Markierung mitlesen. Die Geschichte des Dramas wurde von männlichen Akteuren und einem Diskurs dominiert, der Frauen keine gleichberechtigte Mitwirkung zugestand.
Hürden gab es für Frauen überall im Literaturbetrieb, im Fall der dramatischen Gattung aber noch mit zusätzlicher Schärfe. Aufgrund des Stellenwerts, den man beim Drama der Form zuwies, wurde von Dramatikern besonders mit Blick auf die Tragödie die höchste Kunstfertigkeit gefordert – was nicht selten als Ausschlusskriterium gegen schreibende Frauen ins Feld geführt wurde, denen das Bildungssystem lange nicht offenstand (vgl. Weiershausen 2004). Besonders im späten 18. und im 19. Jahrhundert wurde die soziale Geschlechterrolle mit Trennung von öffentlicher und privater Sphäre, von Werktätigkeit und häuslich-familiärer Arbeit im Diskurs mit einem naturgegebenen ›Geschlechtscharakter‹ verbunden (vgl. Hausen 1976). Insgesamt dominiert in den historischen Quellen der Zeit die Auffassung, das zwar ›schöne‹, aber ›ungelehrte‹ Geschlecht könne sich seinen eher lebens- statt kunstbezogenen Ausdruck allenfalls in weniger streng regulierten Gattungen verschaffen, etwa dem Roman mit seinen Freiräumen zur ›Geschwätzigkeit‹ (vgl. z. B. Becker-Cantarino 1989; Bürger 1990).
Die Problematik des Geschlechterdiskurses zeigt exemplarisch, was Spielregeln im Kunstbetrieb bedeuten können, denn trotzdem gab es im 18. und 19. Jahrhundert eine beachtliche Dramenproduktion von Frauen (vgl. z. B. Lexikon deutschsprachiger Epik und Dramatik von Autorinnen 2006; Colvin 2003). Die Autorinnen sahen sich aber gezwungen, besondere Strategien zu nutzen (vgl. Hahn 1991; Kord 1996): beispielsweise eine anonyme Veröffentlichung oder eine unter männlichem Pseudonym, eine legitimierende Rahmung durch ein wohlwollendes Herausgebervorwort, einen Stoff aus dem wirklichen Leben, einen betont didaktischen Nutzen oder religiösen Bezug (vgl. Kazmaier/Weiershausen 2016). Die Schwierigkeiten einer Teilhabe differierten allerdings je nach sozialem Stand und persönlichem Umfeld sowie dem angestrebten Tätigkeitsfeld (zur allgemeinen Situation von Frauen im geschichtlichen Überblick vgl. z. B.: Geschichte der Frauen 1993–1995; Bock 2000).
Beim Lesen der folgenden Ausführungen kann es ein aufschlussreiches Experiment sein, an die Stelle generisch maskuliner Formen (Dramatiker, Zuschauer, [13]Leser, Regisseur) testweise das weibliche Pendant einzusetzen. Die Leserin und der Leser mögen sich dabei fragen, in welchen Positionen (z. B. Autorin, Poetikerin oder Schauspielerin) und in welchen Epochen (z. B. Antike, Aufklärung oder Gegenwart) es genauso gut passt wie die maskuline Form, in welchen es irritierend und realitätsfremd wirkt und in welchen es Diskussionen öffnet, weil die geschlechterpolitischen Verhältnisse nicht so klar oder im Umbruch sind. In den Fällen, wo das feminine Genus widerständig klingt (z. B.: Poetiker und Poetikerinnen im 17. Jahrhundert), ist dies ein Signal für faktisch bestehende geschlechterbedingte Missverhältnisse: sei es durch den Ausschluss von Frauen von Bildungs- und Kultureinrichtungen oder sei es durch eine Traditionsbildung und Überlieferungspraxis, die kulturelle Beiträge von Frauen marginalisiert hat. Denn nicht nur auf der Produktionsebene wird gesellschaftliche Exklusion betrieben (vgl. Heydebrand/Winko 1995; Thurner 2010).
Erst durch die sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts (mit Anfängen in den 1980er Jahren) etablierende Frauenforschung wurden viele Autorinnen früherer Zeiten (wieder) entdeckt und Frauenliteraturgeschichten und -lexika veröffentlicht (vgl. z. B. Deutsche Literatur von Frauen 1988; Autorinnen Lexikon 2002; Frauen-Literatur-Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart 2003; Lehmstedt 2004; Schmid-Bortenschlager 2009; zur Gegenwart: KLG-Extrakt: Schriftstellerinnen 2018 ff.).
Das Desiderat geht dabei noch weiter, marginalisiert wird bekanntermaßen nicht nur auf der Basis des Geschlechts. Auf strukturelle Rassismen in der aktuellen Theaterlandschaft etwa reagieren Bestrebungen eines »postmigrantischen Theaters« (vgl. Kap. 4.4.4).
[15]1 Texte für das Theater: Voraussetzungen
Im strengen Sinn ist ein Drama als Text ein unvollständiges Kunstwerk, denn es ist ein sprachliches Produkt, das auf seine Präsentation auf der Bühne zielt. Abgesehen von dem Sonderfall, dass es direkt als Lesedrama geschrieben wurde, wird ein Drama erst mit seiner Aufführung vollendet: Die angestrebte Rezeptionsform ist nicht die des Lesens, sondern die des Zuschauens. Der Dramentext selbst, so könnte man zuspitzen, zielt also in erster Linie auf die Vermittler: die Theaterakteure (von Regie und Dramaturgie1 bis zum Schauspiel und zur Bühnenbildnerei). Vom »›Partitur‹-Charakter des Textes« spricht daher Walter Hinck (1980, S. 7), und Franziska Schößler beschreibt die Inszenierung als zweite Komponente, die neben »dem schriftlich fixierten Text« zum Drama dazugehöre, indem sie den Text in eine sinnlich (akustisch und visuell) zu rezipierende Form »übersetzt« (Schößler 2012, S. IX). Dennoch ist das Drama auch schon als Text zu verstehen, da ihm die Signale für den Transfer auf die Bühne eingeschrieben sind, die entsprechend auch beim Lesen wahrgenommen werden können.
Im Vergleich zu Begriffsverwendungen, bei denen mit »Drama« das Theater mitgemeint ist, wird im vorliegenden Band genau getrennt: Als Drama wird hier ausschließlich die Textform bezeichnet (in synonymer Verwendung gebräuchlich: Bühnenwerk, Theaterstück). Dieser Text wird inszeniert und in Aufführungen dem Publikum dargeboten. Auch hier gilt es, terminologisch zu differenzieren: Während »Aufführung« die einzelne konkrete Realisierung bezeichnet, die sich nie genau so wiederholen lässt (z. B. sind bei jeder Aufführung andere Zuschauer anwesend wie auch die Tagesform der Schauspieler variiert), verweist »Inszenierung« auf das dahinterliegende Realisierungskonzept, was die Gesamtheit der Probenarbeit und der Aufführungen einschließt.
Dass sie letztlich nicht für das Medium Buch schreiben, sondern für das Medium Theater, verändert die Rahmenbedingungen für die Dramenautoren wesentlich – was entsprechend auch bei der Analyse von Dramen berücksichtigt werden muss. Für die Autoren gilt, dass beim Schreiben eines Dramas die Theaterbedingungen zu bedenken sind: Was ist technisch (mit der vorhandenen Bühnentechnik usw.) überhaupt aufführbar? Welcher Zeitumfang ist zumutbar? Welche Erwartungen und Konventionen sind zu beachten, um eine erfolgreiche [16]Aufnahme zu fördern? Welche Erläuterungen sind dem Text für die Theaterakteure mitzugeben, damit die Umsetzung in beabsichtigter Weise gelingt? Die Orientierung an den Bühnenerfordernissen (allgemein-strukturell und spezifisch in der jeweiligen historischen Situation) bedingt maßgeblich die Form des Dramas.
Bei all diesen Aspekten wird schnell klar: Sie sind in hohem Maß einem historischen Wandel unterworfen. Außerdem sind sie von den jeweils adressierten sozialen Gruppen (z. B. Theater für eine sozial breite Öffentlichkeit oder für den Hofadel) und von allgemeinen kulturellen Prägungen abhängig. Dies beginnt bei Bühnenformen und technischen Möglichkeiten, geht über Schauspiel- und Regiestile und endet bei Sehgewohnheiten und Geschmacksfragen.
Will man ein Drama analysieren, sollte man sich daher das jeweilige historische Umfeld vergegenwärtigen, in dem und für das es geschrieben wurde. Denn dieses bestimmt wesentlich die Rahmenbedingungen und damit die Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten, die vorherrschten und vor deren Hintergrund auch etwaige Besonderheiten eines Dramas erkennbar werden.
Abb. 2: Beteiligte im Produktions- und Rezeptionsprozess
Außerdem ist ganz allgemein im Blick zu behalten, dass die Wirkungsästhetik eben auf ein zuschauendes Publikum zielt und dass der Zeichencode des Textes im Prozess der Inszenierung also um weitere theatrale Codes (visuelle, akustische) erweitert werden muss. In diesem Sinne kann man das dramatische Gesamtkunstwerk als »aufgeführten Text« auffassen, der »plurimedial« funktioniert, also nicht nur unter Nutzung »sprachlicher, sondern auch außersprachlich-akustischer und optischer Codes« (Pfister 2001, S. 24 f.).
Will der Autor die Zuschauer erreichen, muss er also schon bei der [17]Textproduktion die theatralen Umsetzungsprozesse mitbedenken. In diesem Kapitel wird daher zunächst einmal auf das Medium des Theaters (im Rahmen europäischer Theatertraditionen) eingegangen: als Zielpunkt, auf den hin der Dramentext angelegt ist.
1.1 Was ist Theater?
Die Frage, was Theater ist, hat Erika Fischer-Lichte mit einer Minimaldefinition beantwortet: Theater bedarf mindestens »einer Person A, welche X präsentiert, während S zuschaut« (Fischer-Lichte 2007, S. 16).
Es müssen somit notwendigerweise zwei Dinge zusammenkommen: ein bewusster Darstellungsakt einerseits und die gleichzeitige Anwesenheit von einem oder mehreren Zuschauern. Ohne Darsteller, aber auch ohne Publikum gibt es kein Theater. Rollenspiele unter Kindern (bei denen es nur Akteure und keine Zuschauer gibt), auch Aktionsformen wie das »Unsichtbare Theater« nach Augusto Boal (bei dem kritische Situationen von Eingeweihten gespielt werden, um die – nicht eingeweihten – Passanten zu Reaktionen herauszufordern) fallen damit [18]heraus. Denn erst mit der Zurschaustellung, die als solche von einem Publikum erkannt wird, entsteht Theater im engeren Sinne. Das Theatrale unterscheidet sich vom Alltäglichen durch die absichtsvolle »Hervorhebung« im Rahmen eines »besonders hergerichtet[en]« oder durch andere Markierungen ausgewiesenen Ortes (Eintrittskarte, Versammlungspunkt): »Das Dar- oder Zur-Schau-Stellen bezeichnet […] eine Abgehobenheit in einer bestimmten Umgebung, einem Rahmen (frame)« (Kotte 1998, S. 122).
Innerhalb dieses Rahmens vollzieht sich ein Zusammenspiel mehrererZeichensysteme. Die Theateraufführung eines Dramas realisiert den Text nicht nur mit Sprache und Stimme, sondern kombiniert dies mit Gestik, Mimik und Bewegung der Schauspieler im Raum, ihrer äußerlichen Erscheinung inklusive Kostüm und Maske, einer Gestaltung und Ausstattung des Raums mit Kulissen und Requisiten, Beleuchtung sowie ggf. Videoeinspielungen und Musik oder Geräuschen, womöglich auch Gerüchen.
Abb. 3: Theater (nach Fischer-Lichte 2007)
Bei einer Inszenierungsanalyse sind diese Elemente als komplexer theatraler Code im Wechselverhältnis zueinander zu untersuchen. Das Theatersystem funktioniert natürlich auch ohne Textvorlage, wie etwa im speziellen Bereich der Performance-Kunst. Geht man aber vom textbezogenen Theater aus, bieten sich für die Inszenierungsanalyse zwei Wege an: entweder die Strukturanalyse, bei der man sich die einzelnen Ebenen, also Figur, Handlung, Raum usw., vornimmt, oder die Transformationsanalyse, bei der die Entwicklung vom Text bis zur Inszenierung als Interpretationsakt nachvollzogen wird (zur Vertiefung empfohlen: Balme 2014, S. 87–119; Weiler/Roselt 2017).
Die verschiedenen Elemente der im Theater zur Verfügung stehenden Zeichensysteme bilden den Werkzeugkasten der Inszenierung, die je nach Regiestil nah an der Textvorlage orientiert sein kann (werktreue Inszenierung) oder auch im Gegenteil den Text nur als Ausgangsmaterial für ein ganz neues Kunstwerk sehen kann, das der Regisseur schafft (Regietheater). Dazwischen liegen alle Grade der Abstufung, wobei die Aktualisierung (weitgehende Orientierung am Text, aber Anpassung an die moderne Welt, etwa in den Kostümen oder auch in der Aufladung bestimmter Aspekte der Textvorlage mit aktuellen Bezügen) eine besonders beliebte Variante darstellt (vgl. zu Regiestilen sowie zu einzelnen Regisseuren: Theaterlexikon 2, 2007).
Die Spezifik des Mediums Theater lässt sich auch über die Schlüsselbegriffe Theatralität und Performativität beschreiben. Mit »Theatralität« bezeichnet man die Leistung der Theateraufführung als Kombination der verschiedenen [19]Zeichensysteme, die über den Text hinausgehen. Es handelt sich damit um einen Gegenbegriff zu einer Vorstellung, die das Theater lediglich als nachgeordnet zum Text versteht: als bloße mise en scène (Inszenierung) des Dramas. Mit Theatralität wird zudem die spezifische Theatersituation gefasst, die durch die gleichzeitige Anwesenheit (»Ko-Präsenz«) der Akteure und Zuschauer bestimmt wird. Der Begriff findet jedoch auch jenseits des Theaters Anwendung: für ein bewusst inszeniertes Ausstellen, das so auch aufgenommen wird.
»Performativität« bezieht sich darauf, wie im Theater Inhalte ihre Gültigkeit erhalten. Dem liegt der Begriff der Performanz zugrunde, der der Sprechakttheorie von John Langshaw Austin entlehnt ist: Ein performativer Sprechakt vollzieht im Moment des Aussprechens zugleich eine Handlung (z. B. die Eheformel in der Kirche). Eine solche Kraft kommt im Theater dem Akt des Aufführens zu (allerdings nur für die Dauer der Theateraufführung). Spricht man von der Performativität des Theaters, bezieht man sich auf einer Metaebene auf dieses System des Performativen.
Im Theater wird das im Spiel Ausgedrückte durch das bewusste Darstellen und das bewusste Anschauen besonders ausgestellt. Erika Fischer-Lichte hat für das Zeichensystem des Theaters hervorgehoben, dass es hier nicht nur – wie in der kulturellen Praxis einer Gesellschaft – um eine einfache Bedeutungszuweisung geht (indem man z. B. mit der Kleidung auf eine Wetterlage reagiert, sich einer bestimmten sozialen Schicht zuordnet oder sich berufsbedingt rollengerecht verhält): Im Theater wird dies mit einem zusätzlichen Zeigegestus versehen (der Schauspieler ist nicht identisch mit der Figur, die die Kleidung als Zeichen auf der Bühne trägt usw.). Es findet »in gewissem Sinne eine ›Verdoppelung‹ der Kultur, in der Theater gespielt wird, statt: die vom Theater hervorgebrachten Zeichen denotieren jeweils die von den entsprechenden kulturellen Systemen hergestellten Zeichen. Die theatralischen Zeichen sind daher stets Zeichen von Zeichen« (Fischer-Lichte 2007, S. 19). Diese metareferentielle Beziehung besteht grundsätzlich, kann aber für die Rezeption ausgeblendet (im traditionellen Illusionstheater) oder selbst zum Thema gemacht werden (z. B. in Brechts epischem Theater oder im postdramatischen Theater).
In Anlehnung an Philippe Lejeunes Begrifflichkeiten, mit denen er faktuales von fiktionalem Erzählen unterscheidet (Lejeune 1994),2 könnte man in der traditionellen Theatersituation von einem performativen Pakt zwischen den [20]Theaterakteuren und dem Publikum sprechen: Für die Dauer der Aufführung lässt sich der Zuschauer auf das Spiel auf der Bühne ein, als wäre es eine für sich stehende ›Realität‹. Darauf zielt die Vorstellung der imaginären vierten Wand. Entsprechend pointiert Pfister (2001, S. 327), dass sich im Fall der ›absoluten‹ dramatischen Kommunikation »der reale Schauspieler für den Rezipienten völlig in die fiktive Figur [verwandelt] und ebenso die Bühne in den fiktiven Aktionsraum«. Dagegen werde »diese Absolutheit durchbrochen und ein episch vermittelndes Kommunikationssystem etabliert, wenn die konkreten Elemente der theatralischen Darstellung und damit der Prozeß der Darstellung selbst hinter der Fiktion sichtbar bleiben oder sie sogar verdrängen« (Pfister 2001, S. 327 f.) – wie es etwa speziell im epischen Theater nach Brecht (vgl. Kap. 4.4.1) oder in vielen Inszenierungen der jüngeren Zeit der Fall ist. Solche Durchbrechungen der Trennung zwischen außerfiktionaler Ebene (der Ebene der Produktion und Rezeption) und innerfiktionaler Ebene (der Figurenebene des Dramas) können bereits dem Dramentext eingeschrieben sein, worauf noch einzugehen sein wird.
Man erkennt an der knappen Darstellung bereits, dass man sich dem dramatischen Kunstwerk grundsätzlich von zwei Seiten her nähern kann: eher vom theatralen Endprodukt her (theaterwissenschaftlich) oder von der Ausgangsbasis der Textvorlage her (literaturwissenschaftlich), wobei jeweils auch die andere Seite berücksichtigt werden sollte.
Da es uns um die Dramenanalyse, also sogar im engeren Sinne um den Text geht, ist für unsere Zusammenhänge besonders interessant, welche Theaterfaktoren bereits bei der Textproduktion eine Rolle spielen und die Anlage des Dramas beeinflussen können. Die folgende genauere Darstellung beschränkt sich entsprechend auf zwei Faktoren des Theaterbetriebs: Bühne und Schauspieler.
1.2 Die Bühne
Als Voraussetzung des Zur-Schau-Stellens bedarf es einer ›Bühne‹ als Aktionsraum der Darsteller. Prinzipiell kann jeder Raum zur Bühne werden, auch außerhalb eines genuinen Theatergebäudes, beispielsweise eine Kirche, ein Gerüst auf einem Marktplatz, der Marktplatz selbst mit den angrenzenden Häusern als Kulisse, aber auch eine Straße, ein Wohnzimmer usw.
Die Bühnengegebenheiten unterscheiden sich darin,
ob sie sich im Freien (mit offenen Zugängen oder in einem baulich abgeschlossenen Bezirk) oder in geschlossenen Gebäuden befinden,
[21]ob (und dann in welchem Maße) sie wandelbar sind oder nicht,
ob sie erhöht sind (Podium) oder nicht,
ob es nur eine oder mehrere Spielflächen gibt,
und schließlich darin, wie die Bühne zum Publikum positioniert ist (mittig, seitig oder umgebend). Entscheidend ist dabei immer, dass der entsprechende Raum als Bühne ausgewiesen bzw. wahrgenommen wird.
Welchen Einfluss dabei die Rezeptionshaltung hat, veranschaulicht ein extremes Beispiel des Theaterkollektivs Rimini Protokoll: Die Zuschauer sitzen in einem umgebauten Lastwagen, ausgerichtet auf eine der Längswände, die als Videoprojektionsfläche oder als Fenster dienen kann, so dass von Zeit zu Zeit der Blick auf die reale Stadt freigegeben wird, durch die man fährt (erstmals im Pilotprojekt »Cargo Sofia«, uraufgeführt 2006 in Basel, seither in verschiedenen Varianten fortgeführt). Nun ist dies ein Grenzfall, der die Theaterdefinition von Fischer-Lichte überschreitet, denn die Menschen in der realen Umgebung, durch die der Truck fährt, wissen nicht, dass sie Teil einer Inszenierung werden, sind also keine Schauspieler, die eine Figur verkörpern – wenngleich der Zuschauer sie assoziativ mit den gleichzeitig eingespielten Tonaufnahmen verbindet. Durch die Rahmung wird der Zuschauer mit den eigenen Sehgewohnheiten und Erwartungen konfrontiert. Es wird damit gespielt, die Realität als Inszenierung, die Stadtszenerie als Theaterbühne wahrzunehmen. Dies funktioniert, weil die Zuschauer das Konzept eines Theaters internalisiert haben, das ähnlich mit Sitzreihen auf einen Seh-Ausschnitt hin ausgerichtet ist.
Die heute in Europa immer noch prägende Vorstellung von einer Theaterbühne ist die Guckkastenbühne mit Rampe, ggf. auch mit Orchestergraben, die von einem Bühnenportal mit Vorhang gerahmt wird und deutlich vom Zuschauerraum abgetrennt ist. In dieser Form geht sie auf eine Entwicklung des 17. und 18. Jahrhunderts zurück, die auf die Erzeugung einer möglichst vollkommenen Illusion zielte: Das Publikum schaut dem Geschehen wie durch eine fehlende Wand (die sog. vierte Wand) zu. Diese Grundform passte zum höfisch-repräsentativen wie zum konfessionell-didaktischen Barocktheater, das zur Illusionssteigerung auf aufwendige Kulissen und wirkungsvolle Theatereffekte setzte und mit Unterbühne und Schnürboden (einer Zwischendecke über der Bühnenfläche, von der aus man über Seilzüge Bühnenbestandteile heben und senken kann) auch Hölle und Himmel zu inszenieren verstand. Sie passte ebenso zum bürgerlichen Theater des 18. und dann 19. Jahrhunderts – etwa dem Theater der Aufklärung, das sich der Wahrscheinlichkeit verpflichtet wusste, und dem naturalistischen Theater, dem es um ein möglichst genaues Abbild der Wirklichkeit ging.
[22]Die Raumgestaltung tangiert zudem das Verhältnis zum Publikum. Mit der Guckkastenbühne ist diesbezüglich eine bestimmte Vorstellung verbunden: Die Rolle des Publikums ist auf die des rezipierenden, dabei körperlich passiven Zuschauens beschränkt. Die Trennung zwischen der Aktion auf der Bühne und deren Rezeption ist architektonisch kategorial gesetzt, Interaktionen sind nicht vorgesehen.
In der Moderne und spätestens mit Bertolt Brecht ist diese Trennung zunehmend hinterfragt worden – was konsequenterweise auch zu anderen Raumkonzepten führte: zum Entwurf neuer Formen (man denke etwa an die – nicht realisierten – experimentellen Planungen von Erwin Piscator und Walter Gropius, vgl. Gropius [1934], in: Brauneck 1982, S. 161–169) und zum Rückgriff auf alte Formen (z. B. die mittelalterliche Simultanbühne).
[23]Antike:griechisches Amphitheater(vergleichbar, in leichter Variation: das römische Theater)
Die offene Anlage bestand aus Zuschauerreihen, dem théatron (›Schauanlage‹), im ansteigenden Halbrund oder Überrund um die orchéstra (›Tanzplatz‹), einem Mittelplatz, der dem Chor diente. Die Rundform war allerdings noch bis ins 4. Jahrhundert v. Chr. keineswegs zwingend: Auch Orchestren mit rechteckigem Grundriss sind nachgewiesen. Dahinter befand sich die skené, ursprünglich ein variabler Zeltbau, später ein gemauerter Kulissenbau (Häuserfassade mit Türen und Dachansatz) mit vorgelagertem proskénion, einer kleinen erhöhten Vorbühne, auf der die Schauspieler agierten. Es gab keine künstliche Beleuchtung, aber einen Kran (die mechané), um Flugeffekte oder Göttererscheinungen (vgl. »Deus ex machina«) darzustellen, und einen Bühnenwagen (das ekkýklema) für die Präsentation signifikanter Schaubilder. Es handelte sich um ein Massentheater für viele tausend Zuschauer (für das Dionysostheater aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. in Athen werden bis zu 17 000 Plätze geschätzt; vgl. Isler 2017, S. 78). Schon aufgrund der zu überbrückenden Distanz bis in die letzten Reihen musste auf stilisierte Darstellung gesetzt werden: Masken, Kostüme und das ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. erhöhte Schuhwerk der Tragödien-Darsteller (der Kothurn, von kóthornos ›Stiefel‹), übersteigerte Gesten, Deklamation und Chorgesang.
mittelalterliche Simultanbühne
Im offenen Raum waren alle Spielstätten als Stationen gleichzeitig präsent (im Raum, auf Baugerüsten oder Schauwagen aufgebaut) und wurden von den Zuschauern nacheinander abgeschritten. Die Bezeichnung »Simultanbühne« bildet den Gegensatz zu Theaterformen, bei denen der Wechsel von Szenerien durch Umbau zeitlich nacheinander auf derselben Bühne erfolgt (»Sukzessionsbühne«).
elisabethanisches Theater (England)
Bühnensituation Shakespeares: Der geschlossene runde Theaterbau mit Teilüberdeckung hatte eine von einer Hintergrundbühne in die Mitte hineingebaute erhöhte Vorderbühne, die als zentrale Spielfläche diente. Neben Sitzrängen gab es auch Stehplätze auf dem Platz um die Vorderbühne herum, so dass mit direkter Nähe zum Publikum gespielt wurde. Falltüren in der Bühne erlaubten Versenkungseffekte, mit Kulissen wurde aber nur in eingeschränktem Maß gearbeitet und mit dem offenen Himmel hatte bei Tageslicht Kerzenbeleuchtung kaum Effekt, so dass Nachtszenen und auch größere Wechsel in der Szenerie oft auch durch die Figurenrede markiert wurden, um die Imagination des Publikums zu aktivieren.
Wanderbühne
Bei den Schauspielen für die breite Bevölkerung auf Marktplätzen, die – Ende des 16. Jahrhunderts durch englische, niederländische und italienische Schauspielertruppen eingeführt – im deutschsprachigen Raum bis ins 18. Jahrhundert hinein verbreitet waren, nutzten die Truppen eine mobile erhöhte Bühne mit Rückwand auf einem Wagen, mit dem sie von Ort zu Ort zogen. Diese Bühne bot einfachste Theaterbedingungen im Freien und mit engem Kontakt zum Publikum, das den Wagen umstand. Sie bot kaum Bühnentechnik und nur Raum für wenige Darsteller und Requisiten. Entsprechend ungeeignet war dies für Szenen mit viel Personal oder schnellen Bühnenbildwechseln.
Hoftheater
Aus den höfischen Festen der Renaissance hervorgegangen, entwickelte sich, finanziert und verwaltet vom jeweiligen Hof, ein Theater für ein aristokratisches Publikum, das im deutschsprachigen Raum erst mit dem Ende des Ersten Weltkriegs seinen höfischen Bezug vollständig verlor. Es fand in festen Theaterhäusern mit prunkvoll ausgestatteten Publikumssälen und ausgefeilter Bühnentechnik statt. Im Gegensatz zu den bürgerlichen Schauspielhäusern, die im Zuge der Aufklärung entstanden, erfüllten die Hoftheater neben der Theaterdarbietung den Zweck der Repräsentation höfischer Macht. Symbolisiert wurde dies durch eine spiegelbildliche Theaterarchitektur mit einer der Bühne gegenüber gelagerten fürstlichen Loge. In der Hochphase des Hoftheaters im 17. Jahrhundert wurde die künstliche Beleuchtung auch während der Aufführung nicht gelöscht, was die doppelte Blickführung zur Bühne und zur Loge unterstützte.
Guckkastenbühne
Eine Bühne im geschlossenen Theaterhaus, die mit Bühnenportal und Vorhang vom Zuschauerraum getrennt ist, und zumeist zur Steigerung der Illusion über Bühnentechnik verfügt (Kulissenanlagen, Schnürboden, Unterbühne). Auch wenn sie erst im Laufe des 18. Jahrhunderts mit dem Begriff »Guckkastenbühne« belegt wurde, findet sie sich baulich bereits im opulent ausgestatteten Hoftheater des 17. Jahrhunderts.
[24]Im Gegensatz zur Kinosituation, bei der es keine Interaktion zwischen Darstellern und Zuschauern gibt (Situation der Trennung), erzeugt die Präsenz der Theatersituation immer eine Wechselwirkung, die je nach Bühnenform nur in Art und Intensität variiert. Mit Carlson (1987, S. 67) unterscheidet man grundsätzlich je nach Verortung der Spielfläche relativ zum Publikum vier räumliche Möglichkeiten: Sie kann beim Theater
(1) konfrontativ (Guckkastenbühne),
(2) hineinragend (Vorbühne),
(3) zentriert umkreist (Arena) oder
(4) im Raum verteilt (umgebend) angelegt sein.
Aus theaterwissenschaftlicher Perspektive ist das Raumerlebnis ein Kernthema (vgl. Balme 2014, S. 151–163). Hier werden der theatrale Raum (als Gesamtanlage von Zuschauer- und Darstellerraum) sowie der szenische Raum (der Bühnenraum als Spielfläche und Bühnenbild) behandelt. Der dramatische Raum ist dagegen Gegenstand der textwissenschaftlichen Untersuchung, nämlich die Räumlichkeit, die im Dramentext gestaltet ist (Schauplätze und Raumsemantik, vgl. Kap. 2.3.1).
Im Blick auf die Dramenproduktion gilt allgemein: Bühnenbau und Stückkonzeption können sich wechselseitig beeinflussen. Zum einen entwickelt sich die Theaterarchitektur entsprechend den Bedürfnissen einer Gemeinschaft und deren Vorliebe für bestimmte Arten von Aufführungen, zum anderen hängt von den bestehenden Bühnengegebenheiten ab, welche Stücke spielbar sind und damit vorzugsweise produziert werden. Die herrschende Konvention ist als Faktor im Theaterbetrieb ernst zu nehmen, Reformprozesse sind immer auch vor dem Hintergrund etwaiger Hindernisse angesichts der zeitgenössischen Bühnenpraxis zu bewerten.
Welche Relevanz die bautechnischen Gegebenheiten der Bühne für Überlegungen zum Verfassen von Dramen hat, zeigt exemplarisch ein Blick zurück in die griechische Antike, die als Wiege der europäischen Theaterkultur gilt. Die älteste überlieferte Poetik ist die von Aristoteles, auf die in späteren Jahrhunderten immer wieder verwiesen wurde. Genauer wird darauf in Kap. 4.1 eingegangen, hier sei nur auf ein besonders wirkungsmächtiges Element verwiesen: die »drei Einheiten« (auch »aristotelische Einheiten« genannt) von Handlung, Ort und Zeit





























