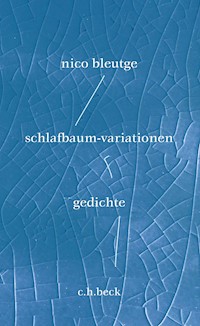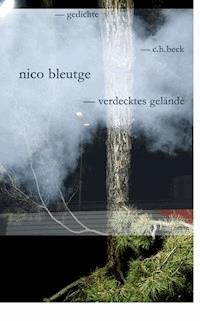17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kann man an der Zimmerdecke schlafen? Kann man unter die Tapete gehen? Nur Gedichte können so etwas, denke ich. Mich hier und zugleich dort sein lassen. Die Sprache dehnen, ohne daß es auch nur im mindesten gedehnt aussehen würde. Mich anregen, vorbehaltlos in die Verse einzutauchen, von mir abzusehen, für Momente jedenfalls. Selbstvergessenheit. Nachdenken. Die Lust des Staunens.
Manchmal genügt der eigene Schreibtisch. Ein Blick auf Zettel, Stifte, die Maserung des Holzes - und schon nehmen die Assoziationen ihren Lauf. Nico Bleutge tastet der Bedeutung von Wörtern und historischen Schichten nach. Seine Sätze schenken uns überraschende Verbindungen und machen etwas spürbar von der Lust der Wiederholung. Ob es sich um ein Gedicht von Elizabeth Bishop handelt, ein Bild des niederländischen Malers Jacques de Gheyn II. oder einen Gedächtnissplitter aus der Kindheit - stets verknüpft er den genauen Leseblick des Dichters mit autobiografischenen Erkundungen und Reflexionen über Erinnerung und Sprache. In seinen Essays und Skizzen taucht Bleutge in die Sprachwelten anderer Dichterinnen und Dichter ein und bringt dabei zugleich Gedanken über das eigene Schreiben an die Oberfläche. Hier lauscht er den morgendlichen Fliegen am Fenster, vertraut der Kraft der Imagination und wird am Ende selbst zur Fliege. Dort versucht er dem Staunen der Tiere auf die Spur zu kommen. So wie Tiere immer ein Moment des Anderen, des Ungleichen an sich haben, suchen diese Texte nach dem Geheimnis der Phänomene, drehen das scheinbar Bekannte, um es uns neu sehen zu lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Nico Bleutge
Drei Fliegen
C.H.Beck
Zum Buch
Manchmal genügt der eigene Schreibtisch. Ein Blick auf Zettel, Stifte, die Maserung des Holzes – und schon nehmen die Assoziationen ihren Lauf. Nico Bleutge tastet der Bedeutung von Wörtern und historischen Schichten nach. Seine Sätze schenken uns überraschende Verbindungen und machen etwas spürbar von der Lust der Wiederholung. Ob es sich um ein Gedicht von Elizabeth Bishop handelt, ein Bild des niederländischen Malers Jacques de Gheyn II. oder einen Gedächtnissplitter aus seiner Kindheit – stets verknüpft er den genauen Leseblick des Dichters mit autobiografischen Erkundungen und Reflexionen über Erinnerung und Sprache.
In seinen Essays und Skizzen taucht Bleutge in die Sprachwelten anderer Dichterinnen und Dichter ein und bringt dabei zugleich Gedanken über das eigene Schreiben an die Oberfläche. Hier lauscht er den morgendlichen Fliegen am Fenster, vertraut der Kraft der Imagination und wird am Ende selbst zur Fliege. Dort versucht er dem Staunen der Tiere auf die Spur zu kommen. So wie Tiere immer ein Moment des Anderen, des Ungleichen an sich haben, suchen diese Texte nach dem Geheimnis der Phänomene, drehen das scheinbar Bekannte, um es uns neu sehen zu lassen.
Über den Autor
Nico Bleutge, 1972 in München geboren, lebt in Berlin. Bei C.H.Beck erschienen die Gedichtbände «klare konturen» (2006), «fallstreifen» (2008), «verdecktes gelände» (2013) und «nachts leuchten die schiffe» (2017). Für sein Schreiben wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Erich-Fried-Preis (2012), dem Christian-Wagner-Preis (2014), dem Stipendium der Kulturakademie Tarabya, Istanbul (2013/2014), dem AlfredKerr-Preis (2016), dem Kranichsteiner Literaturpreis (2017) und dem Stipendium der Villa Massimo Rom (2018/19).
Inhalt
Vorwort
1. Kapitel
Aussichtsturm
Flechten
Drei Fliegen
2. Kapitel
Wie eine Katze hinter Fensterscheiben
Balkon
Traum
Im Nachhall der Geräusche
Gib mir die Augen der Sepien. Drei Splitter
(1)
(2)
(3)
Bucklicht Männlein
3. Kapitel
Auf der Glasfläche
Drei Plätze
(1)
(2)
(3)
An der Decke schlafen
Das Staunen der Tiere
4. Kapitel
In der fließenden Welt
Gedanken wie Reisig zu Füßen
(1)
(2)
(3)
(4)
Den Wiederholungen folgen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Nichts ist wie
Auf der Lichtung
Wiederholung. Variation
5. Kapitel
Die rasende Stimme
Nicht hinauslehnen
Honig des Himmels, Segen des Alls
Geröllfeld
Breeches, Feldstecher, Kodak
In Seitenlage
Die Luft voller Späne
6. Kapitel
Grüne Wellen
Veröffentlichungsnachweise
Vorwort
Wie verhält sich ein kahler Baum zum menschlichen Skelett, fragt die Dichterin Rae Armantrout einmal. Und gibt sich die Antwort gleich selbst: ungefähr so, wie der Heilige Geist Dinge verbindet – «flüchtig//um die Welt zu machen/aus provisorischen Paaren». Solche provisorischen Paare findet die Dichterin immer wieder. Sie läßt sich von scheinbar unschuldigen Wörtern anregen, von «schummern» zum Beispiel oder von «pink». Und geht ihrer Lust nach, das eine beim Namen des anderen zu nennen.
Alles wird Teil einer poetischen Denk- und Wahrnehmungsbewegung. Darin ist zwar nicht der Heilige Geist, aber doch Ähnlichkeit der Motor für die Assoziationen und zugleich ein «Korridor», durch den die Bedeutung flieht, mit einer Abzweigung hier und einem Zwischengang dort. Daß ihre Gedichte bei aller assoziativen Energie immer genau komponiert sind, macht Armantrouts große Kunst aus. Ähnlichkeit der Laute, Ähnlichkeit des Klangs. Untergründige Beziehungen, die hörbar werden. Lose Verwandtschaften, die jede Vorstellung einer festgezurrten Bedeutung unterlaufen. Am ehesten gleichen die Verse vielleicht jener durchsichtigen Erscheinung, die Armantrout in einem anderen Gedicht beschreibt: «Die Spontaneität, mit der/eine Blase sich losreißt//an die Oberfläche steigt/und platzt//als hätte sie etwas erkannt».
Anschauung, Erinnerung und Gedanke schießen zu einem Moment hoher Intensität zusammen, in dem etwas noch Unbekanntes aufscheint – eine Erkenntnis, die über die Möglichkeiten, wie sie etwa in den Wissenschaften zu finden sind, hinausgeht. Was genau dieses Unbekannte ist, eine Verbindung, die plötzlich entsteht, oder ein Muster, pendelt sich in jedem einzelnen Gedicht neu aus. Zweifellos hat es etwas damit zu tun, daß die gewohnten Kategorien des Denkens und Wahrnehmens außer Kraft gesetzt werden, ja, daß schon Trennungen wie jene in Anschauung und Verstand oder Empfindung und Vernunft fraglich werden. Die Sensibilität eines Gedankens, das Spüren historischer Schichtungen, die Reflexion der Gegenwart, ein Wort, das plötzlich in der Landschaft steht, Gerüche, die von Ängsten umstellt sind, oder die Erfahrung, daß ein Gefühl ganz und gar von Denken durchsträhnt sein kann – all das ist im Gedicht möglich.
Der vorliegende Band ist an der assoziativen Kraft des Gedichts ausgerichtet. Er versammelt Essays und Skizzen, die zwischen 2005 und 2019 entstanden sind. In seiner Komposition folgt er einer Idee, nach der Motive und Sprachmomente in unterschiedlichen Kapiteln verteilt, aufgenommen und weitergesponnen werden. Zugleich zeigt er, wie sich ästhetische Vorstellungen entwickeln und verschieben können.
In eigenen Texten zu lesen, ähnelt ein wenig dem Stöbern in einem Archiv. Dabei verfügt der Schreibende nicht über jene penibel angelegten Datenbanken, von denen ein berühmter Biograph einmal berichtet hat: elektronische Synopsen und Zeittafeln, die ihm schnellen Zugriff auf jedes Zitat, auf jeden Tag im Leben seiner Figuren erlauben. Statt dessen stößt er immer wieder auf Lücken und spürt, jede Setzung bringt es mit sich, daß andere Phänomene verdrängt, ausgeschlossen oder vergessen werden. Was ihn in all seinen Recherchen antreibt (und was er sich auch für den Leser wünscht), ist die Hoffnung auf das Glück, die geschriebenen Dinge neu zu entdecken.
1. Kapitel
Aussichtsturm
Von hier oben aus besteht die Welt nur aus Kisten. Seefracht-Container à zwanzig und vierzig Fuß, dahinter Super-Post-Panmax-Containerbrücken gegen den Horizont. Flächen und Muster aus farbigen Rechtecken. Selbst der Aussichtsturm ist aus Containern gebaut. Als sei die Welt ein Gemälde von Paul Klee, nur daß Klee auch die unsichtbaren Elemente des Ortes sichtbar gemacht hätte.
Auf einem früheren Bild Klees ruhen Fische über Algen und zeigen ihre Farben, Rot und Grün und Gold. Doch das Meer könnte auch der Himmel sein. Und beim genauen Hinsehen lassen sich wirklich Blumen auf der Leinwand erkennen, Gräser und ein stilisierter Mond. Man sieht das Meer in der Landschaft und die Landschaft im Meer, bis der Unterschied fast aufgehoben ist.
Jedesmal, wenn ich hier oben stehe, muß ich an Klee denken. Und jedesmal schiebt sich der Rhein in diese Landschaften. Mainz, die Uferstraße, wo meine Großeltern Ende der siebziger Jahre wohnten. Was mich am Rhein interessierte, waren nicht die Fische, sondern die künstlichen Wasserwesen: die Schiffe. Die Rheinfrachter schienen immer da zu sein. Tagsüber staunte ich über die Wellen, die sich an den Bugseiten bildeten, nachts begleitete mich das Stampfen der Motoren in den Schlaf.
Doch alles war ausgerichtet auf die Positionslichter der Schiffe: Rot und Weiß und Grün. Mit dem Aufzug ging es in den fünften Stock. Auf der Fahrt hatte ich immer den Eindruck, mein Körper werde gestrafft, jede Faser schien sich mit einer besonderen Art von Energie zu füllen. Oben angelangt, ließ ich schnell die Begrüßung über mich ergehen, nahm mir dann gleich das Fernglas vom Fensterbrett und verschwand auf dem Balkon.
Was seltsamerweise fehlt in dieser Erinnerung, sind die Gerüche der Schiffe. Kein Kohlegeruch, kein Dunst aus Schiffsdiesel und Rauch ist ihr beigemischt. Nur die Positionslampen leuchten, rot und weiß und grün. Ein Sichtfeld aus Farben, in die ich mich stundenlang versenken konnte.
Rot und Grün sind auch die Farben der China Cosco Shipping Group, einer der größten Reedereien für Containerschiffahrt. Rheinfrachter gehören nicht zu ihrer Flotte, sondern Containerschiffe, hoch funktional angelegte Transportfähren, wie man sie von hier oben aus betrachten kann. Container stehen für einen tiefgreifenden Wandel in den wirtschaftlichen Verhältnissen. Für ein verändertes Denken und Wahrnehmen. Ein Denken, das in den Bahnen von Rationalisierung und Standards abläuft – und in dem sich Meer und Landschaft auf ganz andere Weise durchdringen sollen. Als ließe sich das Meer in eine Linie verwandeln, auf der das Schiff wie auf einem Wasser-Highway fährt. Als gäbe es keine Wellen und keine Gezeiten, keinen Zufall und keine historischen Spuren. Keine einzelnen Menschen.
Thomas Hettche hat einmal bemerkt, Kinder würden durchaus die härtere Realität bestimmter Orte und Menschen spüren. Zugleich aber hätten sie die Neigung, sie in ihre Märchen zu integrieren. Irgendwann taue diese kindliche Welt dann weg, und die eingelagerten Bruchstücke würden wieder so scharfkantig und hart, wie sie es schon immer waren, und verkeilten sich zu einer dichten Schicht. Und nur in den Ritzen, so Hettche, finde man später manchmal noch «Reste der eigenen verlorenen Welt».
Würde Klee heute leben, vielleicht würde er in seine Bilder keine Fische setzen, sondern Schiffe. Jedes Element darin wäre Bruchstück einer in sich verkeilten Landschaft, in der sich Denken und Wahrnehmen, Erinnerung und Gegenwart, Irritation und Kritik fortwährend überlagern. Ein Ensemble widersprüchlicher Orte, deren Sprachen mal parallel laufen, mal auseinanderdriften, mal knirschend ineinanderkrachen.
(2017)
Flechten
Der Ort, an dem ich schreibe, liegt in meiner eigenen Wohnung. Eigentlich sind es zwei Orte. Oder genauer: Es sind zwei Tische. Der eine befindet sich im Schlafzimmer, der andere im Wohnzimmer. Die beiden Zimmer trennt nur eine Wand, aber die Verhältnisse könnten unterschiedlicher kaum sein. Während das Schlafzimmer nach Norden weist, öffnet sich das Wohnzimmer mit einem kleinen Balkon Richtung Süden. Im Schlafzimmer dämpfen die Mauern und Dächer rings um den Innenhof das ohnehin spärliche Licht. So ist es dort immer ein wenig dunkel, auch steigen die Temperaturen kaum über zwanzig Grad, selbst im Sommer nicht. Das Wohnzimmer indes besitzt zwei große Flügeltüren. An sonnigen Tagen wird es von Licht und Wärme geradezu durchflutet. Wie auf einer sommerlichen Veranda kann man sich hier bisweilen fühlen. Es tut gut, zwischen diesen beiden Atmosphären, zwischen diesen beiden Denk- und Empfindungswelten, wechseln zu können.
Trotzdem arbeite ich lieber im Wohnzimmer. Einen Schreibort könnte man sich gewiß schöner vorstellen. Es gibt keine besonderen Lampen, keine Schalen, Uhren oder Statuetten in den Regalen. Und auch der Tisch ist gar kein Schreibtisch, sondern ein kleiner Eßtisch mit ausklappbaren Seitenteilen. Dünne, weiß-lackierte Halbkreise, die mich immer an abgesägte Flügel erinnern. Ohne diese Seitenflügel könnte ich nicht arbeiten. Auf ihnen sammle ich all die Materialien, die ich für das Schreiben brauche. Zeitungsartikel, Photos, erste Entwürfe von Gedichten – und jede Menge Bücher.
Wenn ich an einem Stück sitze, wenn ich über ein Wort nachdenke, über seinen Klang, seine Bedeutungsschichten, oder wenn ich einfach nicht weiterkomme, lasse ich den Blick über die Tischplatte wandern. Dann kann ich Zettel sehen, Stifte, dunkle Staubpartikel. Das korrodierte Ende eines Kabels. Oder die Maserung des Holzes, die durch die Farbschicht des Tisches scheint. Mit den Fingern berühre ich ein Notizblatt, fahre über die Oberfläche des Computers. Die Dinge scheinen mir ihre Gegenwart zu zeigen, ihre Gegenständlichkeit. Und je länger ich sie ansehe, je genauer ich sie betaste, desto deutlicher treten sie hervor. Ja, sie beginnen sich sogar aus ihren vertrauten Zusammenhängen zu lösen. Und so, wie sie mir zunächst nah vorkommen wollen, dann fremd, können sie unversehens durchlässig werden. Ich sehe eine Scharte in der Stuhllehne, und ein Kindheitsbild faltet sich vor mir auf. Ich höre Stimmen aus der Nebenwohnung und muß an meine Mutter denken. Ich beobachte eine Wespe, die in meine Tasse klettert – und plötzlich weiß ich, wie ich den Gedanken des Gedichts fortspinnen, wie ich ihn in die Rhythmen meiner Sprache verwandeln kann.
Die fremd gewordenen Dinge können wie kleine Magneten sein, Kraftpunkte, die die Aufmerksamkeit bündeln. Doch die Haut der Dinge ist porös, sie verfügt über Rißkanten, die den Blick ins Imaginäre öffnen. Um wieviel mehr noch gilt das für die Sprache. Manchmal ist es nur ein einzelnes Wort, das sich aus dem alltäglichen Wahrnehmungsstrom löst. Ein Begriff, aufgeschnappt in der U-Bahn, eine Formulierung, die aus einer Unterhaltung herüberweht. Neben all ihren gegenwärtigenBedeutungsfächern tragen diese Wörter immer auch historische Schichten in sich, Ideen, die auf ihre Entstehung und Verwendung durch die Zeit weisen, aber auch semantische Schatten, die in die eigene Erinnerung führen. «Muschelkalk» ist für mich ein solches Wort.
Als mir das Wort begegnete, war ich gerade auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof unterwegs. Dieser Ort, der als Flughafen zwei Weltkriege und den Kalten Krieg in sich verwahrt, ist seit 2010 frei zugänglich. Die letzte Maschine startete 2008, zu welchem wirtschaftlichen Nutzen das Terrain bebaut werden wird, ist noch offen. Einstweilen zeigt es sich als ein riesiger Park. Und mit seinem inoffiziellen Namen «Tempelhofer Feld» weist es zurück auf seine Anfänge, als es Ackerland und später Exerzierplatz für das preußische Regiment war. Die Weite der Wiesen und der Asphaltflächen, die sich zwischen Columbiadamm und dem Autobahnring bis an die Neuköllner Häuserrücken erstrecken, mag tatsächlich an eine Meereslandschaft erinnern. So wollte mir «Muschelkalk» sofort einleuchten. Vielleicht fanden sich in den unteren Schichten dieses Geländes ja noch Reste, Fossilien einstiger Meeresbewohner. Und Kalk mußte der Boden reichlich enthalten. Zugleich aber ahnte ich, daß Muschelkalk ein Begriff ist, der seine feste Bestimmung hat, womöglich in einem geologischen Kontext.
Ich nahm das Wort mit nach Hause, zerlegte es und setzte es wieder zusammen. Schon die erste Recherche gab meiner Vermutung Feuer. In der Geologie, las ich nach, ist Muschelkalk eine Gesteinseinheit, die verstärkt in Höhenzügen sichtbar wird. Es gibt aber noch eine zweite Verwendung. Als Baumaterial bezeichnet Muschelkalk einen bestimmten Kalkstein, der auffallend dicht geschichtet ist. Wie paßten diese Bedeutungen zusammen? Und vor allem: Was hatten sie mit dem Tempelhofer Feld zu tun? In meinen geologischen Lexika fand sich nichts. Auch das Netz half mir nicht weiter. Ich begann, nach historischen Texten zu suchen, bestellte mir Aufsätze und Übersichtskarten zum Gelände von Tempelhof. Schließlich las ich in einer Studie über den Flughafen, Muschelkalk sei im Nationalsozialismus der bevorzugte Werkstoff für repräsentative Bauten gewesen. Fast die gesamte Außenfassade des Flughafengebäudes und große Teile des Inneren sind mit Platten aus Muschelkalk bedeckt. Ich weiß nicht genau, warum, aber diese Worte setzten etwas in mir frei. Ich war auf einer Spur. Plötzlich öffneten sich Denkräume in meinem Kopf, Verbindungslinien blitzten auf zwischen der Landschaft und der sie umgebenden Stadt, zwischen den Gesteinsformationen und den historischen Resten auf dem Areal. Und ein Impuls wurde in mir spürbar, ein Zwang fast, das Tempelhofer Feld zu erkunden.
Von da an fuhr ich fast täglich auf das Gelände. Mit dem Fahrrad umkreiste ich das Terrain, dann wieder suchte ich mir eigene Schleifen über die verschiedenen Fahrflächen, die Lande- und Startbahnen, die Zufahrts- und Verbindungswege. Die ausgewählten Strecken befuhr ich wieder und wieder, fast meditativ ließ ich die Blickwinkel, die Lichtverhältnisse und das Geräusch der Reifen auf dem Asphalt in mich einsickern – als wolle ich ein Gespür bekommen für den Ton dieses Ortes, für seine Beleuchtung, den Raum und die zahllosen Menschen. Selbst bei Regen war man hier nie allein – doch nicht einmal die lautesten Familien an ihren Grillfeuern schoben sich in den Vordergrund, sondern schienen Teil der Atmosphäre zu sein. Da ich auch nachts auf dem Feld unterwegs war, verlegte ich meine Lektüre in die frühen Morgenstunden. Von den historischen Schichten der beiden Weltkriege ließen sich Assoziationsfäden zur Geologie des Ortes ziehen. Das Tempelhofer Feld liegt auf einem Plateau des Berliner Urstromtals, das gegen Ende der letzten Eiszeit entstanden ist. Und mir fiel ein: War es nicht die Flußlandschaft der Spree, die ich im Vorjahr erkundet hatte? Die sich schon als Wahrnehmungs- und Sprachschicht in mir abgelagert hatte? «Muschelkalk», «Mergel», «Geschiebelehm» – je stärker ich mich mit der Sprache beschäftigte, desto mehr breitete sich das Terrain der Erinnerung in mir aus. Als würde all diese Gedächtnisschlacke einmal quer durch den Kopf wandern.
Nicht weniger wichtig als die Sprachfunde waren die historischen Spuren vor Ort. Die Landschaft, durch die ich mit dem Rad fuhr, zeigte sich mir als Restelandschaft. Bei jeder Fahrt versuchte ich ein anderes Gebiet zu sondieren. Den langen Gebäuderiegel und seine unterschiedlichen Zufahrten. Die mit Zäunen abgesteckten Wiesen, in denen heute Vögel nisten, obwohl der Boden noch voll von eingesickertem Kerosin ist. Ich sah die Verästelungen der Nester, das Geflecht aus Halmen und Gräsern, und ich mußte an die Zündungsnester denken, die man in den letzten Kriegstagen unter dem Boden der Schalterhalle angebracht hatte. Immer noch kann man an den Muschelkalkplatten rötliche Schatten entdecken, die von den Bränden herrühren. Ich stieß auf ausgegrabene Reste von Steinen, lehmverschmierte Quader und Verstrebungen, die so formiert waren, daß sie an den Grundriß eines Gebäudes erinnerten. Daneben gehäufelte Metallfragmente im Gras. Es waren die Spuren von Barackenlagern, in denen die Nationalsozialisten Zwangsarbeiter untergebracht hatten. Ich dachte an das Wort «Lagerfeuer», an das Wort «Arbeitskraft», an das Wort «Fertigungslinie».
Später erforschte ich die Rollbahnen mit ihren Markierungen, die man mehrfach überschrieben hatte. Es genügte mir nicht, diese Dinge im Vorüberfahren zu streifen. Ich mußte sie mir ansehen, immer und immer wieder ihre Lage, ihren Zustand betrachten. Einmal stieß ich auf Schienen, die hinter dem Gebäude des Flughafens verlaufen, von Gras überwachsen und von Sträuchern. Ich berührte das Metall und die rissigen Schwellen, strich mit der Hand darüber. Mit den Augen folgte ich der Bewegung meiner Hand, die meinen Blick am Rand des Feldes entlangführte und in der Gegenrichtung zum Gebäude. Was ich später nachlas – der Flughafen war im Zweiten Weltkrieg ein Fliegerhorst gewesen, ab 1941 ein vollständiges Werk für die Produktion und Reparatur von Kriegsflugzeugen, und die Schienen hatten der Anbindung an den allgemeinen Eisenbahnverkehr gedient –, ließ sich hier schon erahnen. Und wieder die Idee: Jedes Ding ist durchlässig für seine Geschichte, wandert mit seinem Bedeutungshof ein in den Kopf und öffnet sich der Einbildungskraft.
Das Gelände wurde nach und nach zu meinem eigentlichen Ort des Schreibens. Zu einem Ort, der sich immer mehr von den dinglichen Gegebenheiten löste. Oder vielleicht müßte ich genauer sagen: Das eine konnte ohne das andere nicht sein. Der Ort des Schreibens war eine Mischung aus dem Wahrgenommenen und den Geschehnissen in meinem Kopf, die Gleichzeitigkeit der unterschiedlichen Zeitschichten und Wahrnehmungen, der Sprachpartikel, Ideen und Atmosphären – in all ihrer Brüchigkeit und mit all ihren Gegensätzen.
Vom Tempelhofer Feld ergaben sich Korrespondenzen zu anderen Orten in Berlin, Verbindungen zu Parklandschaften oder Wasserläufen, manchmal nur vermittelt über einzelne Silben. Ich grub weiter in der Sprache. Indem ich die gefundenen Wörter und Begriffe sagte oder vor mich hin murmelte, meinte ich Echos zu vernehmen, Echos, die mich in neue Luftschichten führten oder durch die Hintertür wieder zu meinen ersten Wörtern zurück. Ich entdeckte Widersprüche zwischen Formulierungen, zugleich fielen mir Zeilen von anderen Dichtern ein, die sich mit meinen Wortfunden oder dem Gelände kurzschließen wollten. Das Geflecht verästelte sich, fast wie jene Flechten, die sich auf den Muschelkalkplatten des Gebäudes entwickelt hatten. Und das Geflecht verlagerte sich. Irgendwann war es ganz in meinem Kopf. Verwandelt nun in eine besondere Art von Aufmerksamkeit für Atmosphären, eine Sensibilität, ein geistig-körperliches Gespür für die Durchlässigkeit der Dinge und der Sprache und für die Konstellationen, die sie bilden können.
Wenn ich heute an diese besondere Art der Weltwahrnehmung denke, frage ich mich, wie es überhaupt möglich sein kann, den imaginären Ort des Schreibens mit einem realen zu verknüpfen. Ihn zurückzubinden an etwas so Handfestes, Konkretes wie einen Schreibtisch. Die Bewegung, die für meine Recherchen so wichtig ist, die Fahrten mit dem Rad oder das Erkunden eines Geländes im Gehen, das Wieder-und-wieder-Durchqueren der Sprache, all diese rhythmischen Muster und Brüche – wie vertragen sie sich mit der Statik des Schreiborts? Wie lassen sie sich einholen am eigenen Tisch, ohne ihnen etwas von ihrer Beweglichkeit, von ihrer Lebendigkeit und Energie zu nehmen? Und ist es nicht so, daß wir die Dinge, die sich einmal mit uns verbunden haben, mit denen wir uns einmal beschäftigt haben, und sei es nur für eine kurze Zeit, so schnell nicht mehr loswerden? Daß sie uns eingeschrieben sind und unser Verhalten prägen, hinterrücks, ohne daß wir es recht eigentlich merken? Es gehört für mich zu den großen Unbegreiflichkeiten des Schreibens, wie es dennoch immer wieder gelingt, den Kopf am Schreibtisch zu verorten. Mag sein, Imagination und die vermeintlichen Realien, an denen sie sich entzündet, sind enger verschränkt, als es selbst einem Schreibenden lieb sein mag. Es bleibt trotzdem ein Geheimnis.
Wobei ich mir immer einbilde, mein eigener Schreibort wäre mir angenehm, ich wäre aber nicht an ihn gebunden. Ja, manchmal meine ich sogar, ich könnte an jedem beliebigen Ort schreiben, Züge und Flugzeuge und Hotelzimmer vielleicht ausgenommen. Ein paar Kleinigkeiten sind zu beachten. Uhren in der Umgebung wären eher ungünstig, auch sollten keine Figuren in den Regalen stehen. Aber sonst bedarf es keiner besonderen Umstände. Es genügt ein einzelner Tisch. Vielleicht nur eine einfache Holzplatte. Nehmen wir an, sie sei lackiert, vielleicht in Weiß, und darunter könne man die Struktur des Holzes erahnen. An diesem Tisch sehe ich mich sitzen. Ich stelle mir vor, wie ich Kabelenden beobachte oder Staub, wie ich an das Licht denke und an die Temperatur. Möglich, ich höre Stimmen aus der Nebenwohnung. Oder das Summen einer Wespe. Vermutlich liegen ein paar Photos auf der Tischplatte, Artikel, vielleicht auch ein Buch. Ich lasse den Blick über die Tischplatte wandern und versuche, in die Sprache des Gedichts einzulagern, was ich auf dem Gelände an Sprache abgetragen habe, «Mergel» vielleicht und «Schiebesand». Wenn ich nicht weiterkomme, wechsle ich ins andere Zimmer. Ich spüre die Kühle und den dunklen Ton dieses Ortes – und doch meine ich ganz in meinem Kopf zu sein. Und wer weiß, vielleicht haben sich, während ich die Dämmerung auf mich wirken lasse, schon neue Wörter in mir festgesetzt. «Grauwacke» könnte ein solches Wort sein. Oder «Farn».
(2013)
Drei Fliegen
Wer sich mit Erich Fried beschäftigt – und das ist durchaus kein Geheimnis –, der muß zunächst einmal sehr viel lesen. Wenn man, so wie ich, Besitzer der großen Wagenbach-Ausgabe ist, sind das vier Bände zu je sechshundertfünfzig Seiten, das heißt beinahe zwei Kilogramm Gewicht, geschätzte zweitausend Gedichte (gefühlt sind es bestimmt doppelt so viele), ein Roman und etwa hundertzwanzig weitere Prosatexte. Bei wem da nicht der von Fried so geliebte Zweifel aufkommt, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Mir jedenfalls ging es so, daß ich tagelang dasaß, mich durch die Unmengen an Seiten blätterte, mich hier festlas, dort über die Zeilen huschte, und irgendwann nicht mehr recht wußte, wo ich andocken sollte. Und als ich schon fast aufgeben wollte, eines schönen Morgens, bewegte sich plötzlich etwas am Rand meines Gesichtsfeldes, und ein leises Summen wurde hörbar. Eine Fliege krabbelte über die aufgeschlagenen Bücher. Vorsichtig, schon ein wenig ausgeblichen in den Farben, eine letzte Herbstfliege vielleicht. Ein paar Milligramm Fliege gegen fast zwei Kilo Erich Fried – ich mußte den Bewegungen dieser Fliege sofort nachgeben.
Während ich der Fliege mit den Augen folgte, fiel mir jene kleine Erzählung wieder ein, die ich ein paar Tage zuvor bei Fried gelesen hatte. Sie gehört in den Zusammenhang seines Romans Ein Soldat und ein Mädchen und trägt – vielleicht ahnt man es schon – den Titel «Die letzte Fliege». Gleich mußte ich die Erzählung ein zweites und ein drittes Mal lesen, mußte sie für mich auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Fried schildert die Begebenheit als eine Erinnerungsgeschichte, in der sich die Sichtweise des Kindes, der Blick des reifen Erzählers und die Bilder der Landschaft durchdringen. Ein Junge an einem Sommernachmittag, in einem Sommerhaus unweit der Stadt. Die Mutter hat ihm einen Ausflug in den Wald versprochen, ist aber zu müde, ihr Versprechen einzulösen. So ist dem Jungen schrecklich langweilig. Er versucht zu spielen, versucht, sich selbst Geschichten zu erzählen – aber nichts will klappen. Auf einmal bemerkt er Fliegen, die sich auf dem Pingpongtisch versammelt haben, offenbar, um von der klebrigen Spur eines Glases mit Himbeerwasser zu naschen. Und nun erwacht so etwas wie ein Jagdtrieb in ihm. Anfangs ekelt er sich noch vor einer möglichen Berührung. Aber mit einer über die Hand gestülpten Papiertüte will es schließlich gehen. Ein kurzes Lauern – und, patsch, patsch, Schlag für Schlag fallen die Fliegen. Für jede Fliege legt der Junge ein Steinchen vom nahen Kiesweg auf die Tischplatte. Nach und nach verfeinert er seine Ideen und Techniken. Er berechnet etwa, von woher sein verräterischer Schatten auf die Platte fallen könnte, und wechselt von der Papiertütenhand zu einem Lineal, das, wie es heißt, «mit einem kleinen Knall gegen ihre Leiber klopfte wie gegen Erbsen und sie wie Erbsen mit trockenem Schlag fortschleuderte. Der Schlag war tödlich.»
Warum zog mich diese Fliegengeschichte an? Warum folgte ich über fünf Seiten hinweg Sätzen, die davon erzählen, wie ein kleiner Junge Fliegen erlegt? Und nicht nur erlegt, sondern auch aufbahrt, ja, ihnen Gedenksteine setzt, bis irgendwann der ganze Pingpongtisch voller Steinchen und voller toter Fliegen ist. Und mitten im Lesen kam mir die Vermutung: Was, wenn Fried hier nicht nur eine Erinnerungsgeschichte erzählt? Könnte er nicht, so versteckt, wie er in diesen Geschichten immer auch über Ideologien, Hysterien, über totalitäres Denken oder über das Wesen von Affekten nachdenkt, zugleich über das Schreiben nachgedacht haben?
Dann wären die gesammelten Fliegen vielleicht jene «Mikro-Beobachtungen», die Fried ein paar Geschichten später erwähnt, «kleine und kleinste Beobachtungen», wie er schreibt, «besonders aus der Kinderzeit, die (…) als Rohmaterial des Schreibens betrachtet» werden. Und ihre Drapierung ähnelte vielleicht dem «Umschreibung» genannten Verfahren, worunter der Erzähler die «Wahrung eines Abstandes zwischen erlebter und dichterischer Wirklichkeit» versteht, «um beim Schreiben nicht von den eigenen unüberwundenen Erlebnissen überwältigt zu werden».
Fried gibt über den Begriff «Mikro-Beobachtung» hinaus keinen Hinweis darauf, was er sich unter «Rohmaterial» vorstellt. Affektive Spuren, die sich im Körper abgelagert haben? Rhythmische Muster, die das Sensorium in Schwingung versetzen, die sich immer schon in sprachliche Muster verwandelt haben? Tatsächliche Bildpartikel, die sich aus der Erinnerung wie aus einem Archiv suchen ließen? Und was geschieht mit diesem Material, vielleicht kann es einfach abgerufen und montiert werden, vielleicht muß der Schreibende es aber auch erst einmal mit anderen Momenten in Beziehung setzen, umschmelzen, zum Glühen bringen, damit dann alles Teil einer Form werden kann?
Schon einige Seiten vorher, in einer Erzählung mit dem Titel «Der Brand», ist von den Dingen die Rede. Von Möbeln und Schulsachen, aber auch von Geschäftsläden, Laternen, von Gartenmauern und Plakaten. Es sind die Dinge aus der unmittelbaren Umgebung, die das Kind tagein, tagaus beim Spielen oder beim Gang in die Schule sieht, die ihm vertraut sind und so ein Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit vermitteln. Die es aber auch genau deshalb, weil es sie gewohnt ist und den Blick für ihre Besonderheit verliert, nicht mehr recht bemerkt. Dieses – hier schaltet sich der Erzähler ein – «Nichtbemerken aus langer Gewohnheit» ist einer der Gründe, weshalb es dem Erzähler nicht gelingen will, bestimmte Dinge zu beschreiben. Nur ein ungewöhnliches Ereignis, ein Brand zum Beispiel, wie in der Erzählung selbst, kann die Perspektive ändern. So lesen wir: «Die Stimmung unmittelbar bevorstehender Vernichtung läßt den Blick schärfer werden, und die Dinge am Rand ihres Nichtmehrseins treten uns plastischer entgegen.»
Es scheint also eine doppelte Bewegung zu sein, die den Umgang mit den Dingen bestimmt. Offenbar müssen sie zunächst zu den eigenen werden, einrücken in die Sphäre aus Wahrnehmungen, Erinnerungen, raschen Gedanken, Empfindungen und Bildern. So verwandeln sie sich, sagen etwas aus über denjenigen, dem sie gehören, und etwas über ihre Fähigkeit, sich zu ändern. Dann aber, in einem zweiten Schritt gleichsam, müssen sie wieder fremd werden, müssen in Entfernung rücken, damit man über sie schreiben kann. Die Dinge benötigen eine Ferne, die an eine Nähe gebunden ist, und eine Nähe, die den Abstand braucht.
Und gilt das gleiche nicht für die Wörter? Während des Lesens der Fliegenpingponggeschichte erinnerte ich mich daran, daß ich als Kind etwas Ähnliches gemacht hatte wie der kleine Junge. Nur hatte ich damals zuviel Angst, die Fliegen zu töten – egal, ob mit übergestülpter Papiertüte oder ohne. Aber ich war neugierig, wollte unbedingt wissen, wie diese Tiere aussehen. Meine Mutter hatte auf dem langen Fensterbrett im Eßzimmer eine Unmenge von Blumen postiert. Dahlien, Geranien, Gerbera, sogar Usambaraveilchen, wie ich heute weiß, in vielen, in Größe und Farbe überhaupt nicht zueinander passenden Töpfen und Schalen. Die Gerüche dieser Blumen, ebenso wie das Licht, das durch das große Fenster in den Raum fiel, lockten all die Fliegen an, die im Sommer und Herbst ins Haus kamen und von dort, warum auch immer, nicht mehr hinaus. So fanden sich hinter den Töpfen, in den schattigen Nischen zwischen den Untersetzern und dem Holz des Fensterrahmens, zahllose tote Fliegen. Mit einer Pinzette fischte ich diese Fliegen regelmäßig aus ihren Staubnestern, säuberte sie mit einem dünnen Pinsel und legte sie vor mir auf der Tischplatte aus. Es war aufregend und abstoßend zugleich, die Fliegenkörper zu betrachten. Mein Bewußtsein schwankte. Ja, es war eine Mischung aus Versinken und völliger Klarheit, in der ich mich befand. Manchmal saß ich stundenlang vor den Fliegen, sah mir jedes Exemplar genau an, achtete auf die Struktur, versuchte Gemeinsamkeiten festzuhalten, vor allem aber die kleinen Unterschiede, die nach und nach hervortraten. So gelang es mir bald, die Fliegen nach Größe, Dicke und bestimmten Ähnlichkeiten der Beine oder der Flügel zu sortieren.
Ist nicht dieses behutsame Beobachten und Studieren, frage ich mich heute, das Hin-und-her-Wenden, Betasten und Warten, etwas dem Schreiben, etwas meinem Schreiben Verwandtes? Jedenfalls auf einer ersten Ebene. Die Wörter, die ich gesammelt, gefunden, erfunden habe, die sich abgesprengt haben aus der gewöhnlichen Wahrnehmung – und denen ich nachlauschen muß, deren Möglichkeiten für Klang und Rhythmus, deren semantische Schichtungen ich geradezu erforschen will. Das stundenlange Horchen auf einen halben Satz, der auf dem Papier steht, das unermüdliche Lesen und Vorsprechen, um dann, endlich, nach ein paar Stunden oder auch erst nach ein paar Tagen, vielleicht zwei, drei neue Wörter hinzuschreiben. Und mehr noch: Gleichen sich Fliegen und Wörter nicht auch darin, daß beide ihr Eigenleben führen, daß sie, so nah man ihnen bisweilen auch kommt, sich zu entziehen versuchen, am Ende doch fremd und rätselhaft bleiben? Fried beschreibt es so: «Diese Tiere hatten eine unberechenbare Art sich zu bewegen. Sie waren mißtrauisch. (…) Je größer, desto gescheiter waren sie offenbar. Das Ärgste aber blieb ihr lautes Aufsummen, vor dem das Kind jedes Mal erschrak und die Hand zurückzog.»
Aber Vorsicht, jetzt muß ich achtgeben, daß ich mich nicht, wie der kleine Junge vom Jagdfieber, von der Lust am Vergleichen zu sehr mitreißen lasse. Oder, wenn ich schon vergleiche, muß ich darin wenigstens genau bleiben. Es waren ja tote Fliegen, die mir zum Forschungsobjekt dienten. Und bei Erich Fried sind es Fliegen, die der Junge eigens getötet hat, um sie auf der Pingpongplatte aufzubahren und ihrer zu gedenken. Ließe sich auch das auf die Sprache übertragen? Vielleicht ja. Vielleicht verhält es sich mit den Wörtern nicht anders. Denn reißt man als Schreibender die gefundenen Sprachteilchen nicht aus ihrem Zusammenhang, löst man sie nicht aus den Sprachschichten, in die sie eingebettet sind? Auf die gleiche Weise, wie man den Fliegen, um sie zu besitzen und zu bestaunen, das Leben raubt. Oder ihren Tod in Kauf nimmt. Sosehr ich als Junge das Anschauen der Fliegen liebte, sosehr ich durch die genaue Beobachtung tatsächlich auch die lebendigen Fliegen mit einem anderen, aufmerksameren, einfühlenderen Blick sah – sosehr blieb doch ein Wunsch unerfüllt: die vor mir ausgebreiteten Fliegen wieder zum Leben zu erwecken. Jede einzelne von ihnen, jetzt, da ich sie studiert hatte und kannte, da ich ihnen nah und fern zugleich war, wieder fliegen zu sehen.
An dieser Stelle kommt der Schriftsteller mit seinen Möglichkeiten ins Spiel. Natürlich kann er keine Fliegen zum Leben erwecken. Aber er kann etwas viel Großartigeres versuchen. Ich nehme nun freundlich von Erich Fried Abschied und wende mich einem anderen Schriftsteller zu. Und ich schiebe eine dritte Fliegengeschichte ein. In seinem kleinen Prosatext «Das Fliegenpapier» beschreibt Robert Musil ein ebensolches Papier und die Wirkung, die es auf eine Fliege hat, die an diesem Papier kleben bleibt. Genauer: an diesem etwa dreißig Zentimeter langen Streifen, der mit gelbem, vergiftetem Leim bestrichen ist. In einer Reihe von trennscharfen und einer geschickten Dramaturgie unterworfenen Szenen und Bildern skizziert Musil das ganze Drama einer solchen Bewegung. Erst hält das Papier die Fliege nur leicht fest, hier an einem Härchen, dort an den Beinen, «wie wenn wir im Dunkel gingen», schreibt Musil, «und mit nackten Sohlen auf etwas träten, das noch nichts ist als ein weicher, warmer, unübersichtlicher Widerstand». Doch bald schon führt der Wechsel von Sich-Wehren und Erschöpfung zu tieferem Einsinken in den Leimfilm. Nun werden die Bewegungen unnatürlich, die Beine knicken weg, und kurz darauf liegt die Fliege in einem dicken Überzug begraben, der ihrer ursprünglichen Form nur ganz entfernt entspricht. Wie ein «gestürztes Aeroplan», das «mit einem Flügel in die Luft ragt», meint Musil, oder wie ein «krepiertes Pferd».
So wie Musil hier mit Vergleichen aufwartet, wird schnell deutlich: Die ganze Geschichte ist weit mehr als nur die Geschichte einer festklebenden Fliege. Nicht ohne Ironie hat er schon zu Beginn klargestellt, wie in diese Erzählung «allmählich das grauenhaft Menschliche» hineinflute. «Grauenhaft menschlich» ist sie in der Tat, deutet sie doch nichts anderes an als das Drama des Lebens überhaupt, das «Seinesgleichen geschieht», wie es im Mann ohne Eigenschaften heißt. Gemeint ist jene Bewegung, da die Aufmerksamkeit im Vollzug des Lebens nachläßt, da nicht mehr jeder Augenblick mit der gleichen Intensität erfahren wird. Eine Routine, die sich einschleicht. Eine kaum spürbare Kraft des Verharrens, die nun wirkt. Bis all das Pulsieren des Anfangs – die Lebendigkeit, Gewandtheit –, bis dieses Flüssige schließlich einzudicken und zu stocken beginnt. Um am Ende einer erstarrten Schale zu gleichen, einer Hülle aus Konventionen und schon Bekanntem. «Es sind die fertigen Einteilungen und Formen des Lebens», heißt es bei Musil, «was sich dem Mißtrauen so spürbar macht (…), dieses von Geschlechtern schon Vorgebildete, die fertige Sprache nicht nur der Zunge, sondern auch der Empfindungen und Gefühle». Vielleicht muß man gar nicht das «Leben an sich» in Stellung bringen. Im alltäglichen Denk- und Wahrnehmungsstrom verhält es sich nicht anders. Das Feuer einer Beobachtung, ein plötzliches Ahnen, wie sich zwei Phänomene zueinander verhalten könnten, das Aufblitzen einer Ähnlichkeit, die Lust an einem Vergleich – und nur wenig später hat die Erinnerung das Geschehnis schon verfestigt, ist die Denkbewegung schon zur Erkenntnis, zu einer Art abrufbarem Ergebnis also, verallgemeinert worden.
Doch genau hier kann die Literatur ihre Stärke entfalten. Ein Schreiben, wie ich es mir vorstelle, gibt sich nicht mit den Verfestigungen zufrieden, sondern erinnert sich an die Einbildungskraft. Die Einbildungskraft kann gleichsam den von Musil beschriebenen Weg rückwärtsgehen, kann jene zähe Masse, jenen lähmenden Überzug aus Leim wieder flüssig machen. Den Beobachtungen und Wörtern, ich verschiebe ein wenig, Leben einhauchen, sie verwandeln in ein klares und doch in sich geschichtetes Arrangement. Die Verfestigungen in Bewegung bringen, das heißt überkommene Normen und Setzungen, aber auch Gefühlsklischees, Denk- und Wahrnehmungsmuster – und vor allem: Sprache, in die so erschreckend einfach und unbemerkt Wertungen und undurchschaute Vorstellungen einsickern können.
Eine Literatur, die gleichermaßen auf die Beobachtung wie auf die Kraft der Imagination baut, wird den Phänomenen und den Ideen und Widersprüchen ihrer Gegenwart nicht mit einer bloßen Aussage begegnen, sie wird nicht moralisieren und schon gar nicht didaktisch sein wollen. Vielmehr wird sie versuchen, die Widersprüche in sich aufzunehmen und in ihrer Form zu reflektieren. Sie wird versuchen, der Vielschichtigkeit der Welt mit der Vielschichtigkeit ihrer Struktur zu antworten. Ich wüßte nicht, was dafür geeigneter wäre als das Gedicht. Hier gibt es empfindliches Denken, Gespür für geschichtliche Spuren, Buchstaben, die sich zu materialisieren scheinen, oder die Erfahrung, daß ein Sinneseindruck einem Gedanken ähnelt. Beim Schreiben kann ich etwas in die Bildsprache, in Vergleiche und metaphorische Fügungen, einlagern. Doch meist liegt die Eigenart eines Gedichts gar nicht nur auf der bildlichen Ebene, sondern in der Wirkung von Rhythmus und Klang. Und in dem, was man seine Schwingung nennen könnte. Gunnar Ekelöf spricht sogar von den Radiowellen des Gedichts, von einer Strahlung, die sich erst nach langer, langer Zeit abschwächt. Er schreibt: «Diese Radiowellen hat es weniger durch den Inhalt erhalten als durch das Spannungsverhältnis zwischen den Wörtern, die den Inhalt ausmachen, durch die Fähigkeit des Dichters, die Wörter und Bedeutungen in ein solches Reibungs- und Nuancierungsverhältnis zueinander zu setzen, daß die Leere weiter nachbebt, lebt, ausschlägt, ‹sendet›, eine Art von magnetischem Gewebe aus unsichtbaren Fäden».
Was durchaus etwas ganz und gar anderes meint als die gegenwärtig lancierte Sehnsucht nach Gleichzeitigkeit und dauernder Erreichbarkeit. Nichts ist dem Gedicht fremder als die Vorstellung, jederzeit verfügbar zu sein. Es lädt ja gerade dazu ein, die Zeit zu dehnen, es, das Gedicht, immer wieder hervorzuziehen, seinen Schichten zu folgen, innezuhalten, weiterzulesen. Einen Abstand zu den Erscheinungen einzunehmen, sich der Unruhe, den nicht auflösbaren Irritationen auszusetzen. Oder den geschichtlichen Spuren nachzuforschen, aus denen sich jede Gegenwart immer auch speist. Ein magnetisches Gewebe also, ein magnetisches Gewebe, in dem die Kraft der Einzelheiten wirksam ist. Man sieht ja, was schon eine kleine Herbstfliege ausrichten kann.
(2012)
2. Kapitel
Wie eine Katze hinter Fensterscheiben
Immer noch steht der kleine Junge am Wasser. Sein Blick scheint auf das blaurote Frachtboot zu gehen, das langsam durch den Kanal zieht. Die Fahrspur des Bootes ist kaum zu sehen, nur ein paar dunklere Linien deuten den Rand der Wellen an. Wo das Wasser gegen die Kanalwand drückt, hat sich ein wenig Schaum angesammelt. Darüber beginnt der Uferweg, hell und farblos, als habe die Luft ihre Form verändert. Der Junge hat die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Er trägt Hosen mit Schlag und ein blaues Jäckchen, Dinge, die sein schmaler Schatten nicht zeigt. Die Schatten auf der Häuserfront gegenüber sind klar gezeichnet. Hätte das Licht nicht diese kalte Tönung, man könnte es für eine Nachmittagsszene halten.
Ich kann mich an die Reise nicht erinnern. Kein Bild, kein Wort, nicht einmal ein einzelnes Geräusch ist hängengeblieben. Die Signatur unten rechts nennt das Jahr 1977. Ich war also gerade vier Jahre alt. Aber die Leere im Kopf hat nichts mit dem Alter zu tun. Es gibt Erinnerungen, die reichen bis in das zweite oder dritte Lebensjahr zurück. Hier fehlt jede Spur. Mir bleibt nur dieses Bild, das mein Vater gemalt hat. Eine Stadtansicht, Öl auf Leinwand, in einem Stil, den man ohne weiteres realistisch nennen darf.
Lange Zeit dachte ich, das Bild zeige eine Szene aus Grado oder Chioggia, die kleinen italienischen Adria-Städte hatten meinen Eltern schon immer gefallen. Doch tatsächlich ist es Venedig. Und beim genauen Hinsehen kann es auch nur Venedig sein. Der Kanal, die Wölbung der Balkone, der Bug eines Kahns, der sich von links ins Bild schiebt – ein Motiv aus einer der Nebenstraßen, etwas abseits der bekannten Plätze.
Wenn ich mir heute Photos aus jener Zeit ansehe, erkenne ich manchen Ort wieder, ich kann Verwandte zuordnen, Freunde meiner Eltern, auch den einen oder anderen Anlaß. Nur die Aufnahmen von dem Jungen berühren mich nicht. Es gibt Portraitbilder, Bilder mit anderen Kindern, Bilder mit den Großeltern, von Ausflügen, Geburtstagsfeiern, vom Zugfahren. Doch wenn ich den Jungen betrachte, verspüre ich ein Gefühl von Fremdheit. Vielleicht, weil ich nichts Vertrautes in seinem Gesicht entdecken kann, keinen Ausdruck, der sich im Gesicht des Erwachsenen wiederfinden ließe. Ich sehe Merkmale, natürlich, einen Leberfleck, eine Narbe auf dem rechten Arm. Aber das meine ich nicht. 1974, 1975, 1976 – es ändert sich nichts. Ich bleibe beim «kleinen Jungen».
Sowenig ich mich an die Reise selbst erinnern kann, so deutlich kann ich mir doch Bilder und kleine Szenen wachrufen aus der Zeit, in der mein Vater an dem Gemälde arbeitete. Obwohl er eigentlich nur an den Wochenenden Gelegenheit dazu fand, kommt es mir wie eine Spanne sehr dichter Tage und Wochen vor, ohne Alltag, ohne Unterbrechung. Ich spüre, wie es mich hineinzieht in das, was Jürgen Becker einmal eine «Umgebung des Erinnerns» genannt hat. Einen Raum, der sich aufspannt, eine echte Gedächtniswelt, die in ihrer Ferne und Fremdheit plötzlich so gegenwärtig erscheint, daß ich tatsächlich durch die alten Zimmer zu streunen meine. Ich sehe Stehlampen und den Teppich mit seinen groben Fasern, die schwarz-weiße Couch und die Garderobe, an der dicht an dicht die Jacken hängen. Und ich sehe das Licht, das aus dem Zimmer meines Vaters schräg über den Gang in das meine fällt, eine sich öffnende Fläche, die den Türrahmen färbt und die Wand mit einem hellen Keil versieht.
Jeden Abend, sobald die Eltern im Wohnzimmer vor dem Fernseher saßen, ging ich kurz hinüber in das Arbeitszimmer, um einen Blick auf die Leinwand zu werfen. Das Bild war fast fertig, es fehlte nur noch der kleine Junge mit seiner blauen Jacke. Genaugenommen, war auch der Junge schon auf dem Bild, jedenfalls seine Kontur, unfaßbar zunächst, doch nicht mehr wegzudenken aus der Umgebung. Ich hatte es gesehen, als ich im Schlafanzug aus dem Bad gekommen war. Es beruhigte mich, daß mein Vater noch weiter an dem Bild arbeiten, dem Jungen, so dachte ich es mir, nach und nach Farbe verleihen würde. Doch als ich den Klemmstrahler neben der Staffelei anknipste, sah ich etwas ganz anderes. Der Umriß des Jungen war verschwunden. Wie an den Tagen zuvor bestand der untere Rand des Bildes nur aus einer grauen Fläche, die sich beim genauen Hinsehen als Anlegestelle zu erkennen gab.
Ich erinnere mich, wie stark meine Reaktion war. Ein heftig einsetzender körperlicher Schmerz, verbunden mit Übelkeit. Unglaube, vielleicht auch ein seltsames Staunen. Aber all das ging so schnell, so gleichzeitig vor sich, daß ich es nur als großen Hitzedruck wahrnahm. Wenn ich mich heute zurückversetze, meine ich vor allem Angst zu entdecken. Angst, nicht mehr da zu sein. Als hätte mich etwas aufgesaugt, verschluckt, und eine große leere Stelle wäre geblieben. Doch es betraf nicht nur mich selbst – das ganze Bild hatte sich verändert. Was vorher meine Häuser und meine Boote gewesen waren, wirkte nun kalt, fremd, fast feindlich. Eine Gegenwärtigkeit ging von dem Bild aus, die nichts mehr mit mir zu tun hatte. Die Szene hatte sich gleichsam von mir abgesprengt. Das Gemälde schien eine eigene Welt. Ich verließ das Zimmer, ohne noch einmal hinzuschauen. Ich erinnere mich, daß ich ruhig im Bett lag an diesem Abend. Und an das Licht an der Wand, das ausging, bevor ich einschlief.
«Das Gedächtnis», schreibt Jürgen Becker, «ist ein stummes Archiv, in das nur die Erinnerung Leben hineinbringt, oder anders, aus dem sie ihre Bilder hervorholt». Eine Asservatenkammer geistiger und körperlicher Eindrücke, deren Ordnungssystem niemand kennt. Was dort abgelagert ist, bestimmt die Wahrnehmung bis in den kleinsten Impuls hinein. Aber meist merkt man das gar nicht, weil sich das Bewußtsein im Vollzug nicht reflektiert. Es bedarf einer eigenen Art von Anstrengung, um die Bilder und Szenen zu finden, die einen bestimmten Abschnitt von Zeit, von Leben, ausmachen. Manches aber hat sich damals so rasch abgespielt, daß nur Reflexe hängengeblieben sind, Spuren, kaum sichtbar, die sich heute nur zeigen lassen, indem man etwas dazuerfindet, Verbindungen herstellt, einen Zusammenhang.
Uwe Johnson war weit skeptischer, was die Erkenntniskraft der Erinnerung angeht. In den Jahrestagen beobachtet er seine Gesine Cresspahl einmal dabei, wie sie durch die Glastüren eines New Yorker Hochhauses tritt. Erst sieht sie nur die gegenüberliegende Straßenseite in dem Scheibenausschnitt gespiegelt, mit all ihren Ladenschildern, Schaufenstern und Passanten. In der zweiten Front aus Klapptüren aber wirkt die Ansicht verwischt und zerbricht beim Öffnen der Tür in gleich große Teile. Aus der verschwommenen Spiegelung von Marmorflächen, von Schatten und kleinen Lichtflecken erwächst ihr das Bild eines waldigen Sees, die Erinnerung an einen Segeltag in ihrer mecklenburgischen Heimat, der vierzehn Jahre zurückliegen soll. Damals aber war Gesine schon in den Westen gegangen. Die Erinnerung entpuppt sich als Wunschtraum. Das Gesehene, kommentiert Gesine selbst, «erzeugt Verlangen nach einem Tag, der so nicht war, fertigt mir eine Vergangenheit, die ich nicht gelebt habe, macht mich zu einem falschen Menschen, der von sich getrennt ist durch die Tricks der Erinnerung».
Die «Tricks der Erinnerung» also. Und die Katze Erinnerung. Anders als Marcel Proust ist Uwe Johnson der Meinung: Die Wiederholung des Gewesenen gibt es nicht. Noch einmal einzutreten in die Vergangenheit, noch einmal wirklich in ihr zu sein – es bleibt ein Wunsch. Weil das Gedächtnis das Vergangene nicht mit den Begriffen des Denkens fassen kann, so Johnson, mit dem Raster aus Zeit, Kausalität und Logik, das ihm sonst dient, um die Wirklichkeit einzuteilen. Es liefert nur Fetzen, Splitter, Späne, Scherben. «Das Stück Vergangenheit», heißt es an anderer Stelle, «bleibt versteckt in einem Geheimnis, verschlossen gegen Ali Babas Parole, abweisend, unnahbar, stumm und verlockend wie eine mächtige graue Katze hinter Fensterscheiben, sehr tief von unten gesehen wie mit Kinderaugen.»
Bis vor wenigen Jahren war ich überzeugt, mein Vater habe die ersten Entwürfe zu dem Bild vor Ort gemalt. Die Perspektive ist so angelegt, daß der Betrachter von einer leichten Erhöhung aus auf die Szene blickt. Mein Vater könnte hinter einem offenen Fenster gesessen haben oder in einem Türrahmen, in seiner Hand den Skizzenblock. Doch tatsächlich hat er nach einem Photo gearbeitet. Das Bild findet sich in einem der kleinen Alben, die er für jedes Kind angelegt hat. Zwischen Aufnahmen aus Mostar, Trogir und dem Zillertal gibt es eine Serie zu einem, wie es heißt, «Italienurlaub». Darunter der Zusatz «Sept. 76». Mein Vater hat das Gemälde also erst ein Jahr nach dem Urlaub angefertigt.