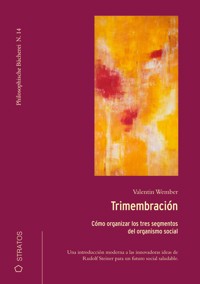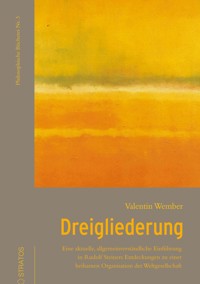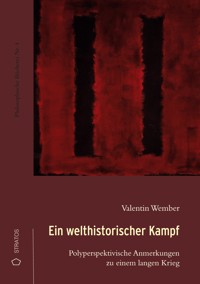Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stratosverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Philosophische Bücherei
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band von Valentin Wember zu Rudolf Steiners Konzept der Dreigliederung des sozialen Organismus erklärt an anschaulichen Beispielen die Idee des alternden Geldes sowie ein völlig neues Verständnis von Zinsen. Im Kontrast dazu wird der Irrsinn des gegenwärtigen Geld- und Wirtschaftssystems analysiert und - was sonst nie geschieht - in seinen Wurzeln untersucht. Diese Wurzeln liegen in einer Mentalität des Haben-Wollens: der Profit-Gier und der passiven Einkünfte. Diese Mentalität wächst auf einem manipulativen Erziehungssystem, das es versäumt, die Kreativität der jungen Menschen genügend freizulegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Es gibt heute etwas höchst Unnatürliches in der sozialen Ordnung, das besteht darin, dass das Geld sich vermehrt, wenn man es bloß hat.
Man legt es auf eine Bank und bekommt Zinsen.
Das ist das Unnatürlichste, was es geben kann.
Es ist eigentlich ein bloßer Unsinn.
Man tut gar nichts;man legt sein Geld, das man vielleicht auch nicht erarbeitet, sondern ererbt hat, auf die Bank und bekommt Zinsen dafür.
Das ist ein völliger Unsinn.
Rudolf Steiner
Inhalt
Einleitung: Dreigliederung - nichts für Ängstliche
Teil A Prolog
1 Die kleine Marie
2 Im Anfang
3 Die neue Bank
4 Die Wahrheit des Geldes
5 «Ich habe dafür nichts geleistet.»
Teil B Analyse
1 Zins-Pandemie
2 Ungläubiges Staunen
3 «Machen Sie Schluss!»
4 Arbeitendes Geld?
5 Eine Umverteilungsmaschine
6 Berechtigte Zinsen?
7 Alterndes Geld
8 Die Trennung von Arbeit und Einkommen
9 Alterndes Geld (2)
10 Exkurs: Maschinen und Zinsen
11 Berechtigter Mietzins?
12 Gesunde Zinsen vs. toxische Zinsen
13 Neues Bodenrecht oder nix
14 Bodenrecht und was Sie tun können
15 Wundersamer Reichtum
16 Ökonomischer Wert und Fake-Werte
17 Arbeitsschulden
18 Verrückte Zuwächse
19 Die Zukunft der Ukraine
20 «Passive» Vermögenszuwächse und Krieg
21 Cloud-Feudalismus
22 Profitmaximierung und Klima
Teil C Wurzeln
1 Eigentlich
2 Die Wurzeln eines toxischen Mindsets
3 Profitmaximierung und Gehirn
Teil D Perspektiven
1 Profit und Gemeinschaft
2 Wie lange?
3 Selbstsichere Selbstlosigkeit
4 Das schönste Geld der Welt
5 Staunen - Ehrfurcht - Dankbarkeit
6 Die Zukunft der Altersversorgung
7 Krankheitswesen - Gesundheitswesen
8 Arbeit und Einkommen von Künstlern
9 Der gute Tischler und der reiche Tischler
Anhang
1 Zwei Formen von Arbeit
2 Pathokratie
3 Zinsen und Inflation
4 «Wörgl» - neu beleuchtet
5 Wörgl: Geld aus dem Nichts?
6 Leitmedien - Leidmedien
7 Dank
Anmerkungen
Einleitung: Dreigliederung - nichts für Ängstliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Nachrichten sind voll von Krieg und Katastrophen und gleichzeitig voll von belangloser Unterhaltung, als ob es nirgendwo auf der Welt Krieg und Zerstörung, Hunger und Leid gäbe. Sehr viel weniger wird über Perspektiven berichtet, wie man aus dem Abgrund, in den man geraten ist, wieder herauskommt. Um eine solche Perspektive geht es im vorliegenden Buch. Dabei sollen zwei Sachverhalte bereits vorab benannt werden. Erstens: Um aus einem Abgrund herauszuklettern, braucht man völlig andere Kräfte und Fähigkeiten als diejenigen, durch die man hineingeraten ist. Zweitens: Wir kommen nicht umhin, möglichst gründlich zu verstehen, worin die Fehler lagen, durch die man in den Abgrund geraten ist. Oberflächliche Erklärungen sind zwar schnell gegeben, helfen aber wenig. In Wahrheit muss man ziemlich tief graben. Ein Beispiel: Der ursächliche Zusammenhang von Krieg, Profit-Interessen und Schulsystem wird so gut wie nie untersucht. Dabei ist dieser Zusammenhang naheliegend: In jedem Krieg gibt es auf der Oberfläche immer irgend ein politisches Blabla, zum Beispiel irgendeine Emser Depesche oder die Ermordung eines Thronfolgers oder den Angriff eines Landes, auf das man ab 5:45 Uhr zurückschießt, oder den Angriff auf ein Kriegsschiff in einer Bucht vor Vietnam oder angebliche Massenvernichtungswaffen, die in einem Fläschchen vor der UNO herumgeschwenkt werden, oder Terrorakte mit vielen Toten oder den Einmarsch in ein benachbartes Land. Neben dem immer wieder neu und immer noch wirksam vermittelten Blabla über irgendwelche Kriegsursachen geht es bei einem Krieg in Wahrheit immer um Eroberungen oder die Absicherung von billigen Rohstoffen und seit 2001 auch um einen dauerhaften Ausnahmezustand, mit dem totale Überwachung und das Aushebeln von Grundrechten rechtfertigt werden und um den Kampf um digitale Plattformen und Bezahlsysteme. Aber auch hinter dem Aushebeln von Grundrechten verbirgt sich das Motiv, die Kritiker der Eroberungen aus dem Feld zu räumen. Dass jeder Krieg überdies immer auch ein Mordsgeschäft für die Rüstungsindustrie ist, ist eine Binsenwahrheit, aber das ändert nichts daran, dass es eine grausame und brutale Wahrheit ist.
Warum lässt eine Gesellschaft das zu? Warum lässt eine Gesellschaft all das lügenhafte und ablenkende politische Blabla zu, all die Eroberungszüge und den Kampf um Rohstoffe und die sich himmelhoch auftürmenden Berge von Leichen? Sind wir als Gesellschaft wirklich noch nicht weiter? Oder sind wir als Gesellschaft vernebelt? Oder nur ohnmächtig? Oder ist etwas falsch an unserer gesellschaftlichen Ordnung, die es mit erschreckender Regelmäßigkeit möglich macht, dass immer wieder die Kriegswilligen regieren und die Massen auf medialen Knopfdruck wie Lemminge ihren Führern folgen?
Ein Mindset, dem es um Eroberungen und um Kriegsrenditen geht, ist nicht vom Himmel gefallen. Kein Kind wird mit diesem Mindset geboren, sondern die entsprechende Mentalität bildet sich im Lauf der Kindheit und Jugend aus. Beispiel: Kinder haben in den Untergründen der Seele durchaus das Potential des Hasses. Dieses Potential gehört zur Natur des Menschen. Aber erst dann, wenn der ältere Bruder eifersüchtig auf den jüngeren Bruder wird, weil die Mama dem jüngeren mehr Zuwendung schenkt, kann ein regelrechter Hass auf den jüngeren Bruder entstehen, der so heftig werden kann, dass man den nervenden Kleinen am liebsten weg haben und vor den Bus schubsen möchte. Geboren wurde man aber nur mit dem Potential des Hasses. Aktiviert wird das Potential durch die Lebensumstände und die Erziehung. Oder eben nicht.
Auch das Mindset, Kriege resignativ hinzunehmen, hat eine mentale Grundlage. Deshalb ist es unabdingbar, den hier vorliegenden Zusammenhang unter die Lupe zu nehmen. Wenn es noch irgendeine gesunde soziale Zukunft geben soll, die nicht mehr auf dem Leid anderer aufgetürmt ist, ist dieses Verständnis entscheidend. Noch entscheidender ist es, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Guter Wille allein, ohne Verständnis, ist gut, aber blind. Klare Erkenntnis allein, ohne guten Willen, ist lahm.
Die Pläne eines «Great Reset», von denen inzwischen immer mehr Menschen gehört haben, hängen sehr direkt mit dem Thema «Geld» und mit dem Thema «Hyper-Vermögen» zusammen. Es ist sogar so: Die gegenwärtige Lage unseres Geldsystems ist eine der Hauptursachen für diejenigen Menschen an den Hebeln der Geldmacht, die einen «Great Reset» ins Werk setzen wollen. Der Grund ist denkbar simpel: Wir haben ein Geldsystem, das exponentiell wächst. Aber dieses System kennt nur eine Richtung: Immer mehr, immer mehr, immer mehr, und zwar exponentiell. Es gibt an den Schalthebeln der Geldmacht aber keinen Plan, wie man das exponentielle Wachstum stoppen oder gar umkehren kann. Das System hat sich verselbständigt so wie sich der Besen in Goethes «Zauberlehrling» verselbständigt hat. Das System wächst jährlich um 8 – 9 Prozent. Das Problem ist, dass die Warenleistungen und die Einkommen der Menschen nur halb so stark wachsen. Dadurch gehen zwei Kurven immer weiter auseinander. Man kann nur Vermutungen darüber anstellen, ab welchem Abstand das System kollabiert und was dann an Implosionen und Explosionen folgt. Deshalb ziehen einige selbsternannte Leader eine kontrollierte Sprengung vor. Sie sprechen von einem «Great Reset».
Unser Geldsystem ist in seiner finalen Phase, aber noch viel zu viele Menschen versuchen verzweifelt, etwas zu ignorieren, was längst offensichtlich ist: Die Aber-Billionen-Vermögen, die auf den Konten der Banken und Finanzverwalter stehen, sind so gigantisch, dass die Menschen dieses Planeten die entsprechenden Leistungen und Werte nicht mehr erschaffen können.
Der Ökonom Chris Martenson wurde einmal gefragt, ob er alle seine Erkenntnisse über unser Finanzsystem und über unsere derzeitige Lage in einem Satz zusammenfassen könne. Seine Antwort: «Who eats the losses? Wer «isst» (schluckt) die Verluste?»[1] Was er damit sagen wollte: Die enormen Geldwerte, die in den elektronischen Büchern stehen, müssten de facto gelöscht werden. Man braucht eine radikale Bereinigung und einen Schuldenschnitt. Daran führt kein Weg vorbei. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß es. Die Frage ist: Auf wessen Kosten gehen die Löschungen? Wessen Vermögen werden gelöscht? Vor allem: Wer entscheidet das? Eine der einfachsten Lösungen wäre die: Man löscht die monströsen Vermögen auf der einen Seite und auf der anderen die monströsen Staatsschulden. Fertig. Man enteignet die Vermögen und gleicht damit die weltweiten Staatsschulden aus. Theoretisch. Aber wir können in einem Gedankenspiel für einen Augenblick die Player an den Tisch setzen: Die Banker werden keine Lust haben, dass die Vermögen der Banken und Finanzverwalter gelöscht werden. Die Besitzer der großen Tech-Konzerne auch nicht. Die Politiker werden sich nicht trauen, für die Löschung der Hyper-Vermögen zu votieren. Also hofft man, dass die kleinen Leute die Rechnung bezahlen. Die gigantischen Geldwerte sollen wenigstens teilweise dadurch gedeckt werden, dass man den kleinen Leuten das wegnimmt, was sie noch haben, denn das hat man in der Geschichte schon immer so gemacht, wieder und wieder und wieder. «Lass es die Masse der kleinen Leute bezahlen, aber doch nicht diejenigen, die auf der Forbes-Liste der einflussreichsten 1000 stehen.» Ein uraltes Muster. Im Unterschied zu früheren Jahrhunderten gibt es allerdings seit ca. einer Generation das Internet mit seinen neuen Möglichkeiten, sich zu informieren. Immer mehr Menschen durchschauen die unschönen Absichten. Um dieses Durchschauen zu verhindern, versucht man im Gegenzug, die Menschen in Gruppen zu fragmentieren und sie abzulenken. Ein Krieg folgt auf den nächsten, parallel (!) folgt ein sportliches Großereignis auf das vorangegangene und eine gehypte Mode auf den letzten Schrei. Nach dem Krieg ist vor dem Krieg und nach der Angst vor dem Virus ist vor der Angst vor dem Dritten Weltkrieg mit Atomwaffen. Perma-Krise hat man das genannt. Die Folge: Es sind alles in allem immer noch zu wenige Menschen, die sich gemeinsam organisieren und die sagen: «Stopp. Wir wollen bei der Frage, wie wir aus der Nummer rauskommen, ein Wort mitsprechen. Wir wollen nicht, dass hinter verschlossenen Türen über unsere Köpfe hinweg entschieden wird, wie die Zukunft aussieht und wer für die Abschreibungsverluste aufkommt.»
Vor dem Hintergrund der skizzierten Lage ist das vorliegende Buch ein weiterer Beitrag zu Rudolf Steiners Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus. [2] Ich weiß, es klingt verrückt und anmaßend, aber jeder, der sich vorurteilslos mit der Dreigliederung befasst, wird es bestätigen: Die Dreigliederung des sozialen Organismus bietet die Perspektive schlechthin, um aus dem Abgrund herauszuklettern. Ich vermute, dass es sogar die einzige ist, aber ich weiß natürlich, dass diese Auffassung nur von wenigen geteilt wird. Das macht sie allerdings nicht falsch.
Nach dem 2022 erschienenen Band 1 befasst sich der vorliegende Band 2 insbesondere mit einer der am meisten verdrängten Ursachen für die Lage unserer Zeit: Er befasst sich mit verschiedenen Formen sogenannter «Arbeitsloser Einkommen» und - sehr ungewöhnlich - mit deren tieferen Wurzeln im Geistesleben. Mit «arbeitslosen Einkommen» ist nicht «Arbeitslosengeld» gemeint, sondern es sind alle großen Vermögenszuwächse gemeint, für die man nicht arbeiten muss. Es gibt - stark vereinfacht - vier Werkzeuge, mit denen man hohe und extreme Einkommen erzielen kann, ohne im Gegenzug irgend etwas zu produzieren:
• Das uralte Prinzip von Zins und Zinseszins
• Das neuere Prinzip, Gewinne durch steigende Werte von Wertpapieren zu erzielen, inklusive unvorstellbar raffinierter Techniken für Spekulationsgewinne
• Die Methode der Geldschöpfung für Bodenkäufe, um dadurch einen Neo-Feudalismus aufzubauen. (Bill Gates ist längst der größte Ackerlandbesitzer der USA.)
• Die Methoden des Hightech-Feudalismus durch das Internet 2.0. Die großen Tech-Konzerne (Amazon, Alibaba, Tencent, Uber etc.)besitzen das digitale «Land» und beziehen daraus extrem hohe Renten, die zu gigantischen Vermögen und damit zu gigantischer Macht anwachsen.
Angesichts dieser Sachlage ist der Titel des vorliegenden Buches vermessen: «Dreigliederung leben». Geht das überhaupt?
Liebe Leserin, lieber Leser, ich will ihnen nichts vormachen. Deshalb gerade heraus: Es geht nicht. Es ist absurd zu glauben, dass man derzeit Dreigliederung leben könnte. Die Gründe sind so einfach wie ernüchternd. Ich nenne nur einige wenige:
1. Dreigleiderung bedeutet für das Geistesleben, dass das Geistesleben, insbesondere Erziehung, Forschung, Medizin und weite Teile der Justiz restlos vom Staat und von der Wirtschaft unabhängig sind. (Ausführliche Begründungen wurden in Band 1 gegeben.) Es ist evident, dass wir meilenweit davon entfernt sind. Es sei denn, man verfällt auf den skurillen Gedanken, dass die Freiheit des Schulwesens vom Staat schon dadurch vorhanden wäre, dass der Staat ein paar Schulen in freier Trägerschaft erlaubt, während 95 Prozent in staatlicher Hand sind.
2. Für das Wirtschaftsleben gibt es innerhalb der Dreigliederung mehrere wichtigste Voraussetzungen, die für eine gesunde und faire Wirtschaftsordnung erfüllt sein müssen, unter anderem:
• Unternehmen sind nicht verkäuflich, sondern werden in Verantwortungseigentum überführt. (Siehe Band 1)
• Grund und Boden sind nicht verkäuflich, sondern werdenVerantwortungseigentum.
• Der Sinn von Unternehmen besteht nicht darin, einen möglichst großen Profit zu machen, sondern darin, der Gemeinschaft auf ökologische Weise möglichst nachhaltlige Produkte zur Verfügung zu stellen.
• Arbeitskraft wird nicht verkauft bzw. von Unternehmen eingekauft (und dann als Betriebskosten verbucht).
• Es gibt keine Finanzwirtschaft und damit keine Profite durch Finanzspekulation etc.
Wir sind meilenweit davon entfernt. Das Gegenteil ist der Fall und zwar stahlbetonhart.
3.) Für das Rechtsleben heißt «Dreigliederung» unter anderem:
• Große Bereiche der Justiz liegen nicht in den Händen des Staates, sondern sind Organe des Geisteslebens.
• Die Gesetzgebung muss völlig unabhängig von wirtschaft lichen Profitinteressen sein. Mit anderen Worten: Jede Form von Lobbyismus wird rückstandslos abgebaut.
• Manipulationsfreie Demokratie gibt es nicht zum Billigpreisder Wahlen, sondern nur durch regelmäßige Beteilung aller am Prozess der Gesetzgebung. (Siehe Band 1. )
Mit einem Satz: Die Dreigliederung des sozialen Organismus liegt in der Zukunft. Sie wird gewiss kommen, aber sie ist noch nicht da. Wer behauptet, dass wir schon viel von der Dreigliederung des sozialen Organismus umgesetzt hätten, der hat sie - sorry - nicht verstanden, sondern Flausen im Kopf, wie auch immer die da hineingekommen sein mögen.
Was also heißt Dreigliederung «leben»? Es fängt damit an, dass man man kleine Brötchen backt und das erste kleine Brötchen besteht darin, die Grundgedanken zu verstehen und dann Schritt für Schritt immer weitere Aspekte. Vor allem: Seit 1919 haben sich die Verhältnisse dramatisch verändert. Um in dieser Einleitung nur ein einziges Beispiel zu nennen: An die Stelle des Privat-Kapitalismus (inklusive der sozialen Marktwirtschaft) ist längst ein neuer High-Tech-Feudalismus getreten. Das ist zu berücksichtigen und wir werden das im vorliegenden Buch tun. Der klassische Kapitalismus (inklusive sozialer Marktwirtschaft) ist wie der mythologische Saturn: Er frisst seine eigenen Kinder. Aber es wird sich zeigen, dass die Dreigliederung gerade auf diese neuen Entwicklungen die richtigen Antworten hat.
Auch die weiteren Brötchen sind immer noch klein: Mit den Gedanken ernst machen an dem Ort, an dem man es kann und so weit es die Verhältnisse zulassen. Aber an dieser Stelle, liebe Leserin, lieber Leser, darf ich Ihnen einen sehr unangenehmen Sachverhalt nicht vorenthalten. Rudolf Steiner hat deutlich ausgesprochen, dass alle Versuche, im Kleinen mit irgendwelchen Elementen der Dreigliederung zu beginnen, über kurz oder lang zum Scheitern verurteilt sind. Wirklich? Ja, lesen Sie selbst:
«Es könnte sich leicht der Glaube festsetzen (...), man solle in der Gegenwart mit allerlei Gründungen im Kleinen anfangen; mit nicht umfassenden Gründungen und gerade bei kleinen Gründungen müsse es sich zeigen, ob irgend etwas sich auch im Großen bewähren könne.
Das ist aber ein vollständiges Unding, denn sie begründen dann innerhalb einer kranken gesellschaftlichen Ordnung irgend etwas, was vielleicht ganz musterhaft sein kann, aber gerade, wenn es gut ist und sich dadurch mächtig unterscheidet von all dem, in das es hineingestellt ist, so muss es um so sicherer misslingen. Sie können unmöglich, so wie die Dinge sich entwickelt haben, wo die Welt im Großen zeigt, wie sie sich ins Absurde geführt hat, auch nur im Entferntesten daran denken, irgendwo mit kleinen Teilchen irgendetwas zu erreichen oder im kleinen Maßstab irgend etwas zu machen. Nur dasjenige kann irgendeine Bedeutung haben, welches das Umfassende heute ergreift, welches seine Strahlen aussenden kann, ich möchte sagen, nach allem, was Mensch ist. Es schadet nichts, wenn solches ins Große Gedachte misslingt, denn es wird die Anregung bleiben, und auf dies kommt es an. Auf den Impuls kommt es an.» (GA 185a, S. 152)
Liebe Leserin, lieber Leser, bitte ziehen Sie aus dem zitierten Text nicht falsche Schlüsse. Rudolf Steiner hat nicht gesagt, dass man keine Mustereinrichtungen aufbauen sollte. Rudolf Steiner wollte nur, dass man sich keinen Illusionen hingibt. Musterreinrichtungen - so sagt er unmissverständlich - sind in einem verfaulten, «kranken» Umfeld auf Dauer zum Scheitern verurteilt. In einer Kiste mit lauter faulen Äpfeln ist ein gesunder Apfel nicht in der Lage, die Kiste zu kurieren. Er wird selbst faul. Meist tritt das Scheitern als innere Fäulnis auf. Trotzdem gilt, was Luther sagte: Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen, sei es den Apfelbaum einer etwas freieren Schule oder den Apfelbaum eines unverkäuflichen Unternehmens oder den Apfelbaum einiger Hektar Land, die dem Bodenmarkt entzogen werden, oder sei es das Abstoßen von Wertpapieren, die ein arbeitsloses Einkommen ermöglichen oder sei es das Fördern von digitalen Plattformen, die nicht Privateigentum von Oligarchen sind. All diese kleinen ApfelbaumSamen haben ihren Wert und sie werden Früchte und vor allem neuen Samen hervorbringen. Aber: Wann diese Samen aufgehen, liegt meist nicht in der Hand der Pflanzer.
Mit anderen Worten: Rudolf Steiner hoffte auf mutige, aber illusionslose Pflanzer. Dreigliederung ist weder etwas für illusionäre Schwärmer noch für depressive Defaitisten. Für angepasste Mitläufer ohnehin nicht. Man muss wissen, dass man mit Idealismus keine Stahlbetonwand einwerfen kann, so wenig man mit 10 Millilitern heißen Wassers einen ganzen Liter Wasser signifikant erwärmen oder gar zum Kochen bringen kann. Dreigliederung leben, heißt verstanden haben, dass Hoffnung nicht etwas ist wie ein Fieber, das kommt oder geht. Hoffnung ist - im Sinne des Apostels Paulus - eine christliche Pflicht. Dreigliederung leben heißt deshalb auch, den unerschütterlichen Glauben zu haben an die Richtigkeit der Gedanken der Dreigliederung und darüber nachzusinnen, was es heißt, dass ein solcher Glaube, und sei er nur so groß wie ein Senfkorn, zu den Bergen an Hindernissen sagen kann: ‹Hebet euch hinweg - und sie werden es tun.›
Vor allem aber bedarf es heute einer neuen Aktivisten-Bewegung, die weitaus stärker sein muss als die Bewegung von 1918/19. Das setzt voraus, dass immer mehr Menschen die Analysen und Ideen der Dreigliederung so gründlich wie möglich verstehen und sich für ihre Verbreitung einsetzen. Dreigliederung und Nischen-Dasein sind ein Widerspruch in sich.
Zurück zu den kleinen Brötchen. An kaum einer Stelle kann man mit den Ideen der Dreigliederung im eigenen Leben so ernst machen wie auf dem Feld des Umgangs mit Geld und insbesondere auf dem Feld der Zinseinkünfte und Mietzinseinkünfte, der Wertpapiere, des Bodens und des Internets. Daher der Titel: «Dreigliederung leben». In einem gesunden sozialen Organismus geht ein bewusster Umgang mit Geld jeden an. Niemand sollte denken: «Die Dreigliederung ist eine spannende Idee, aber mit dem Spezialthema «Geld» oder «Mieteinnahmen» möchte ich mich nicht beschäftigen.» Das Gegenteil ist richtig. Ungezählte Menschen denken zum Beispiel: «Ich habe keine Schulden, deshalb zahle ich auch keine Zinsen.» Oder: «Mein Eigenheim auf eigenem Grund ist abbezahlt und deshalb interessiert mich das Thema nicht.» Wer so denkt, täuscht sich. Erstens zahlt man extrem viele Zinsen, ohne es zu wissen, und zweitens leben wir alle paradoxer Weise in erheblichem Ausmaß von Zinsen und Leistungen, die in den Ländern des Südens erwirtschaftet werden, und drittens haben Abermillionen Menschen so geringe Einkommen, für die sie 24/7 schuften, ohne selbstbestimmt leben zu können. Viertens sind wir alle gerade dabei, die Einkommen von großen Tech-Firmen mit jedem Post auf Facebook oder jedem Einkauf bei Amazon oder jeder Navigation mit Google-Maps zu vergrößern und Geräte wie Alexa oder Siri so zu trainieren, dass der Algorithmus die Herrschaft über uns übernimmt, ohne dass wir es merken. Wir sind dabei, weltweit eine ganze Generation von jungen Menschen auf dem Altar der Social Media zu opfern, die dort eine von außen gesteuerte Identität erhalten. Unsere Gesellschaft ist dabei, enorm viel junge Menschen und junge Erwachsene an die Matrix zu verlieren. Im vorliegenden Buch geht es deshalb auch darum, aus der Ahnungslosgikeit aufzuwachen. Ahnungslosigkeit führt zu Mitschuld. Augen zumachen auch.
Um weniges vorweg zu sagen: In einem gesund organisierten sozialen Organismus, wie ihn die Dreigliederungsidee Rudolf Steiners entwickelt hat, wird es - zum Beispiel - das seit Jahrhunderten bekannte Prinzip der Zinsen so nicht mehr geben. Es wird zwar noch Zinsen geben, aber nicht in der Form, in der sie heute weltbeherrschend sind. Es wird - wie wir sehen werden - Zinsen geben nur in Verbindung mit dem faszinierenden Konzept der Geld-Alterung. Wir werden das erklären. Es wird darüberhinaus in der Zukunft etwas viel Besseres geben als das uralte Zinsprinzip, und damit ist nicht der berühmte NegativZins gemeint. Es wird auch keine Finanzwirtschaft geben - und damit keine Gewinne aus irgendwelchen Finanzprodukten. Und drittens werden Grund und Boden - genauso wie die in Band I dargestellten Produktionsmittel - unverkäuflich werden und in Verantwortungseigentum transformiert. Es wird keine digitalen Plattformen in der Hand privater Eigentümer geben, die dadurch Hyper-Vermögen auftürmen, indem sie sich den Kunden, den sie haben wollen, selber schnitzen. Auch die Plattformen wie Amazon oder Uber oder Airbnb werden nur als Verantwortungseigentum verwaltet werden, wenn wir uns als Menschheit nicht mehr und mehr in die Matrix verabschieden wollen.
Das neue und zutiefst menschliche Zinsprinzip, das wie ein Morgenrot am Horizont auftaucht, ist schnell erklärt und einfach zu verstehen. Ich werde deshalb mit der Tür ins Haus fallen und es gleich im ersten und zweiten Kapitel abhandeln und den Leser nicht erst damit quälen, das ganze Elend des heute gängigen Zinsprinzips und der Bodenakkumulation und des TechFeudalismus zu schildern, um dann am Ende den rettenden Ritter auf weißem Pferd mit der Lösung auftreten zu lassen. Nein, gleich zu Beginn wird das künftige Zinsprinzip wie Athene in voller Rüstung aus dem Haupt des Zeus in Erscheinung treten. Erst anschließend werde ich auf die alten, aber immer noch dominanten und alle Lebensbereiche durchdringenden toxischen Prinzipien (und ihre neuen Varianten) eingehen und erklären, welche heilenden Methoden die Dreigliederung entwickelt hat.
Auch wenn es verschiedene Werkzeuge für arbeitsloses Vermögenswachstum gibt, sodass monströse Vermögen entstehen, die jede Demokratie untergraben, schildere ich vorrangig den altmodischen Mechanismus von Zins- und Zinseszins, weil an ihm das Grundmuster verstanden werden muss. Erst anschließend gehe ich auf die Geldschöpfung für Bodenkäufe und auf Wertpapiersteigerungen sowie auf den derzeitigen Hightech-Feudalismus ein. Ich schildere die entsprechenden Sachverhalte nicht gerne, aber ich habe mich dazu entschieden, weil ich es für wichtig halte, dass immer mehr Menschen die Auswirkungen der toxischen Werkzeuge durchschauen – vor allem aber die Wurzeln durchschauen, denn wir haben es mit einem merkwürdigen Paradox zu tun. Nur ein Beispiel: Das uralte Zinsprinzip liegt offen vor aller Augen da, jeder kennt es, und doch ist es mehr oder weniger unbekannt. Es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die herzensgut sind, aber nicht im geringsten ahnen, was es mit dem Zinsprinzip auf sich hat. Sie freuen sich über ein paar Zinserträge für ihre Einlage auf einem Festgeldkonto oder aber sie stöhnen über die hohen Bauzinsen oder prekäre Arbeitsverhältnisse, doch im Grunde wissen sie nicht, was sie tun oder warum sie leiden. Sie wissen es nicht, weil das Thema in unserer Gesellschaft de facto vermieden wird, als ob es sich um ein Tabu handelt, statt es Tag für Tag in die Schlagzeilen zu bringen, wo es in Wahrheit hingehört. Genauso verhält es sich mit den Gewinnen aus Wertpapiersteigerungen und den Vermögenszuwächsen durch Geldschöpfung für Bodenkäufe und mit dem Hightech-Feudalismus. Die bestehenden Prinzipien sind zwar, wie wir sehen werden, die Ursache zahlreicher Zerstörungsprozesse, aber sie sind selbst nur ein Symptom. Sie sind das Ergebnis eines Mindsets von Abermillionen Menschen, das nicht sein müsste und das wir willentlich verändern können. Die tieferen Ursachen liegen in der Verfasstheit des modernen menschlichen Geistes. Aber die Verfasstheit des modernen Menschen hängt damit zusammen, welche Form von Erziehung und Bildung wir durchlaufen. Die heutigen Formen von Bildung und Erziehung tragen erheblich dazu bei, dass wir nicht wirklich in Kontakt mit uns selbst sind und noch weniger in wahrem Kontakt mit unseren Mitmenschen. Ich werde zeigen, dass beides zusammen der entscheidende Nährboden für ein toxisches Geldsystem ist. Aber jedes System lässt sich überwinden. Mehr noch: Abermillionen Menschen sehnen sich nach einer gesünderen Gesellschaftsform, und je stärker diese Sehnsucht in der Krise und Umbruchzeit der Gegenwart ist, desto mehr wird das Morgenrot einer kommenden Zeit sichtbar. Das vorliegende Buch versteht sich als ein Künder dieses Morgenrots. Im dämmernden Dunkel der Nacht sagt es: «Schau, was da kommt.»
Wäre ich allerdings ein Pueblo-Indianer, so würde ich sagen: «Unsere Aufgabe ist es an jedem Tag, dabei zu helfen, dass die Sonne, die vom Morgenrot angekündigt wird, ihren Gang über das Firmament gehen kann.»
*
Zum Schluss dieser Einleitung sei noch eine Bemerkung zum Stil des vorliegenden Buches angefügt. Die modernen Wirtschafts- und Finanzverhältnisse sind hochkompliziert. Es genügt, einen Blick in die brillant geschriebenen Bücher von Frank Schirrmacher, Norbert Häring, Cord Schnibben, Yanis Varoufakis und vor allem Samirah Kenawi zu werfen:
• Cord Schnibben und Ullrich Fichtner (2012), Billionenpoker – Wie Banken und Staaten die Welt mit Geld überschwemmen und uns arm machen.
• Frank Schirrmacher (2013), Ego. Das Spiel des Lebens.
Norbert Häring (2021), Endspiel des Kapitalismus. Wie die Konzerne die Macht übernahmen und wie wir sie zurückholen.
• Yanis Varoufakis (2023), Techno-Feudalsim.
• Samirah Kenawi (2020 - 2023); Manifest für das 22. Jahrhundert. Die Quadratur des Geldes. (Samirah Kenawis vierbändige Quattrologie über das Geld gehört zum Besten und Gründlichsten, was es zu diesem Thema gibt.)
Im Vergleich zu den benannten Arbeiten wird die Darstellungsweise des vorliegenden Buches sehr elementar sein. Sie könnte deshalb leicht für naiv gehalten werden. Aber genau das ist sie nicht. Das vorliegende Buch nimmt sich – in der Terminologie von Daniel Kahnemann – viel Zeit für ein langsames Denken.[3] Es reflektiert die basalen Grundaxiome, auf denen unsere Verhältnisse aufbauen und es liefert dazu einfache Geschichten und Erzählungen. Naiv wäre es vielmehr, wenn die Grundaxiome, auf denen ein System aufruht, nicht in den Blick genommen und überprüft werden. Diese Vorgehensweise des vorliegenden Buches möchte Sie, liebe Leserinnen, lieber Leser, dazu anregen, selbst zu den Grundgedanken vorzustoßen, um diese kritisch zu überprüfen und um selbst weiter zu denken und Neues zu entdecken. Darüber hinaus hat das vorliegende Buch einen etwas anderen Schwerpunkt als die benannten Arbeiten: Es geht in diesem Buch darum, das Zusammenwirken der drei großen Organsysteme des sozialen Organismus (Geistesleben, Rechts-leben, Wirtschaftsleben) an einer speziellen Stelle zu erhellen, nämlich an der Stelle des Zusammenhangs zwischen einem unfreien Geistesleben und einem toxischen Geldsystem. Der Blick auf gerade diesen Zusammenhang ist indess kein Wunder - bei einem Pädagogen als Autor.
Seewalde (Mecklenburg) im April 2024
Teil A Prolog
1 Die kleine Marie
«Wie kann ich nur so vergesslich sein! Ich bin einfach zu zerstreut!»
«Was ist denn passiert, Mama? Warum ärgerst du dich so? Das bringt doch gar nichts!»
«Ich habe vergessen, Eier einzukaufen. Ich wollte für unsere Gäste heute Abend eine Quiche machen und jetzt ist es zu spät. Die Läden in unserem Dorf haben alle schon geschlossen.»
«Aber das ist doch nicht schlimm, Mama. Ich kann rüber gehen zu unserer Nachbarin und fragen, ob sie uns ein paar Eier leihen kann. Das macht sie bestimmt. Am Montag kaufen wir neue und bringen sie ihr zurück.»
Und so geschah es. Die kleine Marie kam mit 6 Eiern von der Nachbarin zurück, die Mutter machte die Quiche, die dann die Anerkennung der Gäste fand.
Der nächste Tag war ein Sonntag. Die Mutter erlaubte sich, etwas länger zu schlafen. Als sie in die Küche kam, war dort die kleine Marie schon zugange und werkelte an einem Teig für Plätzchen, die sie backen wollte. Dann kam der Montag. Als die Mutter mit den nachgekauften Eiern nach Hause kam, wollte die kleine Marie die Eier unbedingt selbst der Nachbarin zurückbringen. «Bitte Mama, lass mich sie zurückbringen. Ich habe sie ja auch geholt.» Die Mutter war einverstanden. Marie nahm ein paar Plätzchen, die sie gebacken hatte, wickelte sie in Geschenkpapier ein und brachte beides zur Nachbarin.
Liebe Leserin, lieber Leser, das ist schon alles. Die kleine Geschichte enthält in aller Unscheinbarkeit das gesamte Konzept der neuen «Zinsen». Die geliehenen Eier waren ein Kredit, zwar nicht in Geld, aber in Naturalien. Dieser Kredit wurde zurückgegeben. Aber nicht nur das. Es kam noch etwas hinzu, was man «Zinsen» nennen könnte: Die Plätzchen, die Marie selbst gebacken hatte und fein eingewickelt als kleines Dankeschön zu den Eiern hinzugab. Der Unterschied zum herkömmlichen Zinsprinzip ist indes gewaltig: Es handelt sich um Zinsen aus Dankbarkeit. Es handelt sich um Dankbarkeits-Zinsen, nicht um Zwangs-Zinsen. Deshalb ist auch der Ausdruck «Zinsen» nicht gut. Der Terminus «Zinsen» ist zu sehr besetzt durch das, was wir seit mehr als zwei Jahrtausenden unter Zinsen verstehen. Vielleicht sollte man besser von Dankbarkeits-Zeichen oder DankbarkeitsGeschenken sprechen, die an die Stelle eines geforderten Zinses treten. Die kleine Marie wollte die Plätzchen gerne hinzufügen und zwar von sich aus; vielleicht, aber das wissen wir nicht, weil sie ähnliche Dankbarkeitsgesten zuvor bei der Mutter gesehen hatte und diese jetzt nachahmte. Wie auch immer, die Dankbarkeit war für Marie ein Herzensbedürfnis.
Stellen wir uns als Kontrast eine Variante der gleichen Geschichte vor: Marie geht zur Nachbarin und fragt, ob sie ein paar Eier ausleihen darf. Am Montag würde die Mutter sie zurückbringen.
«Ja, du bekommst die Eier, aber nur wenn du mir dafür ein paar Plätzchen backst.»
«Gut», sagt Marie, «mache ich», nimmt die Eier und backt am Sonntag die Plätzchen.
Die kleine Marie wird wahrscheinlich nicht sagen: «Nein Danke, dann nicht. Sie können Ihre Eier behalten!»
Marie wird sich auf die Forderung einlassen, denn die Mama braucht ja die Eier. Aber durch die Bedingung, Plätzchen zu backen, wird das Wichtigste zerstört: Der freie Impuls der Dankbarkeit. Das Plätzchenbacken wird jetzt zu einem Muss. Es wird erzwungen. Und das verändert alles.
Im ersten Fall erlebt die kleine Marie mehr oder weniger unbewusst eine stille, unausgesprochene Freude, wenn sie sich durch ihre Plätzchen bedanken kann. Und auch die Nachbarin freut sich über die Plätzchen, aber mehr noch über Marie, die sie ihr gebacken hat. In Variante 2 bleibt von dieser doppelten Freude nicht viel übrig. Ein erzwungenes Geschenk ist kein Geschenk mehr. Der geforderte Zins zerstört das Schenken und er zerstört mit der Dankbarkeit etwas zutiefst Menschliches.
Jeder Mensch hat ein natürliches Bedürfnis, sich zu bedanken, wenn ihm geholfen wurde. Das ist sogar biologisch veranlagt und deshalb auch bei höheren Tieren eindrucksvoll zu beobachten. Sie bedanken sich, wenn sie gerettet wurden. So gibt es etliche Geschichten von Bären oder Elefanten, die durch ihr Verhalten einen Wildhüter um Hilfe gebeten haben, weil eins ihrer Jungen in Not war. Nach erfolgter Rettung hatten diese Tiere den Impuls, sich zu bedanken, und sie drückten das in verschiedener Weise gegenüber ihrem Helfer aus.
Bei uns Menschen wird im Zuge der Sozialisation der natürliche Impuls zur Dankbarkeit nicht so weit freigelegt, wie es möglich wäre. Oft wird er zugeschüttet und verkümmert. Aber im Grunde kann man das, was die kleine Marie empfunden hat, auch noch als Erwachsener empfinden. Stell dir vor, dass du dir von einem Freund Geld geliehen hast. Sagen wir 1000 Euro. Zum verabredeten Zeitpunkt gibst du ihm die 1000 Euro zurück. Falls du noch so empfindest, wie die kleine Marie (das heißt, falls die Kindheitskräfte in dir noch nicht verschüttet sind), wirst du die Rückgabe mit einem kleinen Geschenk verbinden. Das kann ein Buch sein oder ein Blumenstrauß oder die Einladung zu einem Abendessen. Das alles sind kleine Dankbarkeits-«Zinsen». Es sind freie Schenkungen. Diese Dankbarkeits-Zinsen sind in Wahrheit das Ur-Modell von Zinsen.
Im Zuge des Schenkens und nicht im Zuge des Tauschhandels ist das Geld entstanden. Das kann man bei dem Kulturanthropologen David Graeber nachlesen [4]: Der Fürst eines Stammes besuchte mit seinem Gefolge den Fürst eines Nachbarstammes und überreichte ein Geschenk. Wenn nun der Beschenkte nicht gleich ein Gegengeschenk überreichen konnte, überreichte er zum Zeichen seiner Dankbarkeit und Würdigung des Geschenks eine schöne Muschel oder eine Perle. Diese Muschel war nicht etwa Tauschgeld, wie man lange gedacht hat. Sie war ein Dankbarkeitszeichen. Und sie war zugleich das Versprechen, zu einer passenden Gelegenheit ein würdiges Gegengeschenk zu überreichen.
Am Anfang war das Schenken. Das Schenken wandelte sich erst im Laufe der Zeit in ein Tauschen und in ein Fordern einer Gegengabe, mit all den Folgen, die noch dargestellt werden.
Auch im Neuen Testament findet man den hier geschilderten Sachverhalt: Das erste, was die Priesterkönige machen, als sie zum neugeborenen König aufbrechen wollen, ist zu überlegen, was sie ihm schenken werden. In ihren Augen kann dieses Geschenk gar nicht wertvoll genug sein. In den «Oberuferer Weihnachtsspielen» wurde dieses Motiv auch auf die Hirten übertragen: Die Hirten auf dem Feld haben das tiefe Bedürfnis, dem neugeborenen Kind etwas zu schenken. Nicht überliefert ist allerdings, welches äußere Zeichen der Dankbarkeit Maria zu ihren Dankesworten hinzugefügt hat. Vielleicht, aber das ist pure Spekulation, eine Locke des Kindes.
Geht man dem Wesen des Dankbarkeit-Geschenks noch weiter nach, so beruht es darauf, dass man in sich selbst eine innere Verpflichtung (engl. duty) spürt, sich zu bedanken. Dieses Gefühl, zum Dank verpflichtet zu sein, steigt aus einem noch tieferen Urgrund auf, nämlich aus dem Prinzip der Gegenseitigkeit oder der Wechselseitigkeit. Bei Kindern kann man es gut beobachten. Es kommt unter Kindern nicht gut an, wenn der Hans gerne kleine Leckerli-Geschenke von seinen Klassenkameraden annimmt, aber selbst nie etwas abgibt oder schenkt. Es kommt ebenso wenig gut an und führt gar nicht so selten zu Herzeleid, wenn die Jule von vielen Kindern zum Geburtstag eingeladen wird, sie aber umgekehrt niemanden oder nur andere einlädt.
Das Gefühl, zum Dank eigentlich verpflichtet zu sein, entsteht aus der transzendentalen Grundidee der «Gegenseitigkeit». (Den philosophischen Spezial-Ausdruck «transzendental» erläutere ich in der Anmerkung. [5])
Dem Gegenseitigkeitsprinzip kann der Mensch in zwei Formen gerecht werden: Einmal in Form einer freilassenden Tat und einmal als Forderung. Die Nachbarin, die ein paar Plätzchen einfordert, glaubt, von dem Prinzip der Wechselseitigkeit auszugehen: «Ich helfe dir und du musst mir dafür etwas geben.» Im anderen Fall: «Ich helfe dir und gehe davon aus, dass du mir auch einmal helfen wirst, wenn ich deiner Hilfe bedarf.» Der Unterschied zwischen beiden Varianten ist eine Weggabel. Wer etwas verleiht, ohne eine Gegenleistung zu fordern, denkt nur an den Anderen. Wer etwas verleiht und damit eine Forderung verbindet, denkt beim Verleihen an sich: «Ich will von dem Verleihen einen Nutzen für mich haben.»
Das heißt: Das kosmische Prinzip der Selbstlosigkeit lebt im freilassenden Verleihen und im dankbaren Gegengeschenk. Das kosmische Prinzip der Selbstbezogenheit