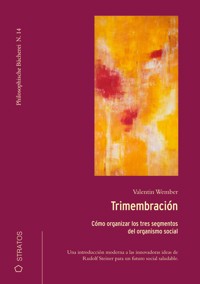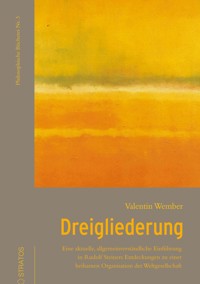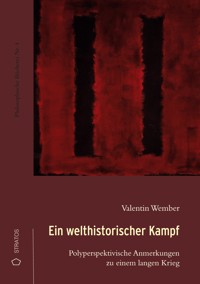
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stratosverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Philosophische Bücherei
- Sprache: Deutsch
Aus dem Inhalt: «Zur Hölle, wir haben gewonnen; Das große Schachbrett; Die entscheidende Weiche; Russland und Wladimir Putin; Frühe Prägungen; Aufstieg zur Macht; «Ausradieren auf dem Plumpsklo; «Wozu eine Welt, wenn es kein Russland gibt»; Unversöhnliche Sichtweisen; Vong ganze langer Hand ; Perspktiven
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
A. Das große Schachbrett
1 Überfordern
2 »Zur Hölle, WIR haben gewonnen.«
3 The winner takes it all.
4 «The Grand Chessboard”
5 Bratislawa, April 2000
6 «Wir ziehen auch eure Züge.»
7 Bukarest und Georgien 2008
8 Wurzeln der US-Dominanz
Die Anfänge
Vom Nest zum Weltraum
Die entscheidende Weiche
Zweierlei Verpackung
9 Sanktionen
10 »Lasst uns in Ruhe!«
11 Die USA sind nicht Amerika
B. Russland und Wladimir Putin
1 Russland - aus der Sicht des Westens
2 Russland ist nicht gleich Russland
3 Putin - Retter oder Zerstörer Russlands?
4 Frühe Prägungen
Methodische Vorbemerkungen
Eltern und Kindheit
Ein Leben auf den Hinterhöfen und Straßen
Sich als Schwächerer gegen Stärkere behaupten
Das Gefühl auserwählt zu sein
Gorbatschows Perestroika
1989
Der KGB nach 1991
Erfahrungen mit dem wilden Kapitalismus
Erfahrungen mit der Demokratie
5 Aufstieg zur Macht
Von Sankt Petersburg nach Moskau
Warum Putin?
Zwischenfazit
»Ausradieren auf dem Plumpsklo«
Jelzins Entscheidung
»Wozu eine Welt, wenn es kein Russland gibt?«
Making Russia Great again
Die Bedeutung der Jelzin-Zeit für Putin
6 Das Bojaren-System
7 Gutsherren-Demokratie
C. Der Weg in den Krieg
1 Unversöhnliche Sichtweisen
2 Aus der Sicht eines Schweizers
3 Exkurs 1: Kriegsberichterstattung
4 Exkurs 2: Kriegspropaganda
5 Von langer Hand
6 Von ganz langer Hand
Zwischen zwei Mühlsteinen
8 Liever doot dan Sklav
D. Diagnose
1 Kampf der Kulturen
2 Das »Ägypten-Problem« in Russland
3 Das »Ägypten-Problem« im Westen
4 Licht
5 Perspektiven
6 Methodische Nachbemerkung
Anhang
Anmerkungen
Literatur
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser, gestatten Sie drei Vorbemerkungen.
Erste Vorbemerkung
Vor etlichen Jahren begleitete mich ein Freund auf einem nächtlichen Spaziergang. Am Himmel sah ich einen hellen Stern. »Schau einmal«, sagte ich, »das ist bestimmt Jupiter.« »Nein«, sagte mein Freund, »das ist nicht Jupiter. Das ist überhaupt kein Stern. Das ist das helle Licht eines Flugzeugs.« Ich war mir da nicht so sicher. Das Licht blieb konstant an seiner Position. Erst einige Minuten später veränderte es seine Position zu anderen Sternen so schnell, dass auch mir klar wurde, dass es sich um ein Flugzeug handeln musste. Woher wusste mein Freund das von Anfang an? Die Antwort: Mein Freund war ein Experte auf dem Gebiet der Astronomie. Er kannte die gesamte Ordnung der Fixsterne, er kannte ihren aktuellen Stand zu jeder Uhrzeit (auch bei Tag), er kannte den momentanen Stand der Planeten – und er kannte das alles dermaßen gut, dass ihm sofort klar war, dass sich an der Stelle, an der das helle Licht zu sehen war, überhaupt kein Stern befinden konnte.- Das war mir eine Lehre. So wie man einen Lichtpunkt am Nachthimmel besser beurteilen kann, wenn man den Fixsternhimmel und die momentanen Planetenpositionen gut kennt, so kann man auch ein aktuelles Zeitgeschehen besser beurteilen, wenn man den geschichtlichen Zusammenhang kennt. Ohne eine Kenntnis der historischen Kontexte kommt man leicht zu falschen Beurteilungen. Aus diesem Grund werde ich im vorliegenden Buch mehrere historische Kontexte aufspannen. Kennt man sie, so erhält man ein anderes Bild und vor allem ein anderes Urteil als ohne eine Kenntnis dieser Kontexte.
Zweite Vorbemerkung
Vor mehr als 10 Jahren hatte ich mit einer Schulklasse eine Israel-Tournee vorzubereiten. Wir führten unter dem Titel »Versöhnende Vernunft« an mehreren Orten vor jüdischen und arabischen Schülern Lessings »Nathan der Weise« in englischer Sprache auf. Zur Vorbereitung auf den Israel-Palästina-Konflikt arbeiteten wir mit einem Geschichtsbuch, das ursprünglich israelische und palästinensische Historiker gemeinsam schreiben wollten. Das hatte sich als unmöglich erwiesen. Die Sichtweisen der Israelis und der Palästinenser lagen zu weit auseinander. Angesichts des Scheiterns entschied man sich für einen Kompromiss. Auf jeder linken Seite des Buches stand das israelische Narrativ, auf der rechten Seite das palästinensische. In der Mitte der beiden Seiten war ein unbedruckter Streifen freigelassen. Der Leser konnte dort Anmerkungen, Ergänzungen und Fragen notieren.[1] Als wir in Israel ankamen, erfuhren wir, dass die israelischen Behörden verboten hatten, das Buch im Schulunterricht einzusetzen. Wir stutzten. Darf es nur eine Sicht geben?
Aus russischer Sicht ist es ganz klar: Propaganda gibt es nur im Westen. Aus westlicher Sicht gibt es Propaganda nur in Russland. »Bei uns doch nicht!« Für die Mehrheit der Menschen in den Nato-Ländern ist Putin ein durchgedrehter oder eiskalter Machtmensch mit imperialistischen Zielen, der rücksichtslos die Ukraine zerstört, während die EU und die Nato unter der Führung der USA für Freiheit und Demokratie eintreten. Wer etwas anderes sagt, ist russischer Propaganda erlegen oder – noch schlimmer – der Kollaboration mit dem Feind schuldig oder schlechterdings ein abgefahrener Spinner. [2]
Die andere Sicht - im Westen die Sicht einer Minderheit - klingt für die Mehrheit völlig irrwitzig und sieht so aus: Die wahren Schuldigen seien die USA, die seit mehr als 150 Jahren im Hinblick auf Russland weitreichende geostrategische Ziele verfolgen und ihren Einfluss auf Eurasien von Lissabon bis Wladiwostok sichern wollen. Die USA hätten 2014 in Kiew einen Putsch lanciert und eine ihnen genehme Regierung eingesetzt. Seit 2014 habe dann die neue Regierung die autonomen Gebiete der Ost-Ukraine drangsaliert. Die russische Sprache wurde als Amtssprache in Schulen und Ämtern verboten. Vor allem aber hätten ultranationalistische Freikorps die Bevölkerung in der Ostukraine acht Jahre lang mit Artilleriebeschuss attackiert und dabei Tausende von russisch sprechenden Ukrainern getötet. Die neue Regierung in Kiew habe das billigend geduldet und oft auch unverhohlen gefördert. Zu Beginn des Jahres 2022 sei dann im Donbass ein finaler Vernichtungsschlag ukrainischer Verbände vorbereitet worden. Diesem sei Putin zum Schutz der russischen Bevölkerung im Donbass zuvorgekommen. Putin wollte die Dauerattacken ukrainischer Verbände ein für allemal beenden.
So ein Unfug, sagen dann die Vertreter der Nato-Sicht. Das sei nichts als russische Propaganda, auf die man nicht hereinfallen dürfe. Und so geht es hin und her und her und hin. Jede Seite wirft der anderen das Verdrehen oder Unterschlagen von Fakten vor. Wollten die Vertreter der beiden Sichtweisen ein gemeinsames Buch schreiben, es würde vermutlich genauso scheitern wie der israelisch-palästinensische Versuch. Vor diesem Hintergrund habe ich – gegen alle Meinungsmonopole auf beiden Seiten – eine polyperspektivische Darstellung skizziert. Polyperspektivisch heißt, den Blick nach rechts und links, nach hinten und vorne, nach unten und oben zu richten.[3] Es handelt sich um die Skizze zu einer umfassenden Anamnese des Krieges. Je gründlicher die Anamnese, desto größer die Chance einer zutreffenden Diagnose und ohne Diagnose keine Therapie. Grundlage war, dass ich mich viele Jahre lang mit der Geschichte der USA und der Geschichte Russlands befasst und dazu umfangreiches Material in meinem Archiv gesammelt hatte. Ich bin allerdings nicht so vermessen zu glauben, dass ich als Einzelner eine erschöpfende Anamnese liefern könnte. Das werden in Zukunft etliche Teams von Historikern tun. Ich bin erst recht nicht so vermessen zu glauben, dass ich als Einzelner eine erschöpfende Diagnose bieten kann. Auch für die Diagnose wird es ganze Stäbe von Diagnostikern geben müssen, die die unterschiedlichen Ebenen eines Krieges beleuchten. Ein Krieg hat nicht nur langfristige, mittelfristige und kurzfristige Ursachen; diese erstrecken sich auf wirtschaftliche, politische und kulturelle Felder. All das wird in der Regel erst mit historischem Abstand erkannt. Mein Beitrag versteht sich als Vorarbeit. Er liefert Bausteine zu einer Anamnese und Bausteine zu einer ungewöhnlichen Diagnose. Meine Anamnese wird unvollständig sein, genauso wie meine Diagnose vieles noch unberücksichtigt lässt. Die Vorschläge, in welche Richtung die Therapie zu gehen hat, habe ich in dem separaten, zeitgleich erscheinenden Buch »Dreigliederung« publiziert.
Das Ziel der vorliegenden Skizze besteht darin, einen Perspektivwechsel vorzunehmen: Weg von der juristischen Perspektive (Wer ist schuld? Wer hat Recht? Wer hat Unrecht?) hin zu einer – wenn man so will – kultur-medizinischen Perspektive: Krieg ist der Ausbruch einer Krankheit, die sich über lange Zeiträume und multifaktoriell aufgebaut hat.
Dritte Vorbemerkung.
Wenn im Zuge der von mir notierten Anamnese die geostrategischen Planungen und imperialistischen Aktionen etlicher US-Regierungen geschildert werden, hat das nichts mit Anti-Amerikanismus zu tun. Amerika ist nicht die Politik der Gruppe von Menschen, die an den Hebeln der Macht sitzt. Wenn im Zuge der von mir notierten Anamnese der brutale Vernichtungskrieg Putins gegen Tschetschenien oder seine »Verstaatlichung« der Oligarchen geschildert wird oder sein selektives, aber ruchloses Vorgehen gegen seine Kritiker oder die zutiefst undemokratische Gutsherren-Politik zwischen Putin und Medwedew oder die imperialistische Geschichte Russlands, ist das genauso wenig Anti-Russizismus. Amerika ist nicht gleich Amerika und Russland ist nicht gleich Russland. Beide Seiten stecken in mehreren gemeinsamen, viel fundamentaleren Problemen, die ich freilegen und verstehen möchte.
Mit dieser Zielsetzung habe ich versucht, auch wenn das zur Zeit nicht en voque ist, mich von jeder Parteinahme fernzuhalten. Dabei hatte ich das auf der nachfolgenden Seite angeführte Zitat als unerreichtes Ideal vor Augen.
Das Tao ergreift nicht Partei; es bringt sowohl das Gute als auch das Böse hervor. Die Meister ergreifen nicht Partei; ihnen sind sowohl Heilige als auch Sünder willkommen.
Laotse
A. Das große Schachbrett
1 Überfordern
2019 veröffentlichte der US-amerikanische Think-Tank Rand Corporation eine Studie unter dem Titel: Overextending and Unbalancing Russia. [4] Übersetzt: Russland überfordern und destabilisieren. Die Firma Rand ist nicht irgendwer. Sie beschäftigt knapp 2000 Mitarbeiter, generiert jährliche Einnahmen von 350 Millionen US-Dollar und wird zu 55 Prozent vom US-Verteidigungsministerium bzw. den Streitkräften der USA finanziert sowie zu 27 Prozent von anderen staatlichen Einrichtungen. Sie gilt als einer der Top Thinktanks des US-Verteidigungsministeriums.
Der 2019 veröffentlichte Beitrag eröffnet einen Blick in die Ziele und in die Denkweise der US-amerikanischen Russland-Politik und er bietet insbesondere einen Einblick in etliche politische, wirtschaftliche und militärische Maßnahmen, die 2019 erwogen wurden, um Russland zu schwächen. Insgesamt schlagen die Autoren des Artikels von 2019 knapp 30 Maßnahmen vor, durch die man Russland destabilisieren könne. Dazu werden die Schwächen Russlands gründlich abgeschätzt und jede Maßnahme wird im Hinblick auf ihre Effektivität und Effizienz beurteilt.
Im Folgenden eine Auswahl:
Eine Ausweitung der Energieproduktion in den USA würde die russische Wirtschaft belasten und möglicherweise den Staatshaushalt und damit auch die Verteidigungsausgaben des Landes einschränken. Durch eine Politik, die das weltweite Energie-Angebot ausweitet und dadurch die globalen Preise drückt, könnten die USA die russischen Einnahmen begrenzen.
Die Verhängung
strengerer
Handels- und Finanzsanktionen würde die russische Wirtschaft wahrscheinlich ebenfalls beeinträchtigen, insbesondere wenn solche Sanktionen umfassend und multilateral sind.
Die Bereitstellung militärischer Hilfe für die Ukraine (
Providing lethal aid to Ukraine)
würde die größte Schwachstelle Russlands ausnutzen. (»
Lethal aid«
– wörtlich:
tödliche Hilfe
.)
Eine verstärkte Unterstützung der syrischen Rebellen im Krieg in Syrien
Die Förderung inländischer Proteste in Russland
Die Verlegung von US-Bombern in Schlagdistanz zu wichtigen strategischen Zielen Russlands
Die Verlegung von Kampfflugzeugen, sodass sie sich näher an ihren Zielen befinden als die bis dato stationierten Bomber
Die Vereinigten Staaten könnten Russland zu einem kostspieligen Wettrüsten anstacheln.
Das war 2019. Neu war diese Linie indes nicht. Bereits 1992 hatte Paul Wolfowitz (damals Staatssekretär unter Georg Bush sen.) seine Doktrin präventiver Erstschläge (»pre-emptive strikes«) in das offizielle Dokument der US-Verteidigungsstrategie geschrieben: Alle potentiellen Rivalen der USA müssten gegebenenfalls durch Erstschläge ausgeschaltet werden, bevor sie für die USA gefährlich werden könnten. [5]
Ein Jahr später, am 1. November 1993, veröffentliche George Soros seinen berühmten Artikel «Toward a New World Order: The Future of NATO.» Soros machte sich Gedanken darüber, wie die damals zerbröselnden ehemaligen Ostblock-Staaten in sogenannte «offene Gesellschaften» transformiert werden könnten und welche Rolle die NATO dabei spielen sollte. [6] Soros machte sich Sorgen, dass das Vakuum, das der zerfallende Ostblock hinterließ, zu erheblicher Unordnung («disorder») führen könnte. Unordnung und Chaos in Osteuropa könnten - so befürchtete er - für die sogenannten offenen Gesellschaften des Westens zu einer neuen Form von Bedrohung werden, die an die Stelle der alten Bedrohung durch die UdSSR treten würde. So könnte aus der zerfallenen UdSSR ein revisionistisches Russland werden, das das Entstehen offener Gesellschaften in Osteuropa verunmöglicht. Um das zu verhindern, schlug Soros mit seinem Konzept der «Partnerschaft für Frieden» (Partnership for Peace) eine neue Sicherheitsarchitektur unter der Leitung der NATO vor. Die USA sollten innerhalb dieses neuen Konzeptes nicht mehr als Weltpolizei mit Truppen eingreifen (wie in Vietnam oder im Irak), sondern eine neue Strategie wählen: Man könne ausgewählte osteuropäische Länder mit amerikanischer Waffentechnologie ausstatten und dann deren Truppen statt NATO-Truppen kämpfen lassen. Dass hätte, so Soros, den Vorteil, dass keine Leichensäcke («body bags») mit NATO-Soldaten in die NATO-Länder zurückkämen. Soros wörtlich:
«Die Vereinigten Staaten wären nicht dazu aufgerufen, als Weltpolizist aufzutreten. Wenn sie handeln, dann in Zusammenarbeit mit anderen. Im Übrigen würde die Kombination von Manpower aus Osteuropa mit den technischen Fähigkeiten der NATO das militärische Potenzial der Partnerschaft erheblich steigern, da diese Kombination das Risiko von Leichensäcken für die NATO-Staaten verringern würde, das das Haupthindernis für ihre Handlungsbereitschaft darstellt. Dies ist eine praktikable Alternative zur drohenden Weltunordnung.» [7]
«United States would not be called upon to act as the policeman of the world. When it acts, it would act in conjunction with others. Incidentally, the combination of manpower from Eastern Europe with the technical capabilities of NATO would greatly enhance the military potential of the Partnership because it would reduce the risk of body bags for NATO countries, which is the main constraint on their willingness to act. This is a viable alternative to the looming world disorder.«
Das schrieb Soros 1993. 30 Jahre später haben die USA und die NATO im Ukrainekrieg tatsächlich (bis jetzt) nicht das Problem mit nach Hause kommenden Leichensäcken. Die Leichen liegen zu Hunderttausenden auf den Straßen, den Äckern und in den zerbombten Häusern der Ukraine, die die «Manpower» einer ganzen Generation geopfert hat.
Kurzer Rückblick: Afghanistan 1979
Als die UdSSR im November 1979 Truppen in Afghanistan einmarschieren ließ, jubelte der damalige Sicherheitsberater von Präsident Carter, Zbigniew Brzezinski (1928 – 2017): »Wir haben die Russen in die afghanische Falle gelockt.« Begründung: Der Afghanistan-Krieg würde der Anfang vom Ende der Sowjetunion sein. Die UdSSR würde mit den Kosten des Krieges überfordert sein und daran zugrunde gehen. Genauso kam es. Nach 10 Jahren Afghanistan-Krieg war die Sowjetunion am Ende, wobei der Afghanistan-Krieg beim Niedergang nur nachgeholfen und ihn beschleunigt hatte. Die USA hatten, um den kalten Krieg zu gewinnen, weitere Maßnahmen eingesetzt, unter anderem ein forciertes Wettrüsten, das die Wirtschaftskraft der UdSSR tatsächlich restlos überanstrengt hat. Gleichzeitig kam es in den Satelliten-Staaten zu Protesten, die von den USA unterstützt wurden – zuerst im katholischen Polen. [8]
1979 ging es um die Destabilisierung der UdSSR. Vier Jahrzehnte später geht es – und zwar ganz offen ausgesprochen – um die Destabilisierung Russlands. Soll also – aus US-amerikanischer Perspektive – die Ukraine ein »Afghanistan 2.0« für Russland werden? Soll die Ukraine für Russland zur tödlichen Falle werden, die Russland nicht überleben wird, so wie die UdSSR die Falle »Afghanistan« nicht überlebte? Wenn es so wäre, dann ginge es in Wahrheit nicht um die Ukraine. Die Ukraine wäre ein von den USA eingesetztes Schlachtfeld, um Russland zu schwächen. Verhält es sich so? Es gibt Analysten wie den Ex-US-Geheimdienstler Scott Ritter, die es so sehen.[9] Dagegen spricht: Wladimir Putin hat die Fehler des russischen Afghanistan-Krieges von 1979 bis 1989 gründlich analysiert. Warum sollte er in die Ukraine-Falle getappt sein? Eine Frage, die sich fundiert nicht so leicht beantworten lässt. Die schnellen Antworten zahlreicher westlicher Kommentatoren sind einfach gestrickt: Putin habe den Krieg aus imperialistischer Gier vom Zaun gebrochen oder aus dem Trieb, die eigene Machtposition zu erhalten oder aus der persönlichen Verblendung, als «Wladimir der Große» in die Geschichtsbücher eingehen zu wollen. Das sind die schnellen Antworten. Die gründlichen Antworten kommen zu einem anderen Ergebnis.
2 »Zur Hölle, WIR haben gewonnen.«
Der US-amerikanische Politologe John Mearsheimer hat in mehreren Beiträgen immer wieder darauf hingewiesen, dass die Nato-Ost-Erweiterung eine Provokation gegenüber Russland gewesen sei. [10] Man habe, so Mearsheimer, durch die Ost-Erweiterung dem russischen Bären so lange ins Auge gestochen, bis dieser sich habe wehren müssen. Mearsheimer sieht deshalb eine Ursache für den derzeitigen Krieg im Verhalten der US-Regierungen seit 1991. Das Vorgehen Putins sei in Wahrheit ein Ergebnis amerikanischer Politik.
Stimmt das?
Im gleichen Zusammenhang wird von Mearsheimer oder Oliver Stone [11] oder Waldimir Pozner [12] oder im deutschsprachigen Raum von Daniele Ganser [13] darauf hingewiesen, dass der Sowjetunion unter Gorbatschow versprochen worden sei, dass die Nato keinen Zentimeter nach Osten ausgeweitet würde, wenn Gorbatschow einer Wiedervereinigung Deutschlands und einer Mitgliedschaft des vereinigten Deutschlands in der Nato zustimmen würde.
Falsch, sagen andere Historiker. Es sei damals nie zu einem völkerrechtlich bindenden Vertrag gekommen. Außerdem sei die mündliche Zusage der Sowjetunion und nicht Russland gegeben worden. Die UdSSR wurde aber erst am 21.12.1991 aufgelöst.
Was für ein hinterlistiges Argument, erwidern darauf die Kritiker der Nato-Ost-Erweiterung. Ein Versprechen auf der Ebene von Staatsmännern habe in den internationalen Gepflogenheiten den Status eines bindenden Vertrages. Eine Missachtung führe in jedem Fall zu einem tiefen Vertrauensbruch.
Das mag sein, heißt es dann. Aber warum sollen die Länder Osteuropas nicht frei entscheiden dürfen, ob sie sich nach Westen orientieren und Mitglied der Nato werden wollen. Ja, heißt es dann auf der anderen Seite, aber die Nato hätte zu den Anträgen Polens, Tschechiens etc. auch »nein« sagen können, um Russland nicht zu beunruhigen und um Russlands Sicherheitsinteressen zu respektieren.
Was wurde tatsächlich versprochen? Die US-amerikanische Historikerin Mary E. Sarotte hat eine gründliche Arbeit zu dieser Frage veröffentlicht.[14] Für ihr Buch lagen ihr alle relevanten Quellen vor. Die Archive der damaligen Regierungen der USA, Deutschlands und der Sowjetunion wurden geöffnet. Mehr noch: Helmut Kohl (BRD), George Bush (USA) und Bill Clinton (USA) haben auch ihre privaten Aufzeichnungen freigegeben. Das gilt auch für die damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher (BRD), Eduard Schewardnadse (UdSSR) und James Baker (USA). Und schlussendlich hat sich auch der damalige Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow – nach dem Vorbild Helmut Kohls – dazu entschlossen, seine Papiere zu veröffentlichen. Das gesamte Material lag Mary Sarotte vor und so hat sie die entscheidenden Tage zwischen dem 6. und dem 25. Februar 1990 nachgezeichnet.
In den benannten Tagen stimmte Gorbatschow in einem Gespräch mit Helmut Kohl einer Wiedervereinigung Deutschlands zu. Vorangegangen waren Gespräche zwischen Schewardnadse und Baker. Der US-amerikanische Außenminister notierte am 9. Februar, dass ein vereinigtes Deutschland zwar Mitglied in einer »(politisch) veränderten Nato« werden könne, deren Geltungsbereich aber »nicht ostwärts« ausgedehnt werde. Das Weiße Haus in Washington war von diesem Angebot Bakers an die UdSSR wenig erbaut und fühlte sich übergangen. Noch am selben Tag schickte Präsident Bush sen. deshalb einen Brief an Kohl: Die USA könnten sich einen »speziellen militärischen Status für Ostdeutschland vorstellen«, aber Deutschland müsse als Ganzes in der Nato verbleiben. Alles andere (z.B. die Option eines neutralen Deutschlands) kam für die USA kategorisch nicht in Frage. Das Thema einer Osterweiterung der Nato stand damals gar nicht zur Debatte. Wie auch? Noch bestand der Warschauer Pakt. Damit war für Kohl klar, was Washington zulassen würde und was nicht. Im entscheidenden Gespräch mit Gorbatschow am 10. Februar 1990 wählte Kohl deshalb die Formulierung, dass »sich die Nato natürlich nicht auf das Territorium Ostdeutschlands ausdehnen« werde. Gemessen an dem, was Bush über einen denkbaren »militärischen Sonderstatus« geschrieben hatte, ging Kohls Zusicherung gegenüber Gorbatschow darüber hinaus. »Sich einen militärischen Sonderstatus vorstellen können« ist etwas anderes als eine »Zusicherung, dass sich die Nato nicht auf Ostdeutschland ausweiten« würde. Das Entscheidende war: Am Ende des Gesprächs erhielt Kohl Gorbatschows Zusage zur Wiedervereinigung Deutschlands. Freilich, als geschulter Politiker wusste Gorbatschow, dass Kohl nur eine Verhandlungsvollmacht hatte, aber keine Entscheidungsvollmacht. Der deutsche Bundeskanzler konnte gar keine Entscheidung fällen, die die gesamte Nato betraf.
14 Tage später fand ein Treffen von Kohl und Bush auf dem Landsitz des amerikanischen Präsidenten in Camp David statt. Bei diesem Treffen platzte Bush irgendwann der Kragen: »Zur Hölle damit. Wir haben uns (im kalten Krieg) durchgesetzt, nicht sie.« Damit war alles gesagt und das deutlich genug. Die USA waren der Sieger im kalten Krieg und der Sieger diktiert die Bedingungen. Was aus Deutschland wird und ob Ostdeutschland einen militärischen Sonderstatus erhält oder nicht, das entscheidet der Sieger und nicht die Sowjetunion. Punkt.
Für Helmut Kohl war damit klar, dass er für seinen Freund Gorbatschow nicht viel herausschlagen konnte, was den künftigen Status von Deutschland betrifft. Diesen Status würden die USA festlegen, denn die saßen am längeren Hebel, zumal der Sowjetunion wirtschaftlich das Wasser längst bis zum Hals stand. Was Kohl noch machen konnte, war, der Sowjetunion Milliardenhilfen zuzusichern. Sie wurden gezahlt und deklariert als »Finanzierung des Truppenabzugs« aus der DDR.
Gorbatschow lag augenscheinlich nichts an einer schriftlichen Fassung der mündlichen Aussagen Bakers oder Kohls. Es war sogar so: Nachdem Bush sich durchgesetzt hatte, legte er seine Sicht im April 1990 in einem langen Telegramm an den französischen Präsidenten François Mitterrand dar, das Gorbatschow bekannt war. Von Gorbatschow kam kein Protest. Gorbatschow brachte vielmehr eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur unter Führung der Nato ins Gespräch. Im Mai 1990 schlug er sogar eine Mitgliedschaft der UdSSR in der Nato vor. Aber Bushs Aussage in Camp David hatte längst klar gemacht, dass die USA daran kein Interesse haben würden. Wozu auch? The winner takes it all.
Vor diesem Hintergrund ist die Frage, wem wann was wo von wem wie versprochen wurde, zweitranging. Die USA waren der Sieger des kalten Krieges und sie sagten fortan, wo es lang geht. Dabei spielte auch die Rüstungsindustrie der USA eine erhebliche Rolle. Die Nato war gegründet worden als Verteidigungsbündnis gegen den Warschauer Pakt. Nach dessen Auflösung hätte auch die Nato aufgelöst werden können. Die Rüstungsindustrie hat damals viel Lobby-Aufwand betrieben, um das zu verhindern. Der kalte Krieg war für die Rüstungsindustrie ein gigantisches Geschäft gewesen. Das durfte nicht aufhören.
Als etwas später nach der Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Paktes etliche osteuropäische Staaten die Aufnahme in die Nato beantragten, sahen die USA keinen für sie überzeugenden Grund, diesem Wunsch nicht zu entsprechen. Im Gegenteil. Weitere Mitgliedstaaten würden die Nato stärken und die Nachfrage nach amerikanischen Rüstungsgütern erhöhen. Russland würde das schlucken müssen. Und Russland tat genau das. Russland war nach 1991 viel zu schwach, um der Ost-Erweiterung irgendetwas entgegenzusetzen. Also schluckte Russland eine Nato-Welle nach der anderen.
Für Gorbatschow war die Nato-Osterweiterung eine menschliche Enttäuschung und ein Vertrauensbruch. Für Putin war sie eine Demütigung Russlands und eine Bedrohung. Das ist der entscheidende Punkt. In ihm liegt eine Quelle für Putins Revisionismus.
Der Dichter und Philosoph Friedrich Schiller (1759 –1805) sagte einst: »Der niedergeworfene Feind kann wiederaufstehen. Nur der versöhnte ist wahrhaft überwunden, denn der ist kein Feind mehr.« Schillers Geist war ganz offensichtlich als Berater der US-Regierung nicht akkreditiert.
3 The winner takes it all.
Hätte es eine Alternative gegeben? Theoretisch schon. De facto nicht.
Alles zu tun, um den Verlierer des kalten Krieges nicht auch noch zu demütigen, wäre weise gewesen. »Lassen wir die Vergangenheit des kalten Krieges Vergangenheit sein. Helfen wir dem Verlierer auf die Beine. Betrachten wir ihn als Partner und nicht als den Schwächeren, der am Boden liegt und der die Kosten des kalten Krieges nun in der Währung billiger Rohstoffe zurückzuzahlen hat.« Theoretisch wäre es möglich gewesen, auf den Geist Schillers zu hören. Die Wirklichkeit sah völlig anders aus.
Boris Jelzin war im Zuge der Auflösung der Sowjetunion der Präsident Russlands geworden. Er hatte beschlossen, mit dem Totalitarismus zu brechen und das, was vom Kommunismus noch übriggeblieben war, radikal zu zerschlagen, indem er maximale Freiheiten gab, nicht nur auf dem Feld der Medien (Jelzin hat nie auch nur eine Zeitung oder einen Fernsehsender verboten [15]), sondern auch auf dem Feld der Wirtschaft, wo in kürzester Zeit »Freiheit« zur maximalen Willkür bei der Bereicherung wurde. Russland taumelte nach den Jahrzehnten staatskapitalistischer Planwirtschaft in einen völlig enthemmten und durch nichts regulierten Privatkapitalismus. Nicht einmal rechtsstaatliche Regeln, Gesetze und Gerichte gab es in ausreichendem Maß. Wenn zwei Geschäftsleute in einen Streit gerieten, gab es oft kein Gericht, um den Streit zu lösen. Das erledigte das Faustrecht. Wer die rücksichtsloseren Typen angestellt hatte, setzte sich durch.
Nach der Auflösung der Sowjetunion kamen scharenweise US-amerikanischen Berater nach Russland. Zum Teil waren es auch Russen, die in den USA studiert hatten. Man nannte sie die »Schock-Therapie-Jungs«. Es waren neoliberale Ökonomen, die dazu rieten, in höchstem Tempo die gesamte Staatswirtschaft so schnell wie möglich zu privatisieren. Jelzin öffnete ihnen die Tür. Die Schock-Therapie-Jungs gingen im Kreml und in Jelzins Weißem Haus [16] ein und aus. Sie rieten zu Auktionen, auf denen die großen staatlichen Unternehmen versteigert wurden und in private Hände gingen. Wer damals als ehemaliger leitender Manager eines sowjetischen Staatskonzerns mit den richtigen Beziehungen clever genug war und mit einem staatlichen Kredit eine ehemals staatliche Firma ersteigerte, wurde anschließend in kürzester Zeit zum Milliardär. Auf diese Weise förderten die US-amerikanischen Neo-Liberalen und ihre gut englischsprechenden russischen Kollegen das Entstehen einer ganzen Oligarchen-Kaste. Der Deal war denkbar simpel: Die Oligarchen durften Milliardär werden, wenn sie für günstige Verträge mit westlichen Firmen sorgten. Gemessen an den Gewinnen, die amerikanische Firmen durch günstige Rohstoffpreise machen konnten, waren die Milliarden der Oligarchen Peanuts. Auf diese Weise fand ein Ausverkauf der russischen Firmen und Bodenschätze statt. Man musste Russland nicht militärisch besetzen, um an dessen Öl und Gas, Eisenerz, Nickel, Kupfer, Platin, Gold, Diamanten und vor allem Uran zu kommen. Man musste nur die richtigen Leute installiert haben, die die Rohstoffe des Landes verscherbelten. Im Grunde handelte es sich um Beutezüge des Westens. Russland hatte den kalten Krieg verloren. Jetzt konnte man den erlegten russischen Bären wirtschaftlich ausweiden. The winner takes it all. Der Westen strich die Kriegsdividende ein, statt für Russland einen Marshall-Plan 2.0 aufzusetzen, wie man es nach 1949 für Westdeutschland getan hatte. Die Förder-Milliarden, die tatsächlich von den USA nach Russland flossen, verschwanden bei den Oligarchen. Im Grunde behandelte man Russland in der Jelzin-Zeit wie ein Schwellenland. Dort duldet der Westen – mal verdeckt, mal unverhohlen – etliche korrupte Regierungs-Chefs, die sich persönlich bereichern dürfen, wenn sie nur die Rohstoffe des Landes günstig an westliche Firmen vermitteln und Aufstände der eigenen Bevölkerung unterdrücken.[17] In Russland gab es Jelzin, der für sich und seine Familie zusammenraffte, was nur möglich war. Jelzin war alkoholabhängig, entweder ständig angetrunken oder verkatert.[18] Seine Grundidee bestand darin, den neoliberalen Schock-Therapie-Jungs zu vertrauen und auf die Kräfte des ungezügelten freien Marktes zu setzen. Dadurch wurde Jelzin zu einem Mann, der alles niedergerissen hat, aber es nicht verstand, etwas zu entwickeln. 1999 gab er das bei seinem Rücktritt zerknirscht zu. Statt die Gelegenheit zu nutzen, in Russland ein gesundes Wirtschaftskonzept aufzubauen, war Jelzin in den Händen einflussreicher US-Berater und mächtiger Oligarchen, während diese an der langen Leine ihrer westlichen Nutznießer liefen. Die Oligarchen waren sozusagen das vergoldete Mundstück eines riesigen Rüssels, mit dem Russlands Rohstoffe ausgesaugt werden konnten. Für die russische Bevölkerung war es eine Katastrophe. Die kapitalistischen Reformen der 1990er Jahren führten laut Unicef zu 3,2 Millionen zusätzlichen Todesfällen.[19] Hinter dieser Zahl in der Größenordnung eines verheerenden Krieges verbergen sich massenhaft tragische Schicksale. Eltern, die zu Sowjet-Zeit wenigstens ein bescheidenes Auskommen hatten, standen jetzt vor dem Nichts und entdeckten, dass ihre Tochter sich prostituierte, um an Geld zu kommen. Biochemiker wurden zu Taxifahrern und Marktstandbesitzer konnten zu CEOs werden. Die Kriminellen wurden zu den Behörden und diejenigen, die versuchten, sich gegen sie zu wehren, wurden zu den Kriminellen. Die Lebenserwartung für Männer sank um sechs Jahre. 18 Millionen russische Kinder wurden in die Armut getrieben. Mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung lebte am Rande des Existenzminimums und darunter. Man muss diese Geschichte kennen, um zu verstehen, dass für Millionen von Russen »westliche Demokratie« ein Synonym für Chaos und Elend ist. De facto war der Kalte Krieg 1989 / 1990 nicht zu Ende. Er ging in veränderter Gestalt weiter: Es begann die Phase der Ausbeutung Russlands durch den Westen. In Russland forderte diese Phase des Kriegs 3,2 Millionen Tote.
In Deutschland erliegt man diesbezüglich einer perspektivischen Täuschung. Man geht – aufgrund der Geschichte der Bundesrepublik nach 1945 – davon aus, dass US-amerikanische Hilfe eine Wohltat sei, denn in Deutschland gab es nach dem Krieg Care-Pakete, es gab die Berliner Luftbrücke und das Wirtschaftswunder. Für die meisten Länder ist das Gegenteil der Fall. Von Afghanistan über Irak und Libyen hinterließen die USA mit ihrem als »Hilfe« deklarierten Eingreifen ein Desaster. Im historischen Kontext war Deutschland die Ausnahme, das Desaster die Regel. Die an Russland geschickte US-»Hilfe« gehörte zur Desaster-Regel: Erst 22 Jahre später, im Jahr 2011, konnte die Russische Föderation wieder das Niveau der Lebenserwartung erreichen, das sie zu Zeiten des Sozialismus in der Sowjetunion im Jahr 1989 gehabt hatte. Kein Wunder, dass eine in Russland durchgeführte Meinungsumfrage aus dem Jahr 2000 besagte, dass 75 Prozent der Menschen den Zusammenbruch der Sowjetunion bedauerten.
The winner takes it all. Für Russland war das eine humanitäre Katastrophe.[20] Gorbatschow hatte diese Katastrophe verhindern wollen, aber er hatte dazu in den 1990er Jahren nicht mehr die Macht. 1991 war er als geladener Gast auf dem Londoner G7-Wirtschaftsgipfel. Er hatte einen Termin mit dem deutschen Journalisten Ralph Niemeyer zugesagt. Niemeyer musste lange warten. Die Sitzung dauerte und dauerte. Als Gorbatschow, sichtlich angeschlagen, aus dem Sitzungszimmer endlich zu Niemeyer kam, platzte es aus ihm heraus:
»Was der Westen von uns verlangt, ist Wahnsinn.«
»Was verlangt er denn?«
»Wir sollen die gesamte Wirtschaft sofort privatisieren.«
»Werden Sie es tun?«
»Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich es nicht tue, so sagten sie,
werden sie ab jetzt Jelzin unterstützen.« [21]
Und genau so kam es.
4 «The Grand Chessboard”
1997 veröffentlichte Zbigniew Brzezinski sein Buch »The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives«. Die deutsche Übersetzung erschien 2001 unter dem Titel: »Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft«. Hans-Dietrich Genscher verfasste ein Vorwort. Brzezinski war in den USA einer der namhaftesten Außen- und Sicherheitspolitiker. Seine Familie gehörte übrigens zum polnischen Adel und stammte aus der (heute zur Ukraine gehörenden) Stadt Brzezany. Daher der Name. Unter der Präsidentschaft Jimmy Carters (1977 – 1981) war Brzezinski dessen Sicherheitsberater.
In seinem Buch geht es darum, »im Hinblick auf Eurasien eine umfassende und in sich geschlossene Geostrategie zu entwerfen«. Man stelle sich vor, ein deutscher Politiker würde ein Buch darüber schreiben, wie Eurasien am besten zu organisieren sei, sodass es den deutschen Interessen entspricht. Was für jeden deutschen Politiker seit 1945 ein Tabubruch wäre, ist für einen US-Geostrategen das Natürlichste von der Welt. Die USA seien – so Brzezinski – »in den Bereichen Militär, Wirtschaft, Technologie und Kultur die einzige globale Supermacht«. Als solche müssten sie ihre Vorherrschaft auf dem »großen Schachbrett« Eurasien sichern, um langfristig eine neue Weltordnung zu ermöglichen. Aus US-amerikanischer Perspektive ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die USA darüber befinden, was für die Welt gut ist und was nicht. Darin besteht ihr sogenannter «Exeptionalismus». Eurasien erstrecke sich – so Brzezinski – von Lissabon bis nach