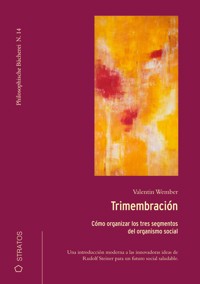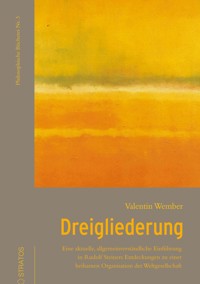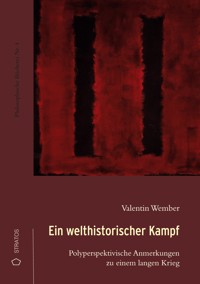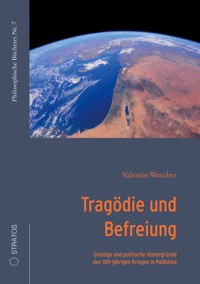
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stratosverlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Buch bietet fast eine Überfülle an Informationen, die in Deutschland kaum bekannt sind. Aus der Sicht des Judaismus wird die Frage beantworte, was - im Sinne des orthodoxen Judaismus - ein Jude ist. Das Konzept der religiösen Vererbung wird erklärt ebenso wie der tragische Wandel im 19. Jahrhundert als aus Religionsgemeinschaft eine Ethnie gemacht wurde. Weitere Themen: Verschiedene Formen des Antisemitismus; die große Bewegung des christlichen Zionismus, die in Deutschland nur wenige kennen, obwohl zu ihr 200 Mio. Anhänger gehören; die Nakba; die Wurzeln des Hamas in den USA; die Operation «Gegossenes Blei». Perspektiven.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Gedenken an Joseph Abileah (1915 - 1994)
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Der israelische Gandhi
Teil A Tragödie
1 Wer ist ein Jude?
2 Warum «Heiliges» Land?
3 Die jüdische Mutter
4 Felix Bartholdy
5 Von der Religion zur Ethnie
6 Tora, Talmud und Messias
7 Antisemitismus (1)
8 Antisemitismus (2)
9 Zionismus
10 Christlicher Zionismus in England
11 Christlicher Zionismus in den USA
12 Jüdischer Zionismus
13 Ein Volk, eine Sprache, ein Staat
14 Netanjahu 2016, 2024
15 Strategische Partner
16 Antisemitismus (3)
17 Alle Mann an Bord
18 Israel – ein Segen, dass es dich gibt!
19 Der neue Tempel
20 Schatten eines großen Lichts
21 Rudolf Steiner über die Wiederkunft Christi
22 Der «Neue» Jude und sein Staat
23 1917 - 1945
24 Zionismus in Deutschland 1933 - 1945
25 Vorbereitung auf den Krieg von 1948
26 1947-1948
27 Die Nakba
28 Das Thema «Nakba» in Israel.
29 1967
30 Die Siedlungen im Westjordanland
31 Die PLO-Charta
32 Jeschajahu Leibowitz – das Gewissen Israels
33 Militarisierte Früherziehung
34 Wurzeln der Hamas in Erfahrungen in den USA
35 Zwischenbetrachtung
36 «Erkenne dich selbst.»
37 1973 bis 2023
38 Operation «Gegossenes Blei»
39 7. Oktober 2023 (1)
40 7. Oktober 2023 (2)
Teil B Befreiung
1 Die Realität mit eigenen Augen sehen
2 Menschlichkeit inmitten der Katastrophe
3 Der Sohn des Generals
Teil C Perspektiven
1 Südafrikas Anklage
2 Der Ben-Gurion Kanal
3 Großer und kleiner Bruder
4 Ibn Chaldun, Asabiyya und die Huthis
5 Mitte der Erde – Spiegel der Welt
Anhang
1 Persönliche Transparenz
2 Kritik und Grenzen der Kritik
3 «Existenz-Recht»
4 G.W.F. Hegel «Der Geist des Christentums»
5 Methodische Nachgedanken
Anmerkungen
Literatur
Vorwort
Nach dem Angriff der Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023, ging Israel zum Gegenangriff über und zwar in einer Größenordnung, dessen Zerstörungswucht mindestens 50 Mal so massiv war, wie alles, was an Gräueltaten am 7. Oktober geschehen ist. Die Wut einiger israelischer Politiker überschlug sich und richtete sich nicht nur gegen die Hamas, sondern gegen die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens. Der Präsident Israels erklärte, dass die Zivilisten in Gaza legitime Ziele seien, da sie sich als menschliche Schutzschilde vor die Hamas-Kämpfer stellen würden. «Es ist eine ganze Nation da draußen, die verantwortlich ist. Es ist nicht wahr, dass die Zivilisten nichts davon wussten und nicht beteiligt waren. Das ist absolut nicht wahr.» [1] Mit ähnlicher Begründung verkündete Yoav Gallant, Israelischer Verteidigungsminister: «Es wird für die Menschen im Gazastreifen keinen Strom geben, keine Nahrungsmittel, kein Wasser und keinen Treibstoff. Alles wird gecancelt. Wir kämpfen gegen Tiere in Menschengestalt. Und wir werden angemessen reagieren. Gaza wird nicht mehr zu dem zurückkehren, was es einmal war. Wir werden jeden eliminieren.» Oder Giora Eiland, ehemaliger Leiter des israelischen Sicherheitsrates: «Eine massive humanitäre Krise in Gaza zu schaffen, ist ein notwendiges Mittel, um unser Ziel zu erreichen, dass die Hamas uns niemals mehr angreifen wird. Gaza wird ein Ort werden, an dem kein Mensch mehr existieren kann.» Galit Distel Atbaryan, Mitglied der israelischen Knesset, ehemalige Informationsministerin: «Die Gaza-Monster werden zum südlichen Zaun fliegen und versuchen, ägyptisches Gebiet zu betreten, oder sie werden sterben. Gaza sollte ausgelöscht werden.» In «The Times of Israel», äußerte ein rechtsextremer Minister: «Atomwaffen auf Gaza sind eine Option, die Bevölkerung sollte nach Irland oder in die Wüste gehen.» Ein anderer: «Gaza muss sich in Dresden verwandeln.»
Genau so wurde es dann umgesetzt. Die Zerstörung von Gaza beträgt ein Vielfaches der Zerstörung Dresdens und Hiroshimas.
Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres meldete sich zu Wort und verurteilte den Anschlag der Hamas. Er sagte allerdings auch, dass der Anschlag «nicht in einem luftleeren Raum» stattgefunden habe, sondern die Palästinenser seit 56 Jahren unter «erstickender Besatzung» litten. Die Folge dieser Äußerung: Mehrere israelische Politiker reagierten mit heller Empörung auf die Äußerung des UN-Generalsekretärs. Der israelische Außenminister Eli Cohen warf dem Generalsekretär vor, in einer anderen Welt zu leben. Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, Erdan, forderte Guterres zum Rücktritt auf. In Deutschland nannte der Journalist Henrik M. Broder Guterres einen «lupenreinen Antisemiten». [2]
Guterres hatte es gewagt, den Schutz von Zivilisten anzumahnen. Hatte Guterres etwas Falsches gesagt? Er hatte Israels Vorgehen im Gazastreifen als «kollektive Bestrafung» von Palästinensern kritisiert – also als einen Verstoß gegen internationales Recht, das Kollektivstrafen verbietet. Israels Außenminister Eli Cohen sah das völlig anders: «Nach dem 7. Oktober gibt es keinen Platz mehr für eine ausgewogene Position.» [3] Die für die Tötung von mehr als 1.000 Israelis verantwortliche Hamas müsse «vom Erdboden vertilgt werden».
Inzwischen (Mitte Februar 2024) sind mehr als 30.000 Palästinenser getötet worden. Davon die Hälfte Kinder. Es geschieht «am hellichten Tag» und die Welt schaut zu. Wie kann das alles sein? Warum? Warum kein stopp! Warum so viel unvorstellbares Leid? Gibt es keine Aussicht auf eine Lösung, mit der alle leben können, anstelle einer Endlösung des Todes?
Sehr verehrte Leser, verzeihen Sie, wenn ich an dieser Stelle den Bogen sehr weit spanne: Der Gautama Buddha gab auf die Frage nach der Ursache von Leid eine grundsätzliche, sehr tiefe Antwort, die auch heute noch gültig ist: In den Untergründen der Menschenseelen gibt es gewaltige Triebkräfte, die jedoch blind sind, solange sie nicht von Erkenntnis durchdrungen werden. Diese Triebkräfte seien im tiefsten Grund immer die Ursache von Leid. Meine Frage ist deshalb: Welche gewaltigen Triebkräfte sind in dem 100-jährigen Krieg in Palästina / Israel wirksam?
Ich werde in diesem Buch Erkenntnisbausteine herantragen, damit Sie als Leserin und Leser diese Steine verwenden können, um sich selbst – mit Buddha zu sprechen – «die richtige Meinung» und «das richtige Urteil» zu bilden, um daraus «das richtige Wort» und «das richtige Handeln» zu finden. Ich selbst maße mir nicht an, im Besitz der Wahrheit zu sein oder gar der einzigen Wahrheit. Ich möchte Ihnen wichtige Ergebnisse anderer Forscher vorstellen, die in der deutschen Öffentlichkeit relativ wenig bekannt sind.
Mit der Wahrheit verhält es sich wie mit einem großen Berg: Es gibt sehr viele verschiedene Sichtweisen und Perspektiven auf einen Berg. Wer einen Berg nur von einem Standpunkt aus betrachtet, würde sich irren, wenn er glaubte, den Berg beurteilen zu können. Auch ich bin weit davon entfernt, den ganzen Berg aus allen Perspektiven und unter allen wesentlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Ich habe nur seit drei Jahrzehnten etliche Arbeiten jüdischer und arabischer Historiker studiert und möchte einiges davon berichten. Es geht um Perspektiven-Erweiterung. Die Historiker, mit denen ich mich beschäftigt habe, sind in meinen Augen Giganten und – im positiven Sinne – auch «Nerds». Sie haben im Zuge ihrer Forschungen jeden Stein und umgedreht darunter geschaut. (Wobei viele Dokumente – vermutlich sogar 80 Prozent - nach wie vor klassifiziert und nicht zugänglich sind.) Einige derjenigen Historiker, die ich studiert habe, haben ihr Leben ihrer historischen Forschung geradezu geweiht und ihre Arbeiten schweren Bedingungen wie Krankheit oder massiven Anfeindungen abgetrotzt. Ich selbst habe auf ihrem Gebiet nie geforscht. Ich komme mir deshalb vor wie ein Zwerg, der auf die Schultern dieser Riesen klettert, dort ein kleines Fähnchen schwingt und ruft: Schaut einmal, was diese Forscher geleistet haben.
Mehrere Arbeiten, die meinen Horizont erweitert haben, zum Beispiel das 1300 Seiten starke Buch «The Empty Wagon» (Der leere Wagen) des orthodoxen Rabbiners Yaakov Shapiro oder das kaum weniger umfangreiche von Tony Greenstein «Zionism During the Holocaust» von 2022 oder manche Arbeiten anderer Autoren sind nicht ins Deutsche übersetzt worden und haben vermutlich auch nur geringe Chancen dazu. Umso mehr hat mich dieser Sachverhalt dazu ermutigt, auf das hinzuweisen, was diese Forscher zutage gefördert haben, zumal mir Freunde, denen ich von diesen Forschungsarbeiten berichtete, versicherten, all das nicht gewusst zu haben. «Das solltest du aufschreiben», sagten sie.
Vorab möchte ich noch benennen, dass ich zwar auf verschiedene Strömungen des Judentums eingehe, aber weniger auf solche des Islam. Der Grund für dieses Ungleichgewicht ist simpel. Mir ging es darum, in einer Perspektiven-Erweiterung die Wurzeln des Zionismus und sein Verhältnis zum Judaismus darzustellen. Das, was ich zur Entstehung des islamischen Fundamentalismus dargestellt habe, schien mir für das Anliegen dieses Buches ausreichend zu sein. Sollte ich mich in diesem Punkt irren, bitte ich um kollegiale Korrektur.
Neben den sachlichen Informationen liegt das innere Zentrum meiner Arbeit in dem Versuch, zu verstehen und nicht bloß zu berichten. Man kann ein Problem nicht lösen, wenn man es nicht richtig identifiziert hat. Aber Erkenntnis ist ein schweres Geschäft – im Unterschied zu schnellen Meinungen und im Unterschied zum politischen Kampf, der versucht, Fakten gezielt auszuwählen und in den Dienst seiner Interessen zu stellen.
Im Unterschied zum politischen Kampf freue mich auf fundierte Korrektur, Kritik und weiterführende Gedanken. Wenig interessiert bin ich an Kommentaren von Menschen, die emotional aufschreien, sobald sie auf eine Perspektive stoßen, die ihrer eigenen widerspricht, insbesondere dann, wenn ihre persönliche Meinung kaum auf einem auch nur halbwegs seriösen Studium beruht. Abweichendes einfach niederzuschreien und zu diffamieren, ist in meinen Augen nicht der Wahrheit dienlich, sondern höchstens der Rechthaberei, politischen Interessen und oft sogar dem Geist der Lüge. Mir geht es nicht um Rechthaberei. Wenn ich Fehler gemacht habe, kann man mir das mitteilen und mich verbessern.
Ich schicke als letztes voraus, dass ich in dem folgenden Beitrag verantwortlich bin für das, was ich sagen werde. (Über weite Strecken werde ich nur referieren.) Ich bin auch verantwortlich dafür, wie ich das sage, was ich sagen werde. Aber ich bin nicht verantwortlich dafür, wie Sie das, was ich sagen werde, aufnehmen. Das liegt allein in Ihrer Verantwortung.
Thun (CH), den 9. Februar 2024
Einleitung: Der israelische Gandhi
Joseph Abileah (1915 – 1994) wurde «der israelische Gandhi» genannt. [4] Als 1979 der Geiger Yehudi Menuhin den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielt, kam Menuhin am Ende seiner Dankesrede auf seinen Freund Joseph Abileah zu sprechen:
«Seit vielen Jahren kenne ich einen Israeli, der aller Friedenspreise würdig ist, die diese Welt zu vergeben hat: Joseph Abileah, ein Violinist aus Haifa, der mir die Ehre erweist, heute hier anwesend zu sein. Ein demütiger und bescheidener Mann, der fließend Arabisch spricht, hat es seit den frühen Tagen des Staates Israel mit Gruppen junger Israelis, Jungen und Mädchen, unternommen, die Wohnungen arabischer Dorfbewohner wiederaufzubauen, die von der israelischen Armee zerstört worden waren. Er hat, zusammen mit gleichgesinnten Männern und Frauen, viele durchaus praktische und praktikable Wege zu einer Mittel-Östlichen Föderation durchdacht.»
Zehn Jahre nach dieser Rede besuchte ich Joseph Abileah in Freudenstadt im Nordschwarzwald. Ich wollte wissen, warum die Stimmen so vieler großer Kulturschaffender wie Yehudi Menuhin zwar gewürdigt werden, aber letztlich nur einen geringen Einfluss auf die reale Politik in Israel haben. Ohnmächtige Kultur?
Joseph Abileah war damals bereits an Krebs erkrankt und unterzog sich in Freudenstadt einer Kur und einer speziellen Diät. Er war nicht nur von kleiner, sehr zarter Statur, sondern in seiner Ausstrahlung – wie Menuhin sagte - ein unglaublich bescheidener Mensch. In unseren Gesprächen wurde mir schnell klar, dass er ein Mahatma war, eine große Seele.
Joseph Abileahs Eltern stammten aus einer alten russisch-polnisch-jüdischen Musikerfamilie. Er selbst war 1915 in Niederösterreich geboren. (Sein damaliger Name war Wilhelm Niswiszki.) In den 1920er Jahren wanderten seine Eltern mit ihm und seinen Geschwistern nach Palästina aus. Sie ließen sich in Haifa nieder und bauten dort ein Musikgeschäft auf. Sein Vater, Ephraim Abileah, 1885 geboren und hundertjährig 1985 gestorben, war einer der bekanntesten Pioniere der klassischen Musik in Palästina (in der Zeit vor der Staatsgründung Israels). Joseph Abileah wurde Profi-Musiker und war sein Berufsleben lang Geiger im Haifa-Symphony-Orchestra. Aber die Musik war nur die eine Seite seines Lebens. Die andere war sein unermüdlicher, lebenslanger Einsatz für ein friedvolles Zusammenleben von Arabern und Juden. Joseph Abileah hielt von Anfang an die sogenannte «Zwei-Staaten-Lösung» für illusionär, für ein abwegiges, irreführendes Konzept. Stattdessen setzte er sich, wie auch Martin Buber, Albert Einstein und Hannah Arendt, für eine jüdisch-arabische Konföderation ein, für ein Zusammenleben in einem Staat. «Warum keine Zwei-Staaten-Lösung?» fragte ich ihn. «Ein palästinensischer Staat wird zu klein sein. Er wird nicht überleben können. David Ben-Gurion sagte einmal, dass der jüdische Staat mindestens 80 Prozent des Landes besitzen und mindestens 80 Prozent der Bevölkerung stellen müsse, um auf Dauer lebensfähig zu sein. Mit nur 20 Prozent des Landes für die Palästinenser ist ein palästinensischer Staat völlig unrealistisch.» Aber neben diesem pragmatischen Gesichtspunkt gab es für Joseph Abileah einen viel wichtigeren Aspekt.
«Als wir Juden nach Palästina kamen», so erzählte er mir auf einem Spaziergang im Nordschwarzwald, «hätten wir es machen sollen wie William Penn, als der nach Amerika kam. William Penn habe den ‹Indianern› erklärt: ‹Wir kommen als Flüchtlinge, nicht als Eroberer. Wir werden in England aus religiösen Gründen verfolgt. Könnt ihr uns aufnehmen und uns Schutz gewähren?› Als die Einheimischen das hörten«, so Abileahs Fassung der Ausnahme-Geschichte, hätten sie Pfeil und Bogen weggelegt und die Frauen und Männer um William Penn willkommen geheißen. Man hätte friedlich zusammengelebt. Später habe man dann die Gegend zu Ehren von William Penn den ‹Wald des William Penn› genannt: Pennsylvania.» Abileah fuhr fort: «So hätten wir Juden es auch in Palästina machen sollen. Als meine Eltern mit mir und meinen Geschwistern einwanderten, war es auch noch so. Wir Juden und Araber lebten friedlich nebeneinander. Auch in den Jahrhunderten vorher. Die Nachkommen derjenigen Juden, die nach der Vertreibung durch die Römer im Land geblieben waren, lebten später - unter der osmanischen Herrschaft – Jahrhunderte lang neben den Arabern in Palästina und kamen miteinander aus. Dann aber hatten immer mehr Einwanderer eine völlig andere Einstellung. Sie wollten einen jüdischen Staat. Schon in Europa hatte doch die Gründung von Nationalstaaten keine guten Folgen. Die Nationalstaats-Idee», so er klärte er mir, «war ein Fehler des 19. Jahrhunderts und wir haben diesen Fehler – sogar mit einem Jahrhundert Verspätung - noch einmal wiederholt.»[5]
Joseph Abileah sagte mir das vor mehr als 30 Jahren. Würde er es heute sagen, würde er vermutlich als Antisemit attackiert werden oder als «sich selbst hassender Jude».
Am 27. Juni 1947 hatte Joseph Abileah einer UN-Kommission konkrete Konföderationspläne vorgelegt. Am 30. August 1948 war er in Haifa wegen Kriegsdienstverweigerung verurteilt worden. Er war damals der erste Kriegsdienstverweigerer Israels. Heute wird so etwas hart bestraft, aber 1948 kam Joseph Abileah mit einer milden Geldstrafe davon. Durch seine Aktion wurde er in Israel schlagartig eine Berühmtheit. Manche hielten ihn freilich für einen «Spinner». Wenig später rief Joseph Abileah die israelische Sektion von «War Resisters‘ International» ins Leben. Er selbst war zutiefst praktizierender Pazifist. 1971 gründete er zusammen mit Yehudi Menuhin und anderen Freunden die «Society for a Middle East Confederation», die sich für einen politischen Zusammenschluss Israels mit seinen arabischen Nachbarn einsetzte.
Nachdem 1987 die erste Intifada (ein als gewaltloser Widerstand geplanter palästinensischer Aufstand [6]) entstanden war, lud ich Joseph Abileah in meine damalige Schule nach Stuttgart ein. Ich organisierte eine kleine Tagung. Er sollte der Hauptredner sein zusammen mit einem arabischen Kollegen von mir, der praktizierender Moslem war. Die Oberstufenschüler der Michael-Bauer-Schule sollten – so dachte ich – verschiedene Perspektiven kennen lernen und vor allem den Geist der friedlichen Verständigung. Dr. Bruno Sandkühler moderierte damals die Gespräche und hin und wieder sprachen die drei Protagonisten arabisch miteinander, wenn sie das weitere Vorgehen klären wollten. Ob die kleine Tagung damals auf unsere Schüler einen nachhaltigen Eindruck machte, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber seit jener Zeit hat mich die Frage beschäftigt, warum die von Yehudi Menuhin und Joseph Abileah, Albert Einstein und Hannah Arendt und vielen anderen vorgeschlagene Konföderation nie umgesetzt wurde und die Zwei-Staaten-Lösung auch nicht. Warum stattdessen der nicht endende mörderische Irrsinn?
Noch verrückter wird es, wenn man in Israel vor Ort erlebt, wie gut jüdische und arabische Israelis miteinander leben und arbeiten können. In jedem israelischen Krankenhaus arbeiten jüdische und arabische Ärzte und Krankenschwester problemlos zusammen. «Die meisten hier wollen in Frieden zusammenleben», sagte mir einmal ein israelischer Kollege, «Ihr Europäer könnt euch von diesem Zusammenleben eine Ecke abschneiden.» Das stimmt. Nach einer Pause fragte ich meinen Kollegen: «Aber wenn man so gut zusammenarbeiten kann, warum dann die grausame Lage in den von Israel dauerhaft seit einem halben Jahrhundert besetzten Gebieten? Warum das brutale, mörderische Vorgehen gegen die Palästinenser im Westjordanland und in Gaza? Warum die furchtbaren gewaltsamen Konflikte ausgerechnet in einem Land, das zu einem friedlichen Zusammenleben aus verschiedenen Gründen berufen ist?» «Das ist eine lange und komplizierte Geschichte», sagte er.
Es wurde eine ganz andere Geschichte als die, die man gemeinhin hört: Nach dem Holocaust haben die Vereinten Nationen endlich den Juden in Palästina einen Staat bewilligt, damit sie dort in Sicherheit leben können. Die Araber des Nahen Ostens aber haben die Juden gehasst und immer wieder Krieg gegen sie geführt und Terroranschläge verübt, um Israel zu vernichten.
Nein, so war es nicht. Es war ganz anders. Es wurde für mich eine schockierende Geschichte, von der ich so vieles nicht wusste. Elementare Sachverhalte über die jüdische Religion waren mir unbekannt und sind heute den allermeisten Menschen unbekannt. Ich hatte auch noch nie etwas vom christlichen Zionismus gehört, ohne den es Israel nicht geben würde. Ich hatte noch nie etwas gehört über die wahren Motive führender Zionisten wie Theodor Herzl, Vladimir Jabotinsky, Max Nordau und anderen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie das orthodoxe Judentum hassten. (Im heutigen Sprachgebrauch würde man sie «Antisemiten» nennen.) Ich wusste nicht, worum es ihnen - lange vor dem Holocaust - wirklich ging. Ich wusste nichts davon, wie sich führende Zionisten während des Holocaust verhalten hatten und wie sie über ihn dachten. Ich kannte zu wenig die Ursprünge des islamischen Fundamentalismus und seine Pläne. Und vor allem wusste ich nicht, welche enorme Bedeutung das komplexe Zusammenwirken der mir lange unbekannten Sachverhalte für die heutige Situation hat. Man kann das, was heute geschieht, unmöglich richtig verstehen, wenn man die wesentlichen Faktoren nicht kennt. Grund genug, sie zu aufzuschreiben.
Joseph Abileah starb vor 30 Jahren am 29.1.1994. In dankbarem Gedenken an ihn habe ich die vorliegende Skizze geschrieben
Teil A
Tragödie
1 Wer ist ein Jude?
Im Selbstverständnis des orthodoxen Judentums ist das «jüdische Volk» kein Volk im gewöhnlichen Sinn des Wortes. [7] Es ist keine Ethnie. Und in der Tat: Was haben die Jüdin Ivanka Trump und eine äthiopische Jüdin gemeinsam? Sie sprechen keine gemeinsame Sprache, sie haben kein gemeinsames Brauchtum, sie haben keine gemeinsame Geschichte, sie haben keine gemeinsame Kultur. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist ihre Religion. Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten konvertierte 2009 vor ihrer Heirat mit Jared Kushner zum Judentum. Dadurch ist sie zu 100 Prozent eine Jüdin. Ihre Vorfahren sind es nicht. Das Einzige, was Ivanka Trump (sie heißt mit neuem jüdischem Namen Yael Kushner) und eine äthiopische Jüdin gemeinsam haben, ist die Verpflichtung, religiöse Vorschriften einzuhalten. Dazu gehören unter anderem etliche Speisevorschriften und das Einhalten des Sabbats. Das aber heißt: Das jüdische «Volk» ist eine rein religiöse Gemeinschaft und in diesem Sinne eine rein geistige Gemeinschaft. Es ist keine Ethnie und erst recht nicht eine «Rasse». Es gibt chinesische Juden, es gibt marokkanische Juden, argentinische Juden, jemenitische Juden, russische Juden. Sie gehören nicht zu einem Volk im ethnischen Sinn. Was sie verbindet, ist ihre Religion, sonst nichts. Begründet wurde diese Religion am Berg Sinai. Nach der orthodox-judaischen Auffassung wurde das jüdische «Volk» dort durch Gott begründet, indem Gott den damals unter Moses versammelten Menschen drei besondere Aufgaben gab:
Erstens: Sie sollten ihr Leben als Gottesdienst auffassen.
Zweitens: Sie sollten die von Gott gegebene Heilige Schrift, die Tora, studieren. Denn in der Heiligen Tora finde man alles, was der Mensch zum Verstehen des Lebens und der Welt brauche.
Drittens sollten die Mitglieder der damals gegründeten geistigen Gemeinschaft die von Gott gegebenen Gebote halten. (Insgesamt sind es 613). Die 10 bedeutendsten wurde auf zwei Tafeln festgehalten und sind als die «10 Gebote» in die Kulturgeschichte eingegangen.
Drei sehr einfache Säulen machen also nach judaischer Auffassung die jüdische Religion in ihrem Kern aus: Gott, Tora, Gebote. Das Leben als Gottesdienst leben, Studium und Schulungsweg.
Auf dem Sinai – so der Judaismus – habe Gott gesagt: «Heute habe ich mein Volk geschaffen.»[8] Vor dem Ereignis am Sinai gab es kein jüdisches Volk. Es gab 12 Stämme. Die Schaffung des jüdischen Volks als geistige Gemeinschaft war ein unerhörtes Ereignis, denn das gab es bis dahin noch nie: Eine Volks-Gemeinschaft, die keine «Blutsgemeinschaft» ist, sondern zu einer damals revolutionären Aufgabe «ausgewählt» wurde: Gemeinschaftsbildung durch geistige Gemeinschaft, indem man gemeinsam das Leben als Gottesdienst auffasst, indem man das Wort Gottes studiert, und sich bemüht, 613 Gebote einzuhalten. Es gibt keine zweite Gemeinschaft, die sich seit mehr als 3500 Jahren eine auch nur annähernd ähnliche Aufgabe gestellt hat. Andere Völker sind auch auserwählt, aber zu anderen Aufgaben. Rabbi Shapiro formulierte es salopp einmal so: «Jude sein ist keine Zugehörigkeit zu einer Nation, sondern eine religiöse Job-Beschreibung.» Gott hat durch Moses einer Gruppe von Menschen den sehr speziellen «Job» angeboten, ihr Leben über Jahrhunderte hinweg einer bestimmten Aufgabe zu weihen. Um ein «auserwähltes» Volk handelte es sich also nicht im Sinne eines «bevorzugten» oder gar besten Volkes.
Auf der anderen Seite sind die «Auserwählten» durchaus frei, den «Job» anzunehmen und sich der damit verbundenen gewaltigen Aufgabe zu verpflichten oder eben nicht. Das Leben als Gottesdienst, plus 613 Gebote plus Tora-Studium sind nicht jedermanns Sache. Bis auf den heutigen Tag kann jeder die Aufgabe annehmen, wenn er denn will. Jeder kann – wie Ivanka Trump – Mitglied dieser geistigen Gemeinschaft werden, indem er sich selbst verpflichtet. In dem Moment wird er Jude. (Heute wird diese Selbstverpflichtung offiziell anerkannt, wenn sie von einem Gremium jüdischer Rabbis bezeugt wird.) Und umgekehrt: Jeder kann sich aus dieser Gemeinschaft verabschieden, aus welchem Grund auch immer. Dann hört er auf, ein Jude zu sein. So war es zumindest Jahrhunderte lang.[9]
Der Jude Jesus Christus hat später den jüdischen Impuls der Geist-Gemeinschaft sogar noch verschärft und nicht nur auf das «Volk» bezogen, sondern sogar auf die Familie:
«Eine große Volksmenge saß um ihn her. Und man sagte ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und verlangen nach dir. Er aber antwortete: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er schaute rings umher auf alle, die im Kreise um ihn saßen und sprach: Siehe, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer aus dem Willen Gottes handelt, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.» (Mk, 3,31-35)
Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer gravierenden Änderung. Plötzlich war von einer «jüdischen Rasse» die Rede oder von einem «jüdischen Volk» im Sinne einer Ethnie. Das war - aus judaischer Sicht - der denkbar größte Angriff auf das Judentum. Man machte aus einer Geist-Gemeinschaft eine «Blutsgemeinschaft». Aus judaischer Sicht war das ein «geistiger Mord». Diese historische Schwelle ist entscheidend. Mit ihr wurde die größte Katastrophe der jüdischen Geschichte eingeleitet und mit ihr auch die heutige Katastrophe in Palästina. Aber bevor es darum gehen wird, möchte ich auf zwei sehr alte, religiös-jüdische Bestimmungen eingehen, nämlich erstens auf das judaische Konzept des «Heiligen Landes» Israel und zweitens auf das rätselhafte Konzept der religiösen Vererbung innerhalb der jüdischen Religion. [10]
2 Warum «Heiliges» Land?
Nach judaischer Auffassung ist das gelobte Land ein «heiliges» Land aus einem ganz bestimmten Grund: Gott (Hashem) schickte in diesen Flecken Erde die Strahlen seiner Liebe. Diese Strahlen wirken seitdem aus dieser Erde zurück, aus ihrem Boden, aus den Flüssen, Bergen und Seen. Sie strahlen in der Weise zurück, dass sie die Erfüllung der Gebote, das Studium der Tora sowie das Leben als gottgeweihtes Leben erleichtern. Die von Gott in diese Erde geschickten Strahlen unterstützen die Aufgabe des jüdischen Volkes. In diesem Sinne und nur in diesem Sinne ist das Land Israel das den Juden verheißene Land. Heute würden manche Menschen von einem besonderen «Kraftort» sprechen. Allerdings handelt es sich – nach judaischer Auffassung – um einen Kraftort für einen ganz bestimmten Zweck. Mit dem versprochenen Land – so die orthodox-judaische Auffassung – sei hingegen auf gar keinen Fall gemeint, dass es als ein «nationales Heimatland» den Juden versprochen worden sei. Das Volk Israel (Klal Ysrael) hat kein Heimatland so wie die Italiener Italien als Heimatland haben, die Franzosen Frankreich und die Russen Mütterchen Russland. Das Volk Israel hat kein nationales Heimatland, weil das Volk Israel keine Nation ist, sondern eine religiöse Gemeinschaft, deren Mitglieder aus allen Ethnien stammen können und die überall auf der Erde leben können, so wie auch fromme Moslems selbstverständlich in Israel leben können. Das Heimatland der Juden ist eine geistige Heimat: Es ist die Tora. Wenn man jedoch – so die judaische Auffassung – das Land Israel für andere Zwecke nutze, so handele es sich – nach orthodox-judaischer Auffassung – um einen Missbrauch und infolge dieses Missbrauchs würden die göttlichen Strahlen, die aus der Erde zurückstrahlen, eine negative und zerstörerische Wirkung entfalten.
Der hier referierten orthodox-judaischen Auffassung zufolge lag eine tiefere Ursache für die Vertreibung der Juden aus Palästina durch die Römer im Jahr 70 nach Chr. darin, dass sie ihrer Aufgabe nicht genug gerecht wurden. Deshalb habe Gott (Hashem) sie durch die Römer vertreiben lassen. Hashem werde sie erst dann aus der Diaspora zurückholen, wenn sie sich des Heiligen Landes durch ihre Lebensführung als würdig erwiesen haben werden. Unter anderem aus diesem Grund lehnen die hier referierten orthodoxen Juden (die meisten von ihnen leben in den USA) den Staat Israel als Nationalstaat radikal ab. Das Heilige Land als Nationalstaat zu benutzen, ist in ihren Augen ein Götzendienst.
Es gibt freilich auch eine andere Gruppe «orthodoxer Juden», die das völlig anders sieht. Sie begreifen das Land als ihnen und nur ihnen versprochenes Heimatland. Araber haben darin – so sagen sie – nichts zu suchen. Juden müssten einen jüdischen Staat schaffen, damit der ersehnte Messias endlich kommt. Der Rabbiner Zvi Jehuda Kook formulierte das so:
«Dieses ganze Land ist unser, absolut. Es ist nicht auf andere zu übertragen, selbst nicht in Teilen. Damit ist ein für allemal klar, dass es keine „arabischen Gebiete“ gibt, sondern einzig und allein die Erde des Landes Israel, das ewige Erbe unserer Vorväter. Dies ist eine Vorgabe göttlicher Politik, die keine niedere Politik durchkreuzen kann.» [11]
Es gibt also durchaus konträre Strömungen innerhalb des orthodoxen Judentums, die eine völlig gegensätzliche Auffassung vom Land Israel haben und in der Folge auch vom Staat Israel.
3 Die jüdische Mutter
Es ist für viele Nicht-Juden rätselhaft: Wenn der Vater eines Kindes Jude ist, die Mutter aber nicht, dann ist das Kind bei seiner Geburt zu 100 Prozent kein Jude. Wenn hingegen ein Kind von einer jüdischen Mutter geboren wird, der Vater aber kein Jude ist, dann ist das Kind ab seiner Geburt Jude, und zwar zu 100 Prozent. Biologisch betrachtet, wäre das absurd. Ein Kind bekommt genetisch von beiden Eltern jeweils 50 Prozent vererbt. Vom Vater absolut nichts vererbt zu bekommen, ist biologischer Unsinn. Aber die rätselhafte Bestimmung – so die Lehre des Judaismus – hat nichts mit biologischer Vererbung zu tun, denn das jüdische Volk ist keine Ethnie. Hinter der wundersamen Bestimmung verbirgt sich eine rein religiöse Vorstellung: Als Gott am Sinai einer kleinen Gruppe von Menschen eine Lebensaufgabe für Jahrhunderte gab und dazu – durch Moses – die Tora und die Gebote überreichte, waren nicht nur die damals unter Moses lebenden Menschen dabei. In der geistigen Welt – so die judaische Auffassung – waren gleichzeitig viele Seelen anwesend, die nicht inkarniert waren, die sich aber der gleichen Aufgabe verpflichteten und weihten. Sie wurden dadurch zu jüdischen Seelen.[12] Diese Seelen suchen sich später für ihre Inkarnation eine jüdische Mutter. Warum eine jüdische Mutter? Eine Mutter, die die jüdischen Gebote praktiziert, bietet der Seele des Kindes während der Schwangerschaftszeit eine Hülle, die für die sich inkarnierende Seele und ihr Judentum günstig ist. Eine solche Hülle kann ein Vater nicht bieten. Die Folge: Wenn ein Kind von einem jüdischen Vater stammt, aber nicht von einer jüdischen Mutter, dann muss das Kind erst zum Judentum übertreten: Es wird erst durch die «Bar Mizwa» zum Juden. Bar Mizwa heißt wörtlich: «Verpflichtung auf die Mizwot (die Gebote)». Durch die Wahl einer jüdischen Mutter aber habe – nach judaischer Auffassung – ein Kind bereits genug unter Beweis gestellt, dass es eine jüdische Seele ist. Es handelt sich also nicht um eine biologische Vererbung, sondern um eine geistige Wahlverwandtschaft. Ohne das religiöse Konzept geistiger Wahlverwandtschaft zwischen Kind und Mutter sei - so der Judaismus - eine angebliche Vererbung nur über die Mutter eine absurde Idee.
Was die leibliche, biologische Vererbung betrifft, so folgt das Judentum der gleichen Praxis, die es bei fast allen Völkern der Erde gibt und die erst seit wenigen Jahrzehnten in modernen Staaten aufgehoben wird: Wenn Vater und Mutter zu verschiedenen Stämmen gehören, richtet sich der Name des Kindes nach der väterlichen Linie. [13]
In dem gleichen Sinn, in dem das jüdische «Volk» eine religiöse Gemeinschaft ist, könnte man auch von einem christlichen «Volk» oder vom «Christenvolk» sprechen. Die Mitglieder eines solchen «Volkes» können jeweils aus allen Ethnien der Erde stammen. Umgekehrt heißt das: Wer den christlichen Glauben dezidiert ablegt, ist kein Christ mehr. Er ist nicht mehr Mitglied der religiösen Gemeinschaft. Er gehört nicht mehr zum christlichen «Volk», genauso wie der, der aus den «Zeugen Jehovas» aussteigt, kein «Zeuge Jehovas» mehr ist. Anders ist das bei einer ethnischen Zugehörigkeit. Die kann man schlecht ablegen. Wer zur Ethnie der Friesen gehört, kann – nach judaischer Auffassung – nicht zur Ethnie der Massai oder der Süd-Slawen oder der Han-Chinesen konvertieren, selbst wenn er von einer chinesischen Familie adoptiert wird.
Diese Auffassung galt innerhalb des Judentums Jahrhunderte lang bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als es zu einem gravierenden und folgenschweren Wandel kam.
Zur Illustration dieses Wandels füge ich das Beispiel «Felix Mendelssohn Bartholdy» in einem kleinen Exkurs ein.
4 Felix Bartholdy
Der Großvater des berühmten Komponisten und Virtuosen war der deutsch-jüdische Philosoph Moses Mendelssohn (1729 – 1786), der Freund Lessings. Moses Mendelssohn war eine Säule der europäischen Aufklärung und das historische Vorbild für die Figur des Nathan in Lessings «Nathan der Weise». Der Nathan war ein Denkmal, das Lessing seinem Freund Moses Mendelssohn gesetzt hat.
Einer der Söhne von Moses Mendelssohn, war der Banker Abraham Mendelssohn (1776 - 1836). Er war der Vater von Felix Mendelssohn. Abraham Mendelssohn hatte zusammen mit seiner Frau Lea vier Kinder. Beide Eltern erzogen ihre Kinder zunächst konfessionslos nach allgemein-menschlichen Prinzipien, ließen die Kinder dann aber – aus Rücksichtnahme auf die gesellschaftlichen Verhältnisse – 1816 christlich taufen. (Felix war damals sieben Jahre alt.) Und nun der entscheidende Punkt: Von da an waren seine Kinder keine Juden mehr. So wurde es damals allgemein gesehen. So sah es Abraham Mendelssohn und so sah es selbstverständlich auch Carl Friedrich Zelter (1758 - 1832), der Freund Goethes und der Kompositionslehrer des kleinen Felix. Als Zelter seinem Freund Goethe das exorbitante Wunderkind Felix vorstellen wollte, kündigte er ihn brieflich an: «Der Junge Felix ist kein Jude, aber er ist der Sohn eines Juden.» Das war in der Tat die einzig korrekte Formulierung. [14]
Der Vater, Abraham Mendelssohn, trat selbst zusammen mit seiner Frau 1822 zum Protestantismus über. Auch er war jetzt kein Jude mehr und er legte sich deshalb einen neuen Namen zu: Bartholdy. Um aber das Andenken an seinen Vater, den Philosophen Moses Mendelssohn, zu würdigen, behielt er auch den Namen Mendelssohn bei und so entstand der Doppelname «Abraham Mendelssohn Bartholdy». Seine Kinder aber hießen fortan mit Nachnamen nur noch Bartholdy: Felix Bartholdy, Fanny Bartholdy, Rebecka Bartholdy und Paul Bartholdy. Allerdings spielte Felix nicht ganz mit. Als Felix erwachsen und längst ein berühmter Solist und Komponist geworden war, bekannte er sich zwar ausdrücklich zu seiner christlichen Identität, wollte aber, genau wie sein Vater, seinen Großvater ehren und fügte deshalb seinem Namen Bartholdy wieder den Namen Mendelssohn hinzu. Den Vater Abraham erzürnte das regelrecht. «Du heißt Felix Bartholdy – und sonst nichts. Kein Zusatz. Es ist nicht in Ordnung, dass du dich Mendelssohn nennst», schrieb er seinem Sohn in einem ernsten und strengen Brief nach England, als er die Konzertprogramme gesehen hatte, auf denen sich sein Sohn «Felix Mendelssohn» genannt hatte. [15]
Felix Mendelssohn Bartholdy ist, wie Zelter richtig schrieb, kein Jude. Aber nur drei Jahre nach Felix Mendelssohns Bartholdys Tod im Jahre 1847 begannen Irrsinn und Verblendung: Richard Wagner veröffentlichte 1850 seine antisemitische Schrift «Das Judentum in der Musik». Wagner bezeichnet «den Juden» an sich als «unfähig, durch seine äußere Erscheinung, seine Sprache, am allerwenigsten aber durch seinen Gesang, sich uns künstlerisch kundzugeben», er könne «nur nachsprechen» oder «nachkünsteln». Wagner attestierte der jüdischen Musik einen «Mangel rein menschlichen Ausdruckes» und die Unfähigkeit zu einer gemüthaften Tiefe. [16] Für Wagner waren Mendelssohns Kompositionen ein Beispiel jüdischer Musik.
Wagners Antisemitismus ist ein bitteres Kapitel für sich und hier nicht Thema. Aber wie konnte Wagner so einen – Entschuldigung – doppelten Blödsinn schreiben, dass Mendelssohns Werke ein Beispiel für jüdische Musik seien, nämlich ohne Gemütstiefe? Erstens: Mendelssohn Werke haben eine geradezu «göttliche inspirierte Gemütstiefe». Es spielt dafür überhaupt keine Rolle, zu welcher Religion, Ethnie oder zu welchem Geschlecht der Komponist gehört und ob Mendelssohn Jude war oder nicht. Und völlig unabhängig davon zweitens: Mendelssohn war kein Jude.
Für Wagner war er es doch. Einmal Jude, immer Jude. Wie das?
5 Von der Religion zur Ethnie
Wenige Jahrzehnte nach Wagner sahen es der Wagner-Fan Hitler und seine Nazis genauso wie Wagner selbst. Felix Mendelssohn war für sie ein jüdischer Komponist. Die Aufführung seiner Werke wurde verboten. Das Denkmal Mendelssohns in Leipzig wurde in einer Nacht-und Nebel-Aktion geschändet und zerstört. Aus Protest trat der Leipziger Bürgermeister Goerdeler zurück.
Die Denkweise von Wagner und Hitler ist absurd im Extrem. Ich möchte diese Absurdität durch Analogien erläutern: Wer sich vom Christentum verabschiedet und Atheist wird, der ist nach eigenem Selbstverständnis kein Christ mehr. Es wäre reichlich absurd, ihm zu sagen: Weil deine Eltern Christen waren, bist du immer noch ein Christ, auch wenn du aus dem christlichen Glauben zum Atheismus übergetreten bist. Ebenso: Wer vom Islam zum Atheismus konvertiert, hört auf, ein Moslem zu sein. Wer sich vom Buddhismus verabschiedet, ist kein Buddhist mehr. Oder: Nehmen wir die Kinder oder die Enkelkinder einer Anthroposophin. Angenommen, diese Kinder wollen nichts mit Anthroposophie zu tun haben. Es wäre völlig absurd, sie zu Anthroposophen zu erklären, bloß weil die Mama oder die Oma Anthroposophin war. Die Kinder würden sich diesen Unsinn schwer verbitten. Aber bei Juden – so dachte man ab etwa 1840 – soll es anders sein. Nach und nach galt man als Jude, nur weil die Oma Jüdin war, während man selbst nichts mit dem jüdischen Glauben «am Hut hatte». Kurz: Was bei Christen, bei Moslems und Buddhisten nicht funktioniert, war jetzt bei den Juden anders. Sogar als überzeugter Atheist galt man ab der zweiten Jahrhunderthälfte als Jude, nur weil es Mama oder Oma waren. Wer hingegen jahrhundertelang christliche Vorfahren hatte, aber sich vom Christentum verabschiedete, von dem sagte niemand, er sei trotzdem noch Christ, weil seine Vorfahren es waren. Sehr wohl aber könnte ein solcher Ex-Christ von sich selbst sagen: «Ich bin zutiefst durch meine christliche Sozialisation geprägt – wahrscheinlich mehr als ich ahne. Vielleicht bin ich sogar eine Art «U-Boot-Christ»: In bestimmten Lebenssituationen tauchen bei mir christliche Vorstellungen aus meiner Kindheit auf. Aber ich bin aus der Gemeinschaft der Christen (und nicht nur aus einer Konfession) ausgetreten und zum Islam konvertiert. Deshalb bin kein Christ mehr.» Niemand würde auf die Idee verfallen, einen solchen Menschen nach wie vor als «Christen» zu bezeichnen, weil er einer christlichen Ethnie angehöre.
Die Frage ist, wie es zu der Wahnvorstellung von einer jüdischen Ethnie oder gar einer «jüdischen Rasse» kommen konnte und immer noch kommt?
Zwei Faktoren spielten eine gravierende Rolle. Erstens: