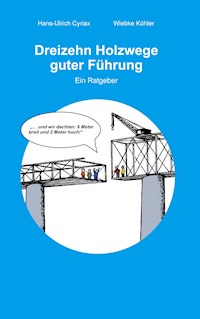
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Führung steht extrem unter Druck: mit immer weniger Budget und Mitarbeitern müssen immer anspruchsvollere Ziele erreicht werden. "Nebenher" gilt es noch allfällige Krisen und revolutionäre Umwälzungen zu meistern. Viele Führungskräfte suchen händeringend nach dem Königsweg der Führung. Gibt es diesen überhaupt? Nein. Es gibt sogar dreizehn Königswege. Und alle dreizehn vermittelt dieses wegweisende Handbuch moderner Führung übersichtlich, pragmatisch und anhand vieler und zupackender Beispiele aus der Praxis: Fundierte, praxisbewährte Strategien und Rezepte zum direkten Anwenden. Die beiden renommierten Berater, Autoren, Führungspraktiker und Business Coaches gehen mit Ihnen auf eine Bildungsreise. Und wenn einer eine Reise macht... Mit jeder Etappe vom Holz-und Königsweg werden Sie wirksamer, effizienter und mit mehr Freude führen - und dadurch zufriedene Mitarbeiter in Ihrem Team haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autoren
Hans-Ulrich Cyriax und Wiebke Köhler arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen und beraten Unternehmen bei der strategischen und kulturellen Neuausrichtung. Beide verbindet die tiefe Überzeugung, dass unternehmerischer Erfolg von guter Führung abhängt.
Hans-Ulrich Cyriax ist Organisationsberater, Personalentwickler, Coach und Trainer. Er begleitet seit mehr als zwanzig Jahren Unternehmen und Führungskräfte in Veränderungsprozessen. Während seiner Karriere war er Executive Consultant bei renommierten internationalen Beratungsunternehmen und Leiter des Strategischen Marketings einer der größten Banken Deutschlands. Seit 2011 führt er die von ihm gegründete Organisations- und Personalberatung Cyriax Partners. Seine Leidenschaft gehört der Transformation und kulturellen Neuausrichtung von Unternehmen sowie der Potenzialentwicklung von Teams und Führungskräften.
Wiebke Köhler ist seit über zwanzig Jahren Top Management Strategieberaterin; auch ist sie Gründerin, Key Note Speakerin und mehrfache Buchautorin. Sie arbeitete während ihrer beruflichen Laufbahn in den Top Management Beratungen bei Roland Berger und McKinsey & Co. Als Partnerin im Executive Search begleitete sie internationale, globale Konzerne bei der Besetzung von Vorstandspositionen und bekleidete zuletzt selber die Position als Personalvorstand bei der AXA Konzern AG in Deutschland. Sie ist CEO der Top Management Beratung impactWun-der und unterstützt Konzerne und Mittelständler in strategischen Fragen des Marketings und im HR, vor allem rund um Kultur, Werte- und Machtwandel und bei der Führungskräfteentwicklung.
Widmung
Dieses Buch widmen wir unseren Lehrern, Mentoren und Ratgebern, allen geistigen Kapazitäten und den Prinzipalen der Erkenntnis, die uns auf unserem Weg inspiriert haben. Wir bedanken uns bei all jenen Unternehmen, die echte Führungskräfte-Trainings durchgeführt haben, um ihre Führungskräfte besser zu machen: Dass sie diese – im besten Sinne – „Bildungsreise“ unternommen und durchgezogen haben. Eine Reise, von der auch wir als Trainer und Coaches vieles von dem mitgenommen haben, was der geneigte Leser auf den folgenden Seiten mit Gewinn genießen wird. Wir danken allen Führungskräften, mit denen wir prägende Erfahrungen machen durften und die uns gelehrt haben, dass gute Führung gleichermaßen Herz und Verstand braucht, stetiges Lernen und ausdauernde Neugier.
Gender-Anmerkung
Wir verwenden im Folgenden des leichten und angenehmen Leseflusses wegen stets nur einen Genus, meinen dabei jedoch ausnahmslos und durchgängig selbstverständlich immer beide Geschlechter. Führung hat nichts mit „männlich“ oder „weiblich“ zu tun, sondern ausschließlich mit Führungskompetenz.
Inhalt
Vorwort
Erstes Kapitel
Strategie und Sinn: Eine Powerpoint-Folie reicht nicht
Zweites Kapitel
Werte und Haltung: Gelesen – Gelacht – Gelocht
Drittes Kapitel
Führung und Rolle: „Keine Zeit für Führung!“
Viertes Kapitel
Prozesse und Zusammenarbeit: Im Fegefeuer der Verschwendung
Fünftes Kapitel
Persönlichkeit: „Mein Chef ist leicht entflammbar!“
Sechstes Kapitel
Gruppendynamik: Der Elefant im Raum
Siebtes Kapitel
Resilienz und Achtsamkeit: Kämpfen, Flüchten, Erstarren
Achtes Kapitel
Kommunikation: Missverständnisse als Regelfall
Neuntes Kapitel
Change Management: Die Regel, nicht die Ausnahme
Zehntes Kapitel
Konfliktmanagement: Verdrängen statt Lösen
Elftes Kapitel
Agilität: Flink statt starr
Zwölftes Kapitel
Das Training: Alle Chefs werden als Chef geboren
Dreizehntes Kapitel
Führen auf Distanz: Virtuelle Teams sind ganz normale Teams
Nachwort vom Königsweg
Vorwort
Führung? Kennen wir alle, können wir alle. Es gibt Tausende Trainings und Seminare, Hunderte aktueller Bücher sowie viele andere Angebote rund um das Thema Führung.
Und obwohl – oder vielleicht gerade weil – es so viele Bücher und Seminare zum Thema gibt, erleben wir in unserer Praxis als Berater, Trainer und Coaches Woche für Woche immer noch und immer wieder viel zu viele Anfragen von Führungskräften zu einem Thema, das eigentlich keines mehr sein dürfte: Führung.
Natürlich kann jede Führungskraft führen! Wenn der Chef sie fragt. Oder der Personalberater. Oder der Beziehungspartner.
Doch wenn wir diskret mit Führungskräften sprechen, stellen uns neun von zehn so viele Fragen und signalisieren so viele Unsicherheiten, manchmal auch eklatante Beispiele mangelhafter Führung, dass sich seit Jahren eine Erkenntnis bei uns verfestigt hat:
Was gute Führung angeht, sind leider viele noch auf dem Holzweg unterwegs.
Die Holzwege
Genauer gesagt: Es sind dreizehn Holzwege, auf die Führungskräfte noch zu oft geraten. Wenn wir die Führungsschwächen betrachten, die wir in unserer beruflichen Praxis täglich sammeln, fällt auf, dass es nicht unendlich viele davon gibt. Über die Jahre haben wir festgestellt: Es gibt im Grunde „nur“ dreizehn, was schlimm genug ist – und gut.
Das zumindest sagen uns die Führungskräfte in unserem Enduring Leadership Program: „Nur dreizehn? Dann kriege ich das Problem in den Griff!“ Das tun sie dann auch. Und Sie, liebe Leser, bald auch, denn dazu sind wir hier auf diesen Seiten unterwegs: Damit Sie runter vom Holzweg kommen – von allen Holzwegen.
Seien Sie dankbar dafür, dass Sie aus eigenem Antrieb hier sind! Denn wenn Führungskräfte auf dem Holzweg sind, glauben sie oft: Das merkt schon keiner! Das ist falsch.
Wissen Sie, was Ihr Chef über Sie denkt?
Es ist gerade umgekehrt: Führt ein Vorgesetzter schwach, haben das alle längst bemerkt – meist bevor es der Betroffene selbst mitbekommt. Das sagen uns zum Beispiel die Vorgesetzten der Betroffenen:
„Er bringt zwar seine Zahlen, aber entscheidungsstark ist er nicht wirklich.“
„Ihre Mitarbeiter beklagen hinter vorgehaltener Hand ihre geringe Offenheit und Transparenz.“
„Er ist sozialkompetent, aber nicht krisenfest. Harmonie ist ihm wichtiger als Effektivität.“
„Sie versteht was vom Fach, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie die zwischenmenschliche Dynamik ihrer Abteilung im Griff hat.“
Manchmal fragen wir uns, ob die betreffenden Führungskräfte wissen, was ihr eigener Chef von ihnen hält. Und warum sie nicht endlich von ihren Holzwegen herunterkommen. Dabei sind die Antworten auf diese Frage relativ einfach:
Warum Chefs schwächeln
Viele Führungskräfte beschäftigen sich eher mit sich selbst, ihren Interessen, Zielen und ihrer Karriere als mit den Kunden und Mitarbeitern und bekommen deshalb viel zu selten Feedback, wenn sie auf Holzwege geraten.
Häufig erleben wir auch eine waschechte Absicherungskultur im Unternehmen, für die der einzelne Vorgesetzte natürlich nichts kann. Da er ihr jedoch folgt, betreibt er eher Absicherung als Führung – und das merken die Geführten und sind nicht amüsiert.
Auch das Konsensstreben ist heutzutage epidemisch verbreitet. Es wird so lange diskutiert, bis alle einverstanden sind – selbst wenn die Entscheidung dann definitiv zu spät gefällt wird oder weitgehend an den Erfordernissen vorbeigeht.
Doch der Knüller ist, was uns viele Führungskräfte unter dem Siegel der Anonymität verraten: „Jetzt mal ehrlich? Ich habe gar keine Zeit, um zu führen. Ich bin operativ so stark eingebunden, dass für Führung keine Zeit bleibt!“
Das muss man sich mal vorstellen: Führungskräfte, die – nach eigenem Bekunden – nicht führen, nicht führen wollen oder es mangels Zeit auch gar nicht können. Das ist erstaunlich?
Das ist es nicht. Denn seit Jahren kursiert an der Basis der Geführten der launige Spruch: „Wer glaubt, dass Führungskräfte führen, glaubt sicher auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.“ Jetzt wissen wir auch, woher dieser Spruch kommt: von Führungskräften, die nicht führen.
Darüber hinaus ist in vielen Unternehmen auch die Unternehmensstrategie nicht klar formuliert oder nicht klar kommuniziert. Dann findet Führung praktisch im luftleeren Raum statt.
Gründe, warum Chefs schwach führen, gibt es also genug. Und nicht alle davon hängen ursächlich mit dem Chef zusammen. Doch alle davon vermeiden Sie, wenn Sie mit uns auf dem Königsweg der Führung unterwegs sind. Das schafft übrigens nicht jeder.
Ein Fleck auf der Krawatte
Oft treffen wir nämlich auf Führungskräfte, die uns nicht betroffen, sondern im Gegenteil recht empört anschauen und fragen: „Holzwege? Welche Holzwege denn?“
Wir geben zu: Für denjenigen, der auf dem Holzweg ist, ist es oft am schwierigsten, den hölzernen Klang seiner Schritte wahrzunehmen. Das ist wie der berüchtigte Suppenfleck auf der Bluse oder Krawatte: Da man/frau sich die längste Zeit des Tages nicht selber sieht, sehen alle anderen den Fleck zuerst. Dabei sind Holzwege sehr viel leichter zu entdecken als Suppenflecken auf der Kleidung. Es reicht schon, auf die häufigsten und intensivsten Klagen der Geführten zu hören:
Die meisten Mitarbeiter in den meisten Betrieben beklagen mangelnde Wertschätzung und/oder ein schlechtes Betriebsklima.
Und jetzt fragen wir uns natürlich: Würde beides oder auch nur eines von beiden unter einer Führungskraft auftreten, die kompetent führen kann?
Indikatoren schwacher Führung
Das war eine rhetorische Frage. Und so reihen sich die Indikatoren für holzweghaft schwache Führung aneinander:
Der Fokus der Führungskraft ist auf die Vergangenheit gerichtet: „So machen wir das hier!“ Bisher. Was ist mit der Zukunft?
Es wird angewiesen und kontrolliert, statt kommuniziert und vereinbart
Es wird so wenig kommuniziert, dass Intransparenz und Missverständnisse überhand nehmen – und Konflikte
Die Konflikte ihrerseits werden nicht gelöst, sondern vermieden
Mitarbeiter bekommen mehr und mehr das Gefühl: „Ganz gleich, wie viele Beine ich mir für den Betrieb ausreiße – das kriegen die da oben sowieso nicht mit.“
Es besteht also gerade in unseren dynamischen und disruptiven Zeiten ein enormer Bedarf an guter Führung – wenn Sie diesen erkannt haben, sind Sie schon halb vom Holzweg runter. Und bitte: Machen Sie sich keine Vorwürfe, dass Sie überhaupt auf diesen Weg geraten sind. Denn erstens sind Sie in guter Gesellschaft.
Und zweitens: Es ist nicht Ihre Schuld. Am Nordpol wächst keine Ananas. Will heißen: Viele Unternehmenskulturen sind geradezu führungsfeindlich. Sie fördern Egoshooter. Selbstoptimierer. Also Chefs, die eher Karrieristen als Führungskräfte sind. Chefs, die sich nicht vorrangig um ihr Team kümmern, sondern um ihr persönliches Vorankommen. In so einer Atmosphäre sind Machtspiele die Regel, Teamwork die Ausnahme.
Nun könnte man sagen: Genau dafür haben wir Führungstrainings! Wenn schon die Firmenkultur führungsfeindlich ist, dann lernen Führungskräfte wenigstens im Training, wie man richtig führt!
Viele Trainings sind Mogelpackungen
Dass Führungskräfte in Führungstrainings fit gemacht werden, würden wir uns auch wünschen. Doch viele Führungstrainings sind „Führungswissen-Vermittlungs-Veranstaltungen“. Es findet keine oder nur wenig Einbettung in den konkreten Kontext und die gelebte Praxis des Unternehmens statt, aus dem die Trainingsteilnehmer kommen.
Diese wissen danach alles, können es aber nicht. Und nicht nur, weil viele Führungstrainings rechtwinklig zur Realität der Firmen stattfinden, aus denen die Teilnehmenden kommen oder in denen die Trainings abgehalten werden. Sondern auch, weil viele Trainings so tun, als ob die Trainierenden keine Persönlichkeit hätten: Ist die Führungskraft extra- oder introvertiert? Ein Kopf- oder Bauchmensch? Visionär oder Detaillist? Piepegal!
Es wird allen nach Maßgabe des Nürnberger Trichters ein angeblich idealer Führungsstil übergestülpt, den jeder gefälligst zu praktizieren habe. Kein Wunder, dass die meisten Führungstrainings einen Nulltransfer, wenn nicht einen Negativtransfer haben: Die Trainingsteilnehmer führen danach noch schwächer, weil die trainierten Rezepte nicht funktionieren, da sie nicht mit ihrer Persönlichkeit kompatibel sind. Und dafür geben Unternehmen Geld aus? Ja, Millionen, jährlich.
Viele Führungstrainings negieren darüber hinaus die Gruppendynamik der geführten Teams – dabei macht es einen Riesenunterschied, ob ich eine Gruppe erfahrener und in Routine gefestigter Ingenieure führe oder einen Haufen genialer, aber subversiver junger Millennials. Der Unterschied ist für jeden durchzuckelnden Büroboten mit bloßem Auge erkennbar – warum nicht für mehr Führungstrainer?
Und als ob das alles nicht ausreichen würde, um das schwache Durchschnittsniveau der Führungskompetenz in vielen Firmen sattsam zu erklären, wabern dazu noch Führungsmythen durch den Äther wie:
Zur Führungskraft muss man geboren sein!
Das Chef-Gen
Echt jetzt? Das gibt es? Es gibt ein Chef-Gen? Natürlich nicht. Niemand wurde oder wird als Führungskraft geboren. Auch Michelangelo wurde nicht als der Michelangelo geboren, sondern hat sich seine Genialität über die Jahre erworben. Führung ist eine Kunst, die man nicht erben kann, sondern erlernen muss. Niemand wird als Führungskraft geboren, sondern alle, die führen können, haben Führung erlernt und trainiert, wie sie all ihre Fähigkeiten erlernt haben, indem sie diese geübt und trainiert haben: Tennisspielen, Schach, Algebra, Englisch …
Leider entsenden viele Unternehmen zum Beispiel den besten Verkäufer eines Teams auf einen 3-Tage-Crash-Kurs, befördern ihn zum Verkaufsleiter und erwarten dann, dass er hinterher genial führen kann. Das ist der Knüller?
Nein, warten Sie, es kommt noch besser: Wenn wir Führungskräfte sacht auf dezidierte Führungsschwächen und die dringende Notwendigkeit eines Führungstrainings ansprechen, erwidern uns einige tatsächlich: „Warum das denn? Ich war doch erst vergangenes Jahr zwei Tage auf Seminar!“
Würden Sie diese Antwort von Robert Lewandowski oder Serena Williams erwarten? Sicher nicht. Ein echter Profi weiß: Training is the breakfast for Champions. Wer siegen will, trainiert. Täglich. Was ist dabei das Trainingsgeheimnis der besten Führungskräfte?
Es gibt kein Geheimnis guter Chefs
Wenn wir exzellente Führungskräfte fragen – und wir kennen beruflich eine Menge – sagen diese unisono:
„Es gibt kein Geheimnis. Mein Geheimnis ist Training.“
„Nicht einmal im Jahr, sondern wie jeder Bundesliga-Profi: stetig und ständig, jeden Tag ein wenig in der direkten Anwendung einüben, verbessern, internalisieren.“
„Regelmäßig professionelles Feedback, das hilft.“
„Führungstraining ist doch nicht schwierig! Bei mir basiert es hauptsächlich auf der Rückmeldung der Geführten.“
Warum trainieren exzellente Führungskräfte so gewissenhaft? Auch das sagen sie deutlich: „Wenn ich es als Führungskraft nicht schaffe, dass meine Mitarbeiter mir folgen, bin ich auch keine Führungskraft.“ Oder wie es im Amerikanischen heißt; frei nach John C. Maxwell: „A leader without followers is just a guy going for a walk!“
Führungswissen ist ein Widerspruch
Dabei bedeutet Führungstraining eben nicht reine Wissensvermittlung – Wissen ohne Anwendung ist totes Wissen. Training schlägt nur dann bei einer Führungskraft an,
wenn es zur Führungskultur, zu Strategie, Werten und Prozessen des Unternehmens passt, aus dem die Führungskraft stammt
wenn es die Dynamik von Teams und Gruppensituationen beinhaltet und behandelt
wenn es Reflexion, Feedback und die Auseinandersetzung mit sich selbst, den Teamkollegen und der Organisation ermöglicht
wenn es die Persönlichkeit der Führungskraft berücksichtigt
Insbesondere der letzte Punkt hat es in sich. Viele Führungskräfte scheuen geradezu davor zurück, sich mit sich selbst auseinander zu setzen: „Bloß keine Emotionen zeigen!“ Sie glauben tatsächlich, sie hätten keine Gefühle bei der Arbeit, sind dann aber verwundert, dass sie zum Beispiel Magenschmerzen bekommen, wenn der Chef sie anbrüllt.
Nur wer sich mit sich selbst als Führungskraft auseinandersetzt, ist auch in der Lage, die Persönlichkeit seiner Mitarbeiter adäquat zu erfassen, zu führen und zu entwickeln. Je besser sich eine Führungskraft selbst versteht, desto besser versteht sie auch ihre Mitarbeiter. Wer die eigenen Emotionen nicht wahrnehmen kann oder möchte, kann sie auch nicht bei den eigenen Mitarbeitern konstruktiv beeinflussen.
Führung entscheidet
Führung entscheidet auch wegen der aktuellen Herausforderungen immer stärker über Erfolg und Misserfolg. Fast jeder Chef muss immer mehr Leistung mit immer weniger Mitarbeitern und Budget erbringen. Disruptionen wie die Globalisierung, die Digitale Transformation und Corona erfordern explizit exzellente Führungsqualität. Immer mehr Aufgaben müssen mit recht begrenzten Ressourcen erledigt werden. Vor diesem Hintergrund sind Resilienz, Achtsamkeit und Agilität die neuen Gebote der Zeit für jede Führungskraft.
Diese Gebote sind bislang dramatisch unterbelichtet und unterschätzt: Führung ist heute viel mehr als nur Anweisungen erteilen. Genau dieses Mehr finden Sie auf den folgenden Seiten. Genau deshalb betrachten wir im Folgenden dreizehn Dimensionen guter Führung, die zusammengenommen den Königsweg exzellenter Führung ergeben.
Apropos Königsweg.
Auf dem Holzweg
Wie sage ich’s meinem Kinde? Ganz zu Anfang unserer Beschäftigung mit Führungsschwächen hatten wir Sorge, dass gerade Führungskräfte, die offensichtliche Schwächen zeigen, eher negativ auf eine direkte Ansprache der Marke „Sie machen da was falsch!“ reagieren würden.
Noch die mildeste Reaktion darauf war: „Das hat mir mein Chef auch schon gesagt. Und einige Mitarbeiter.“ Eine junge Führungskraft im Management eines Start-ups schlug allen Ernstes als Ansprache der Wahl den Begriff „Leadership Fail“ vor.
Gestandene Manager aus der Industrie und anderen Branchen verzogen daraufhin das Gesicht. Dann überraschte uns und andere Sitzungsteilnehmer ein Vorstand nach einem hitzigen Meeting, das er dann letzten Endes doch zu einem guten Ende brachte, mit den Worten: „Da war ich zwischendurch mal offensichtlich für einige Minuten gehörig auf dem Holzweg!“
Und alle lachten: Die Chef-Metapher war geboren. Wir haben bislang keinen Vorgesetzten erlebt, der den Begriff vom Holzweg krumm genommen hätte. Im Gegenteil. Das Spektrum der Reaktionen reicht von mildem Amüsement bis hin zu selbstironischer Erheiterung. Das mag daran liegen, dass der Begriff eine bestens bekannte, uralte Metapher ist. Oder wie Wikipedia meint:
„Die Redewendung ‚Auf dem Holzweg sein‘ beschreibt ein nicht zielführendes Vorgehen und impliziert die Aufforderung, diesen Irrweg zu verlassen.“ Und warum ist der Irr- ein Holzweg?
Weil die ursprünglich so genannten Holzwege im Wald nirgendwohin führen: Sie dienen den Holzfällern lediglich dazu, Holz zu schlagen; heute wird so ein Weg auch als „Rückeweg“ bezeichnet. In diesem forsttechnischen Sinne wurde der Holzweg bereits seit dem 13. Jahrhundert verwendet und erhielt seine übertragene, sprichwörtliche Verwendung im 15. Jahrhundert.
In einer Sittenpredigt des deutschen Predigers Johann Geiler von Kaysersberg aus dem Jahr 1495 fungiert der Holzweg zum Beispiel ausdrücklich als Irrweg: „Man findt under tausent nicht einen, der dem rechten weg nachtrachtet, sonder sie gehn all dem holzweg nach und eilen heftig bisz sie zu der hellen kommen.“
Ins heutige Deutsch übersetzt: „Unter tausend Menschen findet man nicht einen, der nach dem rechten Weg strebt, sondern sie alle folgen dem Holzweg und gehen so lange darauf, bis sie letztendlich in der Hölle ankommen“.
Ganz so schlimm kommt es im modernen Management nicht – wobei wir natürlich schon den einen oder anderen Coachee kennen, der sich ob seiner Führungsschwächen „in der Führungshölle angekommen“ wähnt. Vor allem dann, wenn sein Chef ihm androht, er müsse diese Schwächen schleunigst abstellen, sonst ...
Ganz anders dagegen die komplementären Königswege.
Komm auf den Königsweg!
Der Begriff des Königsweges stammt aus der Zeit antiker Großreiche. Königswege sind Wege, die damals für den Großkönig oder den Pharao sowie deren Gefolge vorbehalten waren und die kürzesten und besten Straßen in die verschiedenen Landesteile waren. Im übertragenen Sinne: Königswege sind die kürzesten und besten Wege zu exzellenter Führung und Unternehmenserfolg.
Wir möchten mit diesen Seiten Führungskräfte aller Branchen und Hierarchieebenen motivieren, vom Holzweg auf den Königsweg abzubiegen, weil Leben, Arbeit und Führung dann leichter werden, mehr Spaß machen und mehr Erfolg bringen.
Auch kosten Königswege weitaus weniger Kraft. Auf dem Königsweg entstehen weniger Konflikte, nicht Probleme, sondern Lösungen rücken in den Mittelpunkt, Innovationen werden angeregt und beschleunigt. Ein jeder Chef ein König? Das ist das Motto.
Der Chef ist König!
Auch dieses Buch hat einen „Führungsstil“. Wie Sie bereits auf diesen wenigen Seiten festgestellt haben: Wir halten wenig vom knochentrockenen Sachbuch-Verlautbarungsstil. Der Bürokratenstil ist umständlich und lädt nicht gerade zum Lesen ein. Wir aber möchten das. Wir möchten Sie nicht belehren, sondern einladen, auf den Königsweg zu kommen, auf dem andere exzellente Kollegen bereits unterwegs sind.
Auch ist das Buch mit vielen Beispielen aus Beratung und Training gespickt, plakativ und unterhaltsam – weil wir möchten, dass Sie auf diesen Seiten möglichst wenig Theorie und möglichst viel Praxis mitbekommen.
Wir haben den Inhalt entlang von dreizehn Kapiteln strukturiert, die wir in unserer Praxis als die „Big 13“ exzellenter Führung erkannt haben. Führungskräfte, die exzellent führen, beherrschen diese dreizehn Felder, indem sie deren Holzwege vermeiden:
1. Strategie: Eine Powerpoint-Folie ist noch keine Strategie!
2. Werte und Haltung: Chefs, die ohne Werte führen? Wertlos. Und Chefs, die ohne Haltung führen?
3. Führung und Rolle: Ich habe keine Zeit für Führung! Ich muss mich ums Geschäft kümmern!
4. Prozesse und Zusammenarbeit: Mein Silo ist meine Welt – der Rest vom Unternehmen soll schauen, wo er bleibt
5. Führungspersönlichkeit: „Ich bin euer Sklaventreiber!“ ist vielleicht kein besonders gutes Selbstverständnis
6. Gruppendynamik: Jeder für sich und nach mir die Sintflut!
7. Resilienz und Achtsamkeit: Ich arbeite, bis ich umfalle!
8. Kommunikation: Es redet viel, wer nichts zu sagen hat.
9. Change Management: Schon wieder wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben.
10. Konfliktmanagement: Wer sägt denn da an Ihrem Stuhl?
11. Agilität und New Work: Wenn agile Teams sich selber führen, brauchen die doch keinen Chef mehr!
12. Führungstraining: Ich bin der Chef und so geboren!
13. Virtuelle Teams sind auch ganz normale Teams.
Wie gesagt: Das sind auf den dreizehn zentralen Feldern der exzellenten Führung jene Holzwege, die Manager in unserer Beratungs-, Coaching- und Trainingspraxis am häufigsten beschreiten: Sorgen wir dafür, dass Sie schnellstmöglich davon runterkommen.
Los geht’s!
Auch wenn es sich in Ihren Händen so anfühlt: Was Sie da vor sich haben, ist eigentlich kein Buch. Es ist vielmehr das Turbo-Skript des Enduring Leadership Program, mit dem wir Führungskräfte aller Branchen und Hierarchieebenen in Präsenztrainings erfolgreich trainieren. In dürren Worten heißt das:
Die machen, was da steht!
Sie setzen um, was sie trainiert haben.
Warum? Weil es sich lohnt. Weil Führungskräfte damit und dadurch besser werden. Sehr viel besser. Und deutlich erfolgreicher in allen Belangen. Das heißt auch: beliebter und respektierter – oben wie unten. Denn sowohl die Geführten wie auch der Chef vom Chef honorieren eine Führungskraft, die besser führt. Oder wie die Engländer sagen: „The proof of the pudding is in the eating!“ Der Beweis Ihrer Führungsexzellenz liegt nicht in Ihrem Wissen über Führung, sondern darin, wie Sie tatsächlich führen.
Wir wünschen Ihnen diesen Beweis – jeden Tag.
Erstes Kapitel
Strategie und Sinn: Eine Powerpoint-Folie reicht nicht
Purpose – Strategie – Ziele
Hat Ihr Unternehmen einen Noble Purpose? Oder „verkaufen wir bloß Produkte“, wie das ein Manager bei einem deutschen Konzern formulierte, als es im Workshop um die Zukunftsfähigkeit und damit auch die Daseinsberechtigung seines Konzerns ging.
Gewiss: Noble Purpose? Was für ein Modewort! Doch Zahlen lügen nicht. Unternehmen, die einen erhabenen Zweck verfolgen und die diesen zum Leitstern ihres Handelns machen,
sind erfolgreicher als jene, die „bloß Produkte“ (oder Dienstleistungen) verkaufen
haben eine bis zum Dreifachen höhere Wachstumsrate als NPC’s (Non-Purpose-Driven-Companies)
leiden kaum oder überhaupt nicht unter Fach- und Führungskräftemangel
binden ihre Führungskräfte und Mitarbeiter deutlich länger
leiden weniger unter firmenpolitischen Spielchen, Intrigen, Reibungs- und Effizienzverlusten
weisen ein besseres Arbeitgeberimage auf
Oder wie es die Amerikaner in ihrer unnachahmlich fokussierten Art ausdrücken: Purpose Drives Profit. Auf gut deutsch: Mehr Sinn – mehr Gewinn.
Wenn zum Beispiel ein Unternehmen in Zeiten eines wachsenden Fachkräftemangels überhaupt noch Bewerber bekommt – und gute, hoch motivierte, kompetente Bewerber obendrein, die sich mit hohem Einsatzwillen auf lange Zeit ans Unternehmen binden wollen – dann liegt das auch an dessen Noble Purpose:
Wir. Dienen. Deutschland.
Erraten? Ja, natürlich, die Bundeswehr. Wohingegen dieser Sinn eines Leihwagenunternehmens, nur als Beispiel genannt, „Wir bedienen das Mobilitätsbedürfnis der Menschen“ sehr deskriptiv, umfassend und markant formuliert ist. Aber reißt Sie dieser vorgebliche Noble Purpose vom Hocker? Eher nicht.
Das hat keinen affektiven Impact. Es erreicht die Herzen nicht, ist nicht emotional. Das ahnt, nein, spürt auch jeder, der damit in Berührung kommt. Und das hat weniger mit der Formulierung eines Purpose zu tun als mit dem Grund des Daseins eines Unternehmens: Wozu ist das Unternehmen überhaupt da?
Wozu sind wir da?
In Workshops stellen wir dem Management der Unternehmen, die uns beauftragen, gerne die Frage:
Wofür gibt es eigentlich Ihre Firma? Wofür sind Sie da?
Wenn das Management mutig ist – und das ist es häufiger als die Medien das vermuten – dann fragen wir auch:
Wenn Ihr Unternehmen morgen plötzlich vom Markt verschwinden würde, würden Ihre Kunden Sie vermissen? Und aus welchem Grund? Oder würden sie per Mausklick schlicht woanders ordern?
Auf diese Fragen hin ruht erst einmal Schweigen über der Versammlung. Dann kommen die Wortmeldungen. Und dann merken alle im Saal: Jeder Manager, jede Managerin hat einen anderen Purpose im Kopf! Spätestens dann merken das alle – in der Regel jedoch deutlich früher (weshalb wir überhaupt erst gerufen wurden).
Natürlich ist es für die Bundeswehr, für Hilfsorganisationen („Wir retten Leben!“) oder für die Seenotrettung („Wir fahren raus, wenn andere untergehen!“) signifikant leichter, einen Noble Purpose zu finden und zu formulieren. Doch seit wann wäre das eine gute Ausrede dafür, es gleich gar nicht erst zu versuchen?
Echte Manager machen es sich nicht leicht. Im Gegenteil. Sie gehen ans Eingemachte.
Ans Eingemachte: Nichts ist sinnvoller als der Sinn
Vieles wird über den Noble Purpose geschrieben, doch im Grunde ist die Sache einfach:
Der Noble Purpose motiviert nicht nur, er begeistert Mitarbeiter wie Führungskräfte gleichermaßen. Wer für eine Firma mit einem relevanten Daseinszweck arbeitet, geht nicht nur jeden Tag zur Arbeit, sondern hat jeden Tag Lust auf seine Arbeit und vor allem Lust auf Leistung.
Der Noble Purpose ist der Nukleus der intrinsischen Motivation. Weil er Sinn, Daseinsberechtigung und einen höheren Zweck vermittelt. Anders ausgedrückt:
Sinnvermittlung ist im 21. Jahrhundert Produktionsfaktor.
Unsere Großeltern gingen zur Arbeit, weil sie das Geld brauchten. Ihre Enkel dagegen erwarten, dass der Job sie (auch) erfüllt. Und jetzt die 100 Millionen Dollar-Frage:
Wie soll das gehen – ohne Sinn und (höheren) Zweck?
Das geht nicht. Das ist klar. Warum hat dann nicht längst jedes Unternehmen einen Noble Purpose – eine Daseinsdefinition, die die Mitarbeiter auch wirklich emotional berührt?
Weil Sinn und Zweck keine sachlichen (also typisch deutschen) Themen sind, sondern hoch emotionale. Das macht es jenen Menschen schwer, die ihre Emotionalität an der Zeiterfassung abgeben, damit umzugehen. Das ändert jedoch nichts an der inzwischen empirisch untermauerten Tatsache (siehe u.a. das Buch „Wettbewerbsfaktor Mensch“, I. Hamm / W. Köhler, Springer Gabler 2020):
Sinn ist der beste Motivator.
Spätestens an dieser Stelle fällt uns im jeweiligen Workshop einer im Vorstand meist ungehalten ins Wort und sagt: „Aber wir haben doch einen Sinn! Wir haben unsere Vision!“
Das ist gut gemeint und sicher nützlich, trifft jedoch die Problematik nicht ganz (denn sonst bestünde sie überhaupt nicht).
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen
Den Spruch soll Altbundeskanzler Helmut Schmidt gemacht haben und in einem späteren Interview (war es mit Giovanni di Lorenzo?) gab er das auch unumwunden zu. Er habe das lediglich als bewusst flapsige Antwort auf die dusselige Frage eines Reporters verstanden wissen wollen – und nicht als Ratschlag fürs Management! Diese ex post Richtigstellung wäre nicht nötig gewesen.
Denn seit der Erfindung des Faustkeils haben Manager und Managerinnen Visionen gepflegt, die die Welt veränderten.
Bill Gates zum Beispiel hatte die Vision: Wir wollen, dass auf jedem Schreibtisch der Welt ein Computer mit Software von Microsoft steht!
Noch heute ist der Sog dieser Vision spürbar: Die Vision wirkt wie ein Magnet, hat eine tolle Anziehungskraft, setzt große Kräfte frei. Dann packt man eine operationalisierte Strategie hinter so eine Vision – und der Unternehmenserfolg ist praktisch unvermeidbar (verkürzt gesprochen).
Der Sog einer Vision
Ein Unternehmen mit so einer Vision cum Strategie bietet viel Orientierung, Transparenz und Motivation. Das Problem daran: Solche Vision/Strategie-Dichotomien sind oft rein monetär oder quantitativ ausgerichtet: „Wir wollen doppelt so schnell wachsen wie der Markt!“ Oder: „Wir wollen 20 Prozent mehr Umsatz machen!“ Einmal davon abgesehen, dass solche Sätze im Führungsalltag zwar als Vision/Strategie verstanden und verkauft werden, jedoch eher Ziele sind, erhebt sich die viel größere Purpose-Frage:
Wen soll das begeistern?
Worauf eine Geschäftsführerin in einem unserer Strategie-Workshops einwarf: „Jetzt sollen wir die Mitarbeiter auch noch begeistern? Motivieren allein reicht nicht mehr?“ Die Antwort ist offensichtlich: Nein – denn Mitarbeiter können gar nicht motiviert werden. Sie brauchen Inspiration und Ermutigung.
Genau das ist doch der vielzitierte Wertewandel, der am Arbeitsmarkt stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Mitarbeiter und Führungskräfte wollen nicht „nur“ Gehalt und Bonus, sondern jetzt auch noch einen Purpose!
Und wenn ein Mitbewerber seine Belegschaft via Noble Purpose begeistert, wie lange überleben wir dann noch ohne Purpose? Das ist eine strategische Existenzfrage, auf die es nur eine Antwort gibt.
Ein Noble Purpose muss her!
Im 21. Jahrhundert gehört er zur Betriebs- und Geschäftsausstattung wie das Smartphone oder ein Tablet – und erfordert im Übrigen kein Zusatzstudium, sondern lediglich wenige Wochen mit einem Projektteam und diversen Workshops: praktisch Business as usual. In dieser Zeitspanne erarbeitet sich jedes Unternehmen einen brauchbaren und begeisternden Noble Purpose.
In praktisch jeder auf Dauer angelegten Tätigkeit schlummert ein Noble Purpose, der lediglich gefunden, geweckt und formuliert werden möchte. Das macht Arbeit.
Jedoch Arbeit mit einer ungeheuren Rendite: Nichts beflügelt stärker als die Sinnvermittlung hinter dem eigenen Tun.
Wofür arbeiten die Leute denn?
In nicht wenigen Unternehmen hören wir bis hinauf ins mittlere Management:
„Wir haben aber keinen Noble Purpose, keine Vision und keine Strategie! Keine, von denen ich wüsste oder die ich und meine Leute verstehen würden.“
„Was machen Sie dann den ganzen Tag?“
„Wir arbeiten Aufträge ab und erledigen unsere Projekte.“
„Und wofür arbeiten Sie?“
„Fürs Gehalt, ein bisschen Status“ und die Verfolgung persönlicher Ziele (hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen).
Reicht das?
Ihnen?
Ihren Führungskräften und Mitarbeitern?
Das Ende einer Ära
Den meisten Führungskräften ist seit langem klar, dass sie Mitarbeiter brauchen, die mitdenken und selbstständig agieren und nicht welche, die man mit Bonusprogrammen „zum Jagen tragen muss“, wie das Sprichwort sagt. Warum sollten die Leute selbstständig mitdenken und mitarbeiten?
Wie sollten sie das bewerkstelligen? Ohne Sinn?
Ohne Purpose, Vision und Strategie, die jedem sofort einleuchten und mitreißen?
Die Ära der extrinsischen Motivation ist tot. Es lebe die intrinsische Motivation – zumindest für jeden Job, der nicht am Fließband stattfindet. Und Sinn ist eben der mächtigste Treiber der intrinsischen Motivation. Um Viktor Frankl zu variieren: Wer sein Wozu gefunden hat, findet immer ein Wie. Oft fragen wir Führungskräfte: Wissen Ihre Leute, warum und wozu sie das tun, was sie tun? Ist ihnen bewusst, dass sie die Welt und das Leben der Menschen/Kunden mit ihrer Arbeit jeden Tag ein wenig besser machen?
Oder arbeiten sie lediglich wegen des Gehalts? Haben und leben sie einen Purpose und folgen einer Strategie? Oder produzieren und verkaufen sie „bloß Produkte“?
Platzhirsch-Purpose
Der Knüller ist: Selbst wenn ein Unternehmen keinen Noble Purpose hat, hat jedes Unternehmen einen Noble Purpose. Einen? Meist ganz viele. Denn wenn Menschen keinen Sinn „von oben“ vermittelt bekommen, toleriert die (menschliche) Natur kein Vakuum und sinnorientierte Menschen basteln sich den nötigen und sinngebenden Purpose selber. Zum Beispiel der Leiter der Sonderfertigung, der zu seinem Vorarbeiter sagt: „So könnt ihr den Auftrag doch nicht rausschicken! Wir liefern erstklassige Ware – der Kunde soll das nicht nur kaufen, sondern auch stolz drauf sein, unsere Produkte zu verwenden!“
Das hebt doch gleich die Stimmung, gibt Sinn und Orientierung. Wenn dann dieser Purpose mit angedeuteter Vision auch noch mit einer Strategie hinterlegt ist, die beschreibt, wie diese stolze Erfahrung – neudeutsch User Experience – in der Abteilung erreicht werden kann, ist der nachhaltige Erfolg vorprogrammiert. Doch in vielen Unternehmen fehlen sowohl Purpose als auch (verständliche) Vision und Strategie.
Selbst wenn alle drei vorhanden sind, will das noch nichts heißen.
Strategie – haben wir sowas?
Selbst in Unternehmen, in denen Purpose, Vision und Strategie ausformuliert und dokumentiert sind, ist das keine Garantie dafür, dass alle Führungskräfte den Purpose teilen, die Vision verstehen und die Strategie vermitteln können oder wollen. Leider wird genau das oft „von ganz oben“ unterstellt: „Wir haben die Strategie verabschiedet – also läuft das jetzt!“ In der Regel nicht.
Denn eine Strategie allein sagt zum Beispiel lediglich: „In fünf Jahren sind wir die Nr. 3 im Markt!“ Wie soll das gehen? Wie erreichen wir das?
Genau das wissen viele Führungskräfte nicht. Weil es zwar holistisch für das Unternehmen in der Strategie steht. Aber es fehlt die Ausdetaillierung: Die Strategie müsste in den Zielen für jede einzelne Abteilung definiert sein. Und wer macht das? Wer bricht herunter? Das ist in vielen Strategieprozessen unklar bis nicht geregelt.
Deshalb wird die Strategie, so teuer sie auch entwickelt wurde, schnell auf der operativen Ebene vergessen – eben weil nicht deutlich aufgezeigt wird, wie genau die operative Arbeit auf die Strategie einzahlt. Was zu dem seltsamen Erlebnis führt, dass wir in manchen Unternehmen auf die Frage, ob sie denn eine Strategie hätten, zu hören bekommen: „Hm, wir hatten mal eine. Aber ob es eine aktuelle gibt - ich glaube nicht. Ist mir jedenfalls nicht bekannt.“
Eine Strategie ist nur so viel wert, wie die Ziele, die aus ihr bis auf die unterste Ebene abgeleitet werden. Manchmal sagen uns Geschäftsleitungen: „Wir schaffen das nicht allein mit Bordmitteln. Helft uns!“ Uns wundert, dass nicht mehr auf die Idee kommen. Denn die Ableitung von Zielen aus der Strategie für einzelne Bereiche und Abteilungen ist keine Aufgabe, die man rasch nebenher bewältigt. Das lässt die „eigentliche Arbeit“ oft rein zeitlich und terminlich nicht zu. Diese Aufgabe erfordert neben externer Kapazität auch ausreichend Moderationskompetenz. Ist diese nicht intern vorhanden oder verfügbar, kauft man sie sich zu. Die Alternative ist undenkbar: Strategie-Vakuum.
Doch fehlende Ziel-Stringenz ist nicht das einzige Phänomen, das Strategien im Unternehmensalltag entwertet oder unverstanden macht.
Das strategische Dilemma
Was viele Strategen tatsächlich nicht erkennen oder nicht erkennen wollen:
Jede Strategie provoziert unvermeidliche Zielkonflikte.
Werden diese Zielkonflikte vom Top-Management nicht aufgelöst, torpedieren sie treffsicher die Strategie. Da verabschiedet zum Beispiel ein Mittelständler die strategische Vorgabe: „Wir müssen profitabler werden! Also streben wir fünf Prozent Kundenwachstum an, wollen die Kosten um zehn Prozent senken und flankieren das alles mit einem Kulturwandel!“
Praktisch in derselben Sekunde, in der die Strategie proklamiert wird, sagt ein Drittel von Management und Belegschaft: „Wie soll denn das gehen? Mehr Kunden und gleichzeitig weniger Kosten? Das schließt sich doch gegenseitig aus!“
Prima facie auf jeden Fall. Doch die Geschäftsführung kann ebenfalls rechnen. Sicher hat sie sich Mittel und Wege überlegt, wie der Vertrieb mehr Geld von Abteilungen bekommen kann, die ihr Budget teilweise abgeben müssen. Ja? Das wissen wir nicht.
Niemand weiß das. Denn diese Konfliktauflösung wurde nicht gemacht oder nie kommuniziert. Und so begeben sich alle Manager und Mitarbeiter, die es gut machen wollen, in ein unvermeidliches Dilemma: Ganz gleich, wie sie es machen, sie machen es falsch oder unzulänglich.
Akquirieren sie wie gefordert mehr Kunden, steigen die (Akquise)Kosten und sie ernten einen Rüffel.
Streichen sie die Kosten zusammen – auch die Akquisekosten – wird das Kundenwachstum verfehlt und sie ernten einen Rüffel.
Also was denn nun?
So klingt der stumme Schrei von Belegschaft und Führung. Im Top Management geht man(ager) dagegen davon aus, „dass alles klar ist! Die Strategie ist auf gutem Wege“, auch Holzweg genannt. Wenn hinterher herauskommt, dass der Holzweg tatsächlich der Holzweg war, ist das natürlich doppelt peinlich. Zum einen, weil es passiert ist und zum anderen, weil jeder halbwegs vernünftige Mensch doch sofort sagt: Das hätten wir uns auch sparen können!
Der Mitarbeiter und Manager auf der operativen Ebene lässt sich übrigens von so einem Dilemma nicht irritieren. Er löst ihn brachial.
Wie?
Die brachiale Lösung
Jeder gewiefte Manager oder Mitarbeiter ist es gewohnt, dass sein Holzweg-Management ihn täglich in verschiedene Dilemmata verwickelt. Was macht er oder sie dann?
Jedes Dilemma löst eine kognitive Dissonanz aus. Was tun?
Der/die Betroffene macht einfach das, woran er oder sie gemessen wird. Das geben viele Führungskräfte hinter vorgehaltener Hand unumwunden zu: „Ich verstehe unsere Strategie schon, ich bin ja nicht dumm. Doch das damit aufgeworfene Dilemma verstehe ich ebenso. Also mache ich das, woran ich gemessen und wonach ich bezahlt werde.“
Zum Beispiel verfolgt er oder sie dann vorrangig das Ziel des Kundenwachstums – und das Kostenziel fliegt zum Fenster raus. Unter größtem Bedauern zwar, doch:
Was belohnt wird – wird gemacht.
Wer nach Umsatz bezahlt wird, vernachlässigt die Kosten – auch wenn beide Ziele gleichwertig in der Strategie verkündet oder angedeutet wurden.
Was wie ein unauflösbares Dilemma erscheint, ist alles andere als das. Manchmal dauert es Wochen, bis wir mit vielen Meetings und Diplomatie solche Dilemmata unter Einbezug aller Betroffenen geklärt haben, manchmal ist das in einer Mammut-Sitzung erledigt. Wie?
Indem über den Elefanten im Büro geredet und eine Lösung gesucht wird! Das Dilemma ist doch jedem eigentlich evident: Also wie lösen wir es? Umsatz oder Kosten? Oder beides? In welchem Verhältnis, nach welchen Maßgaben?
Wenn vernünftige Menschen über solche Zielkonflikte im Meeting reden, haben wir es noch nie erlebt, dass keine Lösung gefunden worden wäre. Das ganze Problem liegt sehr häufig nur darin, dass zu viele Führungskräfte zu weit oben zu oft denken:
Strategie?
Läuft!
Nein, tut sie nicht. Erst nach Auflösung der Zielkonflikte.
Holzweg „Aktionismus“
Weil Aktionismus so ein massenhaft begangener Holzweg ist, wird er oft auch bei der Entwicklung von Purpose, Vision und Strategie eingeschlagen: Auf einen Schlag starten mehrere Parallelprogramme und Projekte zum Thema, die allesamt meist lebhaft ablaufen und auch gute Ergebnisse produzieren.
Was zur Folge hat, dass nicht ein Purpose, eine Strategie und eine Vision entstehen, sondern deren viele. Was niemanden weiterbringt und die Themen oft auf Jahre hinaus „verbrennt“ und tabuisiert. Danach wird die Sache wieder vergessen, Mitarbeiter kümmern sich um Aufträge und Projekte im Tagesgeschäft – und begeben sich langfristig ins strategische Abseits. Das muss nicht sein.
Wir kennen auch einige Unternehmen, in denen die Führung nach so einem Desaster sagte: „Den ersten Anlauf vergessen wir am besten gleich und probieren es noch einmal. Denn diese drei Themen sind die Stütze unserer Zukunftsfähigkeit. Also machen wir es diesmal richtig.“ Es ist erstaunlich, wie schwer manchen Führungskräften diese Worte über die Lippen kommen. Doch alle, die den aktionistischen Holzweg verlassen, kommen anschließend erfolgreich zum Ziel..
Holzweg „Wer nur einen Hammer hat …
…für den sieht alles wie ein Nagel aus.“ Will heißen: Manchen Unternehmen und Führungskräften fehlt das richtige Instrumentarium für einen Prozess der Strategieentwicklung.
Also sitzt der Projektstab Woche für Woche, Sitzung für Sitzung über viele Monate zusammen und entwirft wohlklingende Formulierungen für die Strategie, die man zusammenfassen könnte unter dem Motto: „Wenn wir uns alles wünschen könnten, was wir wollten, sehen wir so in X Jahren aus.“
Und die ersten Kunden, die nach Monaten der Strategieentwicklung die neue Strategie sehen, fragen sich spontan: So stellt ihr euch das vor – habt ihr mal gefragt, was wir uns so denken und von Euch erwarten?
Es ist erstaunlich, in wie vielen Strategiegruppen eine Frage nie gestellt wird: Welches Problem unserer Kunden wollen wir eigentlich lösen?
Nicht, weil die Strategiegruppe so kundenfeindlich wäre. Sondern weil sie über der Analyse von Märkten, Wettbewerbern und technischen Neuerungen den Kunden manchmal vergisst.
Holzweg „Alles bisher war Mist!”
Fast alle neuen Strategien lösen einen unfreiwilligen Effekt aus, den so gut wie niemand auf dem Radar hat:
Die neue Strategie entwertet oder beschädigt den Status quo.
Sie macht das Erreichte mies und damit jene, die es erreicht haben; ein Beispiel aus der Lebensmittelbranche:
„Unsere neue Strategie lautet ab sofort: Wir liefern qualitativ hochwertige Lebensmittel zu vernünftigen Preisen bei nachhaltiger Produktion.“, proklamiert die Geschäftsführung.
Erste Reaktion der Hälfte von Belegschaft und Management: „Und was haben wir bislang gemacht? Überteuerten Mist ausgeliefert, für den Tiere gequält werden?“
Das hat die Strategiegruppe und die Geschäftsführung nie behauptet! Doch Kommunikation ist nicht das, was man sagt, sondern das, was beim Empfänger ankommt.
Eine Abteilungsleiterin umging diese Alles-Mist-Verurteilung im selben Unternehmen elegant, indem sie bei der Vorstellung der eben verabschiedeten neuen Strategie schlicht sagte: „Alles, was wir bislang so toll gemacht haben, fasst jetzt die neue Strategie in einem einzigen Satz zusammen! Morgen lassen wir T-Shirts damit drucken!“
Alle jubelten, alle fühlten sich in ihren Erfolgen bestätigt, alle tragen noch heute die neue Strategie mit (was die anderen Abteilungen damit machen, darüber breiten wir hier den Mantel des Schweigens).
Holzweg „Das ist nicht unsere Strategie!“
Auch das hören wir an der Basis oft (wenn wir Anonymität zusichern). Wir fragen dann meist zurück:
„Wessen Strategie ist es denn dann? Die Strategie kommt doch von eurer eigenen Geschäftsleitung!“
„Ja, schon – aber wir wurden nie gefragt, was wir davon halten.“
Der Klassiker: das Akzeptanzproblem.
Führungskräfte wurden in den Strategieprozess nicht involviert. Also ist die neue Strategie „nicht unsere“. Und Führungskräfte sind beileibe nicht die einzige Zielgruppe, die pikiert auf eine neue Strategie reagieren kann. Auch viele Kunden fragen sich: „Und dieses Unternehmen will uns als Kunde? Das halten wir strategisch für unvereinbar.“ Klassischer Fall von Betriebsblindheit: Man sieht nur die eigene Meinung und nicht die Erwartungen der Kunden ans Unternehmen. Deshalb testen erfahrene Strategen ihre Strategie-Entwürfe ganz einfach bei den verschiedenen Stakeholdern mit der Frage: Wenn das unsere neue Strategie wäre – was würden Sie davon halten? Was würden Sie uns ins Pflichtenheft schreiben, sich von uns wünschen?
Holzweg „Basis-Verfehlung“
Die Anzahl der Vorstände, die klagen „Unsere Strategie kommt nicht bei den Mitarbeitern an!“ ist durchaus umfangreich. Das liegt manchmal an einer hartleibigen Basis, manchmal auch daran, dass man einen Schritt vergaß: Die Operationalisierung.
Die Strategie wurde nicht auf die einzelnen Geschäftsfelder, Bereiche und Abteilungen heruntergebrochen und ausdetailliert. Stattdessen werden weiter Aufträge abgearbeitet, Projekte durchgeführt und „Die eigentliche Arbeit“ gemacht, bis der Unternehmensleitung auffällt, dass die Basis die eigentliche Arbeit macht und nichts von der neuen Strategie verstanden hat oder umsetzt. Da die Strategie nicht weiter auf die operativen Teams heruntergebrochen wurde, schlussfolgerte die Basis messerscharf: „Dann kann das mit der neuen Strategie auch nicht so wichtig sein!“
In Unternehmen, die sich für den Königsweg entschieden haben, ist das anders. Da hängen sich (alle) Mitarbeiter für die Strategie rein, weil sie einen Sinn erkennen und vor allem selbst daran beteiligt waren, die Ziele für ihre jeweilige operative Tätigkeit herunterzubrechen.
Das wiederum motiviert die Mitarbeiter immens, weil sie mit ihrer eigentlichen Arbeit nun so hochfliegende Konstrukte wie die hehre Firmenstrategie unterstützen.
Darauf kann man am Ende eines Arbeitstages stolz sein: „Ich habe heute wieder einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung unserer Strategie geleistet!“ Menschen arbeiten gerne für etwas Höheres, für übergeordnete Ziele, das große Ganze – wenn sie wissen, womit und wie sie das tun können.
Holzweg „Not-Invented-Here“
Neulich waren wir in einem Unternehmen, das unter schwer zu diagnostizierenden Problemen litt. Nur eines war sicher: Vor Monaten war eine Unternehmensberatung im Haus, um die Strategie zu modernisieren. Der Beginn der Probleme, wegen deren wir gerufen wurden, fiel ungefähr mit der Verabschiedung der neuen Strategie zusammen.
Die Diagnose ahnen Sie bereits: Not invented here! Ungefähr die Hälfte von Management und Belegschaft lehnte die neue Strategie ab, „weil das nicht unsere ist – die haben Außenstehende entworfen, die von unserem Laden im Grunde keine Ahnung haben! Wir, die wir seit 20, 30, 40 Jahren dabei sind und das Business von unten bis oben kennen, wurden nicht gefragt.“ Das wäre vermeidbar gewesen.
In eine gute Strategie fließen deshalb in- und externe Perspektiven ein. Der Clou dabei ist: Eine bestimmte externe Gruppe nimmt oft bereits eine Firmenstrategie wahr, obwohl die betreffende Firma noch gar keine explizite Strategie hat – oder eine gänzlich andere. Wenn man Kunden danach fragt, sagen sie nämlich Dinge wie: „Ach, die Firma X – die haben wegen der Qualität ihre komplette Lieferkette verändert!“ Tolle Strategie – von der das Unternehmen selbst nichts weiß, weil es Kunden stets nach Aufträgen und nicht nach wahrgenommenen Strategien fragt.
Holzweg „Strategie ohne Narrativ“
Die meisten Strategien leben wo? Auf Folien und Charts. Nicht in den Köpfen und Herzen jener, die sie umsetzen sollen – damit rechnen die Betroffenen selten. Eine Bereichsleiterin bei einem Mittelständler erklärt das so: „Ach, Strategie! Das ist doch wie das Kennzeichen am Auto. Wenn man das mal angeschraubt hat, schaut man das nie wieder an.“
Im selben Unternehmen fragten wir einen leitenden Angestellten nach der aktuellen Fassung der Strategie, worauf dieser meinte: „Ja, da war doch was! Erinnere ich jetzt leider nicht mehr. Muss irgendwo aufgeschrieben sein.“ Wir waren verwundert: Er war vor einem Jahr selbst Mitglied in der Strategiefindungsgruppe, hatte die neue Marschroute mit ausgearbeitet und konnte sich nun an kein Element davon erinnern: „Irgendwas mit User Experience.“
Wie sollen sich Manager wie Mitarbeiter auch merken, was weder einleuchtend noch nachvollziehbar ist und weder verständlich noch markant formuliert wurde und kein einprägsames Narrativ besitzt? Wenn etwas so lieblos, sperrig und bürokratisch aufgeschrieben wurde, ist die einzige Botschaft, die Rezipienten daraus ableiten jene, die uns ein Werksleiter im Norden Deutschlands mitteilte: „Das ist so sperrig, das muss ich nicht verstehen. Ich muss mich um mein Werk kümmern. Strategie ist nicht meine Sache.“
So geht es natürlich auch. Die Aufträge werden auch so abgewickelt. Kurzfristig. Doch was soll langfristig aus Unternehmen werden, die heute glauben, ihr Management und ihre Belegschaft würden ohne Noble Purpose, ohne prägnante Strategie und operationale Ziele jene Hochleistungen erbringen, die heute und vor allem übermorgen die Existenz und den unternehmerischen Erfolg sichern?
Zweites Kapitel
Werte und Haltung: Gelesen – Gelacht – Gelocht
Wie wollen wir miteinander umgehen?
Es geht in der Wirtschaft worum? Um Umsatz, Kosten, Effizienz und um das, was „unterm Strich dabei rauskommt“. Das würde niemand bestreiten.
Auch würde niemand anzweifeln, dass es im 100-Meter-Finale bei den Olympischen Spielen darauf ankommt, wer gewinnt. Und wer gewinnt?
Wer am schnellsten ist. Wer am besten trainiert hat. Jeder Trainer in jeder olympischen Sportart würde die Basis der errungenen Goldmedaille mit „Trainingsfleiß und Disziplin“ angeben. Beides sind Werte (früher hätte man „Tugenden“ gesagt):
Werte sind die Basis des Erfolgs.
Auch das würde niemand bestreiten. Trotzdem sind Werte in vielen Unternehmen nicht mit der gleichen Bedeutung adressiert wie zum Beispiel der Gewinn vor Zinsen und Steuern. Unternehmenslenker und Belegschaft reden zu wenig darüber, wie sehr Werte das tägliche Verhalten bestimmen. Immer wieder erleben wir in der Unternehmenspraxis Dialoge wie diesen:
„Werte? Ja, sicher wichtig – aber ich wüsste jetzt nicht, was dezidiert unsere Werte wären.“
„Sie wissen nicht, wie und auf welche Art und Weise Sie miteinander zusammenarbeiten und Ihre Kunden behandeln wollen?“
„Wenn Sie das so ausdrücken: Nein.“
Wie soll man es sonst ausdrücken?
Wie merkt man, dass man Werte hat?
In anderen Unternehmen finden wir tatsächlich ein Leitbild, in dem die zentralen Werte definiert sind, zum Beispiel: „Wir arbeiten vernetzt“ oder „Wir wertschätzen unsere Kunden und lösen ihre Probleme.“ Und dann moderieren wir ein Meeting im Vertrieb, in dem sich zwanzig Verkäufer in der Kaffeepause ausgiebig über „diese technisch absolut ahnungslosen Kunden“ lustig machen. Ist das wertschätzend? Und wenn nicht, warum?
Weil die Werte im Leitbild stehen. Sie stehen dort. Aber gelebt werden sie nicht.
Seit dem vielbeschworenen Wertewandel im 21. Jahrhundert arbeiten immer mehr Unternehmen diesen Wertemangel auf. Die Workshops dazu sind teilweise rührend. Da fragt uns zum Beispiel ein Senior Manager:
„Woran merkt man, dass man Werte hat?“
Gute Frage. Einfache Antwort: Menschen merken es spätestens dann, wenn ihre Werte verletzt werden. Zum Beispiel, wenn jemand nicht ganz ehrlich ist, sich die Welt schönredet, keine Transparenz schafft oder Informationen vorenthält, dann sagen die Leute: „Da stimmt doch was nicht! Das kann doch nicht sein! Was erzählt der denn für einen Unfug! Ich glaube, der ist nicht ganz ehrlich.“ Die Werte offenbaren sich: Ehrlichkeit im Umgang miteinander, Offenheit und Transparenz.
Was ist was wert?
Werte sind absolut. Man kann genauso wenig „ein bisschen“ ehrlich sein wie ein bisschen schwanger.
Weil Werte so absolut gelten, haben sie eine extrem hohe, aber ebenso oft übersehene Wirkung auf Motivation, Charakter und Leistung von Menschen. Niemand kann sich da herausreden. Jeder Mensch hat Werte. In Stellenanzeigen werden Mitarbeiter mit Werten gesucht, zum Beispiel „Teamfähigkeit“. Die häufigste Absage an qualifizierte Bewerber lautet bei Personalverantwortlichen und Fachvorgesetzten: „Kandidat passt nicht zum Team!“ Werte schlagen Qualifikation? Aber sicher doch; an jedem Tag des Jahres. Das ist hart, denn das verkörpert zugleich die Antwort auf die ur-alte Frage: Wer bin ich?
Ich bin die Werte, die ich habe. Ich bin, wie ich mich verhalte. Ehrlich oder unehrlich. Gewissenhaft oder schlampig. Erfolgsorientiert oder schonhaltungsorientiert. Allein diese wenigen Beispiele zeigen: Werte sind das Benzin des Unternehmensmotors. Angesichts dessen ist es ein Mysterium, warum sich so viele Unternehmen eher wenig um ihren Werte-Kanon kümmern. Das hat Folgen.
Werte-Wildwuchs
Solange es die Unternehmensleitung verpasst hat, einen Prozess mit der Belegschaft zu starten, um herauszufinden, welche Werte im Unternehmen gelten sollen, schleicht sich über kurz oder lang ein Wertesystem ein, das auf Dauer kaum noch zu jenen Werten passt, die Leistung und Qualität ermöglichen.
Es entsteht ein Wildwuchs an Werten und Werte-Phänomenen, die uns allen bekannt sind: Den eigenen Hintern retten, Dokumentaritis, Schuld-Spiele, überbordende Bürokratie, Schonhaltung, Intrigen…
Den größten Schaden in diesem Wildwuchs richtet oft die Konsequenzlosigkeit an, die ein bestimmtes Verhalten nach sich zieht: Führungskräfte und Potenzialträger werden überwiegend nach der Frage beurteilt: Erfüllen sie ihre Ziele? Und eben nicht auch: Auf welche Art und Weise erreichen sie diese Ziele? Zum Beispiel unter Einsatz unfairer, unethischer oder nicht nachhaltiger Mittel?
Es wird auch selten bei der Beurteilung von Führungskräften gefragt: Arbeiten seine/ihre Mitarbeiter gerne für ihn? Vertrauen sie ihm? Würden sie ihm freiwillig auf ein weiteres Projekt folgen und weiterhin gerne mit ihm arbeiten? Oder wären sie froh, wenn er weg wäre?
Das Resultat dieser Werte-Verirrung ist eine sogenannte sinnwidrige Auswahl: Es werden über Jahre und Jahrzehnte Leistungsträger mit teilweise großen Werte-Defiziten in immer höhere Positionen befördert. Das Peter-Prinzip lässt grüßen. Manager machen Karriere bis zur höchsten Stufe der Unfähigkeit. Irgendwann kommt es dann zum Wirtschaftsskandal oder zum Shitstorm und eine verblüffte Öffentlichkeit fragt sich: Warum konnte es in diesem Unternehmen bloß soweit kommen? Weil Werte nichts wert waren.
Das Max-Frisch-Theorem
Vor einiger Zeit trat in einem Unternehmen, das wir berieten, ein neuer Geschäftsführer sein Amt an. Das Unternehmen war und ist groß, alt und sehr hierarchisch. Der neue Chef warf einen Blick auf den gelebten Werte-Kanon und meinte dann lakonisch: „Wir brauchen neue Werte.“
Er schlug seiner erweiterten Geschäftsleitung vor: „Wir wollen impulsgebend, verbindlich und lebendig sein.“ Das heißt: Den eigenen Kunden ständig neue Impulse geben, stets das Versprochene halten und nicht in Routine und Bürokratie erstarren. Gute Werte?
Ganz sicher. Der Haken daran: Bislang wurde eher das Gegenteil gelebt. Eben deshalb wollte der neue Boss die Werte-Reform. Oder wie Max Frisch sagen würde:
„Du musst bei deinen Werten ein Stück weit du selber sein, aber gleichzeitig auch ein anderer werden.“
Will heißen: Niemand wird aus dem Stand allen seinen postulierten Werten gerecht. Wer sich nach hehren Werten richtet, verändert sich dabei, weil er sich „nach der Decke strecken“ muss und wird. Ein Mensch, der zum Beispiel kraft seines Wertes ehrlich(er) mit Kunden und Mitarbeitern redet, wird dabei und dadurch auch selber ehrlich(er). Das ist die normative charakterbildende Kraft von Werten.
Werte-Konflikte
Alles Normative hat ein Problem, dem wir bereits bei der Strategie (Kapitel 1) begegnet sind: Es gibt keine Werte ohne Werte-Konflikte. Dabei fällt uns als Beispiel ein bestimmtes Unternehmen ein, das ausgesprochen werte-orientiert ist.
Das Werte-Credo in diesem Unternehmen lautete lange Jahre ungefähr: „Wir sind regional verwurzelt und stolz auf unsere Tradition und unsere Heimat!“ Ein starkes Werte-Bekenntnis. Auch weil Werte eine so enorme Kraft verleihen, war das Unternehmen in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen, zum Global Player geworden. Und plötzlich gab es einen knirschenden Werte-Konflikt zwischen dem alten und dem neuen Wert: Regionalität versus Globalität.
Sobald zum Beispiel eine der neuen Auslandstöchter ein repräsentatives neues Hauptgebäude bekam, sagten die Manager und Mitarbeiter zu Hause: „Und wir sitzen tagein, tagaus in diesem alten Kasten, dessen Aufzüge alle paar Wochen ausfallen und dessen Telefonanlage bei der automatischen Rufweiterleitung zusammenbricht, sobald der Geschäftsführer und der Vertriebsleiter beide im Home Office sind!“
Und umgekehrt. Sobald die Firma in die Heimat investierte, meldeten sich die Töchter mit: „Und wir?!“
In vielen Unternehmen schwelen oder toben solche Werte-Konflikte und vernichten Produktivität im Millionenbereich (über eine gesamte Volkswirtschaft gerechnet). Einmal davon abgesehen, dass Werte-Konflikte Atmosphärenkiller sind. Niemand arbeitet gern in Unternehmen, in denen solche Konflikte eskalieren. Nicht so im betrachteten Unternehmen.
Hier managt die Geschäftsleitung aktiv die eigenen Werte. Relativ früh nach erfolgreicher Globalisierung sagte sie: „Da wir jetzt nicht nur regional verwurzelt, sondern auch global aktiv sind, sollten wir unsere Werte weiter entwickeln.“
Das tat sie dann auch und nahm neue Werte in den Kanon auf wie Offenheit für Neues, kulturelle Vielfalt, Weltoffenheit, kosmopolitisches Denken und interkulturelle Kompetenz. Seit dieser Weiterentwicklung ist das Unternehmen heute global so erfolgreich wie es früher regional erfolgreich war. Das ist es, was Max Frisch meinte: „Du musst bei deinen Werten ein Stück weit du selber sein, aber gleichzeitig auch ein anderer werden.“
Leider kommen auf so ein Königsweg-Beispiel bestimmt fünf Holzweg-Beispiele.
Holzweg „Werte-Blindheit“
Werte sind im Grunde unproblematisch – wenn man sie zentral festlegt und individuell umsetzt. Wenn nicht, lebt jeder und jede im Betrieb die eigenen Werte, reflektiert diese nicht, sondern regt sich täglich über alle anderen auf, die seine oder ihre Werte nicht teilen. Wer diese Aufregung nicht mehr ertragen kann, der geht: Talenteabwanderung; das Unternehmen blutet in seinen Kompetenzen aus.
Der Exodus qualifizierter Arbeitskräfte wird von werte-tauben Erklär-Bären meist monetär erklärt: „Die Konkurrenz bezahlt mehr!“ Das stimmt so nicht. Viele Leistungsträger gehen zwar auch wegen des Geldes. Doch viele gehen, weil sie es „nicht mehr aushalten können!“ Was? Den eklatanten Werte-Konflikt.





























