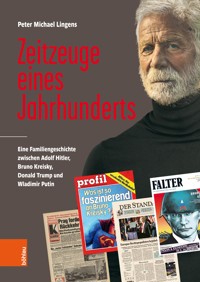Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Kampf gegen Drogen: Warum er scheitert. Wer ihn gewinnt. Wie es anders gehen könnte. In den Kriegen gegen die Drogen sterben mittlerweile mehr Menschen als durch ihren Konsum. Und die Zahl derer, die in Drogenabhängigkeit geraten, steigt weiter, statt zu fallen. Der mit Hilfe der USA geführte blutige Kampf in Afghanistan, in Kolumbien, in Mexiko scheitert: Die Gewinne aus dem Drogenhandel finanzieren Taliban, Rebellen und Drogenmafia. Mit den Erlösen werden neue Waffen angeschafft und der Kreislauf aus Unterdrückung und Gewalt dreht sich weiter. Richter, Staatsanwälte, Polizeioffiziere und Ärzte, die das Drogenproblem aus ihrer täglichen Arbeit kennen, fordern immer energischer ein radikales Umdenken. Peter Michael Lingens präsentiert in diesem Buch ein neues Modell der Drogenpolitik, abseits immer härterer Strafen und militärischer Einsätze, aber auch abseits der völligen Legalisierung. Die radikale Verstaatlichung des Drogenvertriebs und die kontrollierte Abgabe könnten den Teufelskreis aus Korruption, Gewalt und tödlichen Geschäften durchbrechen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.kremayr-scheriau.at
ISBN 978-3-218-00830-3
Copyright © 2011 by Verlag Kremayr & Scheriau KG, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Schutzumschlaggestaltung: Mag. Christa Vadoudi
unter Verwendung eines Fotos von Reuters/Daniel Aguilar
Typografische Gestaltung: Gerald Waibel, Wien
Druck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH, St. Stefan i. Lavanttal
Inhalt
1. Kriegsschauplatz Mexiko
Kritische Berichterstattung nahezu unmöglich
Korrupte Polizei
Ciudad Juárez – die lebensgefährliche Drogenmetropole
2. Ein amerikanischer Krieg
Der Opiumkrieg
Opium als Medizin
Das Verbot des Drogenkonsums
3. „Prohibition“ als Leitfaden
Alkohol: Nur ein Genussmittel?
Die Temperance-Bewegung, Vorläuferin der Prohibition
Das Reich des Bösen
Die Durchsetzung der Prohibition
Destillerien in der Badewanne
Alkohol-Schmuggel: Das große Geschäft
Schlussfolgerungen
4. Hat die Prohibition versagt?
Speakeasies – die Lasterhöhlen
Die Gegner der Prohibition
Das Ende der Prohibition
Was hat die Prohibition gebracht?
5. Vom Hanf zu Marihuana
Hanf: Über Jahrhunderte eine wichtige Nutzpflanze
Die Verteufelung des Hanf
Anslingers Feldzug
Die Gefängnisindustrie
6. Vom Marihuana zum Kokain
Schauplatz Kolumbien
Die Pablo-Escobar-Story
Das Cali-Kartell
Die Kooperation der Kartelle
7. Der „Plan Colombia“
Die Ziele des „Plan Colombia“
George W. Bushs Dreifach-Krieg
8. „Friedliche Koexistenz“
Der „Lord of the Druglords“
Der Kampf um Marktanteile
Die Schlacht der Drogenkartelle
Das Leid der mexikanischen Bevölkerung
Der verfehlte „Krieg gegen Drogen“
9. Der Erfolgsbericht der UNO
Drogenproduktion: Zahlenspiele auf unsicherem Terrain
Die vagen Schätzungen zur Anzahl Drogenkonsumenten
Amphetamine und Ecstasy: Die großen Unbekannten
10. Der „Geheimbericht“
Die Gefährlichkeit verschiedener Drogen
Was die Drogensucht kostet
Drogenanbau: Kaum Alternativen in armen Ländern
Der Weg der Drogen zu den Kunden
„War on drugs“: Keine Erfolgsstory
Drogen: Ein Geschäft mit gigantischen Gewinnspannen
11. Sucht als „Nachfrage“
Die vielen Formen der Sucht
Suchttote – (k)ein aufschlussreicher Vergleich
Für und wider die Prohibition
12. Ein Ausweg?
Die Legalisierung von Cannabis
Harte Drogen unter staatlichem Monopol
1. Kriegsschauplatz Mexiko
Als ich dieses Buch zu schreiben beginne – im September 2010 – hat der Drogenkrieg soeben in Mexiko 72 neue Opfer gefordert: Männer und Frauen aus Guatemala, Peru und Honduras, die hofften, über die mexikanische Grenze in die USA zu gelangen. Mitglieder der Drogenmafia boten an, ihnen dabei zu helfen, wenn sie sich bereit erklärten, bei dieser Gelegenheit Rauschgift zu schmuggeln. Als sie ablehnten, wurden sie erschossen.
Knapp davor, im Juli, hatte die Polizei 51 Leichen auf einer Müllhalde nahe der Stadt Monterrey gefunden, und im März war sie in einer verlassenen Mine südlich von Mexiko Stadt auf 55 Leichen gestoßen. Die Drogenmafia bevorzugt verlassene Minen, wenn sie die Spuren größerer Gemetzel beseitigen will.
Für denselben Monat listet eine Meldung von „Bild“ die Leichen auf, die an einem einzigen Wochenende zusätzlich zu den in der Mine gefundenen angefallen sind: 28 Menschen, darunter sechs Polizisten, wurden im Bundesstaat Guerrero erschossen, zehn sind bei einer Schießerei rivalisierender Drogenbanden in Acapulco umgekommen, und als die Polizei am Tatort eintraf, entdeckte sie auch gleich fünf ältere Leichen in einem nahen Gebäude. Im Bundesstaat Sinaloa blieben acht Leichen zurück, als Bewaffnete eine Geburtstagsfeier überfielen. In Ciudad Juárez ermordeten Drogengangster 19 Menschen, darunter eine Mitarbeiterin des US-Konsulats. Und im südlichen Bundesstaat Chiapas schleuderten Unbekannte aus einem fahrenden Auto Handgranaten gegen ein Gebäude der Staatsanwaltschaft, nur dass diesmal einer der Angreifer umkam, weil eine Granate im Auto explodierte.
Kritische Berichterstattung nahezu unmöglich
Zwischendurch wurde die Leiche eines entführten Journalisten entdeckt. 30 Journalisten sind in Mexiko seit Beginn des „Krieges gegen die Drogen“ im Jahr 2006 verschwunden, weil sie sich zu intensiv mit dem organisierten Verbrechen beschäftigt haben – elf sind bisher als Leichen wieder aufgetaucht.
„El Diario“, die größte Zeitung der Drogenmetropole Ciudad Juárez, gestand im September 2010 öffentlich das Ende kritischer Berichterstattung ein: „Wir wollen keine Toten mehr und auch keine Verletzten. Unter den gegebenen Umständen ist es uns unmöglich, unsere Aufgabe weiter auszuüben. Die Kartelle des organisierten Verbrechens sind derzeit die wahre Autorität in der Stadt“, schrieb der Herausgeber in einem Editorial.
Vorangegangen war die Ermordung des Fotoreporters Luis Carlos Santiago Orozco. Als er zusammen mit einem anderen „Diario“-Mitarbeiter auf die Straße trat, traf ihn ein Schuss in die Stirn und sein Kollege wurde schwer verletzt. Ein erster „Diario“-Mitarbeiter war schon 2008 umgebracht worden. Ein Journalist, der am Begräbnis seines Kollegen teilnehmen wollte, erhielt über Handy die Warnung, dass er der nächste auf der Abschussliste sei, und zog es vor, in den USA um politisches Asyl anzusuchen. Das taten zum Zeitpunkt des „Diario“-Editorials gleich vier Journalisten aus Ciudad Juárez, unter ihnen die Kameramänner einer Fernsehstation, die berichteten, sie seien vom Sinaloa-Kartell gekidnappt worden, als sie den Tatort eines Massakers filmen wollten. Man habe ihnen mit dem Tod gedroht, wenn sie nicht durchsetzten, dass ihre Station einen Beitrag sendet, in dem Polizisten unter Folter über ihre Zusammenarbeit mit einem konkurrierenden Kartell berichten.
Die Medien geben fast durchwegs nach: Die Herausgeber zensurieren, was dem jeweiligen lokalen Drogenkartell missfallen könnte, oder die Journalisten bringen es aus Vorsicht gar nicht mehr zu Papier.
Wie im Iran findet kritische Berichterstattung zur Drogenmafia daher zunehmend im world wide web statt. Am bekanntesten wurde der Blog „Del Narco“, wo die Teilnehmer ihre Informationen anonym deponieren können: Kaum erträgliche Bilder Ermordeter wechseln mit opulenten Bildern jener prächtigen, goldverzierten Waffen ab, mit denen die Drogengangster ihre Morde verüben. Die Schlagzeilen einer Woche illustrieren einmal mehr die Zustände. „Vier Männer geköpft“, „19 Leichen gefunden“, „33 Männer erschossen“, „Massaker in La Quinta“, „Weibliches Mordkommando entdeckt“.
Eingerichtet wurde der Blog von einem Studenten der Stadt Monterrey, von der er sagt, sie sei bis 2006 eine blühende, sichere Gemeinde gewesen. Jetzt befindet sie sich in Geiselhaft der Drogenmafia: Morde sind an der Tagesordnung, die Zeitungen sind eingeschüchtert, das Fernsehstudio wurde mit Granaten beschossen und die Polizei fürchtet sich mindesten so sehr wie die Journalisten. Sie vermag Medienmitarbeiter nicht zu schützen und die haben aufgehört, diesen Schutz zu suchen: Nirgendwo sonst sind so viele Polizisten bestochen und geben ihre Informationen sofort an die Drogengangster weiter.
Korrupte Polizei
Hunderte Polizeibeamte wurden bereits wegen Verdachtes der Korruption außer Dienst gestellt, und es werden täglich mehr. Ihren nächsten Job treten die entlassenen Polizisten dann direkt als Bodyguards bei Drogenbaronen an. Oft geht der Verdacht gegen sie von vorneherein weit über Korruption hinaus: Polizei-Einsatztrupps mussten ihre Waffen abgeben, damit anhand ballistischer Untersuchungen festgestellt werden konnte, wie weit sie an Verbrechen beteiligt waren. „Die Behörde, die Kidnapping verhindern soll“, schrieb General Sergio Aponte Polito, der höchste Armeeoffizier in Bundesstaat Baja California, der diese „Reinigungs-Aktionen“ durchführte, in einem offenen Brief an die Medien, „ist in Wirklichkeit ein Kidnapping-Team.“ Die speziell zur Bekämpfung der Drogenkriminalität eingerichtete „Agencia Federal de Investigación“ AFI wurde zugesperrt, nachdem Berichte nicht mehr zu unterdrücken waren, sie habe in Wahrheit die Interessen des Sinaloa-Kartells gefördert. Unter den Behördenleitern, die im Verlauf einer „Reinigungsaktion“ im Jahr 2008 verhaftet wurden, befanden sich: der Chef der Bundespolizei, zwei Ex-Chefs der Abteilung für organisiertes Verbrechen und der Ex-Chef von Mexikos Interpol.
Mexikos Polizei ist in ihrer Gesamtheit korrumpiert – sie ist als Ordnungsmacht im Kampf gegen Drogen sinnlos geworden.
Beamte, die korrekt nach Drogengangstern fahnden, stehen nicht symbolisch, sondern tatsächlich auf der Abschussliste: Die so genannten Hitlisten werden von den Drogenkartellen meist sogar öffentlich verlautbart, um die entsprechende abschreckende Wirkung zu entfalten – dann werden die Beamten der Reihe nach exekutiert. Im Oktober 2010 wurden gleich acht Mitglieder einer Spezialeinheit auf einer Schnellstraße im Bundesstaat Sinaloa von einem Killerkommando hingerichtet.
Immer mehr mexikanische Drogenfahnder suchen deshalb in den USA um politisches Asyl an und stürzen die zuständigen Behörden in juristische und politische Probleme: Als Grund ihres Ersuchens geben sie an, dass ihr Staat nicht in der Lage sei, sie vor der Rache der Kriminellen zu schützen. Die Gewährung physischer Sicherheit, eine der wesentlichsten Aufgaben jedes Staatswesens, ist in Mexiko nicht mehr gegeben.
Ciudad Juárez – die lebensgefährliche Drogenmetropole
Monterrey oder Ciudad Juárez sind keine Nester in den Pampas, sondern zählen mit 1,3 und 1,5 Millionen Einwohnern zu Mexikos größten Städten. Ciudad Juárez, benannt nach jenem ehemaligen Präsidenten, der Mexikos Unabhängigkeit erkämpfte, galt lange Zeit als Muster für geglückte bilaterale Wirtschaftsentwicklung: Durch die Grenzziehung von 1848 aus der Teilung der Gemeinde El Paso in eine mexikanische und eine texanische Hälfte hervorgegangen, ist sie vom texanischen El Paso nur durch einen Fluss getrennt, und seit dem Freihandelsabkommen NAFTA bedingt diese Nahbeziehung das massive Engagement großer US-amerikanischer Unternehmen, die in grenznahen Fabriken mit billigen mexikanischen Arbeitskräften preisgünstig produzieren – daher der wirtschaftliche Aufschwung.
Nur bedingt die gleiche Nahebeziehung seit Jahrzehnten auch das massive Engagement mexikanischer Drogenkartelle, die via Ciudad Juárez den amerikanischen Markt mit Drogen aus Kolumbien, Guatemala, Venezuela, Peru und aus eigener Produktion versorgen – daher der aktuelle Absturz ins Chaos des Drogenkrieges.
Kokain, Marihuana, Amphetamine und Heroin im geschätzten Wert von 15 Milliarden US-Dollar passieren unter der Kontrolle des Juaréz-Kartells jedes Jahr den Río Bravo. Daher versucht das derzeit wahrscheinlich mächtigste Drogenkartell des Landes, das Sinaloa-Kartell, dem Juárez-Kartell diese Schmuggelroute mit allen Mitteln zu entreißen.
Das hat die Stadt zu einem Schlachtfeld gemacht, auf dem nicht einmal Kinder verschont bleiben: Im Oktober 2010 stürmte ein Killerkommando ein Geburtstagsfest in einem Hochhaus und mähte 14 Gäste nieder, weil es unter ihnen ein Mitglied des gegnerischen Kartells vermutete.
Wenn nicht mehr als zehn Tote auf einmal anfallen, gelangen Meldungen dieser Art nicht einmal mehr in Europas Medien – zehn Tote pro Tag sind in Ciudad Juárez die Regel.
Als Präsident Felipe Calderón sich 2006 auf Drängen der USA entschloss, im „Krieg gegen Drogen“ zusätzlich zur korrumpierten Polizei Soldaten einzusetzen, war die Stadt am Río Bravo zwangläufig eines seiner vorrangigen Einsatzziele – aber statt zurückzuweichen haben die Privatarmeen der Drogenkartelle ihren Kampf um die Vorherrschaft in diesem Brückenkopf des Drogenhandels weiter verschärft. Seither ist Ciudad Juárez die gefährlichste Stadt der Welt: 2008 gab es 1600 Morde, 2009 waren es schon 2657 und 2010 waren es 3111.
Rund 10.000 Mexikaner sind im Jahr 2009 im „Krieg gegen Drogen“ umgekommen, weit über 30.000, seit er 2006 von Felipe Calderón öffentlich erklärt worden ist.
Das sind mehr Menschen, als auf der ganzen Welt jemals am Konsum von Kokain gestorben sind und in weiteren 100 Jahren sterben werden. Dabei ist Mexiko nur eines der Länder, in denen mehr Menschen im Kampf gegen die Drogen sterben, als durch den Konsum von Drogen zugrunde gehen.
2. Ein amerikanischer Krieg
Der „war on drugs“ (Krieg gegen Drogen) wurde nicht nur von einem amerikanischen Präsidenten – Richard Nixon – im Jahr 1972 ausgerufen, sondern ist ein durch und durch amerikanischer Krieg. Die Amerikaner führen ihn, wie viele ihrer Kriege, aus durchaus hehren Motiven: Das stärkste dieser Motive ist zweifellos ein puritanisch religiöses: Drogen werden als Versuchung des Teufels angesehen, den Menschen von einem fleißigen, gottgefälligen Leben abzubringen.
Die USA sind bis heute ein religiöses Land: Schwüre werden grundsätzlich auf die Bibel abgelegt; es gibt keine wichtige Rede des Präsidenten, die nicht mit der Floskel „God bless America“ (Gott segne Amerika) endet; in den Staaten des „Bible-Belt“ (des Bibel-Gürtels) ist es bis heute undenkbar, dass eine Frau in der Öffentlichkeit raucht oder ein alkoholisches Getränk bestellt. Das Schul-Gebet ist eine Selbstverständlichkeit und George W. Bush wollte seine Mitarbeiter bekanntlich zu Beginn jeder Sitzung zum Gebet verpflichten. Indem Drogen abgewehrt werden, wird das Böse (der Teufel) abgewehrt und erringt das Gute einen Sieg.
Gleichzeitig sind diese religiösen bis bigotten Amerikaner Teil einer unverändert fortschrittlichen Nation: Sie will Vernunft und Rationalität im Umgang der Menschen miteinander siegen sehen, und Rauschzustände werden als Beeinträchtigung rationalen und sozialen Verhaltens erachtet. Psychische und physische Gesundheit werden angestrebt und als Kennzeichen des Amerikaners angesehen: Er ist fleißig, diszipliniert, sozial, kraftvoll und sportlich – keiner, der sich einraucht und benommen irgendwo im Schmutz verkommt.
Die Vorstellung, dass auch ein „Amerikaner“ psychisch krank und deshalb anfällig für eine Sucht sein könnte, ist mit diesem Selbstbild unvereinbar: Es ist das von außen kommende Gift, das den gesunden Amerikaner zerstört. Daher muss man in erster Linie dieses Gift abwehren, wenn man das starke Amerika bewahren will.
An dieser Stelle wird ein drittes Motiv wirksam: Obwohl die USA ein Schmelztiegel der verschiedensten Völker sind – oder in Wirklichkeit gerade deswegen –, wird dieses unkritische Selbstbild zur Förderung des inneren Zusammenhalts einer schlechten, ungesunden, unamerikanischen Außenwelt gegenübergestellt: Vom „Ausland“ wird nicht nur im Schmelztiegel Österreich, sondern auch in den USA nichts Gutes erwartet.
Wie in Österreich die Probleme mit zugewanderten Bosniern, Serben oder Türken spielen dabei Probleme eine wesentliche Rolle, die das „weiße“, „angelsächsische“ Amerika mit einwandernden Lateinamerikanern und Asiaten, voran Chinesen, hatte und hat: Vor allem die Chinesen waren nicht gewillt, sofort voll und ganz „Amerikaner“ zu werden, sondern bildeten eigene, fremdländische Inseln inmitten der amerikanischen Städte. Also neigte das „weiße“ Amerika dazu, in den Chinesen eine Bedrohung zu sehen: Man identifizierte sie nur zu gern mit einigen ihrer brutalen Verbrecherorganisationen, die, ähnlich der italienische Mafia, in den USA Wurzeln schlugen. Der schlitzäugige, gelbe, fremdartige, gefährliche Chinese war ein im 19. und 20. Jahrhundert in den USA recht verbreitetes Feindbild, dem das Selbstbild des „weißen“, „christlichen“, „tugendhaften“ Amerikaners gegenübergestellt wurde.
Der Opiumkrieg
Ein Brauch, der Chinesen gut sichtbar von den „echten“ Amerikanern unterschied, war das Rauchen von Opiumpfeifen. Obwohl es nicht stimmte, wurde das Vordringen von Opium in den USA den Chinesen und damit einem von außen kommenden Feind zugeschrieben. Gleichzeitig wurde die Niederlage des chinesischen Reiches im „Opiumkrieg“ als Beleg für die These erachtet, dass Opium geeignet ist, den Niedergang einer ganzen, großen Nation zu bewirken.
Bekanntlich war China zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein feudal organisiertes Kaiserreich in selbstgewählter Isolation, das im „Opiumkrieg“ einem entwickelten, kapitalistischen Großbritannien gegenüberstand. Die Briten, die durch den Handel, voran mit ihrer indischen Kolonie, zu ihrem Reichtum und damit letztlich auch zu ihrer militärischen Überlegenheit gelangt waren, wollten auch mit den Chinesen Handel treiben und insbesondere Rohseide und Tee von ihnen erwerben. China aber unterwarf diesen Handel allen nur möglichen Beschränkungen. Insbesondere hob es hohe Zölle für britische Waren ein, sodass die Briten teuer mit Silbermünzen für Waren bezahlen mussten, die innerhalb Chinas weit billiger gehandelt wurden.
Zwangsläufig wurde bald kreuz und quer geschmuggelt. Um die chinesischen Behörden zu diesem Zweck erfolgreich zu bestechen, verwendeten die Briten Opium, das sie aus dem heute pakistanischen Teil Indiens reichlich zur Verfügung hatten. 1838 waren es immerhin 40.000 Kisten à 60 Kilo Opium, die britische Kaufleute nach China einschleusten und einerseits zur Bestechung verwendeten, andererseits teuer – nun ihrerseits für Silber – an Süchtige verkauften.
Der chinesische Kaiser Daoguang sah seine Herrschaft durch diese Mischung aus überschießender Korruption und überschießender Drogensucht gefährdet und versuchte es mit Prohibition: Er ernannte einen Sonderbeauftragten namens Lin Zexu, der den Opiumhandel der Briten (das britische Drogenkartell) energisch bekämpfen sollte. Tatsächlich ließ Lin Zexu die chinesischen Beteiligten am Opiumhandel festnehmen, die bestechlichen Beamten bestrafen und zwang die britischen Beteiligten, ihm ihr lagerndes Opium herauszugeben und zu unterschreiben, dass sie nie wieder welches nach China bringen würden.
Der wutentbrannte britische Handelsdelegierte Charles Elliot war gezwungen, von seinen Landsleuten die Herausgabe von 1,15 Millionen Kilo Opium zu verlangen, die Lin Zexu in der Folge nach Art der heutigen US-Regierung öffentlich verbrennen ließ.
Diese Schmach – und vor allem den Verlust ihrer Handelsbeziehungen zu China – wollten die Briten nicht auf sich sitzen lassen und schickten eine Flotte von 40 Kriegsschiffen. Damit begann der Opiumkrieg, in dem die Engländer anfangs erstaunliche Rückschläge erlitten, sich aber nach Entsendung weiterer 26 Kriegsschiffe schließlich durchsetzten: Als ihre Truppen bereits vor Shanghai standen, willigte der Kaiser 1842 in Friedensverhandlungen ein, die unter anderem dazu führten, dass er Hongkong an die Briten abtreten musste.
Darüber hinaus musste er ihnen 21 Millionen Silberdollar Entschädigung – unter anderem für das verbrannte Opium – bezahlen, und künftige Zölle durften nicht mehr als fünf Prozent betragen. Diese Zoll-Obergrenze wurde in der Folge auch für den Warenverkehr mit Frankreich und den USA vereinbart, die außerdem das Recht erhielten, mit ihren Kriegsschiffen den freien Handel mit Chinas Küstenstädten sicherzustellen.
Aus westlicher Sicht kann man als positiv anmerken, dass alle diese Maßnahmen Chinas Feudalsystem zersetzten – aus chinesischer Sicht müsste man wohl sagen, dass Großbritannien aus ausschließlich wirtschaftlichen Motiven die Degeneration einer bestehenden chinesischen Opiumkultur zur Opiumsucht provozierte, dass es China, als es das verhindern wollte, brutal überfiel und dass die USA zu Nutznießern dieser Politik wurden.
Die Amerikaner entnehmen dieser Geschichte indessen nur, dass China seinen Niedergang dem Opium verdankt und dass sie die USA vor einem ähnlichen Schicksal schützen müssen, indem sie verhindern, dass Opium aus Asien in die USA eingeschleppt wird.
Opium als Medizin
In Wirklichkeit wurde Opium nicht erst von „bösen Gelben“ in die USA eingeschleppt, sondern war dort in der christlichen und weißen Gesellschaft erstaunlich weit verbreitet – allerdings nicht als Genuss-, sondern als Heilmittel. In einer Zeit, in der die Ärzte nur wenig über Krankheiten und noch weniger über Sucht wussten, war Opium in zahlreichen Tinkturen enthalten, weil sich die Patienten nach deren Einnahme schon deshalb besser fühlten, weil sie die Schmerzen weniger wahrnahmen. Kuren mit opiumhaltigen „Medikamenten“ waren deshalb häufig, und vor allem Morphium galt als das Schmerzmittel par excellence und wurde entsprechend häufig verschrieben.
Da Ärzte darüber hinaus in dem riesigen Land oft nicht zu erreichen waren, griffen viele Menschen zur Selbstbehandlung, und wieder waren Tinkturen, die Opium enthielten, das offensichtlich wirksamste Mittel, um über Schmerzen hinwegzukommen, so dass Apotheken oder auch andere Läden es in selbst verfertigten Mischungen und Patentrezepturen landesweit anboten.
Irgendwelche Handels- oder Import-Beschränkungen gab es so wenig wie eine Rezeptpflicht, und Menschen, die von Opium oder Morphium abhängig waren, waren deshalb keineswegs so selten, nur dass diese Abhängigkeit vielfach nicht als „Sucht“ wahrgenommen wurde.
Aus der Medizin waren Opiate jedenfalls nicht wegzudenken.
Aber es gab in den USA des 19. Jahrhunderts nicht nur Opium, es gab in noch größerem Ausmaß Kokain. Der Extrakt der Kokapflanze spielte in der Medizin eine wichtige Rolle, war aber darüber hinaus lange vor der Existenz des Sinaloa- oder des Juárez-Kartells ein weit verbreitetes Genussmittel: Kokablätter waren die Basis zahlreicher Getränke und bekanntlich einmal der wichtigste Bestandteil von Coca Cola.
Ebenfalls als Genussmittel, vor allem aber als Heilmittel, erfreute sich auch Cannabis bzw. der Hanf, aus dem es gewonnen wird, großer Beliebtheit.
Marihuana (Blüten und Blätter des Hanf ) rauchten allerdings vor allem die dunkelhäutigen Zuwanderer aus Mexiko und anderen mittelamerikanischen Staaten. Das sollte unter veränderten wirtschaftlichen Bedingungen – als die Zuwanderung als wirtschaftliches Problem empfunden wurde – dazu führen, dass auch Kokain und Marihuana als „unamerikanisch“, von außen eindringend und damit bedrohlich, eingestuft wurden.
Das Verbot des Drogenkonsums
Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts begannen Ärzte darüber hinaus das Phänomen der Drogenabhängigkeit zu sehen und die damit verbundene soziale Problematik zu erkennen: Die USA waren das erste Land, in dem ein „Drogenproblem“ beobachtet wurde. Damit setzte auch die soziale Zuordnung der Drogen ein: Kokain und Marihuana gehörten zur schwarzen, lateinamerikanischen Unterschicht – Opium gehörte zu gelben, chinesischen Gangs. Beide wurden als Eindringlinge empfunden, und der Rauschzustand, in den Marihuana oder Koka die Mexikaner beziehungsweise Opium die Chinesen versetzte, war in den Augen des weißen Amerika einerseits schuld daran, dass diese sich „unamerikanisch“ verhielten, und konnte andererseits die amerikanische Bevölkerung mit „Laster“ infizieren. Aus beiden Gründen waren Drogen in den Augen der „echten“ Amerikaner unglaublich gefährlich. Hinzu kam, dass die USA im spanisch-amerikanischen Unabhängigkeitskrieg die Philippinen als Kolonie gewannen und dort auf eine intensive Drogenkultur stießen: Sowohl der Konsum von Cannabis wie von Opium, das vor allem geraucht wurde, war in diesem Inselstaat ein ernstes Problem, mit dem sich die Amerikaner nun auseinandersetzen mussten. Sie sahen darin einen Grund für den unterentwickelten Zustand dieser Region und das war einmal mehr eine Bestätigung für ihre Überzeugung, dass man den Opiumkonsum der Bevölkerung abwehren muss, wenn man eine Nation stark und gesund erhalten will. Gleichzeitig rückten die USA durch die Philippinen näher an China heran und entdeckten es als riesigen Markt, auf dem man größere Chancen hatte, wenn man die Beziehungen zu China verbesserte – und das tat man zweifellos, indem man nicht mehr, wie die Briten, für den freien Opiumhandel eintrat, sondern sich der Haltung Chinas zum Opium annäherte. Alle diese Entwicklungen zusammen veranlassten den Kongress 1908, den nichtmedizinischen Opiumkonsum und den Konsum von Marihuana und Kokain zu verbieten und dieses Verbot 1914 mit dem Harrison Act zum Gesetz zu machen.
Die zugehörigen Motivationen sind bis heute die gleichen:
• Der Konsum von Opium, Kokain und Marihuana ist religiös verwerflich und unmoralisch.
• Er zerstört die psychische und physische Gesundheit und bedingt dadurch soziale Probleme.
• Aber er kommt nicht in erster Linie dadurch zustande, dass Amerikaner, wie andere Völker auch, zu einem bestimmten Prozentsatz zur Sucht neigen (dass also „Nachfrage“ besteht), sondern dadurch, dass Opium, Kokain oder Marihuana von Lateinamerikanern und Asiaten eingeschleppt werden, so dass es ein Drogen-„Angebot“ gibt.
Die Drogenpolitik der USA war und ist daher grundsätzlich „angebotsorientiert“: Sie ist beherrscht von der Überzeugung, dass sich das Drogenproblem lösen lässt, indem man das Drogenangebot mit allen Mitteln verhindert oder zumindest stark reduziert.