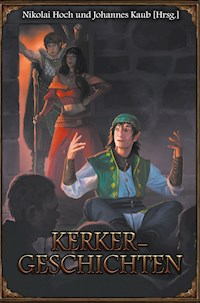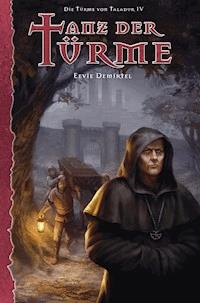Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Kasim ben Gaftar, Stadtgardist in Khunchom, will einfach nur seine Arbeit machen und Schmiergelder kassieren. Eine Leiche in der Taverne seines Onkels, einen unbestechlichen Partner und äußerst widrige Umstände hatte er nicht erwartet. Deniz ibn Seyshaban, Kasims Kollege, will eigentlich nur seine Ruhe. Seine Ermittlungsmethoden sind unkonventionell und ebenso unerwünscht, sogar bei seinen eigenen Arbeitgebern. Als er erkennt, dass mehr hinter dem Mord steckt, versucht er die Wahrheit aufzudecken. Um jeden Preis. Federigo Madanaldo Sforigan, Herumtreiber aus Almada, will in Khunchom endlich zur Ruhe kommen und bei Gelegenheit schnelle Münze machen. Niemals hätte er sich träumen lassen zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall zu werden. Gejagt vom Mörder und der Garde versucht er seine Unschuld zu beweisen und stößt auf Wissen, für das weitaus mehr Menschen zu töten bereit sind als angenommen. Alle haben sie eines gemeinsam: Sie haben die Skrupellosigkeit ihrer Gegner bei weitem unterschätzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biografie
Eevie Demirtel (geb. 1982 in Frankfurt am Main) hat das letzte Vierteljahrhundert in und um die Mainmetropole verbracht. Nach einem kurzen Ausflug in die große weite Welt der Hochschulbürokratie hängte sie ihr Studium (Archäologie, Anglistik und Germanistik) kurzerhand an den Nagel, um sich ihrer Leidenschaft für bedrucktes Papier zu widmen und absolvierte eine Ausbildung zur Sortimentsbuchhändlerin. Seither liest und verkauft sie alles, was nicht niet- und nagelfest ist, schreibt nebenher Zeitschriftenartikel oder schlägt sich die Nächte mit der Organisation von Rockkonzerten um die Ohren.
Der aventurische Erstkontakt erfolgte im zarten Alter von 12 Jahren durch das Abenteuer »Unter dem Nordlicht«, und ihre Irritation war groß, als sie statt Regelwerken ein Computerspiel zu Weihnachten bekam. Das konnte sie jedoch nicht davon abhalten, diesen Missstand kurze Zeit später zu beheben und ihre erste eigene DSA-Runde zu eröffnen. Einmal Spielleiterin, wurde sie von ihren Allmachtsphantasien dazu getrieben, sich immer wieder neue Geschichten für ihre Spieler auszudenken, und hat bis heute nicht damit aufgehört.
Nebenher hat sie immer fleißig selbst geschrieben, ohne jemals an eine Veröffentlichung zu denken. Erst als sie eines Tages genug davon hatte, die Bücher und Abenteuer anderer Korrektur zu lesen, ließ sie sich von Marco anstiften, Khunchomer Pfeffer zu schreiben.
Marco Findeisen (geb. 1984 in Bad Soden am Taunus) wuchs in Usingen im Hochtaunus auf und studiert heute Literaturwissenschaft, Mittlere und Neuere Geschichte an der Justus-Liebig-Universität in Gießen.
Sein Einstieg in die Welt des Schwarzen Auges erfolgte 1997 durch das Computerspiel Schatten über Riva. Er schrieb bereits für den Aventurischen Boten und nahm zweimal am Autorenwettbewerb Der Goldene Becher teil, bei dem er einmal den vierten und einmal den sechsten Platz belegte. Erste Pläne für ein Abenteuer oder eine Geschichte aus der Welt des Schwarzen Auges entstanden schon sehr früh, konnten aber erst mit diesem Roman realisiert werden.
Khunchomer Pfeffer ist der erste Roman von Marco Findeisen.
Die Autoren freuen sich über Kritik und Anregungen unter der e-Mail-Adresse [email protected].
Titel
Eevie Demirtel und Marco Findeisen
Khunchomer Pfeffer
Schattenflüstern
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 11030PDFTitelbild: Alan LathwellAventurienkarte: Ralph HlawatschLektorat: Catherine BeckBuchgestaltung: Ralf BerszuckE-Book-Gestaltung: Michael MingersCopyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DERE sind eingetragene Marken. Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Buch-ISBN 978-3-89064-237-6E-Book-ISBN 978-3-86889-809-5
Danksagung
Wir danken Werner Fuchs und Catherine Beck für die Unterstützung, den Glauben an uns und ihre große Geduld, Fantasy Productions und Ulisses sowie allen Autorinnen und Autoren der Spielhilfen Die Wüste Khom und die Echsensümpfe und Land der Ersten Sonne, ohne deren Mühen Khunchom nicht halb so farbenprächtig ausgestaltet wäre.
Thomas Finn fürs Mut machen, als wir selbst nicht glaubten, dass aus unserem Plot mal ein Buch werden würde, Stefan Küppers für Nerven wie Drahtseile in letzter Minute, Denny Vrandecic für die unkomplizierte Zusammenarbeit und seine wahrhaft ehrwürdige Drachenei-Akademie, Michael Masberg für die kritische Auseinandersetzung mit unserer verquer-maraskanischen Weltsicht und den letzten Schliff für Achmedziber, Daniel Heßler für das kurzfristige Bornland-Briefing und außerdem Christian Saßenscheidt mit seinen meisterlichen Talentwerten in Tulamidya und Bosparano.
Und natürlich an: Aaron, Alex, Christian, Cläre, Corn, Fabian, Florian, Frédéric, Gabriela, Jan, Joachim, Julian, Karin & Antti, Lena, Mareike, Marko, Melanie, Nici, Nicki, Nina, Philipp, Richard, Sabine, Sven, Thorben, Thorsten, Tobias, die Bergener Chaos-WG und Darth Nora. Danke für die Inspiration, die vielen durchspielten Tage und Nächte und für unzählige Handlungsstränge, Nebenfiguren und konstruktive Kritik.
Nicht zu vergessen: Unsere Großeltern, die wahrscheinlich keine Vorstellung hatten, was es auslösen würde, als sie uns vor Jahr und Tag ein Computerspiel mit dem verheißungsvollen Titel »Das Schwarze Auge« unter den Weihnachtsbaum legten. Und natürlich an unsere Eltern, die durch unsere Jugendzeit unsere ausgefallene Freizeitbeschäftigung, trotz allem Unverständnis, finanziell und moralisch unterstützt haben.
Und Markus – nicht, dass du denkst, wir haben dich vergessen: Für jedes einzelne gelesene Wort, für Kommentare wie „Irgendwas stimmt mit dem Satz nicht” und für den monatelangen, selbst auferlegten Schlafentzug – Danke!
»Was sagst du da? Zu teuer?
Das hier, Sayid, ist echter Khunchomer Pfeffer! Er ist so blumig wie der Geschmack eines schweren Weins auf deiner Zunge und doch zugleich feurig wie die heißen Winde der Wüste Khôm. Er kitzelt Nase und Gaumen, als stündest du leibhaftig auf einem tulamidischen Basar. Versuche ihn nur, und du wirst sehen, dass er dich vor Verzückung schwindeln lässt und deinen Atem raubt, wie der leidenschaftliche Tanz einer Sharisad.
Er ist jeden Heller wert, den ich in meiner Bescheidenheit von dir verlange, Sayid.
Aber wenn du es vorziehst, o Pfefferkörner zählender Sohn des Zweifels, mir nicht zu glauben, so unternimm doch selbst eine Reise ins Land der Ersten Sonne und überzeuge dich von der unumstößlichen Wahrheit meiner Worte! Die altehrwürdige Perle am Mhanadi heißt jeden willkommen, der in die Geschichten aus 1001 Rausch eintauchen will.«
— gehört auf einem Markt in Punin, neuzeitlich.
Prolog
Gareth, im Jahr 1027 BF
Der eigentliche Schrecken aber lag darin, dass sich das wahre Ausmaß der Verwüstung dem Betrachter erst langsam eröffnete. Von den Feuerbränden der Altstadt wehten dichte Rauchschwaden herüber und hüllten die zerstörten Teile der Stadt in einen gnädigen Mantel aus verglommener Asche.
Lina zog den zerschlissenen Umhang enger um den Körper und hastete weiter. Immer wieder kamen ihr Gestalten aus dem unwirklichen Dunst entgegengetaumelt, einige bis zu Unkenntlichkeit verbrannt, andere die von Asche bedeckten Gesichter zu von Schmerz und Furcht gezeichneten Masken verzerrt. Linas Augen waren offen gewesen, zumindest so weit, wie es der beißende Qualm erlaubte, aber sie hatte nicht hinsehen wollen. Nicht, dass sie skrupellos genug gewesen war, sich angesichts des Leids vollends zu verschließen, aber sie wusste, dass es nur diese eine Gelegenheit geben würde.
›Aus heiterem Himmel‹bekommt so eine ganz andere Bedeutung, dachte sie und schob sich langsam an der eingestürzten Wand eines Fachwerkhauses vorbei. Was genau geschehen war, konnte Lina nicht sagen. Sicher war nur, dass etwas Großes auf die Stadt hinabgestürzt war, mitten ins Herz des Reiches. Ebenso plötzlich, wie es über der Stadt aufgetaucht war, war es vom Himmel gefallen und hatte alles darunter Liegende begraben. Das noble Neu-Gareth, wo die piekfeinen Herrschaften und die dicken Pfeffersäcke ihre Stadtvillen bewohnten, sowie den Palast des Kaisers und die glänzende Stadt des Lichts, den größten Tempel des Praios mit seiner golden glänzenden Kuppel.
Wahrscheinlich war auch der Tempel des Herrn Phex getroffen worden. Lina seufzte leise. Während sie die Geweihten des Praios ob ihres offen zur Schau getragenen Reichtums und ihrer Autorität gleichermaßen verachtete wie fürchtete, dauerte sie das Schicksal des Phextempels. Nur einmal war sie in dem hübschen Gebäude gewesen, wo der Himmlische Fuchs als Gott der Händler und Herr der Nacht verehrt wurde. Wie Sterne funkelten kleine Diamanten am tiefschwarzen Boden der Halle, und der Klugscheißer Elgrid hatte immer wieder betont, dass es sich dabei um ein getreues Abbild des Nachthimmels handelte. Diamanten, schoss es ihr durch den Kopf, und gleichzeitig stieg ihr die Röte ins Gesicht. Du willst doch schließlich nicht den Herrn der Diebe bestehlen, Närrin!
Sie spürte, wie ihre Handflächen feucht wurden. Ob es lasterhaft war, das Elend der Stadt zu nutzen, um sich zu bereichern? Lina wusste lediglich, dass sie sich schon seit Tagen mit einigen Kanten trockenen Brotes über Wasser hielt. Die Stadt war in den letzten Wochen von Flüchtlingen übergequollen. Hätte Lina jemals einen eigenen Hof im Osten besessen, sie hätte ihn gewiss nicht so leichtfertig aufgegeben. Angesichts wandelnder Toter jedoch, so musste sie zugeben, wäre sie wahrscheinlich ebenso aus Tobrien oder Darpatien geflohen wie viele der Vertriebenen.
Aber das Schicksal hatte ihr damals beschieden, frei geboren zu werden, im elenden Südquartier dieser Stadt. Frei, aber ohne Besitz und ohne jemandes Besitz zu sein. Ohne einen Adligen, der sich um sie kümmerte, aber auch ohne Verpflichtungen. Darauf war sie immer stolz gewesen. Einfacher war Linas Leben deswegen nicht gewesen. Doch wenigstens hatte sie eines auf Gareths Straßen gelernt: sich selbst durchzubringen. Und genau das würde sie auch diesmal tun. Noch nie hatte diese Stadt Rücksicht auf ihre Bedürfnisse genommen. Warum also sollte sie sich nicht auch nehmen, was ihr zustand?
Sie schüttelte sich bei dem Gedanken an das schale Bier vom Vormittag und zog das dichte Leinentuch fester vor Mund und Nase. Beißende Hitze schlug ihr entgegen, als der Wind einen Funkenregen über die Straße trug, der sich noch im Flug zu heißer Asche verzehrte. Ich spiele nie wieder Gareth brennt, wenn das hier vorbei ist. Ich schwör’s!, versuchte sie sich abzulenken, während die Glut ihr beinahe die Augenbrauen versengte. Lina duckte sich in den Schutz eines zerborstenen Mauerstücks und zog den Arm schützend über das Gesicht. Der Wind trug das Geräusch knisternder Flammen und Waffengeklirr heran. Offenbar war die Schlacht um Gareth noch nicht entschieden.
Doch Lina hatte nicht vor zu warten. Onkel Alrik pflegte immer zu sagen: »Wenn du deinen Teil vom Kuchen hast, verschwinde, Kind!« Und ebenso wollte sie es halten. Sie musste nur noch den passenden Kuchen finden.
Eben als sie sich aus dem Schutze der Mauerreste lösen wollte, vernahm sie ein leises Stöhnen hinter sich. Erschrocken fuhr sie herum und fluchte heftig, als ihr Kopf gegen einen der Schiefersteine krachte. Ihr Instinkt gebot ihr, die Beine in die Hand zu nehmen, doch der Laut war so schwach gewesen, dass er keine große Gefahr vermuten ließ. Sie lenkte den Blick nach unten. Bis eben hatte sie dem Gestein, das sie vor dem Glutregen schützte, wenig Beachtung geschenkt. Nur mit Mühe unterdrückte sie den Aufschrei, als sie wenige Spann vor sich einen Körper im Halbdunkel entdeckte. Bis zur Hüfte unter Mauerresten begraben lag ein Mann. Der braune Umhang verdeckte nur unzureichend seine prachtvolle Gewandung. Langsam beugte sich Lina nach unten, um ihn genauer zu betrachten. Die weiße Oberbekleidung des Mannes wies schwungvolle goldene Verzierungen auf, doch ihr Blick haftete wie gebannt an den großen Flecken, die den hellen Stoff an zahlreichen Stellen dunkel gefärbt hatten. Einen gequälten Laut ausstoßend, der eher an ein Tier erinnerte, drehte der Liegende den Kopf zu ihr herum. Lina schrak zurück. Die rechte Hälfte seines Gesichts war von verkrustetem, halblangem Haar verdeckt. Es hatte so viel Blut aufgesogen, dass es eine starke Ähnlichkeit mit verrosteten Eisenfäden aufwies. Der linke Arm stand in unnatürlichem Winkel ab, während seine Rechte eine Ledertasche fest umklammert hielt.
Lina atmete tief ein und beugte sich vorsichtig zu ihm hinunter. Ihr Atem stockte plötzlich, als sie unter all dem Blut das Symbol auf seiner Brust erkannte: der goldene Greif. Der Mann, der blutbesudelt und würdelos unter einem Mauerstück begraben lag, war ein Pfaffe. Oder zumindest jemand, der es eng mit der Praioskirche hielt. Das Mahlen seiner Zähne jagte Lina einen kalten Schauer über den Rücken. Ihr Blick glitt an seinem Arm hinab. Seine Finger schlossen sich so fest um die Ledertasche, dass seine Knöchel weiß hervortraten.
»Was tust du hier?«, flüsterte sie.
Er riss die Augen auf und presste die Tasche an den Körper, als wolle er sie im Augenblick des Todes mit sich in die Hallen Borons reißen. Lina schluckte. Ihr Mund fühlte sich trocken an. Sie konnte unmöglich einen Sterbenden bestehlen, womöglich noch einen Geweihten. Andererseits war der Mann nicht mehr zu retten. Seine Verletzungen waren zu schwer, soweit Lina das beurteilen konnte. Und noch im Verrecken krallt er sich an dem Ding fest wie ein Besessener. Er wollte damit abhauen. Es in Sicherheit bringen, dämmerte es ihr. Du rettest es einfach, was es auch ist, und zwackst was ab. Sozusagen als Lohn. Das ist doch sehr im Sinne des Herrn Phex. Und da sollte auch der gestrenge Herr Praios nichts gegen haben.
Vorsichtig streckte sie die Hände nach der Tasche aus, doch der erwartete Widerstand blieb aus. Entweder war der Verschüttete endlich von gnädiger Ohnmacht umfangen worden, oder er lebte nicht mehr. Lina war nicht daran gelegen, die Wahrheit herauszufinden. Stattdessen schlug sie die Lederklappe zurück, um den Inhalt zu begutachten. Für einige Sekunden blieb ihr der Mund offen stehen. Sie war vollkommen überwältigt von dieser Pracht. Die Tasche war gefüllt mit goldenen Schmuckstücken, fein gearbeiteten Trinkpokalen, kostbaren, mit Gemmen bestückten Statuetten und einigen winzigen Kästchen mit kunstvollen Einlegearbeiten. Ihre Hände suchten sich wie von allein den Weg ins Innere der Tasche und griffen sicher nach einem schlichten Diadem, das über die Jahre bereits dunkel angelaufen war. In ihre Augen trat ein feuchter Glanz. Alle anderen Reichtümer verblassten plötzlich neben diesem Kleinod. Mit seiner schlichten Schönheit konnte sich keines der anderen Stücke messen. Lina wusste, dass sie gefunden hatte, weswegen sie hergekommen war. All das Leid um sie herum berührte sie nicht mehr. Eine ruhige Gewissheit durchflutete ihren Körper.
Mit einer schnellen Bewegung schob sie den Stirnreif in ihren Überwurf und lächelte. Sie würde Gareth noch heute verlassen und das Schmuckstück in Sicherheit bringen.
Erst als Lina die Gasse hinunterlief, spürte sie, wie schnell ihr Herz gegen ihren Brustkorb hämmerte. Was, wenn sie mich erwischen?, schoss es ihr durch den Kopf. Als sie einen Blick über die Schulter riskierte, sah sie im Rauch eine Gestalt hinter sich auftauchen.
»Hier ist etwas, Hauptmann!«, hörte sie eine raue Männerstimme.
»Sieh gefälligst nach, Belharion! Oder brauchst du etwa ein Kindermädchen?«
Ein unwilliges Schnauben war die Antwort. Schwere Stiefel bewegten sich in ihre Richtung. Ohne einen weiteren Gedanken zu verschwenden rannte Lina los, doch schon nachdem sie wenige Schritt zurückgelegt hatte, kam ihre Flucht zu einem abrupten Ende. Vor ihr ragten einige grotesk verformte Splitter aus ölig schimmerndem, schwarzem Metall aus dem Boden und schnitten ihr den Weg ab. Sie schlug einen schnellen Haken und hechtete über den Zaun eines Anwesens. Obwohl der Westflügel und das Dach des Gebäudes vollkommen zerstört waren, hoffte sie, dort Schutz zu finden, und hielt auf den von schlanken, spätbosparanischen Säulen gerahmten Eingangsbereich zu. Ausgerechnet die schwere Tür aus heller Steineiche hatte die Katastrophe überlebt. Dunkle Fensterhöhlen starrten ihr wenig einladend entgegen.
Warum rennst du?, meldete sich ihr Verstand. Es ist besser, dich zu verstecken. Du weißt doch gar nicht, ob er noch hinter dir her ist.
In diesem Moment durchflutete sie blanke Panik, und sie geriet auf der Treppe ins Straucheln.
Natürlich ist er hinter mir her! Sie alle sind hinter mir her! Hinter uns! Ihre Knie und Hände schlugen hart auf den Stufen auf. Er will das Diadem! Die zahlreichen Glassplitter knirschten unter ihrem Gewicht und bohrten sich wie spitze Nadeln in ihre Haut. Das Diadem! Er darf nicht ...
Taumelnd versuchte Lina, wieder auf die Beine zu kommen. Er durfte sie nicht finden. Um keinen Preis. Sie presste sich hinter eine der Säulen und versuchte, ihren rasselnden Atem zu beruhigen. Das Blut rauschte ihr in den Ohren, und doch konnte sie nur zu deutlich hören, wie sich der Mann die sechs Stufen nach oben bewegte. Das Knirschen seiner harten Stiefel auf Glas, das metallische Klirren seiner Rüstung. Erst jetzt fiel Lina auf, dass sie sich in eine Sackgasse manövriert hatte. Neben dieser Säule hatte sie ein offenes Fenster vermutet, durch das sie im Falle ihrer Entdeckung hätte ins Haus gelangen können. Doch die Öffnung in ihrem Rücken war durch einen Haufen Schutt blockiert. Offenbar hatte der Boden des ersten Stockwerks der Belastung durch das eingestürzte Dach nicht standhalten können.
Lina fluchte innerlich, als sie hörte, wie ihr Verfolger seine Waffe zog. Phexverflucht, wie hat er nur ... Ihr Herz setzte einen Schlag aus, als sie an sich hinunterblickte. Da waren keine Schmerzen, doch einige der spitzen Glassplitter steckten noch immer in ihr. Und eine fein gesprenkelte Blutspur am Boden führte genau zu ihrem Versteck. Der fremde Soldat war offenbar ein geschulter Beobachter. Ihre Hand fuhr unter den speckigen Umhang und tastete zitternd nach dem Stirnreif, als ein Schatten auf Linas Gesicht fiel. Sie fuhr nach oben und blickte in das rußverschmierte Antlitz eines Kämpfers. Wahrscheinlich war er kaum älter als sie selbst, höchstens dreißig Götterläufe mochte er zählen. Doch seine Züge waren von Kälte durchdrungen, als er ohne zu zögern zustieß. Lina blickte ungläubig an sich hinab. Der Schmerz verbrannte sie innerlich, doch kein Laut kam von ihren Lippen. Was die Waffe in ihrem Inneren anrichtete, als er die Klinge in ihr drehte, war bedeutungslos. Sie wusste ohnehin, dass sie sterben würde, und krallte ihre Linke verzweifelt um das Schmuckstück unter ihrem Umhang. Im Glauben, sie taste nach einer Waffe, riss der Söldner ihre Hand mit dem Diadem nach oben. Kraftlos sank sie an der Wand zu Boden, nachdem er endlich die Klinge aus ihrem geschundenen Körper gerissen hatte. Sie fühlte, wie langsam ihr Bewusstsein schwand, doch es war ihr gleich. Noch immer galt ihre einzige Sorge dem Schmuckstück in ihren Fingern, das er ihr gerade mit gierigem Blick aus den Händen wand. Und so merkte sie nicht einmal, wie sie an der Wand zu Boden glitt.
Tod eines Handlungsreisenden
Khunchom, in der Gegenwart
Deniz’ Kopf schmerzte. Das rasende Pochen begann hinter seinen Augen, setzte sich bis in die Schläfen fort und breitete sich wie bohrende Nadelstiche über den gesamten Kopf aus. Durch ruhiges Atmen versuchte er des Dämons, der von innen gegen seinen Schädel hämmerte, Herr zu werden. Die Nacht war kurz gewesen. Viel zu kurz.
Noch vor wenigen Stunden hatte er bei Dattelwein und Rauchkraut in einer Schänke gesessen. Dabei musste er dem Alkohol heftig zugesprochen haben, denn er konnte sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wie er nach Hause gekommen war. Wie nach jeder durchzechten Nacht fühlte er bleierne Taubheit in den Gliedern. Doch das war nichts im Vergleich zu diesen niederhöllischen Kopfschmerzen.
Wie lange mochte er bereits geschlafen haben, als ihn das laute Klopfen und Rufen aus seiner wohlverdienten Nachtruhe gerissen hatte? Zwei, höchstens drei Stunden. In jedem Fall zu kurz. Noch völlig schlaftrunken hatte Deniz vor seinem Hausboot einen rundlichen Kerl in der Uniform der Stadtgarde erblickt. Bevor er sich überhaupt klar werden konnte, ob er dem Mann schon einmal begegnet war, hatte dieser damit begonnen, ihn mit einem nicht enden wollenden, aber ausgesprochen höflichen Wortschwall einzudecken. Selbst nüchtern hätte er dem verschlungenen Redefluss des Mannes kaum folgen können. In seinem Kopf hallten einige lose Satzfetzen wider. Es ging um Mord, so viel hatte er verstanden. Doch für alles weitere fand sein durch Schlafentzug und Alkoholgenuss getrübter Verstand keine Verwendung. Wenigstens der Name des nächtlichen Störenfrieds war haften geblieben: Kasim ben Gaftar.
Zuerst hatte er ihm einfach die Tür vor der Nase zuschlagen wollen. Doch als der Novadi schließlich die Hände gefaltet und Deniz bei seinem Gott Rastullah beschworen hatte, ihm zu folgen, war ihm klar geworden, dass er ihn so schnell nicht wieder loswerden würde. Wahrscheinlich wäre der Kerl ein paar Augenblicke später vor ihm auf die Knie gegangen, hätte Deniz nicht durch ein dumpfes Nicken seine Einwilligung signalisiert.
Schlafen konnte er nach dem leidenschaftlichen Gejammer des Novadis ohnehin nicht mehr. Also hatte er seine Gardeuniform übergeworfen und war seinem Kollegen durch die Gassen des nächtlichen Khunchoms gefolgt. Auf dem Weg zu ihrem Ziel, einer Schänke, die den Namen Wüstenblume trug, hatte der Novadi weiterhin unentwegt auf ihn eingeredet und versucht, ihn in ausschweifenden Formulierungen über die bisherigen Ereignisse in Kenntnis zu setzen. Doch mehr, als dass die Taverne Kasims Onkel gehörte und im Hinterzimmer ein Toter liegen sollte, hatte Deniz nicht heraushören können. Wieder einmal machte er murrend seinen alkoholumnebelten Verstand für diesen Umstand verantwortlich. Sicher würde er mehr erfahren, wenn sie ihren Bestimmungsort erreicht hatten. Immerhin steuerten sie wenigstens auf eine Schänke zu. Der Gedanke an einen kräftigen Schluck ließ ihn beschleunigen.
Die Wüstenblume war im Erdgeschoss eines weißen Flachdachbaus untergebracht und lag im Quad‘el‘Basar, unweit der Feldstraße, die am Grünen Mhanadi in die große Fürst-Istav-Allee mündete. Über der Tür war ein Holzschild angebracht, das eine erblühte Wüstenrose zeigte. Vor dem Eingang stand eine kleine Menschentraube, die in aufgeregtes Geplapper vertieft war. Ein braungebrannter Kerl mit grauen Locken und dickem Schnauzer stand im Eingang und zog gerade drei Goldmünzen aus der Hosentasche, während er mahnend den Zeigefinger hob. Direkt vor ihm stand ein Mann in teurem rotgoldenen Kaftan und hielt die Hand auf.
»Und ich kann auch wirklich sicher sein, dass du Stillschweigen bewahrst?«, vergewisserte sich der Gelockte.
»Rastullah sei mein Zeuge, Mezzek! Ich werde kein einziges Wort darüber verlieren«, beteuerte sein Gegenüber.
Die Münzen wechselten den Besitzer. Deniz glaubte Unsicherheit und Zweifel im Gesicht des Gelockten zu sehen. Die Beteuerungen des Rotgekleideten schienen ihn nicht zur Gänze überzeugt zu haben. Als er sah, wie sich die beiden Gardisten an ihm vorbei in die Schankstube schoben, verabschiedete er sich hastig und folgte ihnen. Nur noch wenige Lampen brannten, und Deniz wäre beinahe über einen der niedrigen Tische gestolpert. Die Wasserpfeife darauf schwankte bedrohlich. Erst im letzten Moment gelang es dem Gardisten, sie vor dem drohenden Absturz zu bewahren. Fluchend trat er gegen eines der bequemen Sitzkissen.
»Kasim!«, erklang die Stimme des gelockten Mannes. »Was bedeutet das?« Fragend sah er die beiden Gardisten an.
»Dies, Onkel Mezzek, ist Deniz ibn Seyshaban«, erklärte Kasim und deutete auf Deniz, der gerade den Schlauch der bauchigen Wasserpfeife einer genaueren Untersuchung unterzog.
Als er bemerkte, dass über ihn gesprochen wurde, nickte er steif und murmelte ein knappes: »Salâm.«
»Salâm«, entgegnete der Onkel unsicher. Seine Augen verharrten Hilfe suchend bei Kasim, der gerade zu einer Erklärung ansetzen wollte, als Deniz ihn unterbrach.
»Könnt ich ’n Schluck Arraq bekommen?« Mit schmerzverzerrtem Gesicht fasste er sich an die Schläfen. Sein Kopf dröhnte noch immer.
Er erntete entgeisterte Blicke. Für einen Moment war es so ruhig um Deniz, dass er bezweifelte, deutlich genug gesprochen zu haben. Er wollte gerade zu einem zweiten Versuch ansetzen, als Mezzek zögerlich nickte. »Aber sicher doch«, murmelte er. Er schlich zur Theke hinüber und zog eine große bauchige Tonflasche aus einem Regal hervor. Während er begann, die klare Flüssigkeit in einen kleinen Holzbecher zu füllen, starrte Deniz Kasim unverhohlen an. Der Novadi hatte den Kopf gesenkt und die Stirn in der Hand vergraben. Er schüttelte fassungslos das Haupt. Deniz fluchte innerlich. Offenbar hatte er doch etwas Falsches gesagt. Vielleicht hatte er ungewollt irgendeine Obszönität von sich gegeben. Seine Zunge war noch immer schwer vom Wein, und er wollte dringend das trockene Gefühl auf den Lippen loswerden.
»Bitte schön.« Mezzek reichte ihm den kleinen Holzbecher.
»Shokran«, bedankte sich Deniz und stürzte den Inhalt in einem Zug hinunter. Der Schnaps war schärfer als erwartet. Deniz verzog das Gesicht und schüttelte sich.
Wenn das nicht geholfen hat, dich wach zu kriegen, alter Knabe, dann solltest du dich einfach wieder hinlegen. Scheiße, brennt der nach!
Er drückte dem Wirt den Becher in die Hand und sah hinüber zu Kasim. »Und wo ist jetzt die Leiche, von der du gesprochen hast?«
Der Novadi wies wortlos auf einen schweren Vorhang am anderen Ende des Raums.
Komisch, dachte Deniz, jetzt kannst du plötzlich die Klappe halten. Auf dem Weg hierher hast du noch geplappert wie ein Wasserfall.
Schwerfällig setzte er sich in Bewegung. Im Gehen fischte er ein kleines Säckchen aus der Hosentasche, zog ein bräunliches Kraut daraus hervor und stopfte es sich in den Mund. Genüsslich begannen seine Kiefer zu mahlen. Seufzend sah Kasim dem grobschlächtigen Gardisten nach.
Rastullah, das darf doch nicht wahr sein!
Kasim wäre am liebsten vor Scham im Boden versunken. Seine letzte Hoffnung hatte er in diesen vielgepriesenen Vater der Feinsinnigkeit gesteckt, in den Mann, der damals den Mord an Hamil Bureshi aufgeklärt hatte. Aber angekommen war er mit dem berauschten Sklaven der Genusssucht. Einem Kerl, der aussah, als hätte Kasim den erstbesten Herumtreiber in eine Gardeuniform gezwängt. Seine Fahne kündigte ihn bereits drei Straßenecken voraus an. Ein Wunder, dass er diesen Mann, der offensichtlich die Nacht durchzecht hatte, überhaupt hatte wecken können – oder war es ein Fluch? Vielleicht war das Rastullahs direkte Strafe dafür, dass er Hilfe bei einem Ungläubigen gesucht hatte. Wie sollte er das nur seinem Onkel erklären?
»He, Novadi!« Deniz war stehen geblieben und hatte sich zu Kasim umgedreht. »Erst kann’s dir nicht schnell genug gehen, und dann lässt du mich warten. Richtung Keft verbeugt wird sich erst wieder, wenn wir hier fertig sind, klar!«
»Bitte verzeih, o du ungeduldiger Sohn des Großmuts!«, presste Kasim gezwungen höflich hervor. Für diese Lästerung seines Glaubens hätte er den Ungläubigen eigentlich zurechtweisen müssen. Aber er war wohl oder übel auf ihn angewiesen. Zudem war es Deniz hoch anzurechnen, dass er mitten in der Nacht diese Strapazen auf sich nahm, noch dazu für einen Fremden.
Kasim wollte gerade zu seinem Kollegen aufschließen, als er an der Schulter zurückgehalten wurde.
»Was soll das, Kasim?«, fauchte ihm sein Onkel ins Ohr. »Ich habe dich gerufen, damit wir diese Angelegenheit diskret aus der Welt schaffen können. Und jetzt schleppst du mir diesen Ungläubigen an, der auch noch die Unverschämtheit besitzt, in meinem Haus über As’Sali zu spotten. Da hätte ich mich auch direkt an die Stadtgarde wenden können.«
»Vertrau mir, Amja. Ich weiß, was ich tue.« Rastullah! Ich wünschte, es wäre so! Aber wie soll ich dir erklären, dass ich von all dem keine Ahnung habe? Ich bete nur, dass sich dieser Deniz doch noch als der rastullahgesegnete Sohn der Weisheit erweist, den ich mir erhofft habe.
»Da!« Kasim riss den schweren Samtvorhang zur Seite, der den Schankraum von einem kleinen Separée trennte. »Nun sieh ihn dir an, diesen unglücklichen Vater des vorschnellen Ablebens!« Kasim stand deutliches Unbehagen ins Gesicht geschrieben.
In der Mitte des Raums, der gerade groß genug war, dass ein glänzender Lacktisch und einige große, bestickte Kissen darin Platz gefunden hatten, lag ein beleibter Mann. Sein Körper hing in unnatürlicher Haltung über den Tisch gebeugt. Das Teegedeck aus Unauer Porzellan hatte er umgestoßen, der Ausguss der Kanne war abgebrochen, der Tee ausgelaufen. Als dunkle Lache hatte sich das Getränk auf die umliegenden Kissen und die kostbaren Teppiche am Boden ergossen. Zwei Tassen und ein verziertes silbernes Tablett waren auf eines der Sitzkissen und unter den Tisch gestürzt.
Der Mann mit dem kurzen blonden Haar hätte wahrscheinlich auch lebend keinen sonderlich schönen Anblick geboten. Sein fleischiges, rot angelaufenes Gesicht lag flach auf den Tisch gepresst. Die Augen waren weit aus den Höhlen hervorgetreten und ruhten starr auf dem Eingang zum Separée, die Zunge hing ihm aus dem Mund, ähnlich der eines großen Hundes, und klebte wie ein rohes Stück Fleisch auf der Tischplatte.
Nachdenklich verzog Deniz den Mund und sog dabei scharf die Luft ein. Dann schob er einen der rot schimmernden Seidenschleier zur Seite, welche die Wände verkleideten und den Raum wie einen Baldachin überspannten, und trat näher an das Opfer heran. Dabei musste er über eine große Wasserpfeife hinwegsteigen, die der Tote wohl im Moment seines Ablebens umgestoßen hatte. Das Wasser war ausgelaufen, und ein herausgefallenes Stück Kohle hatte eines der Kissen versengt. Sie dampfte noch immer leicht und verströmte einen angenehmen Geruch nach Süßholz und Arangen.
Gelassen kaute Deniz auf dem Tabak in seinem Mund herum. Die Leiche schien ihm ebenso wenig auszumachen wie das unterschwellige Gefühl der Gefahr, das Kasim immer wieder erschauern ließ.
Hoffentlich kommt diesem Kerl nicht die Idee, den Kautabak im Anschluss auf den Teppich zu spucken. Der Novadi konnte sich bereits lebhaft das wutverzerrte Gesicht seines keifenden Onkels vorstellen.
Vorsichtig ging Deniz einmal um den Toten herum. Kasim versuchte die Zweifel, mit denen er seinen Kameraden betrachtete, zu verbergen. Deniz trat gegen eine der umgestürzten Tassen am Boden, hob sie auf und betrachtete das Stück eingehend. Da Kasim dem Tatort beim besten Willen keine erhellenden Erkenntnisse abgewinnen konnte, blieb sein Blick an dem hochgewachsenen Tulamiden haften. Sicher zählte Deniz bereits über dreißig Sommer. Vermutlich war er zwei, drei Jahre älter als Kasim selbst. Im Gegensatz zu seinen breiten Schultern war der Rest seines Körpers eher sehnig geraten. Seine dunklen, tief liegenden Augen, die unter dichten, ausdrucksstarken Brauen lagen, glitten aufmerksam und wach durch den Raum. Kasim war seine Erleichterung deutlich anzumerken.
Offenbar weiß dieser Enkel der Einsicht, was er tut. Rastullah sei gepriesen!
Als er ihn aus dem Schlaf gerissen hatte, war Kasim schon froh gewesen, dass Deniz es geschafft hatte, seine Uniform ordentlich anzulegen. Mit dem dunklen Dreitagebart wirkte der Gardist im schummrigen Licht der Wüstenblume nicht wie jemand, dem Kasim in einer dunklen Gasse begegnen wollte.
»Ich begreife noch immer nicht ganz, warum du jemanden hinzuziehen musstest«, flüsterte Mezzek plötzlich in Kasims Rücken. »Ist er etwa ein Freund von dir?«
Der Novadi fuhr mit der Hand durch seinen Vollbart und atmete schwer aus. Dann drehte er sich zu Mezzek herum und antwortete ebenso leise: »Nein, Amja, er ist kein Freund von mir. Ich kenne ihn nicht viel länger als du. Aber wenn ich dir sage, dass dieser Vater des Unglücks da drin eines natürlichen Todes gestorben ist, glaubst du mir ja doch nicht.« Er hoffte inständig, dass er recht behielt. Sein Onkel sollte um keinen Preis bemerken, dass er keine Erfahrung mit einem echten Mord hatte.
Eine Messerstecherei. Warum, beim All-Einen, hätte er denn nicht in einer Messerstecherei zu Tode kommen können? Dann müssten wir uns jetzt nicht die Mühe machen, nach dem Schuldigen zu suchen. Rastullah, streue Sand in die Augen meines Onkels und lasse ihn meine Unfähigkeit nicht erkennen!
Das sah nach Heimtücke aus, und für gewöhnlich tat man gut daran, sich aus solchen Angelegenheiten herauszuhalten. Kasim war in der Vergangenheit nur zu bereit gewesen wegzusehen. Für ein kleines Bakshish, eine Gefälligkeit, hatte er sich wichtigeren Dingen gewidmet. Doch dieses Mal ging es um das Ansehen seines Onkels, seiner Familie. Deniz war seine einzige Hoffnung, egal wie betrunken, unrasiert und unleidlich er sein mochte.
Kasim bemühte sich um einen festen Blick, als er seinem Onkel ins Gesicht sah. Doch Mezzeks Miene blieb misstrauisch. »Und deswegen soll ich mich auf das Urteil eines Ungläubigen verlassen, der schlimmer nach Al’Kohol stinkt als eine Schiffsbesatzung nach drei Tagen Landgang?«
»Glaub mir, einen besseren wirst du nicht finden«
Kasim versuchte, so überzeugt wie möglich zu klingen.
Mezzek sah misstrauisch zu Deniz hinüber, der interessiert um die Leiche herumging. »Das spricht nicht gerade für die Garde«, murmelte er.
»Ich bin überzeugt, dass er meine Worte bestätigen wird. Der Mann ist eines natürlichen Todes gestorben.« Er wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn. Warum war er nur ein so ausgesprochen schlechter Lügner?
»Ich hoffe, du irrst dich, Kasim. Sonst pfeifen die Khômfinken bald von den Dächern, dass mit meinem Essen etwas nicht stimmt. Dann kann ich zumachen!«
»Und ein Mord in deinem Haus wäre dir lieber? O du Sohn des törichten Wortes! Als ob das nicht genauso auf dich als Gastgeber zurückfallen würde.«
»Aber dann gäbe es wenigstens jemanden, den ich dafür zur Rechenschaft ziehen könnte«, entgegnete Mezzek trotzig.
Kasim breitete ratlos die Arme aus. »Warum haben wir diesen nimmersatten Herrn der Völlerei nicht einfach in den Mhanadi geworfen, so wie ich es vorgeschlagen hatte? Dann hätte ihn niemand mit der Wüstenblume in Verbindung gebracht. Und mit ein bisschen Glück wäre er weit genug getrieben, damit sich die Hafengarde mit ihm hätte herumschlagen müssen.«
»O Kasim, du einfältiges Kamel! Das hätte ich doch auch getan, wenn meine übrigen Gäste den Toten nicht gesehen hätten. Die Angelegenheit lässt sich jetzt nicht mehr vertuschen!«, jammerte sein Onkel.
Kasim schüttelte verständnislos den Kopf. »Aber ich habe doch eben gesehen, wie du ihnen ein Bakshish bezahlt hast, damit sie schweigen?«
Mezzek seufzte. »Glaubst du denn tatsächlich, dass ein Bakshish diese Söhne und Töchter geschwätziger Waschweiber abhalten könnte zu tratschen? Es verschafft mir lediglich Zeit, aber sei dir gewiss, dass ihr Schweigen nicht lange vorhalten wird.«
»Aber wieso hast du sie dann überhaupt bezahlt, Amja?«
»Weil ich will, dass sie wenigstens ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie meinen guten Namen in den Dreck ziehen!«, fauchte Mezzek. Er legte seinem Neffen die Hand auf die Schulter und sah ihm ernst in die Augen. »Kasim, ich habe nach dir gerufen, weil du ein Gardist und mein Neffe bist. Du kennst dich mit so etwas aus. Und bei dir kann ich mich auch darauf verlassen, dass du dieser Angelegenheit ernsthaft nachgehen und dich nicht von Bestechungsgeldern ablenken lassen wirst. Schließlich steht hierbei auch die Ehre deiner Familie auf dem Spiel.«
Kasim seufzte schwer. Wie sehr wünschte er sich in diesem Moment, seinen Onkel nicht zu kennen.
»Ich weiß, dass es gefährlich sein kann«, fuhr Mezzek fort. »Aber es soll dein Schaden nicht sein. Ich will nur wissen, wer es war. Du musst ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Das werden Freunde von mir erledigen. Ich will nur einen Namen.«
»Falls du recht hast und er ermordet wurde, kannst du dich natürlich auf mich verlassen, Amja.«
Mezzek legte Kasim stolz beide Hände auf die Schultern. »Rastullah sei Dank, dass ich einen so tüchtigen Neffen habe! Natürlich werde ich dir ein großzügiges Bakshish zahlen.«
»Schon gut, Onkel, du Vater der überschwänglichen Freude.« Kasim entwand sich seinem Griff und warf einen flüchtigen Blick über die Schulter zu Deniz. »Nun lass uns erst mal unsere Arbeit machen. Wir kommen schon zu dir, wenn wir noch Fragen haben.« Kasim schob seinen Onkel nach draußen und zog den schweren Vorhang hinter ihm zu, als ihn ein widerliches Schmatzgeräusch zusammenfahren ließ.
Deniz hatte eine der beiden Tassen aufgehoben und spuckte das braune Gemisch aus Speichel und Tabaksaft, das sich inzwischen in seinem Mund angesammelt hatte, in das teure Porzellan seines Onkels. Kasim verzog angewidert das Gesicht, doch Deniz schien keine Notiz davon zu nehmen. Vielleicht war es ihm auch vollkommen gleichgültig.
»Was fällt dir auf?«, fragte er.
»Mir fällt auf, dass du Vater unappetitlicher Manieren die Würde der Unauer Porzellanmacher beschmutzt«, platzte es aus Kasim heraus, und er deutete empört auf die Tasse. »Hast du überhaupt einen Gedanken daran verschwendet, dass jemand deinen widerlichen Rotz da wieder herauskratzen muss?«
Schon im nächsten Moment bereute Kasim, was er gesagt hatte. Er war auf Deniz angewiesen und sollte es sich besser nicht mit ihm verscherzen.
Glücklicherweise überging Deniz die Beleidigung, als hätte er sie nicht gehört, und zeigte schulterzuckend auf die Tasse: »Hat ohnehin nen Sprung.« Dann deutete er mit dem Kopf zwischen Wasserpfeife und Leiche hin und her: »Und?«
Kasim verstand nicht, worauf er hinauswollte. Hatte er etwas übersehen? Er bemühte sich, seine Antwort diesmal so höflich wie möglich zu formulieren. »Ehrwürdiger Herr mit den falkenscharfen Augen«, setzte er an. »Ich bitte dich, sieh es diesem unwissenden Sohn eines blinden Khôm-Maulwurfs nach, dass ihn sein getrübter Blick nicht einmal das Offensichtlichste erkennen lässt.«
Kasim erntete einen genervten Blick.
»Einfach nur Deniz, in Ordnung? Raspel dein Süßholz gefälligst woanders!«, kam es zurück.
»Selbstverständlich. Ich werde deine empfindlichen Ohren nicht mehr mit meinem unwürdigen Geschwätz belästigen«, antwortete Kasim beschwichtigend, bevor ihm einfiel, was er gesagt hatte und sich korrigierte: »Ich meine natürlich: selbstverständlich!« Er biss sich auf die Unterlippe. »Und?«, fragte er dann. »Was hätte mir hier auffallen sollen?«
Deniz deutete auf die zerbrochene Tasse, das Tablett und die Wasserpfeife. »Was glaubst du, warum die Gegenstände alle aufm Boden liegen?«
»Na«, erwiderte Kasim, »weil der Unglückliche diese Welt wohl nicht ganz schmerzfrei verlassen hat. Vielleicht hat ihn ja der Schlag getroffen, und er hat den Tisch abgeräumt, während er sich in Krämpfen gewunden hat.«
»Du glaubst also, dass er ohne fremde Hilfe gestorben ist?«, fragte Deniz und zog eine Augenbraue hoch.
Kasim zuckte hilflos mit den Schultern. »Beim weisen Herrscher des Himmels! Mein Onkel schreit die ganze Zeit etwas von Mord und Totschlag. Ich weiß es beim besten Willen nicht zu sagen. Wie findet man so etwas denn heraus?«
»Indem man nachsieht«, raunte Deniz. Er trat hinter den massigen Körper des Toten, packte ihn an der Kleidung und wuchtete ihn vom Tisch, sodass er zu Deniz’ Füßen auf dem Rücken zu liegen kam. Erneut ergriff er die Tasse, die auf dem Tisch stand, und spuckte mit einem saftigen Geräusch mehr des zähflüssigen Tabakgemischs hinein. Dann begann er, die Leiche genauer zu betrachten. Kasim trat hinzu und blicke ihm neugierig über die Schulter. Er bewunderte, wie leicht es Deniz fiel, sich einem Toten zu nähern und ihn sogar zu berühren. Ein kalter Schauer lief Kasim über den Rücken, als sein Blick auf der Leiche verharrte. Der Mann war höchstens Mitte fünfzig. Gewesen, korrigierte er in Gedanken. Sein Gesicht war ausgesprochen rund, mit einem üppigen Doppelkinn und hängenden Wangen, die an die triefenden Lefzen eines Hundes erinnerten. Die Gesichtshaut hatte stellenweise eine rötliche Färbung angenommen. Die Ursache hierfür war Kasim schleierhaft. An den Füßen trug der Unbekannte schwarze Spangenschuhe. Feine weiße Strümpfe spannten um seine kräftigen Waden. Dazu trug er eine Hose aus dunklem schweren Samt und ein feines, rüschenverziertes Hemd. Trotz der Hitze hatte er den dunkelroten Samtmantel nicht abgelegt.
Bei Rastullah! Wahrscheinlich hat er sich zu Tode geschwitzt!
Kasim hielt für einen Moment die Luft an. Jetzt, wo der dicke Mann auf dem Rücken lag, konnte er sehen, dass der Saum des Mantels über und über mit kostbaren Goldstickereien verziert war. Um den Hals trug er eine wuchtige Goldkette, die er offenbar bewusst über dem Mantel angelegt hatte. Kasim staunte nicht schlecht über den offen zu Schau gestellten Reichtum.
»Keine offenen Verletzungen«, stellte Deniz abwesend fest, während er mit den Händen sorgsam den Körper des Toten abtastete.
»Also gibt es gar keinen Mörder?«
»Sieht fast so aus«, murmelte Deniz.
Kasim wollte gerade seiner Erleichterung lautstark Ausdruck verleihen und zu seinem Onkel eilen, als seine Hoffnungen zunichte gemacht wurden.
»Nein, warte!«, erklang es in seinem Rücken. »Siehst du das hier? Du musst schon hinsehen, verdammt!« Deniz deutete auf die rot unterlaufenen Augen des Toten. »Die Adern hier platzen, wenn einem die Luft abgedrückt wird – findest du auch bei Perlentauchern. Und hier«, er deutete auf den wulstigen Hals des Mannes, »siehst du die blauen Flecken? Sind sehr schwach, ich weiß, aber könnte darauf hinweisen, dass er erdrosselt wurde.«
Kasim trat ehrfürchtig einen Schritt näher. »Woher weißt du das alles?«
Deniz zuckte mit den Schultern. »Erfahrung«, gab er knapp zurück. »Fällt dir sonst noch was auf?«, fragte er dann.
Kasim schüttelte ahnungslos den Kopf. Vielleicht hätte er noch ein paar Anmerkungen beisteuern können, aber er wollte sich keine Blöße geben. Also beschloss er zu tun, was seiner Natur nicht im Mindesten entsprach: er schwieg.
Deniz stöhnte. »Mensch, Kasim. Ist doch ganz einfach: Sein Haar ist blond, die Kleidung mehr als unpraktisch. Schau dir doch mal an, wie dick sie ist.« Er zupfte am Mantel des Toten. »Muss geschwitzt haben wie ein Selemferkel bei der Paarung. Deutet darauf hin, dass unser Freund hier aus dem Norden kommt.«
Kasim hatte die Arme vor der Brust verschränkt und bedachte Deniz mit einem strengen Blick. »Darauf bin ich auch schon gekommen, du allweiser Vater der Hellsicht. Er sieht schließlich nicht im Mindesten aus wie ein Landsmann.«
Deniz zog geräuschvoll die Nase hoch. »Scheint, als hätten wir dann alles Wichtige gesehen. Sollten noch mit deinem Onkel sprechen.«
»Worüber denn?«
»Hab da noch ein paar Fragen.« Er ging an Kasim vorbei und zog schwungvoll den Vorhang zur Seite.
Kasims Onkel stand mit dem Rücken gegen den Türrahmen gelehnt am Eingang der Taverne. Gedankenverloren blickte er nach draußen in den Sternenhimmel. Er schrak zusammen, als Deniz durch den Schankraum polterte.
»Ich hätte da noch ein paar Fragen, Mezzek, oder wie du heißt.«
»Was hast du Vater der Freimütigkeit auf dem Gewissen?«, erkundigte sich der Wirt übertrieben höflich.
»Hast du irgendwas am Tatort verändert?«, wollte Deniz wissen und baute sich zu voller Größe auf.
Mezzek schüttelte den Kopf. »Nein, nicht, dass ich wüsste. Ist das wichtig? Wisst ihr inzwischen, wie er gestorben ist?«
»Ist wohl ermordet worden«, antwortete Deniz.
»Also doch!«, murmelte der Wirt und warf seinem Neffen einen raschen Blick zu.
»Hast du etwas Verdächtiges bemerkt?«, fragte Deniz.
»Leider nein«, seufzte Mezzek. »Mein Sohn und ich, und natürlich meine Sklaven,hatten heute alle Hände voll zu tun. Es galt, eine Hochzeitsgesellschaft zu bewirten. Da blieb wenig Zeit, darauf zu achten, wer hier ein- und ausging.«
»Kanntest du den Toten?«, fragte Deniz und musterte Mezzek eingehend.
»Flüchtig. Dieser Sohn des Unglücks weilte schon seit mindestens einer Woche hier in Khunchom. Zuletzt war er jeden Abend hier und wollte immer diesen Raum dort hinten. Er sagte, er wolle Verkaufsgespräche führen.«
»Und? Hat er? Etwas verkauft, meine ich.« Deniz begann scheinbar gelangweilt, den Dreck unter seinen Fingernägeln einer genaueren Betrachtung zu unterziehen.
»Vielleicht. Jeden Abend traf er sich mit jemand anderem. Nur selten konnte ich sehen, mit wem. Alle Verabredungen hat er von einem Laufburschen erledigen lassen. Den Knaben habe ich allerdings nie zuvor gesehen.«
Kasim staunte, was sein Onkel noch alles zu berichten wusste. All diese Fragen wären ihm wahrscheinlich auch nach heftigem Grübeln nicht eingefallen.
»Aber wer die Leute waren, mit denen er sich getroffen hat, weißt du nicht?«, bohrte Deniz weiter.
»Nein«, antwortete Mezzek. »Ich durfte die Besprechungen nicht stören. Ich sollte vor den Treffen Tee servieren und die Pfeife entzünden. Ein zweites Mal habe ich den Raum immer erst dann betreten, wenn die Herrschaften wieder gegangen waren – höchst zufrieden, wie ich wohl hinzufügen darf.« Er plusterte sich für einen kurzen Moment stolz wie ein Feuerpfau vor Deniz auf. Doch dann beugte sich Mezzek zu ihm herüber und senkte die Lautstärke seiner Stimme, so als könne außer seinem Neffen noch jemand die Unterhaltung belauschen.
Kasim spürte Unmut in sich aufsteigen. Er fühlte sich von seinem Onkel ausgeschlossen und rückte daher näher an die beiden heran.
»Aber ein bisschen seltsam war der Kerl ja schon«, flüsterte Mezzek verschwörerisch. »Hatte immer so einen gehetzten Blick. Konnte sich gar nicht oft genug umdrehen. Und beim ersten Mal hat er sich mehrfach von mir versichern lassen, dass seine Unterhaltung keinesfalls gestört würde. Einen Marawedi mehr hat er mir dafür jeden Tag gezahlt – einen ganzen Marawedi!« Mezzek wedelte mit der Rechten, als hielte er ein unsichtbares Geldstück in der Hand.
»Wir haben dort nichts gefunden, was nach einem Verkaufsgegenstand aussah. Weißt du, worum es in den Verhandlungen ging?«, fragte Deniz.
»Nein.« Der Wirt schüttelte bedauernd den Kopf. »Ich habe nie gesehen, dass er etwas Besonderes bei sich hatte. Einmal wollte ich sogar neugierig am Vorhang lauschen, aber ich hab nichts verstehen können. Die beiden müssen äußerst leise gesprochen haben«.»In welcher Herberge er untergekommen war, weißt du nicht zufällig?«
Mezzek verneinte abermals.
Kasim kam eine Idee, und er beschloss, sich in das Gespräch einzumischen. »Sag, Amja, der Mann war Mittelländer, nicht wahr? Hat er jemals erzählt, woher er kam oder wie er hieß?«
Sein Onkel schüttelte erneut den Kopf. »Nein. Woher er kam, hat er nie erwähnt. Er sprach Tulamidya, jedoch mit starkem Akzent. Ich vermute, dass er aus Garetistan stammt. Seinen Namen hat er mir zwar einmal genannt«, er winkte mit der rechten Hand ab, »aber ihr kennt ja diese Mittelreicher: Sie haben barbarische Manieren, ihre Frauen haben kein Schamgefühl, und ihre Namen kann man sich weder merken noch aussprechen.«
Kasim und Mezzek lachten, nur Deniz starrte unbewegt weiter auf seine Hände. Nachdem der kurze Moment der Heiterkeit vom Ernst der Lage wieder verdrängt worden war, warf Kasim seinem Kollegen einen fragenden Blick zu.
Deniz zuckte scheinbar gelangweilt die Schultern. »Das wäre dann alles, denke ich. Wenn uns noch etwas einfällt, schauen wir noch mal vorbei.«
Mezzek nickte und begleitete die beiden Gardisten hinaus. Im Gesicht seines Onkels glaubte Kasim ein wenig Zuversicht zu entdecken.
»Habt ihr denn schon einen Verdacht?«, erkundigte sich Mezzek hoffnungsvoll, als er sie verabschiedete.
Deniz winkte ab. »Dafür ist es noch zu früh. Aber wir lassen es dich wissen.«
Beschwörend legte Kasim seinem Onkel die Hand auf die Schulter. »Sei unbesorgt, Amja! Wir finden den Kerl, das schwöre ich. Rastullah sei mein Zeuge!«
Der Mann im Dunkel
»Gern will ich deiner Herrin beschaffen, wonach sie sich derart verzehrt.« Der Händler fuhr sich mit seiner beringten Hand durch den Bart und hob den Blick vom Spielbrett. »Aber ich verlange im Gegenzug, dass sie ihre Güter ausschließlich an mich liefert. Derartige Waren sind in dieser Zeit äußerst rar auf dem Festland.«
»Und so soll es geschehen«, lispelte sein Gegenüber und zog die nächste Figur.
Der Händler lächelte zufrieden. Die kostbare Ladung des alabasternen Kamels würde schon sehr bald ihm gehören.
Die sanften Wellen des Tiefen Mhanadi glucksten verspielt gegen die Mauern der Uferstraße. Schon lange war in der Oase Akhram Ruhe eingekehrt. Beschienen vom silbrig glänzenden Licht des vollen Madamals, durchbrach einzig das stete Zirpen der Zikaden die nächtliche Stille. Es schien, als habe der Mantel der Nacht die Herberge vom pulsierenden Leben in den Gassen des Khunchomer Hafenviertels abgeschirmt. Während nur ein paar Straßenzüge weiter das ausgelassene Johlen betrunkener Matrosen zu hören war, erklang aus dem Innenhof des altehrwürdigen Gasthauses das gleichmäßige Schnarchen seiner Bewohner.
Auch hinter den mit Ziergittern versehenen Rundbogenfenstern des Hausherrn war es schon lange dunkel geworden, als ein dumpfer Aufprall das nächtliche Konzert der Zikaden übertönte. Unter gurrendem Protest stoben drei Tauben auseinander, die kurz zuvor noch friedlich auf dem Dachfirst genächtigt hatten. Die dunkel gekleidete Gestalt war schwer auf dem flach abfallenden Spitzdach der Herberge aufgekommen. Beim Versuch, sich aufzurichten, ruderte sie unbeholfen mit den Armen, um nicht nach hinten in die Tiefe zu stürzen. Dann setzte sie bedächtig einen Fuß vor den anderen. Wann immer sich der nächtliche Besucher einen Schritt weiter vorwagte, ächzten die Holzbalken des Daches unter seinem Gewicht. Er legte den Kopf schief und lauschte. Außer den Tauben schien es, als habe bisher niemand seine außergewöhnliche Kletterpartie bemerkt.
Ein erfrischender Lufthauch zog vom Meer herüber, und er genoss das streichelnde Gefühl auf seiner Haut. Plötzlich schnellte seine Hand nach oben. Um ein Haar hätte es ihm den breitkrempigen Hut vom Kopf geweht. Er gluckste leise und setzte sich schwankend wieder in Bewegung. Der Inhalt des prall gefüllten Beutels an seiner Seite klimperte leise. Sichtlich um sein Gleichgewicht ringend, machte sich der Unbekannte daran, den Dachfirst zu erklimmen. Doch bereits sein nächster Schritt ließ es an der erforderlichen Leichtfüßigkeit mangeln. Wieder erklang ein dumpfer, knackender Laut. Das gleichmäßige Schnarchen aus einem der Fenster verstummte für einen Moment. Sicherheitshalber kniete der Schatten nieder und presste sich flach gegen die Dachschindeln. Erst als der Fassadenkletterer sicher sein konnte, dass er niemanden aus dem Schlaf geschreckt hatte, tastete er sich, einem Tsamäleon gleich, langsam auf allen vieren weiter am Dach empor.
Als sich Federigo auf die Galerie im zweiten Stock hinabließ, wischte er sich zitternd den Schweiß von der Stirn. Das langsame Überwinden der Dachschräge hatte weit mehr seines Könnens beansprucht, als er erwartet hatte. Obwohl er geübt darin war, sich mit der Lautlosigkeit und Anmut eines Berglöwen fortzubewegen, verfluchte er im Geiste diese unnötige Kraxelei. Der Dattelwein war ihm weit schneller zu Kopf gestiegen, als er bereit war, sich einzugestehen.
Ein Lächeln zeichnete sich auf Federigos Gesicht ab. Trotz aller Hemmnisse, so musste er zugeben, hatte er seine Aufgabe auch unter erschwerten Bedingungen mit Bravour gemeistert.
Du bist halt einfach ein Fuchs, Amigo! Deine Mutter wäre stolz auf dich. Na ja, wohl eher nicht, wenn sie wüsste, was du hier tust. Was hat dir der Halunke im Schankraum nur in den Wein gekippt? Du verträgst doch sonst ‘ne ganze Stange mehr.
Er stützte sich für eine kleine Verschnaufpause gegen das hölzerne Geländer der Galerie und spähte hinunter in den rechteckigen Innenhof der Oase Akhram. Unter ihm plätscherte leise ein Wasserspiel zwischen den Palmen. Das blauweiß gemusterte Mosaik am Boden zeigte Kreise und Bögen – und kam plötzlich näher. Jäh verlagerte Federigo sein Gewicht nach hinten und wieder ein Stück nach vorn. Er grinste breit. Das Geländer war an dieser Stelle nur locker im Sockel verankert und schwankte leicht hin und her. Wenn er das Haus nachher auf dieselbe Art wieder verlassen wollte, musste er vorsichtig sein. Er brauchte das Geländer als Trittbrett, um auf das Dach zu gelangen. Federigo schluckte und blickte über die Brüstung hinab. Gute zehn Schritt trennten ihn vom Boden. Im Grunde konnte dem Mosaik dort unten gar nichts Besseres widerfahren, als dass es durch ein dunkles, kräftiges Rot bereichert wurde. Er fand es trotz seiner Muster ein wenig trist. Allerdings legte Federigo wenig Wert darauf, die Rolle des Malers zu übernehmen.
Halsbrecherisch! Das trifft es gut, phexverflucht! Wärst du bloß nicht so besoffen! Selbst nüchtern wäre die Acción nicht ohne Anspruch. Federigo, wo soll das mit dir enden? Da unten?
Unternehmungslustig wankte er mit der Anmut eines Thorwalers auf Landgang über die Galerie auf eine der Türen zu. Er strahlte sie an wie einen alten Zechkumpan und tippte sich wie zum Gruß an die Spitze seines Caldabresers. Obwohl er erst vor wenigen Stunden bei Bernhelm geklopft hatte, grübelte er, ob er tatsächlich vor dem richtigen Zimmer stand.
Das blassweiße Licht des Madamals fiel zwischen den Stützpfeilern hindurch und durchbrach an einigen Stellen die Schwärze der Nacht. Zahlreiche brünstige Zikadenmänner hatten aus unerfindlichen Gründen beschlossen, im Innenhof dieses Hauses um die Gunst ihrer Weibchen zu buhlen, während sich Federigo um Lautlosigkeit bemühte. Beinahe neidete er den liebestollen Tierchen ihre Sorglosigkeit. Tsa allein wusste wohl, wieso sich die Nachtschwärmer vor ihrem Rahjastündchen zunächst zu einem Sängerwettstreit treffen mussten, statt sich, über die Stadt verteilt, konkurrenzlos um ein Weibchen zu bemühen. Unwillkürlich fühlte sich Federigo an einen billigen Fasarer Puff erinnert, in dem notgeile Männer Gebote für die begehrteste Hure durch den Raum brüllten – der so groß gepriesene Unterschied zwischen Mensch und Tier wollte ihm dabei jedoch nicht so recht einleuchten. Er schüttelte den Kopf.
Mensch, Amigo, werd endlich klar in der Birne!
Mit geübtem Blick untersuchte er das Türschloss. Ein Kinderspiel! Die Hand glitt zum spannlangen Lederumschlag an seinem Gürtel, und er entrollte eine Reihe schmaler metallener Instrumente. Gute Schlösser waren eine kostspielige Angelegenheit, und jedes Zimmer mit einer mechanisch verschließbaren Tür auszustatten, galt als echter Luxus. Das hatte offenbar auch der Besitzer der Oase Akhram erkannt, denn er hatte sich für Schlösser minderer Qualität entschieden. Jeder, der schon einmal ein Fasarer Besteck aus der Ferne gesehen hatte, würde dieses Schloss öffnen können. Federigo fühlte sich beinahe in seiner Ehre gekränkt und bedachte die Tür mit einem vorwurfsvollen Blick. Sorgsam verglich er die Form der Kleinen Alriks mit denen des Schlosses. Dann fischte er einen Hakenschlüssel aus dem Leder und visierte das Schlüsselloch an. Seine Treffsicherheit hatte unter dem Alkoholeinfluss allerdings deutlich gelitten, und so gelang es ihm erst im dritten Anlauf, das Werkzeug in Position zu bringen. Nur eine leichte Drehung aus dem Handgelenk, und das verheißungsvolle Klicken verriet, dass die Tür ihm keinen weiteren Widerstand entgegensetzen würde.
Na bitte! Einfacher, als einem Kind den Valpobären zu klauen! Schnell verstaute Federigo die Nachschlüssel wieder an seinem Gürtel. Dann betrat er den Raum und schloss leise die Tür.
In Bernhelms Zimmer war es deutlich dunkler als im Innenhof der Oase. Das einzige Licht fiel durch das verzierte Bogenfenster herein und malte helle Muster auf Boden und Einrichtung. Federigo konnte die dunklen Umrisse eines Baldachins ausmachen, unter dem sich eine geräumige Schlafstatt befand. Die Decke lag ordentlich und unberührt unter zahllosen bunt bestickten Kissen. Als Federigo zwei Schritte weiterging, wäre er beinahe über den Saum eines der langhaarigen Teppiche gestolpert. Aus den Augenwinkeln konnte er neben dem Diwan eine Kerze auf dem Nachttisch ausmachen. Aber wozu brauchte ein Fuchs wie er schon Licht? Seine Augen hatten sich mittlerweile an das Halbdunkel gewöhnt, und schließlich wollte er das Risiko, entdeckt zu werden, so gering wie möglich halten. Sein Interesse galt nun der gegenüberliegenden Wand, an der er die Umrisse zweier Truhen und eines Schreibpults ausmachen konnte. Einen Moment lang bezweifelte er, im richtigen Zimmer zu sein, so ordentlich war es. Dann fiel sein Blick auf eine der Truhen, und er beschloss, es darauf ankommen zu lassen. Die meisten Menschen hielten es für außerordentlich einfallsreich, ihre Wertsachen zwischen ihren Kleidern oder in Schubladen zu verstecken. Federigo war sicher, dass auch sein Freund Bernhelm in dieser Beziehung nicht mehr Kreativität an den Tag gelegt hatte.
Mit einem dünnen Draht öffnete er das Schloss und begann, sich vorsichtig durch Bernhelms Garderobe zu tasten. Was Bernhelm hier in Khunchom auch verkaufen wollte, es musste klein genug sein, dass es sich vor neugierigen Blicken verstecken ließ. Andererseits war es wohl wertvoll genug, damit sich die weite Reise nach Khunchom auszahlte. Der füllige Garether, vorgeblich Tuchhändler, wollte sich in der Stadt nach neuen Stoffen und Handelspartnern umsehen. Federigo war nicht sicher, wie viel Glauben er dieser Information schenken sollte, denn Bernhelm hatte weder Waren mit sich geführt, noch unterwegs die Möglichkeit genutzt, sich auf einem der zahlreichen Märkte nach Stoffen umzusehen. Warum also sollte er den weiten Weg über den Raschtulsstieg und entlang des Mhanadi auf sich nehmen? Schon nach wenigen Tagen waren Federigo einige Merkwürdigkeiten im Verhalten seines Reisegefährten aufgefallen. Zuerst nichts Schwerwiegendes, aber die vielen kleinen Ungereimtheiten hatten ihn nachdenklich gestimmt. Der Händler hatte sich mit der Zeit immer seltsamer benommen, wenn er unter Menschen war. Immer wieder hatte er die Hände fest um seine Umhängetasche gelegt, als habe er panische Angst, bestohlen zu werden. Zuletzt hatte er sich sogar geweigert, Lebensmittel auf dem Markt zu kaufen, und Federigo geschickt, nur um nicht vor die Tür gehen zu müssen. Nie ließ er sein Hab und Gut aus den Augen, nicht einmal, wenn ihn der Ruf der Natur auf den Abort zwang. Federigo vermutete, dass ein Händler wohl kaum eine so kostspielige Reise unternahm, wenn er sich nicht entsprechenden Gewinn verspräche. Da Bernhelm es aber wiederum nicht so eilig hatte, als würde er verfolgt, konnte Federigo nur mutmaßen. War der Grund für seine Reise vielleicht ein besonders kostbares Verkaufsobjekt?
Der Almadaner hatte das stillschweigende Übereinkommen der beiden ungleichen Reisegefährten, keine Fragen über die Beweggründe des anderen zu stellen, geschätzt. Beide hatten sie die Geheimnisse des anderen respektiert. Aber da sich an diesem Abend die einmalige Gelegenheit ergab, nachzusehen, ohne dass Bernhelm jemals etwas davon erführe, hatte er beschlossen, seiner drängenden Neugier nachzugeben.
Allabendlich traf sich Bernhelm, so viel hatte Federigo aus dem Wirt der Oase herauskitzeln können, zu Verkaufsgesprächen außer Haus. Da er auch heute Abend noch nicht zurückgekehrt war, konnte das nur eines bedeuten: Er hatte noch nicht verkauft. Vielleicht war dies die letzte Gelegenheit für Federigo, das Geheimnis seines Freundes zu lüften. Selbst wenn Bernhelm das Verkaufsobjekt mit sich führte, konnte er vielleicht einen Hinweis darauf in seinen Unterlagen erhaschen.
Für einen Augenblick meldete sich sein schlechtes Gewissen, doch er brachte es mit einem harten Schnauben zum Verstummen. Schließlich hatte er nicht vor, etwas zu stehlen.
Immerhin hat Bernhelm dich heute versetzt! Wäre er wie verabredet aufgetaucht, hättest du ihm sein Geld auf den Tisch zählen können, und ihr hättet einen netten Abend verbracht.
Federigo ließ die Hand kurz über seinen prall mit Goldstücken gefüllten Geldbeutel gleiten. Die meisten davon würden ihren Weg, wie versprochen, noch diese Nacht in Bernhelms Taschen finden, als Entschädigung für die Reisekosten, die der Garether ihm vorgestreckt hatte. Federigo pflegte sein Wort stets zu halten, eine Frage der Ehre für einen aufrechten Almadaner. Besser, er zahlte seine Schulden sofort zurück. Am Ende vergaß er noch, weshalb er eigentlich gekommen war. Der Geldbeutel hing schwer an seiner Seite und klimperte bei jeder Bewegung. Warum also sollte er seinen Gürtel nicht von dieser schweren Bürde befreien?
Sorgsam zählte er die Goldmünzen in kleinen Türmen auf den Nachttisch. Es ärgerte ihn, dass er nur auf so umständlichem Wege zur Einlösung seines Versprechens gelangte. Den ganzen Abend hatte er damit verbracht, unten im Schankraum auf Bernhelm zu warten. Rahja verdammt! Anstatt die Wartezeit mit billigem Dattelwein totzuschlagen, hätte er heute Nacht glücklich und besoffen in den Armen einer wunderschönen Tulamidin liegen können. Wahrscheinlich war er der erste Einbrecher, der etwas daließ, statt etwas mitzunehmen – und der erste Schuldner, der seinem Gläubiger nachlief. Warum nur hatte der starrköpfige Wirt den Beutel nicht für Bernhelm annehmen wollen? Wahrscheinlich war es ohnehin besser so, schoss es Federigo durch den Kopf. Wer weiß, wo sein Geld am Ende gelandet wäre.
Er zählte gerade zwei weitere Münzen auf einen der Türme, als er beinahe sein Bauwerk umgestoßen hätte. Die Haare auf seinen Armen stellten sich auf, und es lief ihm kalt den Nacken hinunter. Er fühlte sich beobachtet, fast so, als wäre er nicht allein im Zimmer. Seine Hand suchte das Rapier an seiner Seite, während sein Blick durch das Halbdunkel glitt.
Die Kerze. Mit unsicheren Fingern tastete er nach seinem Zunderkästchen und entzündete den Docht. Flackernde Schatten zeichneten sich an den Wänden ab. Außer seinen eigenen, unregelmäßigen Atemzügen war es still im Raum. Beinahe zu still. Die einzigen Geräusche, die der Wind durchs Fenster trug, waren die Brunftgesänge der Zikaden und das leise Glucksen des Mhanadi, dessen Wellen sanft gegen die Uferstraße schwappten. Er schrak zusammen, als er eine Bewegung wahrnahm, und starrte auf den flackernden Schatten am Boden. Ihm war, als hätten sich seine Ausläufer ein Stück in seine Richtung bewegt.
Wahrscheinlich ist es nur ein Luftzug, der das Licht der Kerze bewegt, Federigo! Du siehst Gespenster. Verflucht noch mal, reiß dich zusammen!
Er stellte die Kerze auf den Nachttisch, um den Rest des Geldes zu deponieren. Dreißig Dukaten! Phexverflucht, was hatte er sich nur dabei gedacht! Wie hatte er dermaßen über seine Verhältnisse leben können? Zwar war er nicht mittellos aus Punin aufgebrochen, jedoch fast ohne Barvermögen. Glücklicherweise hatte Bernhelm die Wappenkette und den Armreif als Sicherheit akzeptiert. Aber in der Nähe seiner Heimatstadt konnte Federigo die Stücke unmöglich zu Barem machen. Erst in Khunchom, wo der Name ihres Besitzers wenigen etwas bedeutete, war es ihm gelungen, einen Käufer zu finden. Und obwohl zwischen Khunchom und Punin Hunderte Meilen lagen, war es nicht einfach gewesen.
Glücklicherweise schien sich der Zwerg wenig darum zu scheren, aus welch zweifelhafter Quelle Federigos Habe stammte. Der Angroscho war in Khunchom eine bekannte Größe – sofern man bei einem Zwerg von ›Größe‹ sprechen konnte – und bot in seinem Geschäft die absonderlichsten Dinge feil. Ganz den örtlichen Gepflogenheiten entsprechend, hatte er das zwergische ›Sohn des‹ in seinem Namen gegen ein tulamidisches ibn ausgetauscht und führte nun als Thuref ibn Taschbad den Kuriositätenladen am Rande des Basars. Knallhart hatte er Federigo auf die Hälfte des ursprünglichen Preises heruntergehandelt, wohl wissend, dass man erst zu ihm kam, wenn die meisten anderen Möglichkeiten ausgeschöpft waren.
Zähneknirschend hatte Federigo akzeptiert. Schließlich wollte er seine Schulden baldmöglichst zurückbezahlen. Außerdem erfüllte es ihn mit grimmiger Genugtuung, Geld für einen Diebstahl zu erhalten, den er tatsächlich einmal nicht begangen hatte.
Wäre er damals doch bloß nicht so verdammt wagemutig gewesen. Im Nachhinein betrachtet war die vorgezogene Liebesnacht mit seiner Zukünftigen das Risiko nicht einmal wert gewesen. Vom Parlieren in den Salons mochte sie vielleicht etwas verstanden haben, aber in Liebesdingen war sie unerfahren und geradezu sterbenslangweilig gewesen.
Wenn er nur wüsste, wer ihm ausgerechnet die Wappenkette seiner zukünftigen Schwiegereltern untergeschoben hatte. Es kränkte ihn noch heute, dass der Unbekannte tatsächlich angenommen hatte, Federigo wäre so töricht gewesen, ein dermaßen auffälliges Schmuckstück zu stehlen. Man hatte es darüber hinaus auch nicht versäumt, seinen Schwiegervater in spe über das nächtliche Schäferstündchen zu unterrichten. So hatte sich Federigo, unerwartet und leicht bekleidet, ein rasantes Duell mit dem Hausherrn liefern müssen und war danach bei Nacht und Nebel aus der Stadt getürmt. Um jeden Preis galt es, eine Familienfehde zu vermeiden. Zu locker saßen die Klingen in den Gehängen der hitzigen Almadaner. Zu leicht hätte das Ganze in einer Tragödie enden können.
Der einzige Trost, als er seiner Heimatstadt blutenden Herzens den Rücken gekehrt hatte, war der Gedanke, nicht auf ewig an ein und dieselbe, wenig aufregende Gattin gebunden zu sein.