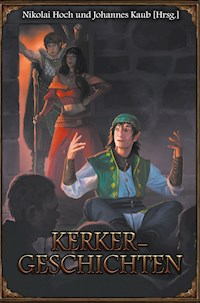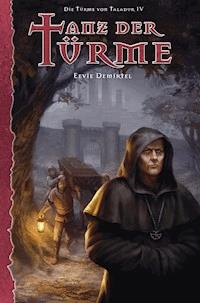Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
DSA5 Kurzgeschichtenband Sterne fallen vom Himmel und auf Aventurien haben Menschen wie Nichtmenschen, von Bauer Alrik bis hin zu Klerus und gekrönten Häuptern, Visionen vom Untergang, richtige und falsche, mögliche und unmögliche. Die Mauern Alverans erbeben, die Ketten des Dreizehnten Gottes rasseln, und wenn eine Entität mächtig wie er auch nur den kleinen Finger rührt, werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus. Die Weltzeitwende bringt große Veränderungen für Aventurien mit sich, und allein wackere Helden mögen das Zünglein an der Waage sein, wenn es um das Schicksal eines gesamten Kontinents, ja einer gesamten Welt geht. Dieser Kurzgeschichtenband versammelt Geschichten rund um das schicksalhafte Ereignis des Sternenfalls. Enthalten sind mehr als 20 phantastische Geschichten, welche die Leser in die verschiedensten Winkel Aventuriens führen und manchmal sogar darüber hinaus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgeber Eevie Demirtel
Autorinnen & AutorenEevie DemirtelMarco FindeisenMike Krzywik-GroßDaniel HeßlerM. A. LippertMichael MasbergCarolina MöbisMarie MönkemeyerDaniel Simon RichterGudrun SchürerStefan SchweikertAlex SpohrJens UllrichJudith C. und Christian VogtJosch K. Zahradnik sowie Lena Zeferino
Sternenleere
24 Kurzgeschichten aus der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Mit aufrichtigem Dank an alle Spieler und Leser, die uns jeden Tag aufs Neue zum Schreiben inspirieren.
»Great heroes need great sorrows and burdens, or half their greatness goes unnoticed. It is all part of the fairy tale.«
—Peter S. Beagle, The Last Unicorn
Impressum
Ulisses SpieleBand US25702Titelbild: Nadine SchäkelLektorat: Eevie DemirtelKorrektorat: Stephan Naguschewski, Marco FindeisenUmschlaggestaltung und Illustrationen: Nadine SchäkelLayout und Satz: Michael Mingers
Copyright © 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR. Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Printed in the EU.
Print-ISBN 978-3-95752-117-0Ebook-ISBN 978-3-95752-255-9
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
willkommen in der phantastischen Welt des Schwarzen Auges! In diesem Erzählband dreht sich alles rund um den Sternenfall, jenes mystische Ereignis, das Aventurien in eine neue Heldenzeit begleitet. Die 24 Geschichten dieser Anthologie wurden von 17 verschiedenen Autorinnen und Autoren ersonnen, und sie allesamt handeln von den großen und kleinen Veränderungen, die dieses Ereignis für die Welt und die unterschiedlichen Völker, die in ihr Leben, mit sich bringt.
Sternenleere versammelt Erzählungen aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Aventuriens. Einige wagen sich auch über die Grenzen des Kontinents hinaus ins ferne Güldenland oder sogar in den Limbus, die Welt zwischen den Sphären.
Jetzt aber genug der Vorrede: Lasst euch von den phantastischen Geschichten in den zauberhaften Bornwald entführen, in die weiten Steppen des Orklandes oder bis auf die höchsten Gipfel der Hohen Eternen. Erlebt die Ereignisse rund um den Sternenfall in der verdorbenen Dämonenstadt Yol-Ghurmak, den märchenhaften Tulamidenlanden, dem Arenarund von Al’Anfa oder in den Gassen der Kaiserstadt Gareth.
Wir wünschen euch eine phantastische Lektüre!
Kent an einem sonnigen Herbsttag 2015
Eevie Demirtel
Pflicht – Teil I von Marie Mönkemeyer
Bei Porta Yaquiris, 290 Jahre vor Bosparans Fall
»Wir hätten dort sein sollen! An ihrer Seite streiten! Es waren unsere Kameraden! Wir haben sie im Stich gelassen und jetzt sind sie tot!« Die Stimme von Reitereipräfekt Aradnus war ein dumpfes Grollen voll Zorn und Verzweiflung.
»Und die Löwenanbeter werden noch nicht genug Blut vergossen haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie kommen. Bis dahin sollten wir wissen, mit welcher Taktik wir ihnen begegnen.« Centurio-Maga Cirania war eine zutiefst praktisch veranlagte Frau, die den Blick stets nach vorne richtete. Nur der harte Griff um ihren Magierstab zeigte die Gefühle, die in ihrem Inneren brannten. Ich schwieg, auch wenn ich wusste, dass sie auf meine Worte warteten.
Zwei Monate zuvor war die Schlacht an den Bluthügeln geschlagen worden. Eine große Entscheidung, ein Götterduell hatte es sein sollen, wer es verdient als Gott des Krieges verehrt zu werden: Rahandra oder Shinxir. Die Diener der Löwengöttin hatten betrogen und gesiegt. Von den Streitern Shinxirs war niemand am Leben geblieben.
Ich war nicht bei ihnen gewesen. Und das, obwohl ich ein Priester des Göttlichen Feldherrn war. Aber mein Platz war seit 36 Jahren bei den Legionen, ich konnte die Männer und Frauen nicht allein ihrem Schicksal überlassen. Als meine Brüder und Schwestern zu den Waffen riefen, hatte ich mich viele Stunden im Wesen unseres Gottes versenkt. Doch ganz gleich, wie ich in der Meditation die Steine auf dem Spielbrett bewegte oder mit der Waffe übte, bis mein linkes Bein den Dienst versagte, das Ergebnis war immer dasselbe. Eindeutig und doch kaum verständlich. Shinxir befahl mich in seine Dienste, doch er rief mich nicht zur Schlacht.
Er war mein Gott und oberster Feldherr. Was er von mir verlangte, würde ich tun. Und so war ich bei der Legion geblieben.
Seit der Schlacht an den Bluthügeln herrschte Rahandra als einzig wahre Kriegsgöttin. Und seitdem kroch Angst in dicken, zähen Strömen zwischen den Zelten hindurch. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Glaube an Shinxir verboten, Priester exekutiert und Gläubige aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Offiziere wie Soldaten duckten sich, passten sich an und leisteten Bekenntnisse zu Rahandra. Oder sie glaubten, dass dies wahrhaft der Wille der Götter war.
Und so kam es, dass wir jeden Abend zu dritt in meinem Zelt saßen statt in der Offiziersmesse und unausgesprochene Fragen den Raum zwischen uns füllten.
Aradnus und Cirania waren mehr als tief gläubige Kameraden und gute Offiziere, sie waren Freunde, beide bereit, ohne Zögern ihr Leben für mich zu geben. Sie nahmen mit Schweigen Rücksicht auf mich und lenkten ihren Zorn auf die Diener Rahandras und die Offiziere, die mich von einem Tag auf den anderen mieden. Doch sie sehnten sich nach Antworten. Hätten sie mit in die Schlacht ziehen sollen? Sollten sie die verbliebenen Shinxirtreuen um sich scharen und einen Krieg mit den Löwinnendienern beginnen? Sollten sie gar den Tod suchen? Was war Shinxirs Wille?
Ich hatte mir diese Frage selbst oft gestellt.
Einen Großteil meines Lebens und in den letzten Monaten umso mehr. Ich hatte sie mir gestellt, vor allem aber meinem Gott. Stundenlang hatte ich darüber meditiert, bis die schwarzen und goldenen Quadrate des Spielbretts meinen Geist ausfüllten und alles andere verdrängten. Zwölf mal zwölf Felder, schwarz und gelb wie eine Hornisse, ordentlich wie ein Legionslager. Ein Spiel, das Taktik forderte, planvolles Vorgehen und schnelle Reaktion auf unerwartete Züge des Gegners. System und Taktik, Disziplin und Ordnung, Kameradschaft und Gemeinschaft.
Auch jetzt richtete ich meinen Blick fest auf das Spielbrett, das auf dem Tisch stand, umrahmt von Aradnus’ und Ciranias Weinpokalen. Ich hatte es seit über einem Jahr nicht mehr weggeräumt.
Zwölf mal zwölf Felder, darauf für beide Spieler jeweils zwölf Steine. Einzeln hatte keiner von ihnen Bedeutung. Nur im Zusammenspiel der Gruppe hatten sie Bedeutung – wie eine Legion. Um zu siegen, mussten sie richtig eingesetzt werden, systematisch und überlegt. Ein einzelner Stein konnte wertlos werden. Oder, von der Gemeinschaft gestärkt, auf der richtigen Position den Sieg ausmachen.
Shinxir war kein ungestümer Kämpfer, der sich unbedacht gegen jeden Herausforderer warf. Er war ein Feldherr, ein Stratege, der im Voraus plant und seine Reserve nicht sinnlos verheizt. Und er war mein Gott.
»Übrigens, sollten sie dich verhaften wollen, ich halte immer mein schnellstes Pferd für dich bereit«, brach Aradnus in meine Gedanken ein und klopfte mir aufmunternd auf die Schulter.
Ich riss den Blick von den schwarzen und goldenen Feldern los. Es würde ein wirklich gutes Tier sein, als Präfekt der Reiterei war er anspruchsvoll. Aber ich brauchte es nicht. »Danke, aber das ist nicht nötig.«
»Wenn du meinst.« Er zuckte skeptisch die Achseln und griff nach dem Wein.
»Ja. Ich werde nicht fliehen. Es ist Zeit für Taten.«
An der Art, wie sich Cirania vorbeugte und Aradnus kurz in der Bewegung stockte, erkannte ich, dass sie darauf gewartet hatten. Auch Offiziere saßen nicht gerne herum, ohne zu wissen, wann oder ob es neue Befehle gab.
»Wenn auch wir als Märtyrer sterben, wer soll dann Shinxir dienen? Wer soll die Heiligtümer bewahren und wer den Streitenden ehren? Ihr wisst, was man tut, wenn man eine Schlacht verliert. Setzt man sich in die Ecke und weint? Nein! Man zieht sich zurück, sammelt die Kräfte und formiert sich neu. Und genau das werden wir tun. Heute mag die donnernde Löwin gesiegt haben, doch das heißt nicht, dass es immer so sein muss, oder gar, dass der Krieg vorbei ist. Die nächste Schlacht kommt, und eines Tages wird Shinxir wieder die Verehrung zuteil, die ihm gebührt.«
Sie sogen Trost aus meinen Worten und vorsichtige, zögerliche Hoffnung.
»Wenn der Krieg nicht vorbei ist, sollten wir dann nicht eine Armee aufstellen und sie gegen Rahandras Diener führen?« Cirania suchte immer nach einer Möglichkeit zu handeln.
»Nein. Wir ziehen uns zurück. Ihr könnt in der Legion bleiben, wenn ihr wollt, ich werde mich als Privatmann auf dem Besitz meiner Familie niederlassen.«
»Also doch abhauen«, grummelte Aradnus in seinen Pokal.
Ich warf ihm einen tadelnden Blick zu, unter dem er rot wurde und Haltung annahm wie ein gescholtener Rekrut.
»Bitte um Entschuldigung!«
Ich winkte ab, bevor er ausgesprochen hatte. Aradnus stammte aus dem Grenzland zu Corapien und seine Umgangsformen waren allem Drill zum Trotz noch immer so schroff und wild wie seine Heimat, das würde sich nie ändern.
»Meinst du, dass du dort sicher bist?«, fragte Cirania.
»Ja. Ich werde alt und bin noch dazu ein Krüppel. Welche Gefahr soll ich schon sein?« Ich tippte auf mein linkes Bein und lächelte.
»Du bist kein Krüppel«, widersprach mir Cirania entschlossen. Noch etwas, das sich nie ändern würde. Sie brauchte es für sich selbst, dieses Wort nie zu akzeptieren, einfach um sich zu vergewissern, dass sie alles ihr Mögliche getan hatte.
Ich war noch ein junger Mann gewesen und sie noch in der Ausbildung, als ein feindlicher Pfeil mein Pferd traf. Im Sterben begrub mich das Tier halb unter sich und ich wäre sicher in Shinxirs jenseitige Heerscharen eingegangen ohne Cirania. Sie half, mich unter dem Pferd hervorziehen, und heilte unter großem Risiko für ihr eigenes Leben meine schlimmsten Verletzungen. Dass ich lebte und wieder laufen konnte, wenn auch hinkend, verdankte ich ihr.
»Sollen mich doch einige so sehen. Du weißt, der gefährlichste Feind ist der, den man unterschätzt.«
»Ja.« Sie nickte. »Du sagst, zurückziehen und warten. Bis wann?«
»Bis zu Shinxirs nächster Schlacht.«
Aradnus runzelte die zauseligen Brauen, Cirania sah aus, als würde sie innerlich die Augen verdrehen ob der Offensichtlichkeit meiner Antwort.
Die Wahrheit war für einen sterblichen Geist nicht einfach zu erfassen. Aber ich brauchte die beiden, alleine würde ich an dem Vorhaben scheitern, nicht heute oder morgen oder in einigen Jahren, aber wahrscheinlich irgendwann später. Ich konnte meine priesterliche Autorität nutzen, aber sie würde mich nicht überleben. Die beiden mussten überzeugt dabei sein. Deswegen musste ich ihnen erklären, wofür ich selbst kaum Worte hatte. »Es wird vielleicht eine sehr lange Zeit sein. Der Streitende ist ein Gott, und Götter ... sie ... sie denken in anderen Dimensionen. Für sie sind wir klein, wie ein Stein auf dem Spielbrett. Zeit ist für Götter ... anders. Hundert Jahre mögen für uns Sterbliche sehr lang sein, doch für Götter sind sie kaum länger als ein Augenblick.
Es wird einen Tag geben, an dem Rahandras Schwert stumpf wird und Shinxir erneut gegen sie kämpft. Dieser Tag wird kommen, ich weiß es, ich habe es gesehen! Aber ich weiß nicht wann. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es an diesem Tag immer noch Menschen gibt, die Shinxirs Kampf hier, im Diesseits, auf der Erde, unterstützen, damit der göttliche Feldherr den Sieg erringen kann, wenn seine Zeit gekommen ist.
Ich weiß, es mag eine lange Zeit sein, aber wir dürfen uns davon nicht abschrecken lassen. Die Stunde des Streitenden wird kommen! Und wir werden unseren Teil dazu beitragen, auf unserem Posten als seine treuen Soldaten.«
Weiter in Pflicht Teil II
Kräuterkunde von Gudrun Schürer
Am Rande des Bornwaldes, Peraine 1038 nach Bosparans Fall
»Yoline!«
Der Ruf schallte von der Hütte zu der jungen Frau, die sich einen Steinwurf entfernt an dem Unkraut unter einer Hecke von Weißdornbüschen zu schaffen machte.
»Das geht schon so, seit du tot bist«, murrte sie eine Schlüsselblume an und zupfte die vertrockneten Blüten ab.
»Yoli-i-ine!«
Die Stimme war diesmal eine andere.
»Das ist noch in Gartimpen zu hören«, seufzte die Frau und verteilte etwas Erde um einen Widderhornschößling, der sich zwischen dem Weißdorn angesiedelt hatte.
»Yo-o-li-ine! Es wird Zei-eit!«, erschallte es im Duett.
»Was sage ich: Gartimpen. Im ganzen Bornwald!« Sie runzelte die Stirn. »Aber du warst auch kein bisschen anders als die beiden. Albern wie Klein-Alrik an seinem dritten Tsatag. Possenreißer hättet ihr werden sollen, keine Töchter Satuarias.«
Sie erhob sich und betrachtete liebevoll das Grab. Trotz ihrer unwirschen Worte vermisste sie ihre Lehrerin.
»Ich möchte nur wissen, wer sich den Unfug mit den Namen ausgedacht hat. Als wären es eine Amtsbezeichnung, die von der Lehrerin an die Schülerin weitergegeben wird. Zwei Yolinen sind doch wirklich genug!«
Mit den letzten Worten wandte sie sich dem nächsten Grab zu, dem zweiten in einer Reihe von vier. »Das ist doch bestimmt noch auf eurem Mist gewachsen.«
Sie bückte sich, um einen letzten Grashalm aus der Erde zu zupfen, als ihr plötzlich etwas auf die Kehrseite klatschte. Erbost drehte sich sich um. Das etwas war ein Kochlöffel, der vor ihrer Nase schwebte und einladend hin und her wippte. »Yoline!«, rief es erneut im Chor. »Es ist Zeit für die Suppe!«
Ungehalten schnappte sie sich den Löffel aus der Luft und stapfte zur Hütte, wo zwei alte Vetteln sie eilig an die Feuerstelle winkten, auf der ein riesiger Kochtopf stand.
»Ich wünschte, ihr würdet das lassen!«, fuhr sie die beiden an. »Yoline liegt draußen unter dem Weißdorn. Neben Yoline, Maline und Zeline.«
Die beiden zeigten sich unbeeindruckt. »Zeline sammelt die Kräuter, Maline hackt die Kräuter, Yoline rührt die Suppe um«, leierten sie im Chor, wobei sie auf die jeweilige Namensträgerin zeigten. »Das hat Tradition.«
Die Yoline Geheißene strafte sie mit Schweigen.
»Du brauchst ein Schälchen Kräutersuppe«, bemerkte Maline, die Alte zu ihrer Rechten.
»Besser gleich zwei«, kicherte Zeline zu ihrer Linken.
»Aller guten Dinge sind drei«, berichtigte Maline. »Wie die drei Gartimpener Schwestern, deren Kräutersuppe auch die schlimmste Übellaune vertreibt. Yoline, schwing’ den Löffel!«
Seufzend gab Yoline auf und tauchte den Kochlöffel in die sämige Brühe. Unterdessen hatten sich drei Schleiereulen auf dem hölzernen Kronleuchter niedergelassen, der von der Decke hing, und zankten sich um den besten Platz. Maline griff nach dem ersten einer Reihe von Kräuterbündeln, die ordentlich nebeneinander auf dem Tisch neben der Herdstelle lagen. Mit geschickten Fingern zupfte sie Stiele und Stängel von den Blättern, griff sich das größte und schärfste Messer, das die Hexen besaßen, wischte es an Zelines Schürze blank und hackte die Kräuter in kleine Stücke. Diese sammelte sie vom Tisch in die hohle Hand und ließ sie gleichmäßig in den Kochtopf gleiten.
»Beifuß«, verkündete sie und wandte sich dem nächsten Bündel zu.
»Dann der Kerbel«, sagte Yoline, die fleißig rührte.
»Und das reichlich«, ergänzte Zeline.
»Dann schmeckt das Süppchen unvergleichlich«, kicherte Maline, als sie die nächste Portion Kräuter in den Topf warf.
»Sauerklee«, forderte Yoline.
»Aber schnell, gleich gefolgt vom Bibernell«, legte Zeline nach.
Ein Kraut nach dem anderen wanderte in die Brühe: Kresse, welche sehr gesund, Petasil, den ganzen Bund, Salbei, geschnitten in der Nacht, Gilbornskraut, das lustig macht, Widderhorn nur knapp gemessen, wurde nicht noch was vergessen?
»Schnittlauch!«, riefen die Schwestern, als das letzte Grün im Topf verschwand.
Sechs Augenpaare folgten der Bewegung des Kochlöffels, der eine Spirale grüner Sprenkel hinter sich herzog. Als die ersten Blasen auf der Oberfläche der Flüssigkeit zerplatzten, hielt Yoline inne.
»Suppe!«, sprach sie. »Zeige uns, was in dir steckt!«
Eine große Dampfblase stieg vom Boden des Topfes empor und mit ihr eine Kräuterwolke, die auf der Oberfläche herumwirbelte, nachdem die Blase den Hexen ihren Dampfatem ins Gesicht gehaucht hatte. Die Kräuter sammelten sich wie auf Geheiß in der Mitte des Topfes und formten sich zu einem Bild.
»Ein Schaf«, sagte Zeline.
»Eine Wolke«, vermutete Maline.
Nacheinander lösten sich Schnittlauchstückchen aus der Ansammlung und schwammen in gezackter Linie auf den Topfrand zu.
»Ein Gewitter!«, riefen die Schwestern wie aus einem Mund.
Die Suppe antwortete mit einer weiteren Dampfblase, die das Bild der Sturmwolke verschwinden ließ.
»Das hat mir mein Hühnerauge auch schon verraten«, beschwerte sich Maline. »Es juckt ganz entsetzlich.«
An ihr Ungemach erinnert, streifte sie den Pantoffel von ihrem rechten Fuß und kratzte sich ausgiebig an der großen Zehe. Yoline nahm ihre Arbeit am Kochlöffel wieder auf. Die nächste Blase trug die Kräuter an die Oberfläche. Sie sortierten sich und zeigten den Umriss eines Menschen.
»Ein Mann«, stellte Yoline fest.
Der Umriss wurde größer.
»Ein großer Mann«, ergänzte Zeline.
Der Umriss wuchs weiter und gleichzeitig entspross dem Gesicht ein langer Bart.
»Ein Riese!«, rief Maline.
Auf der linken Wange bildete sich ein kleiner Wirbel, der sich rhythmisch weitete und wieder zusammen zog.
»Ihm schlägt das Herz in der Backe«, mutmaßte Yoline.
Das Pulsieren wurde stärker, die Gestalt krümmte sich.
»Er hat Schmerzen«, meinte Zeline.
»Er hat einen bösen Zahn«, folgerte Maline.
»Milzenis hat Zahnschmerzen!«, riefen die Hexen im Chor.
Eine Blase stieg auf und das Bild verschwand. Vom Kronleuchter ließ sich ein besorgtes Gurren hören.
»Nicht du, Milzenis«, beruhigte Maline ihren Vertrauten. »Du hast gar keine Zähne. Der Riese Milzenis hat offenbar einen bösen Zahn. Wir sollten ihn alsbald besuchen und etwas aufmuntern, den Armen.«
Yoline rührte weiter, eine Blase stieg auf und hinterließ das Bild dreier Frauen.
»Drei Frauen«, sagte Maline.
Eine der Frauen hob den Arm und winkte.
»Das sind wir«, stellte Zeline fest und winkte zurück.
Die mittlere der Kräuterfrauen trug etwas auf dem Arm.
»Was hat sie da?«, fragte Yoline. »Ein Bündel vielleicht?«
Das Bündel streckte zwei Ärmchen von sich.
»Ein Kindlein!«, rief Maline erstaunt und blickte, wie auch Zeline, die dritte Schwester an. »Hast du etwa ein süßes Geheimnis?«, wollte sie wissen.
Yoline wurde rot. »Hab’ ich nicht!«, empörte sie sich. »Welch ein Unfug!«
»Aber wir haben es gesehen«, riefen die beiden Alten.
»Aber wir haben es nicht gesagt«, beharrte die Jüngere.
Zeline nahm ihrer Schwester den Löffel aus der Hand und rührte in der Brühe. Das Bild kehrte umgehend zurück. Yoline starrte gebannt auf das nun zappelnde Bündel. Dieses wand sich in den Kräuterarmen seiner Mutter, sprang herab und lief auf allen Vieren zum Topfrand. Sein Hinterteil zierte ein Ringelschwänzchen.
»Alberne Weiber«, murrte Yoline und riss den Löffel wieder an sich. »Nur Unfug im Kopf. Als wäre alles nur Spiel und Schabernack. Irgendwann passiert aus lauter Ulk etwas ganz Schlimmes und dann ist das Gejammer groß.«
Die beiden Alten kicherten vergnügt und knufften sie in die Seite. »Ganz schlimmes Gejammer«, bestätigten sie.
Die Dampfblase stieg, eine Hütte erschien. Ein kleines Wesen lief flügelschlagend darauf zu, gefolgt von einem vierbeinigen Räuber mit spitzer Schnauze und buschigem Schwanz.
»Unser Hühnerstall!«, riefen die drei Hexen entsetzt, doch die Suppenbotschaft war noch nicht zu Ende. Vom Rand her stürzte sich pfeilschnell ein Schatten auf den Fuchs, packte ihn mit den Krallen, hackte ihn mit dem Schnabel und schüttelte ihn, bis er die Flucht ergriff.
»Eine Eule«, seufzte Maline erleichtert.
Die Eulen auf dem Kronleuchter reckten die Hälse. Diese bedeutende Botschaft wollten sie sich nicht entgehen lassen.
»Meine Eule«, hauchte Yoline entzückt.
»Mim vertreibt den Hühnerdieb!«, riefen die Schwestern zusammen und wandten ihre Blicke den Vögeln zu. Die kleinste der drei Eulen plusterte sich sichtlich zufrieden auf, während die beiden anderen mit neuem Respekt auf ihre Gefährtin blickten. Milzenis hüpfte ein Stück zur Seite, um für die künftige Heldin den besten Aussichtsplatz zu räumen.
Mit einem lauten Glucksen zog die Suppe die Aufmerksamkeit aller Anwesenden wieder auf sich. Yoline rührte und eine neue Dampfblase stieg empor. Diesmal schienen die Kräuter willkürlich auf der Oberfläche verteilt zu sein. Die Schwestern blickten ratlos in den Topf.
»Mehr hast du uns nicht zu sagen?«, fragte Zeline.
Eine Gruppe grüner Sprenkel verdichtete sich, formte einen Kopf und einen langen Körper und schlängelte sich zum Topfrand, wo sie elegant in der Tiefe verschwand. Gleich darauf tauchte das ursprüngliche Muster an der gleichen Stelle wie vorher wieder auf.
»Eine Schlange?«, fragte Maline zweifelnd.
»Das Sternbild!«, rief Yoline und klatschte in die Hände, erfreut über ihren Einfall. »Seht, dort ist auch der Fuchs mit den spitzen Ohren.«
»Der ganze Götterkreis. Und hier ist der Drache, daneben der Held.« Zeline deutete aufgeregt mit dem Finger auf die Kräutersterne. Die Suppe gab ein warnendes Blubbern von sich und sie zog die Hand geschwind zurück. Dann kam Bewegung in die Kräuter. Da war die Schlange wieder. Sie schlängelte und krümmte sich und bildete schließlich einen Kreis.
»Was macht sie da?«, fragte Maline verwundert.
Erneut verdichtete sich das Sternbild, bildete einen Kopf und einen langen Körper, dessen Ende nun dort lag, wo das Maul der Schlange sein musste.
»Die Schlange beißt sich in den Schwanz!«, riefen die Schwestern.
Der Sternenhimmel im Topf verabschiedete sich in einer großen Blase und ließ die Hexen verwirrt zurück.
»Die Schlange beißt sich in den Schwanz«, wiederholte Maline. »Das kann nicht sein.«
»Aber wir haben es gesagt«, stellte Zeline fest.
»Also ist es wahr«, bestätigte Yoline.
Die Hexen sahen sich besorgt an und überlegten, ob sie sich nicht vielleicht doch schon einmal getäuscht hatten. Auch die Vögel waren unruhig, obgleich diesmal keine Eulen vorgekommen waren. Aber Schlangen, durchaus schmackhaft für die nächtlichen Jäger, waren wohl auch sehr interessant.
Die Grübelei wurde von der ungeduldigen Suppe unterbrochen, die Yoline mit einem Gurgeln an ihre Aufgabe erinnerte. Sie rührte. Eine Dampfblase stieg empor und mit ihr erneut der Sternenhimmel. Die Schwestern schwiegen betroffen.
Die Änderung war kaum zu bemerken. Ein einzelnes Schnittlauchröllchen drehte sich rasend schnell um sich selbst und verschwand.
»Das Auge des Drachen«, bemerkte Zeline. »Es hat sich geschlossen.«
»Der Drache schläft ein«, wisperten die Schwestern gemeinsam.
Eine neue Blase und wieder erschien der Sternenhimmel.
»Wenn wir es nicht sagen, wird es vielleicht nicht wahr«, flüsterte Maline verschwörerisch, als würde sie fürchten, die Suppe könnte sie hören.
»Meinst du?«, fragte Yoline zweifelnd.
»Wir sollten es versuchen«, meinte Zeline entschlossen.
Die Schwestern sahen einander an und nickten sich zu. Yoline rührte die sich aufbäumende Stute weg. Als sie damit aufhörte, lag der Sternenhimmel, so wie er sein sollte, wieder vor ihnen. Die Hexen seufzten erleichtert auf und warteten auf neue Botschaften. Nur Yolines wache Augen bemerkten, dass im Sternbild des Schwertes die Spitze verschwand und sie rührte wieder abermals kräftig um. Diesmal blieben alle Sterne an ihrem angestammten Platz. Nahe des Gehörns jedoch erschienen fünf neue.
»Ein neues Sternbild«, stellte Zeline erstaunt fest.
»Ist das eine Schale?«, fragte Maline.
»Ein Ke...«, setzen die Schwestern gemeinsam an, hielten aber gerade rechtzeitig inne, bevor sie das Wort ausgesprochen hatten.
Yoline rührte weiter und vertrieb das fremde Sternbild mit ihrem Kochlöffel. Danach verscheuchte sie den Raben, der sich zwischen Fuchs und Storch gedrängelt hatte, und jagte den Hund zurück an seinen Platz. Yoline rührte und rührte.
»Der Sternenhimmel spielt verrückt«, stieß Zeline hervor.
»Verrückter als die Gartimpener Schwestern!«, rief Maline.
»Zu verrückt für uns!«, beschlossen sie gemeinsam und Yoline schob den Deckel auf den Topf, in dem sich die Eidechse gerade zwei weitere Beine wachsen ließ. Die Suppe begann zu brodeln, wie es Suppen für gewöhnlich tun.
»Es ist Zeit für das Abendmahl«, stellte Zeline fest.
Die Eulen ließen sich elegant vom Kronleuchter auf die Lehnen der drei Stühle gleiten, die um den Tisch standen. Zeline stellte Schalen auf den Tisch, drei große und drei kleine, Maline zog den Topf von der Herdstelle und Yoline tauschte den Kochlöffel gegen eine Schöpfkelle.
Nach der ersten Schale Suppe wich die Beklemmung, nach der zweiten Schale war der verrückte Sternenhimmel fast schon vergessen und nach der dritten kicherte sogar Yoline und die Eulen klapperten vergnügt mit den Schnäbeln.
»Mir steht der Sinn nach Eierkuchen«, verkündete Maline.
»Mit Honig«, stimmte Zeline zu.
»Und Schmalz«, ergänzte Yoline.
»Ich hole die Eier«, beschloss Maline.
»Ich schlage sie auf«, bot sich Zeline an.
»Ich rühre sie um«, erklärte Yoline.
Wenig später, das Mehl stand bereit, in der Pfanne zerfloss das Schmalz mit köstlichem Duft und Maline hatte den großen Honigtopf auf den Tisch gestellt, zerschlug Zeline das erste Ei am Rand einer hölzernen Schüssel. Yoline, den Löffel in der Hand, stieß einen spitzen Schrei aus, als statt des Dotters ein weißes eiförmiges Gebilde aus watteartigem Gespinst in die Schüssel plumpste. Die auf den Eierkuchen wartenden Eulen hüpften auf den Tisch und umringten neugierig die Schüssel. Beherzt pickte Milzenis einen großen Fetzen aus dem Kokon. Er verbarg etwas Schwarzes. Es zuckte.
Diesmal war es Zeline, deren spitzer Schrei alle aufschreckte. Die Vögel flüchteten auf den Kronleuchter und im Gerangel stießen sie die Schüssel vom Tisch. Sie fiel klappernd zu Boden, das Gebilde kullerte in die Mitte der Stube. Maline riss die Pfanne von der Herdstelle und ließ sie wie einen Vorschlaghammer auf das Watteei donnern. Es breitete sich erstaunlich großflächig auf dem Stubenboden aus. Die Hexe zog die Pfanne beiseite. Hin und her gerissen zwischen Grausen und Neugier betrachteten die Schwestern, was vor ihnen lag.
»Ist das ein Kopf?«, fragte Maline und deutete auf einen apfelgroßen schwarzen Fleck.
»Oder ist das der Kopf?«, sinnierte Yoline über den birnenförmigen Umriss am anderen Ende des Wesens.
»Es hat zu viele Köpfe«, stellte Zeline fest.
»Oder zu viele Leiber«, ergänzte Maline.
»Und zu viele Beine«, zählte Yoline nach. »Oder ist das ein Schwanz?«
Vom Kronleuchter ertönte ein Schmatzen und Würgen. Schließlich spuckte Milzenis den Schwestern einen schleimigen Wattebausch vor die Füße, aus dem ein haariges schwarzes Insektenbein ragte.
»Kein Schwanz«, beschloss Zeline. »Sechs Beine. Hat es Flügel?«
Das ließ sich nicht recht erkennen.
»Oder gar einen Stachel?«, erkundigte sich Maline besorgt.
Auch das blieb den Schwestern verborgen.
»Lasst uns sehen, was in den anderen ist«, schlug Zeline vor, hob die Schüssel vom Boden und schlug die beiden anderen Eier auf, die Maline zusammen mit dem befremdlichen Fund aus dem Hühnerstall geholt hatte. Sie enthielten goldgelbe Dotter in klarem Eiweiß. Erleichtert wandten sich die Hexen wieder dem Bild auf ihrem Stubenboden zu.
»Was ist das für ein Wesen? Eine Ameise? Ein Käfer? Eine Hornisse?«, wisperte Yoline.
»So groß!«, staunten die Hexen wie aus einem Mund.
»Jedenfalls ist es kein Huhn«, konstatierte Maline nach einer Weile, deren Sinn für das Praktische die Oberhand gewann. »Wir wollten Eierkuchen machen.«
Die Eulen, inzwischen schon etwas ungeduldig, flogen wieder auf die Lehnen der drei Stühle, die um den Tisch standen.
»Ich rühre die Eier«, bot sich Yoline an.
»Ich wärme die Pfanne«, meinte Zeline.
»Dann wische ich die Schweinerei auf«, beschloss Maline und hieß mit einem Wink ihrer Hand den Eimer, sich Wasser vom Brunnen zu holen.
Der Marsch der Hundert von Stefan Schweikert
Kaiserstadt Gareth, Mitte Peraine 1038 nach Bosparans Fall
»Euer Gnaden! Wacht auf!«
Die Konturen eines Mädchens stahlen sich zwischen Juniveras schlaftrunkene Lider. Es hüpfte aufgeregt auf der Stelle, als habe es den rechten Moment, auf den Abtritt zu gelangen, fast verpasst.
»Ähm? - Was ist denn?«, murmelte Junivera.
»Verzeiht, Euer Gnaden! Ich wollte Euch nicht wecken. Aber er ließ sich nicht beruhigen und wollte auch nicht bis zum Morgen warten, Euer Gnaden. Es tut mir leid, Euer Gnaden.«
»Nenn mich nicht immer Euer Gnaden«, murmelte Junivera. »Und von wem redest du? Ist Geronius hier?«
Das Zappeln endete abrupt. Der Novizin schoss die Röte ins Gesicht, sie senkte den Kopf und erwiderte: »Nein, Euer Gnaden. Nicht Euer ... nicht der Herr Rechtswahrer.«
Junivera musste lächeln. Noch vor einem Jahr hatte die kleine Novizin Angst vor dem meist finster dreinschauenden Mann gehabt, der unregelmäßig im Siechenhaus im Sonnengrund erschien, um dessen Leiterin, die Dienerin der Ähre Junivera Algerein, zu besuchen. Das hatte sich geändert: Inzwischen himmelte Emer Geronius Bosko geradezu an. Aber wünschte sich nicht jedes junge Mädchen einen geheimnisvollen Fremden, der es in ein großes romantisches Abenteuer entführte?
Ich muss auf sie aufpassen, sie ist fast noch ein Kind, dachte Junivera. Und nicht jeder Mann ist so blind und verbohrt wie Geronius, dass er die Avancen eines jungen Mädchens einfach ignoriert und nicht zu nutzen weiß. Junivera schüttelte den düsteren Gedanken ab. »Wer ist es dann?«, fragte sie.
»Er hat seinen Namen nicht genannt, Euer ... Junivera. Aber er ist ganz verzweifelt und ließ sich nicht vertrösten.«
»Gut, gut. Ich komme.«
Junivera zog die grüne Robe über das Nachthemd, wusch sich an der Anrichte den Schlaf aus den Augen und folgte Emer nach draußen.
Der nächtliche Bittsteller wartete auf der Schwelle des Siechenhauses. Als er die Perainegeweihte erblickte, ging er zitternd auf die Knie und senkte den Blick.
Junivera kannte ihn nicht, aber sie vermutete, dass er aus dem Viertel stammte. Schlicht waren seine Kleider, sauber und geflickt, als habe er sich in den Praiostagsstaat geworfen, ehe er sich mitten in der Nacht zum Siechenhaus aufgemacht hatte.
»Peraine zum Gruße, guter Mann. Wie können wir dir helfen?«, fragte Junivera.
Der Mann blickte nicht auf, als er nuschelte: »Peraine zum Gruße, Euer Gna...naden. Bitte, Euer Gnaden, mein Weib, die Ilke, sie ist so seltsam und anders. Ilke geht’s gar nicht gut. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Arme Ilke!«
»Deine Frau ist krank? Du weißt, dieses Haus ist für jene, denen anderswo nicht mehr geholfen werden kann. Ist es denn so schlimm? Dann musst du deine Ilke sofort hierher bringen, damit sie niemanden ansteckt.«
»Nein, nein, Euer Gnaden! Es ist nich ... so was! Nein. Nicht so was. Ilke is gesund und doch nich gesund! Sie is nich mehr sie selbst. Sie ist anders. Anders! Einfach anders!« Hektisch spie er die Worte aus, seine Stimme drohte zu überschlagen.
»Guter Mann«, sagte Junivera ruhig. »Jetzt steh erst mal auf und sieh mich an.«
Der verunsicherte Mann sprang auf die Beine, als habe man ihn getreten. Junivera und Emer mussten ihn auffangen, damit er nicht gleich wieder hinfiel.
»Verzeiht«, nuschelte er verlegen und wich Juniveras Blick aus.
Sie legte die Hand an sein Kinn und zwang ihn so, sie anzusehen. »Ganz ruhig atmen. Besser so? Und jetzt sag mir erst mal deinen Namen. Den deiner Frau kenn ich ja schon.«
»Ihr kennt Ilkes Namen?«
»Du hast ihn mindestens drei Mal genannt.« Junivera merkte, wie Emer neben ihr die Hand vor den Mund schlug und ein Prusten unterdrückte. Junivera musste sich zügeln, ihr keinen Klaps zu geben.
Der Mann starrte Junivera unverwandt an.
Diese wartete schweigend.
»Fredo!«, rief er plötzlich, als kehrte eine tief vergrabene Erinnerung zurück. »Ich heiße Fredo. Und die Ilke, die ist mein Weib.«
Neben Junivera taumelte Emer nach hinten und verschwand im dunklen Hausflur. Kurz darauf war verstohlenes Keuchen und Japsen zu hören.
Ich muss mit ihr ein ernstes Wort reden, dachte Junivera. Dann wandte sie sich wieder dem nächtlichen Besucher zu. »So. Fredo. Und nun von vorne. Was ist mit deiner Frau passiert? Krank ist sie nicht, sagst du. Und sie ist anders als sonst. Wie anders? Hast du gefragt, ob sie etwas bedrückt? Fürchtet sie sich? Habt ihr Kummer?«
»Ja – und nein. Ich kann’s nicht recht erklären. Kommt doch bitte mit und seht sie Euch an!« Da Junivera keine Anstalten machte, sofort von der Türschwelle weg loszurennen, fuhr er fort. »Hat damit angefangen, dass die Ilke gesagt hat, sie hätt seltsame Träume ...«
»Jeder hat mal böse Träume, guter Mann. Das geht vorbei. Habt ihr Sorgen? So was beschert schon mal böse Träume.«
»Seltsam, hat sie gesagt, nicht böse. Keine Alpträume, nich. Ilke fand sie sogar ganz schön, hat sie gesagt. Aber als ich wollte, dass sie sie mir erzählt, hat sie gesagt, sie kriegt sie nicht mehr richtig zusammen so seltsam sei’n sie. Ich hab mir erst Sorgen gemacht, vielleicht träumt sie von nem anderen Mann und will’s deshalb nicht sagen. Doch sonst ... war sie so lieb wie immer ... ihr wisst schon, wo, nicht wahr, Euer Gnaden? Und dann ... war es nicht mehr wichtig wegen der Träume. Langsam, so langsam, dass ich’s erst gar nicht gemerkt hab, hat sie nicht nur nicht mehr von ihren Träumen geredet. Sie hat überhaupt immer weniger geredet ... und dann ... Ach, ich bitt Euch, Euer Gnaden, kommt mit und seht es Euch an!«
***
Ilke musste in den frühen Zwanzigern sein. Sie stand am Fenster der kleinen Schlafkammer und schaute nach draußen in die Nacht. Eine leichte Wölbung des Bauches verriet, dass sie schwanger war. Auch so etwas konnte zu seltsamen Träumen und Veränderungen im Wesen führen, folgerte Junivera und fragte: »Ist es euer erstes Kind?«
Fredo schüttelte den Kopf. »Wir haben schon drei. Ich hab sie zu den Nachbarn geschickt. Sie woll’n sowieso nich mehr bei ihrer Mutter sein. Sie macht ihnen Angst. Sie macht mir Angst, Euer Gnaden. Ich lieb sie, aber trotzdem macht sie mir Angst! Euer Gnaden! Bei der gütigen Peraine und bei allen Zwölfen, macht sie wieder gesund. Ich will meine Ilke zurück! Die richtige! Die echte!« Fredo zitterte, als habe er Schüttelfrost, doch ehe er in Tränen ausbrach, stürzte er aus dem Zimmer.
Junivera wandte sich der jungen Frau zu. Die hatte sich nicht geregt und weder ihren Mann noch die eingetroffene Geweihte eines Blickes gewürdigt. Junivera legte ihr eine Hand auf die Schulter und erwartete eine Reaktion.
Nichts geschah.
»Ilke?«
Nichts.
»Was ist so interessant da draußen?« Junivera schob sich zwischen die Frau und das Fenster und sah ihr ins Gesicht. Noch immer zeigte sich keine Reaktion. Ilke schien einfach durch sie hindurchzuschauen. Ihre Miene war friedlich und ein leichtes Lächeln umspielte ihre Mundwinkel. Nichts deutete auf ein Leiden hin, weder am Körper noch am Geiste. Aber Junivera wusste gut, dass sich nicht jedes Gebrechen in den Gesichtszügen eines Menschen widerspiegelte, auch nicht jene des Geistes. Und dann gab es ja noch eine dritte Möglichkeit, an die Junivera nicht denken wollte.
Fredo hatte sich etwas beruhigt und kam zurück ins Zimmer. »Es is nicht immer so«, sagte er.
»Wie ist es dann?«
»Es is schlimmer.«
»Wie meinst du das?«
»Hab Euch ja gesagt, Euer Gnaden, dass sie irgendwann mal angefang’n hat, einfach dazustehen oder dazusitzen. Vor sich hinzustarren tut sie und nichts sagen, außer manchmal wirre Sachen, die ich nich versteh. Anfangs war sie immer bloß immer mal für eine Weile weg. Und wenn sie dann wieder sie selber war, dann hat sie gesagt, alles is gut und ihr fehlt doch nichts. Doch ist’s dann immer schlimmer geworden und bald konnt man kaum noch richtig mir ihr red’n. Dann, nach ein paar Woch’n, hat sie auch noch angefangen, urplötzlich rumzuschrei’n und in der Stube zu toben, wie ein gefangenes Viech in nem Käfig. Ja! Und seitdem haben die Kleinen Angst vor ihrer Mutter und woll’n nich mehr in ihrer Nähe sein. Und gestern dann ... da ist die Ilke plötzlich davongelaufen! Davongelaufen! Mitten in der Nacht und im Hemd ist sie weggerannt! Im ganzen Quartier hab ich sie gesucht. Im ganzen Südquartier! Erst ganz unten bei den alten Mietshäusern, wo nich mal die Ärmsten der Armen wohnen wollen, hab ich sie gefunden. Und sie wollt noch weiter, wenn ich sie nicht festgehalt’n hätte. Aber da ist ja nur noch ... und da hätte ich dann nich mehr ... Bei allen Zwölfen, da hätt ich nich mehr ...« Fredo stockte.
Danach kam nur noch die Dämonenbrache, und nicht einmal der treueste Ehemann wäre bei klarem Verstand seiner Frau dorthin gefolgt, schloss Junivera.
»Was wollte sie nur dort?«, fragte sie.
Fredo zuckte mit den Schultern.
Da sang plötzlich jemand mit dünner Stimme: »Sie folgen den Sternen, sie folgen dem Funkeln, sie folgen den Wolken, sie gehen im Dunkeln. Und hundert werden gehen. Tausend werden ...«
»Ilke?«, rief Fredo, als seine Frau verstummt war. »Ilke! Komm doch zu dir!«
Junivera nahm die Frau sachte an den Schultern und schaute ihr in die Augen. »Ilke? Was meinst du damit?«
Doch die junge Frau beachtete die Geweihte nicht, sondern starrte weiterhin aus dem Fenster.
»Was ist da draußen?«, flüsterte Junivera ihr ins Ohr. »Was siehst du?«
»Siehst du es denn? Siehst du es nicht? Was siehst du, wenn du die Augen schließt? Was siehst du nicht?«, setzte Ilke ihren Singsang fort. »Was siehst du ...«
Einem Gefühl folgend stellte sich Junivera neben Ilke und versuchte deren Blick zum Horizont nachzuvollziehen. Es war der Monat Peraines und ihr Sternbild, der Storch, stand im Zenit. Das Fenster ging nach Osten und Ilkes Blick ging zum Horizont. Dort erhob sich gerade das Sternbild der Stute über die Dächer der Stadt. Junivera war verwirrt.
»Mein Kind hat keinen Namen. Mein Kind hat kein Gesicht. Mein Kind hat keinen Vater. Und auch seine Mutter nicht«, sang Ilke weiter.
»Liebes!«, rief Fredo. »Was singst du da? Du tust mir weh. Hör auf damit, hör schon auf!«
Tatsächlich wandte sich Ilke ihrem Gatten zu. Mit sanfter Stimme fragte sie: »Fredo? Liebster? Was ist, wenn die Dunkelheit geht, aber kein Licht kommt?«
Dann schloss sie die Augen und fiel wie ein welkes Blatt zu Boden.
***
Junivera ließ die bewusstlose Frau von Fredo und einem Nachbarn ins Siechenhaus bringen. Es dämmerte und die Geweihten und Laiendiener hatten gerade mit dem Tagwerk begonnen.
»Ist das diese Ilke? Was hat sie?«, fragte Emer.
»Sei keine neugierige Emm!«, tadelte Junivera das Mädchen mit ihrem alten Spitznamen. »Richte ein Bett her in einem der leeren Zimmer. Nimm eine Kammer mit einem Schloss an der Tür.«
»Warum das, Euer Gnaden?«
»Weil ich nicht will, dass sie uns wegläuft.«
Fredo hatte Junivera auf dem Weg zum Siechenhaus erzählt, dass Ilke, kaum dass er sie zurück nach Hause gezerrt hatte, sich sofort wieder auf den Weg machen wollte. So hatte er sie in ihrer Kammer eingesperrt, wo sie bis zum Abend getobt hatte, nur um mit dem Einbruch der Nacht in jenes stumme Starren zu verfallen, in dem Junivera sie angetroffen hatte.
Junivera zweifelte daran, dass sie der Frau helfen konnte. Im besten Fall war sie bei den Noioniten in guten Händen, die sich um die geistig Verlorenen sorgten. Vielleicht war auch nur ein erfahrener Geweihter vonnöten, der Zeichen einer Besessenheit erkennen konnte. Aber Fredos Bericht von seltsamen Träumen hatten Juniveras Aufmerksamkeit auf sie gezogen, und der rätselhafte Singsang hatte ihr Interesse nur noch gesteigert. Sie war ganz sicher: Das, was mit Ilke geschah, hatte eine Bedeutung. Nicht nur für die unglückliche Familie.
»Zu welcher Arbeit bist du heute eingeteilt, Emer?«, fragte Junivera die wartende Novizin.
»Ihre Gnaden Bernika hat mir aufgetragen, die Böden in den oberen Zimmern zu schrubben«, sagte Emer, offensichtlich nicht begeistert von der Aussicht darauf.
Bernika hatte fast siebzig Götterläufe erlebt und war als einzige Geweihte nach dem Brand vor fünf Jahren in das Siechenhaus im Sonnengrund zurückgekehrt. Abgesehen von Junivera, aber sie war damals noch keine Geweihte gewesen. Bernika hatte sechs eigene und unzählige Findelkinder aufgezogen, und obwohl Junivera sie mit all ihrer Kraft unterstützte, tat sie sich schwer damit, der Jüngeren die Leitung des Siechenhauses zu überlassen. Dass Bernika Emer aufgetragen hatte, die Böden im Obergeschoss zu schrubben, war auch so eine Sache. Diese Zimmer wurden zurzeit nicht gebraucht, und somit glich diese Aufgabe einer Strafarbeit. Bernika war der Überzeugung, dass Junivera ihre Novizin viel zu nachsichtig behandelte, und versuchte, dies mit der ihr eigenen Strenge wettzumachen. Junivera hätte Bernikas Anweisungen gerne widerrufen, da sie Emer brauchte, aber sie wusste, dass das auf die Novizin zurückgefallen wäre, die sich doch alle Mühe gab, sich nicht über die Ungerechtigkeit zu beklagen.
Für Junivera war Bernika fast so etwas wie eine Mutter. Eine Mutter, die man liebte und an der man ab und an verzweifelte.
Also sagte Junivera: »Gut. Mach das, sobald du mit Ilkes Kammer fertig bist. Wer weiß, wie schnell wir weitere Zimmer brauchen.«
Emer zog eine Schnute, sagte aber nichts, sondern nickte stumm.
»Und sag Janka, sie soll dir helfen.«
Emers Miene hellte sich schlagartig auf.
»Sobald ihr fertig seid, kommst du zu mir. Ich habe eine besondere Aufgabe für dich. Aber jetzt kümmern wir uns um unseren neuen Gast.«
Junivera half Emer beim Herrichten der Kammer, dann steckten sie die bewusstlose Frau in ein schlichtes Nachthemd und legten sie ins Bett.
Emer hatte die ganze Zeit schweigend ihre Arbeit verrichtet, obwohl Junivera ahnte, dass ihr die Fragen auf der Zunge brannten.
»Ich muss jetzt ... Böden schrubben«, sagte Emer, als sie fertig waren.
»Warte einen Moment«, Junivera setzte sich an Ilkes Bettkante und hieß Emer, es ihr gleich zu tun. »Du willst doch sicher wissen, was ich für eine Aufgabe für dich habe?«
Emer nickte.
»Sieh sie dir an.«
Emer betrachtete die bewusstlose Frau. »Sie schläft. Ist sie krank? Ich meine ... sie muss krank sein, wenn sie hier ist. Aber sie sieht eigentlich gesund aus.«
Junivera nickte. »Nicht alle Krankheiten sieht man. Manchmal braucht es lange, bis wir sie erkennen können. Und es gibt Krankheiten des Geistes und der Seele. Die kann man nicht sehen.«
»Wenn sie verrückt ist, können wir ihr dann helfen? Ist das nicht Aufgabe der Noioniten? Die kennen sich damit aus.«
»Ich glaube nicht, dass sie verrückt ist. Hör zu: Ich erzähle dir jetzt alles, was ich heute Nacht gehört und gesehen habe. Und wenn du dann die Böden im Obergeschoss schrubbst, dann überlege dir, was das bedeuten könnte. Erzähle mir einfach alles, was dir dazu einfällt. Denn du wirst dich um sie kümmern. Tag und Nacht wirst du bei ihr sein, bis sie wieder gesund ist oder bis wir wissen, dass wir ihr nicht helfen können.«
Als Junivera ihren Bericht beendet hatte, verließ Emer das Zimmer mit nachdenklicher Miene.
Junivera blieb bei der Kranken zurück. Einfache Arbeit hilft dabei, schwierige Gedanken zu wälzen, ging ihr durch den Sinn. Gerne wäre sie jetzt in den Garten gegangen und hätte sich den Pflanzen gewidmet. Aber sie wollte Ilke nicht alleine lassen. Nachdenklich betrachtete sie die schlafende Frau und versuchte die Botschaft in Ilkes Worten und Handlungen zu erkennen. Eine Botschaft gab es, davon war Junivera überzeugt.
Ilke hatte wie gebannt zum östlichen Horizont gestarrt. Welche Botschaft war in der Stute, in Rahjas Sternbild verborgen? Rahja, die schöne Göttin. Die Göttin der Lust und des Weines. Hatte Ilke vielleicht doch eine Liebschaft gehabt? Fürchtete sie, dass das Ungeborene die Frucht dieser Liebschaft war? Dazu würde auch ein Teil des Singsangs passen. Dass das Kind keinen Namen hatte? Weil Fredo dem vermeintlichen Bastard keinen geben würde? Dass es keinen richtigen Vater hatte, weil es nicht seines war?
Aber warum hatte sich alles so bedrohlich angehört? Was hatte es mit der Dunkelheit auf sich, auf die kein Licht mehr folgte?
***
»Hundert werden gehen. Tausend werden bleiben. Hundert werden sehen und einer wird ...«
»Einer wird?«, fragte Junivera. »Einer wird was?«
»Das hat sie nicht gesagt«, erwiderte Emer. »Sie hat es nur ganz leise vor sich hin gemurmelt. Ich hab es kaum verstanden. Sie ist dabei nicht mal aufgewacht.«
»Oder du bist dabei nicht richtig aufgewacht?«
»Ich bin die ganze Zeit wach geblieben! Ich dachte, das ist was Wichtiges. Dabei schläft sie bloß die ganze Zeit! Seit einer Woche schläft sie!«
»Ja. So lange du nicht eine Woche schläfst!«, brauste Junivera auf. Sie wusste, sie war ungerecht, aber sie war auch mindestens so enttäuscht wie Emer.
Das Mädchen war aufgesprungen und rannte mit rotem Gesicht aus der Kammer.
»Emer!«, rief ihr Junivera nach. Dann seufzte sie.
»Was ist so wichtig an dieser Frau, Junivera?«, fragte Geronius Bosko, der hinter Junivera stand und einen Arm um ihre Hüften gelegt hatte. »Was ist so wichtig, dass du deine Novizin aus nichtigem Grund tadelst? So wichtig, dass du keine Zeit mehr für mich hast?«
»Ich weiß es nicht, Geronius«, seufzte Junivera. »Ich weiß nur, dass es wichtig ist. Ich ahne, dass etwas auf uns zukommt.«
»Haben dich deine Visionen und Traumbilder nicht schon früher getrogen?«
»Ich habe sie nur falsch verstanden!«, rief Junivera und verschwieg Geronius damit ein weiteres Mal die entscheidende Tatsache: Den größten Teil ihres Lebensweges war Junivera von Visionen und hellsichtigen Träumen begleitet worden. Nicht alle hatte sie verstanden oder richtig gedeutet, aber sie waren immer ein Teil ihrer Nächte gewesen.
Bis sie vor ein paar Götternamen einfach ausgeblieben waren. Zunächst waren es einige Nächte, an die sie sich nach dem Erwachen nicht mehr erinnern konnte, dann folgte die Erkenntnis, dass nicht nur Gesichte und Visionen, sondern auch ganz gewöhnliche Träume einer Leere gewichen waren, die ihre Nächte in trostlose Abgründe verwandelten.
Stattdessen klagten die Menschen im Sonnengrund vermehrt über seltsame Träume. Nicht wirkliche Alpträume, aber unheimlich und fremd und das Leben der Menschen mit Ruhelosigkeit und einem Gefühl der Bedrohung erfüllend.
Doch keinem war widerfahren, was mit Ilka geschah. Oder er konnte es nicht mehr berichten, kam es Junivera in den Sinn. Was, wenn mehr wie Ilka waren, nur hatten ihre Liebsten nie hier um Hilfe gefragt? Das Siechenhaus war bei so etwas ja nicht unbedingt die erste Adresse. Hatten sie bei den Noioniten Aufnahme gefunden? Waren sie in die Fänge zwielichtiger Scharlatane und Geisteraustreiber geraten? Murmelten sie weggesperrt in dunklen Kammern ihre Botschaften? Oder war ihnen die Flucht gelungen, und sie eilten längst einem Ziel zu, das unerkannt jenseits des östlichen Horizonts lag?
***
Drei Tage später saßen Junivera und Geronius im Perainegarten unter einem blühenden Apfelbaum.
Es war ein sonniger Nachmittag und Junivera wusste, dass Geronius gerne mit ihr an einem anderen Ort gewesen wäre. Irgendwohin, wo sie füreinander da sein konnten. Sie spürte sein Begehren, und doch teilte sie es nicht. Nicht heute. Aber es war gut, ihn bei sich zu wissen.
Ein Schrei ließ sie auffahren. Sie musste lange geschlafen haben, es war tiefe Nacht. Geronius war verschwunden. Sie wollte aufstehen, aber ihre Glieder waren wie gelähmt. Da sah sie Geronius hinter dem Brombeergebüsch an der Gartenmauer auftauchen. Auch er musste den Schrei gehört haben.
Geronius, wollte sie rufen. Geronius, was passiert da? Aber ihre Stimme versagte den Dienst. Da sah sie hinter Geronius eine kleine Gestalt in weißem Hemd, ihr Haar war zerzaust und ihr Blick war verklärt, sie legte den Arm um Geronius und schmiegte sich an ihn. Siehst du, sagte dieser Blick, du wolltest ihn nicht, da hat er sich eine Jüngere genommen. Da hat er mich genommen, Junivera!
»Emer!«, schrie Junivera.
Und dann zogen Sternschnuppen über den Himmel. Dutzende waren es, dann Hunderte, und dann war der Himmel voller fallender Sterne.
»Junivera! Junivera, wach auf, etwas ist geschehen?«
Das war Geronius’ Stimme, aber er stand noch immer schweigend im gleißenden Licht der fallenden Sterne und seine Miene war eine Fratze der Gier.
»Junivera!«, rief die Stimme wieder.
Da öffnete sie noch einmal die Augen und Geronius’ Gesicht war über ihr, und das Gleißen waren nicht fallende Sterne, sondern helles Sonnenlicht.
»Was hast du getan!«, schrie sie ihn an. »Sie ist noch ein Kind!«
Geronius sah verständnislos auf sie herab.
»Wie konntest du ... Geronius? Ich habe geträumt!«
»Komm jetzt, ich glaube, sie brauchen deine Hilfe!«
Aus dem Haus waren aufgeregte Stimmen zu hören. Geronius reichte ihr die Hand und Junivera ließ sich von ihm aufhelfen. »Ich habe geträumt«, wiederholte sie. Und diese Erkenntnis war ebenso erleichternd wie erschreckend.
Alle Bewohner des Siechenhauses waren auf den Beinen. Schnell fand Junivera die Quelle der Aufregung. Die Tür zu Ilkes Kammer stand offen, und dort kniete Bernika am Boden, den blutenden Kopf Emers in ihren Schoß gebettet.
»Emm!«, rief Junivera.
Zu ihrer Erleichterung öffnete Emer die Augen und murmelte: »Ich bin eingeschlafen. Tut mir leid, Euer Gnaden ... Junivera. Ich bin eingeschlafen, und sie ist aufgewacht.«
»Schon gut, Emer. Es muss dir nicht leidtun. Ich hätte besser auf dich aufpassen müssen.« Ihr Blick ging zu Bernika.
Diese nickte und schenkte ihr ein Lächeln.
»Es ist eine Platzwunde, nichts Schlimmes. Deine Patientin muss recht kräftig zugeschlagen haben, aber die Kleine wird es überstehen.«
»Wo ist Ilke?«
Bernika zuckte mit den Schultern. »Sie kann noch nicht weit sein. Wir sind durch den Lärm aufmerksam geworden, fanden es aber wichtiger, uns um Emer zu kümmern, als dieser Person hinterherzurennen. Besser, wenn sie einfach fortbleibt.«
»Ich muss sie finden«, sagte Junivera entschlossen.
Bernika sah sie entrüstet an, sagte aber nichts. Stattdessen sprach Geronius: »Wäre es nicht besser, wenn du dich um die Deinen kümmern würdest? Ich kann ja die Augen offen halten nach dieser Ilke. Kümmere du dich ruhig um Emer.«
»Das würdest du ja wohl gerne tun!«, fuhr sie ihn an.
»Was meinst du?«, fragte er sichtlich erschüttert. »Was ist los mit dir? Du bist nicht du selbst!«
Junivera kehrte der Kammer den Rücken.
»Junivera! Wohin willst du? Du wirst sie nicht finden!«
»Ich weiß, wo sie hin will.« Junivera vermied die Blicke der anderen, als sie an ihnen vorbei zur Tür ging. Sie brauchte Antworten, und die würde sie nicht in dieser Kammer finden.
»Junivera, was soll das alles?«, rief Geronius, als er schnellen Schritts neben ihr durch die Gassen des Südquartiers ging.
Junivera antwortete nicht, zu tief war sie in Gedanken versunken. Warum hatte sie heute wieder geträumt? Und was wollte ihr der Traum sagen? Waren Geronius und Emer ein Gesicht von Kommendem oder spiegelte der Traum nur Juniveras Ängste wider? Und warum fielen die Sterne wie Schnee?
Junivera beschleunigte ihre Schritte. Immer nach Süden und Westen und mit dem Blick in jede Seitengasse.
»Geronius!«, sagte sie. »Mein ganzes Leben haben mich die Bilder und Gesichte begleitet. Haben mich gequält und gejagt. Haben mich gewarnt und in die Irre geführt.«
»Ich weiß, Junivera. Aber welcher Traum lässt dich jetzt durch die Stadt eilen?«
»Kein Traum, Geronius, Liebster. Kein Traum. Und vielleicht viel mehr als das. Erst langsam verstehe ich ein wenig. Und ich kann erst stehen bleiben, wenn ich alles verstehe.«
»Und ich verstehe immer weniger.«
»Geronius, ich habe es dir nie gesagt, aber ich habe meine Träume und Traumbilder verloren.«
»Aber hattest du nicht gerade eben ...«
»Warte! Meine Nächte waren dunkel und leer, seit Monden schon. Obwohl ich eigentlich froh sein sollte, dass mich die Gesichte nicht mehr quälten, neidete ich sie denen, die sie hatten. Es war, als sei ein Teil aus mir herausgerissen worden, ohne dass ich es merkte. Bis ich die leere Stelle erkannte. Bis ich die Sicherheit und die Gnade erkannte, die mir die Träume geschenkt hatten. Und während jeder Alptraum die Gnade des Erwachens in sich birgt, birgt die Leere nichts in sich außer Verzweiflung ob der versagten Erlösung. Und dann tauchte Ilke auf und da erkannte ich es endlich: Was ich für die Abwesenheit der Träume hielt, war eine Botschaft. Geronius, verstehst du denn nicht: Wenn die Dunkelheit die Abwesenheit des Lichts ist, was bleibt, wenn auch die Dunkelheit geht?«
»Dann ist wieder Licht.«
»Nein! Das ist es ja. Dann bleibt nichts, nur die Leere!«
»Aber ist das Nichts nicht gleichbedeutend mit der Dunkelheit?«
»Nein. Nichts ist weniger als Dunkelheit. Und Geronius?«
»Ja?«
»Ilke sah etwas im Osten. Dort steigt gerade die Stute an den Himmel. Doch was folgt der Stute?«
Geronius sagte nichts. Langsam schien er zu begreifen.
»Das Kind ohne Namen und Gesicht? Ohne Mutter und Vater?«, sagte Junivera.