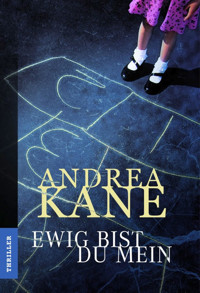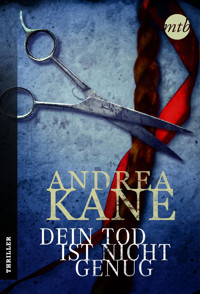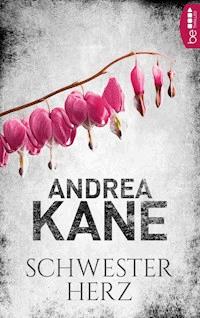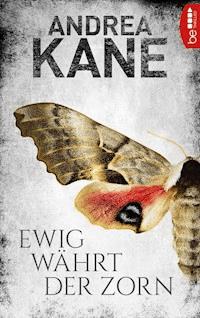4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Romantic Suspense der Bestseller-Autorin Andrea Kane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Gefahr und Ekstase ...
Julia Talbot macht sich Sorgen um einen ihrer Schüler: Brian Stratford scheint unter großem Druck zu stehen. Die engagierte Lehrerin führt dies auf Familienprobleme zurück, denn sein Vater möchte vom Bürgermeister zum Senator aufsteigen. Ihre anhaltenden Nachfragen beunruhigen Brians Onkel Connor, der die Familie und ihre Geheimnisse schützen will. Er versucht, Julia zu beschwichtigen - und gleichzeitig, sie zu verführen. Doch plötzlich verschwindet Brian, und die Suche nach ihm wird zu einem gefährlichen Unterfangen ...
Ein heißer Thriller von Andrea Kane, Autorin der Bestseller "Schwesterherz" und "Angsttage".
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumMottoDANKSAGUNGEN123456789101112131415161718192021222324252627282930313233NACHWORTÜber dieses Buch
Zwischen Gefahr und Ekstase …
Julia Talbot macht sich Sorgen um einen ihrer Schüler: Brian Stratford scheint unter großem Druck zu stehen. Die engagierte Lehrerin führt dies auf Familienprobleme zurück, denn sein Vater möchte vom Bürgermeister zum Senator aufsteigen. Ihre anhaltenden Nachfragen beunruhigen Brians Onkel Connor, der die Familie und ihre Geheimnisse schützen will. Er versucht, Julia zu beschwichtigen – und gleichzeitig, sie zu verführen. Doch plötzlich verschwindet Brian, und die Suche nach ihm wird zu einem gefährlichen Unterfangen …
Über die Autorin
Andrea Kane ist eine erfolgreiche US-Autorin, die u. a. psychologische Thriller schreibt. Ihre Bücher wurden bereits in über 20 Sprachen übersetzt. Sie lebt mit ihrer Familie und einem Zwergspitz in New Jersey. Im Internet ist sie unter www.andreakane.com zu finden.
Andrea Kane
DUNKELZIFFER
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Barbara Ritterbach
beTHRILLED
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Digitale Neuausgabe
Titel der amerikanischen Originalausgabe: NO WAY OUT
© 2001 by Andrea Kane
Copyright © 2005/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Published by Arrangement with Rainbow Connection Enterprises, Inc.
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © shutterstock: pupsy | Krasovski Dmitri | designbydx
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5134-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Auf Neuanfänge –in jedem Alter, in jeder Lebensphase –und auf all die Hoffnungen und Versprechen,die sie verheißen.
DANKSAGUNGEN
Mein Dank gilt:
Der American Professional Society on the Abuse of Children (apsac) (Amerikanische Vereinigung zur Unterstützung von Angehörigen bestimmter Berufsgruppen, die häufig mit Kindesmisshandlung konfrontiert werden; d. Übers.) für ihre vielfältigen Bemühungen bei der Erforschung, Verhütung und Bekämpfung jeglicher Form von Kindesmisshandlung. Mit Hilfe ihres Netzwerks aus Medizinern, Juristen, Lehrern, Angehörigen sozialer Berufe und Wissenschaftlern sorgt sie dafür, dass denjenigen, die von Kindesmisshandlung betroffen sind, die Hilfe zuteil wird, die sie benötigen. Ihre Veröffentlichungen, ihre juristischen Recherchen und ihre Aufklärungsarbeit sind von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die vielfältigen Formen von Kindesmisshandlung zu lenken.
Den Lehrern überall – sowohl jenen, die ich interviewt habe, als auch den Tausenden, mit denen ich nicht sprechen konnte – dafür, dass sie das größte Geschenk, das wir besitzen, erziehen, ausbilden und behüten: unsere Kinder.
Dr. Hillel Ben-Asher für die medizinische Beratung, die sie mir mit unendlicher Geduld und unvergleichlicher Weisheit zukommen ließ.
Und den tollsten Brainstorming-Partnern überhaupt – meiner Familie. Ihr demonstriert, was Teamwork bedeutet, und ich liebe euch.
1
14. April, Leaf Brook Mall
Westchester County, New York
Falscher Ort. Falsche Zeit.
Sie musste hier raus.
Julia biss die Zähne zusammen und kämpfte sich durch die Menschenmasse, die durch die Einkaufs-Mall wogte. Sie schob sich mühsam Richtung Ausgang, der in das zwölfstöckige Parkhaus führte. Überall herrschte dichtes Gedränge. Eigentlich wurde die Neueröffnung eines neuen Einkaufszentrums gefeiert, aber es war eher wie Karneval in Rio.
Es war naiv gewesen, heute hierher zu kommen. Die Stratfords waren dicht umlagert, bedrängt von Presseleuten. Und der Bürgermeister stand ununterbrochen zwischen seinem Vater und seinem Bruder, um zu demonstrieren, dass die Familie Stratford eine feste Einheit bildete. So verzweifelt sie auch war, Julia hatte keine Chance, zu ihnen zu gelangen. Sie würde einen anderen Weg finden müssen.
Mit einem der Aufzüge zu fahren war ausgeschlossen. Eine lange Warteschlange hatte sich gebildet, und jedes Mal wenn sich eine Aufzugtür öffnete, sah Julia, dass die Kabinen völlig überfüllt waren. Ihr blieb nur das Treppenhaus. So schnell sie konnte, rannte sie hinauf, Stockwerk für Stockwerk. Die ohrenbetäubende Musik drang sogar bis hierher und vibrierte in ihrem Kopf.
Ganz allmählich, je weiter sie sich von dem Fest entfernte, begannen sich die Menschenmassen zu lichten. Julia war schlecht vor Angst und Verzweiflung. Wenn ihr Verdacht richtig war, dann lief die Zeit. Sie musste dringend etwas unternehmen, ehe es zu spät war.
Sie verließ das Treppenhaus im elften Stock, wo sie ihr Auto in die einzig verfügbare Parklücke gequetscht hatte. Hier war sie weit entfernt vom Tumult der Eröffnungsfeier. Schon im Gehen begann sie, nach ihrem Schlüssel zu suchen.
Das Quietschen von Reifen ließ sie aufschrecken.
Sie hob den Kopf genau in dem Moment, als der silberne Mercedes um die Ecke schoss und mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf sie zu gerast kam.
Sie wusste sofort, dass er es auf sie abgesehen hatte. Und sie wusste auch, warum.
Ihr Verdacht war richtig. Und sie sollte zum Schweigen gebracht werden.
Für den Bruchteil einer Sekunde war sie vor Angst wie gelähmt. Dann schoss Adrenalin durch ihren Körper. Instinktiv versuchte sie zur Seite zu springen.
Sie schaffte es nicht.
Sie spürte den Zusammenstoß und registrierte im Unterbewusstsein, dass sie durch die Luft geschleudert wurde. Der Betonboden kam auf sie zu gerast.
Brian, dachte sie, als ein scharfer Schmerz durch ihren Kopf fuhr. Wer wird nun Brian retten?
2
30. März
Poughkeepsie, New York
Darling, bist du sicher, dass du nicht doch über Nacht bleiben willst?« Meredith Talbot sah ihre Tochter fragend an. Sie saßen am späten Abend in dem hübschen Bistro des kleinen Ortes und tranken einen Kaffee. »Du musst über eine Stunde fahren, bis du zu Hause in deiner Wohnung bist. Morgen ist Samstag. Dein Vater hat keinen Unterricht, und deine Grundschule ist ebenfalls geschlossen. Du könntest das Wochenende bei uns verbringen.«
»Danke, Mom, aber ich muss wirklich zurück.« Julia Talbot warf ihrer Mutter einen dankbaren Blick zu. Sie wusste, dass hinter dieser Einladung mehr steckte als die Hoffnung auf ein nettes Familienwochenende. Dafür brauchte Julia keine Einladung. Sie fuhr gern nach Hause, tauschte Klassenzimmer-Anekdoten mit ihrem Vater aus und führte mit ihren Eltern leidenschaftliche Diskussionen. Sie unterhielten sich über alles – über Bücher, Politik und die Probleme der modernen Gesellschaft. Aber mit ihrer Einladung heute Abend beabsichtigte ihre Mutter keine Unterhaltung. Sie beabsichtigte, Julia ein wenig aufzumuntern.
Leider würden ihre Bemühungen nicht fruchten.
»Dieser Workshop war anstrengender als die meisten anderen«, meinte Meredith leise.
»Das ist untertrieben.« Julia seufzte. »Jede Woche, wenn ich dieses Krankenhaus betrete und neben dir stehe, rede ich mir ein, dass unsere Workshops wichtig sind. Aber dann höre ich Berichte wie den von Dr. Garber und frage mich, ob das alles einen Sinn macht oder ob unsere ganzen Anstrengungen völlig nutzlos sind.«
»So darfst du nicht denken. Unsere Anstrengungen sind nicht nutzlos. Wir bekommen zunehmend mehr Aufmerksamkeit. Das ist doch ein Anfang.«
»Du hast einfach viel mehr Geduld als ich. Diese Statistiken anzuhören – das tut so weh.«
Julia schob ihre leere Kaffeetasse zur Seite und dachte an die Frustration, mit der Dr. Garber einer Hand voll Workshop-Teilnehmern die Ergebnisse seiner jüngsten Studie vorgetragen hatte. Dr. Garber war Psychologe und hatte kürzlich eine Untersuchung über emotionale Kindesmisshandlung und Vernachlässigung durchgeführt. Das Ergebnis war erschreckend. Emotionale Kindesmisshandlung beschränkte sich nicht auf bestimmte kulturelle, demographische oder sozioökonomische Gruppen. So wie es alle möglichen Formen der Misshandlung gab, so gab es alle möglichen Typen von Menschen, die sie verantworteten. Zwei Pädagogen hatten Dr. Garbers Fallstudien bestätigt, ein Vorschullehrer und ein Beratungslehrer einer Mittelschule. Ihre Berichte über die beschädigten Persönlichkeitsstrukturen psychisch misshandelter Kinder hatten Julia zutiefst berührt.
Es war unvorstellbar, dass es Eltern gab, die ihren Kindern körperliche Gewalt antaten. Fast ebenso unvorstellbar war es, dass viele von ihnen ihren Kindern psychisch Gewalt antaten und ungeschoren davonkamen, weil sie keine sichtbaren Narben verursachten, die als Beweis herhalten konnten. Ganz abgesehen davon, dass viele von ihnen ihr Verhalten gar nicht als Misshandlung betrachteten.
Wie konnte jemand nicht erkennen, dass Vernachlässigung und Missachtung ebenso zerstörerisch sein konnten wie körperliche Gewalt? Vor allem wenn es um kleine Kinder ging, die leicht zu beeindrucken waren und die sich nichts sehnlicher wünschten, als ihren Eltern zu gefallen?
Allein der Gedanke zerriss Julia das Herz. Manchmal war es so schlimm, dass sie sich ernstlich fragte, ob sie auf Dauer stark genug sein würde, diese Workshops mit ihrer Mutter fortsetzen zu können. Ihre Mutter kam mit den emotionalen Belastungen viel besser zurecht – vielleicht weil sie Krankenschwester war und vielleicht weil sie älter und reifer war. Dabei war auch Julia durchaus nicht unerfahren. Sie hatte die Auswirkungen kindlicher Misshandlungen aus nächster Nähe miterlebt, und das schon in sehr jungen Jahren. Das Erlebnis hatte einen unauslöschlichen Eindruck in ihrem Kopf und in ihrer Seele hinterlassen und ihr Leben sehr geprägt. Aber es bedeutete nicht, dass sie den Horrorgeschichten gegenüber je immun werden würde.
Wie auch immer, diese Workshops waren dringend notwendig. Irgendwer musste schließlich bei den unmittelbar betroffenen Berufsgruppen, zum Beispiel bei Erziehern und Erzieherinnen sowie bei Angehörigen medizinischer Berufe, Aufklärungsarbeit leisten und ihnen die Sinne schärfen, vor allem für die subtilere und daher leichter zu übersehende Form der seelischen Misshandlung von Kindern. Meredith kümmerte sich nun seit fünf Jahren ehrenamtlich darum und bot in Zusammenarbeit mit der American Professional Society on the Abuse of Children diese wöchentlichen Kurse an. Julia unterstützte sie dabei, seit sie ihre Ausbildung beendet hatte. Mit ihren Hauptfächern Kinderpsychologie und Pädagogik war sie dazu in idealer Weise geeignet. Sie konnte sich ihrer Karriere als Lehrerin widmen und zugleich etwas tun auf einem Gebiet, das ihr sehr am Herzen lag.
Wenn der Weg bloß nicht so endlos wäre ...
»Ich habe keine Geduld. Ich bin pragmatisch«, sagte Meredith jetzt. »Und das bist du auf deine Art auch. Du bist einfach nur viel emotionaler als ich – zumindest nach außen.« Sie drückte die Hand ihrer Tochter. »Warum kommst du nicht mit nach Hause? Wenigstens für die eine Nacht, wenn du schon nicht das ganze Wochenende bleiben willst?«
»Ich kann wirklich nicht, Mom.« Julia bemühte sich, die Sorgen ihrer Mutter zu zerstreuen. »Ich erwarte heute Abend noch einen Anruf von Greg. Er wollte uns Karten für ein Musical besorgen. Und dann möchte ich unbedingt morgen früh zu Brians Baseballspiel. Es ist das Saisoneröffnungsspiel, und er ist der Pitcher. Das darf ich einfach nicht versäumen.«
»Nein, natürlich nicht.« Ihre Mutter lächelte liebevoll. »Ich darf gar nicht daran denken, was passiert, wenn Brian Stratford irgendwann die Grundschule verlässt. Aber wenn ich es mir so recht überlege, weiß ich, was passieren wird. Er wird einmal in der Woche bei dir in der Schule auftauchen, um dir seine neuen Freunde vorzustellen, und du wirst während der Frühjahrssaison jeden Samstag auf den Sportplatz fahren, um ihn anzufeuern.«
Zum ersten Mal an diesem Abend lächelte Julia. »Wahrscheinlich. Deshalb bin ich auch gar nicht so begeistert davon, dass Brians Vater für den Senat kandidiert. Zumal ich mir sicher bin, dass er die Wahl gewinnen wird. Er ist ein großartiger Bürgermeister, und er wäre ein ebenso guter Senator. Ich hoffe nur, dass er nicht vorhat, anschließend nach Albany zu ziehen. Ich würde Brian schrecklich vermissen – auch wenn er bis dahin längst nicht mehr in meiner Klasse sein wird. Er wird dann schon im dritten Schuljahr sein.«
»Glaubst du ernsthaft, die Tatsache, dass er nicht in deiner Klasse ist, würde ihn von dir fern halten?«, fragte Meredith und lächelte erneut. »Er ist nicht von deiner Seite gewichen, seit du ihm an einem seiner ersten Schultage in der Pause beigebracht hast, einen Effetball zu werfen. Seither ist er dir ein treuer Freund.«
»Brian ist ein ganz besonderes Kind. Er ist so offen und sensibel, und er ist intelligent und reif. Eines Tages wird er auf dieser Welt etwas bewegen, da bin ich ganz sicher. Wirklich, ich wünschte, es gäbe mehr Menschen wie ihn.« Julia bemühte sich um einen unbeschwerteren Ton. »Und was seine Treue angeht, kenne ich tatsächlich kaum Männer, die mit ihm vergleichbar wären. Außer Dad natürlich.«
»Was ist denn mit Greg?«, erkundigte Meredith sich vorsichtig. Auch wenn sie und Julia ein sehr enges Verhältnis hatten, versuchte sie, die Privatsphäre ihrer siebenundzwanzigjährigen Tochter zu respektieren. Dennoch sorgte sie sich, ob begründet oder nicht, um diesen Aspekt in Julias Leben. »Fällt er auch in diese Kategorie, oder hast du ihm noch gar keine Chance gegeben, seine Treue zu beweisen?«
Julia zuckte mit den Schultern, und ihr seidiges, kastanienbraunes Haar flog auf und ab. »Keine Ahnung«, meinte sie. »Ich kenne Greg noch nicht sehr gut. Wir treffen uns erst seit einem Monat regelmäßig. Und das bedeutet in unserem Fall, dass wir uns genau sechs Mal verabredet haben. Er hat noch mehr zu tun als ich. Ich manage eine Klasse – er managt eine Stadt. Nicht politisch, sondern organisatorisch und finanziell. Er versinkt total in Arbeit.«
»Also stimmt die Chemie zwischen euch nicht.«
Julia sah ihre Mutter erstaunt an. »Das habe ich nicht gesagt.«
»Das brauchst du auch nicht.« Meredith neigte den Kopf zur Seite. Ihr glänzendes dunkles Haar hatte fast dieselbe Farbe und Struktur wie das ihrer Tochter, nur dass sie es kurz geschnitten trug. »Ich bin noch nicht so alt, um nicht mehr zu wissen, wie es ist, wenn man sich verliebt. Das dauert keinen Monat und ist auch nicht rational steuerbar. Es passiert einfach, manchmal auf eine Art und Weise, die überhaupt keinen Sinn macht. Aber ich schätze, das weißt du längst, oder?«
Unbehagliches Schweigen.
»Julia, das Leben steckt voller Überraschungen. Manchmal reißen sie dich aus der Bahn. Das kann riskant sein. Risiken sind nicht immer schlecht, sie sind nur manchmal unangenehm – vor allem wenn sie einen Plan durchkreuzen, den man für sich selbst für richtig hält. Verlass dich auf deine Instinkte. Lass dich nicht von irgendwelchen Ängsten beeinflussen.«
Erneut entstand eine unangenehme Pause. »Mich beeinflussen keine Ängste, Mom. Höchstens meine Arbeit.«
»Wenn du meinst.«
Eine weitere Pause. »Ich muss jetzt fahren.« Julia erhob sich hastig und wich dem aufmerksamen Blick ihrer Mutter aus. Das Letzte, was sie jetzt wollte, war diese eine Diskussion. Es ging ihr zu nah. In letzter Zeit war sie sich nicht mehr so sicher, wo ihre Prinzipien aufhörten und ihr Unwohlsein begann. Und sie hatte keine Lust es herauszufinden.
Sie suchte ihre Tasche und ihre Unterlagen zusammen. »Danke für den Kaffee. Und dafür dass du mich ein bisschen aufgemuntert und über Brian gesprochen hast. Deine mütterliche Medizin hat gewirkt. Ich fühle mich jetzt viel besser.« Sie stand auf und beugte sich vor, um ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange zu geben. »Umarm Dad von mir. Ich rufe dich im Laufe der nächsten Woche an.«
»Tu das.« Meredith’ Stimme klang unbeschwert, aber sie betrachtete das Gesicht ihrer Tochter ganz genau, als hätte sie noch eine Menge mehr zu sagen, was sie aber klugerweise zurückhielt. »Ich möchte unbedingt erfahren, wer dieses Saisoneröffnungsspiel gewonnen hat.«
»Das wirst du.«
Julia verließ das Bistro und überquerte die Straße, um zu ihrem Auto zu gehen. Sie blieb stehen und warf einen kurzen Blick auf die vertrauten Straßen, wo sie aufgewachsen war. Wehmut überfiel sie, als sie sich an die Geborgenheit erinnerte, die sie als Kind hier empfunden hatte – nicht jedes Kind hatte das Glück, diese Geborgenheit erleben zu dürfen. Sie war fest entschlossen, daran etwas zu ändern, dafür zu sorgen, dass immer mehr Kinder die Sicherheit bekamen, die sie verdienten. Vielleicht war dieses Ziel idealistisch, aber sie würde darum kämpfen.
Trotzdem. Julia musste wieder an die Ergebnisse des heutigen Workshops denken. Manchmal war es sehr mühsam, sich diesen Idealismus zu bewahren.
Aber sie würde nicht aufgeben.
»Wirklich? Bist du sicher, dass die Aufnahmen scharf sind?« Greg Matthews streckte seine langen Beine vor sich aus. Er lehnte sich in seinem Wohnzimmer auf dem Ledersessel zurück, hielt das Telefon in der Hand und hörte sich die Informationen, die er vom anderen Ende der Leitung erhielt, aufmerksam an. »Das ist genau das, worauf ich gehofft hatte. Schick sie mir sofort rüber, ja? Ja. Heute Abend noch. Ich brauche sie für das Meeting morgen.«
Er legte auf und überlegte, welches die beste Strategie für sein bevorstehendes Frühstücksmeeting sein würde. Normalerweise machte er samstags keine Termine. Aber in diesem Fall blieb ihm keine andere Wahl. Und wenn die Dinge wie geplant verliefen, würde es das auch wert sein. Dann würde er am Montag die Sache ins Rollen bringen – und sie würde eine solide Investition für die Stadt und für ihn selbst bedeuten.
Er war rundum zufrieden. Sein Berufsleben kam endlich so richtig in Schwung. Jetzt musste er sich nur noch um sein Privatleben kümmern.
Nachdenklich stand er auf und warf einen Blick auf die Uhr. Halb zehn. Und Julia war immer noch nicht zu Hause. Er hatte seit Mittag zwei Nachrichten auf ihrem Anrufbeantworter hinterlassen. Keine Reaktion. Das bedeutete, dass sie noch nicht aus Poughkeepsie zurückgekehrt war. Er hoffte nur, dass sie nicht beschlossen hatte, bei ihren Eltern zu übernachten. Er hatte Broadway-Karten für den nächsten Abend, die er kurzfristig von einem ortsansässigen Geschäftsmann bekommen hatte. Er hatte es Julia erzählt, als sie vormittags telefoniert hatten, und sie hatte versprochen, den Samstagabend für ihn freizuhalten. Das Problem war nur, dass sie dabei so gehetzt geklungen hatte. Vermutlich war sie mit ihren Gedanken bereits bei dem Workshop gewesen, den sie heute Abend abhalten wollte. Deshalb hatte er nicht allzu viel Hoffnung, dass sie sich tatsächlich an ihre Verabredung erinnerte.
Er würde bis zehn Uhr warten. Dann würde er sie wieder anrufen. Julia Talbot war eine Klassefrau. Er hatte nicht die Absicht, sie entwischen zu lassen.
Vor allem jetzt nicht.
3
31. März
Leaf Brook, New York
Stephen Stratford schaute auf sein Autotelefon. Er war versucht, den Anruf, der ihm so unter den Nägeln brannte, zu tätigen, noch während er das letzte Stück zum Baseballstadion fuhr. Weder seine Frau noch sein Sohn würden es bemerken. Sie saßen auf dem Rücksitz seines Geländewagens und waren mit der kleinen Krise beschäftigt, die sich soeben ereignet hatte.
Von Brians Trikot war ein Knopf abgesprungen.
Unglücklicherweise hatte sich dieser Knopf genau in der Mitte seines Hemds gelöst und nicht etwa an einer Stelle, die weniger auffällig war und wo das Fehlen eines Knopfes bei diesem einen Spiel gar nicht aufgefallen wäre. Glücklicherweise reiste Nancy nie irgendwohin ohne ihre Erste-Hilfe-Ausrüstung und ihr Nähzeug – zumindest nicht seit Brians Kleinkindzeit, als sich bereits abgezeichnet hatte, was für ein Wirbelwind er einmal werden würde.
Nancy hatte ihrem Sohn bereits aus dem Hemd heraus- und in seine Aufwärmjacke hereingeholfen und widmete sich nun konzentriert ihrer Aufgabe, um rechtzeitig fertig zu werden. Brian erschwerte ihr die Sache noch, indem er vor Ungeduld wie ein Gummiball auf dem Rücksitz auf und ab hopste. Die offene Jacke schlug dabei rhythmisch gegen seine nackte Brust.
»Mom, wir sind fast da«, rief er und schaute aus dem Wagenfenster. »Das Spiel fängt in ein paar Minuten an. Ich brauche dringend mein Trikot.«
»Hier hast du es.« Nancy warf ihrem Sohn das fertige Hemd zu. »Schnell jetzt, raus aus deiner Jacke, damit wir dein Trikot wieder anziehen können. Bis Dad geparkt hat, siehst du wieder aus wie ein richtiger Profi-Pitcher. Die Yankees sind nichts gegen dich. Bloß dass sie aufgehört haben zu wachsen und ihre Uniformen passen. Wenn du deinen Muskeln mal sagen würdest, sie sollten ein bisschen langsamer wachsen, würde so etwas vielleicht nicht ganz so oft passieren.«
»Danke, Mom.« Brian schälte sich aus seiner Jacke und sah seine Mutter mit der ganzen Erleichterung eines Siebenjährigen an, dem gerade ein peinlicher Auftritt in aller Öffentlichkeit erspart worden war.
Nancy fuhr ihm durch die Haare, während er sein Trikot überstreifte. »Komm, ich helfe dir beim Zuknöpfen, dann kannst du losrennen.«
Keine Zeit für Telefongespräche, dachte Stephen, nahm das Handy aus der Halterung und steckte es in seine Jackentasche. Das Baseballfeld kam in Sicht. Seine vielversprechende Investition würde noch warten müssen.
Frustriert steuerte er den Wagen auf den Parkplatz. Kieselsteine flogen auf, als er auf die Schattenplätze in der Nähe der unüberdachten Tribünen zufuhr.
Brian presste die Nase gegen die Fensterscheibe. »Ist Miss Talbot da?«
»Ich weiß es nicht, Darling.« Nancy folgte seinem Blick und versuchte, unter den Leuten, die auf den Eingang zustrebten, Brians Lehrerin auszumachen. Am Tag der Saisoneröffnung war immer viel los. Die Eltern der Grundschüler von Leaf Brook engagierten sich für ihre Kinder. Und die Baseballsaison war hier sehr wichtig. Das wiederum bedeutete, dass zum ersten Spieltag alles kam, was Beine hatte, Eltern und Großeltern, Geschwister und Freunde.
»Ich kann Miss Talbot nicht sehen«, meinte Nancy und löste ihren Sicherheitsgurt, als das Auto zum Stehen kam. »Aber das heißt gar nichts. Es sind einfach viel zu viele Leute, um etwas Genaues zu erkennen.«
»Wie ich Miss Talbot einschätze, ist sie bestimmt da«, versicherte Stephen seinem Sohn. Er stellte den Motor aus und schob seine eigenen Probleme erst einmal nach hinten. Während des Spiels würde er sicherlich Gelegenheit haben, sein Telefongespräch zu führen. Wenn Brians Team mit dem Schlagen an der Reihe war, würde er sich entschuldigen und für ein oder zwei Minuten verschwinden. »Vor allem, wenn sie es dir versprochen hat. Sie hat bisher noch kein Versprechen gebrochen, das sie dir gegeben hat.«
»Ich weiß.« Brian sah immer noch besorgt aus. »Aber es ist das erste Spiel der Saison. Was ist, wenn sie vergessen hat zu kommen? Der Winter ist lang. Seit September gab es keine Spiele. Sie ist aus dem Training.«
Stephen schmunzelte, als er aus dem Auto stieg, Nancy die Tür öffnete und die Wasserflasche nahm, die sein Sohn jedes Mal vergaß. Dass ein Zuschauer aus dem Training sein könnte, so etwas konnte nur Brian einfallen.
Seine Frau kletterte vom Rücksitz und warf einen kurzen Blick auf ihren Mann, ehe sie Brian half, seine Ausrüstung auszuladen. »Heute eröffnet die Juniorliga die Saison. Und es ist kein Geheimnis, wer wirft. Ich vermute, angesichts der bevorstehenden Wahlkampagne wird die Presse sich auf dich stürzen.«
»Wahrscheinlich.« Stephen zuckte mit den Schultern. »Ich werde mit ihnen reden – nach dem Spiel. Jetzt bin ich erst einmal nur Brians Vater. Nicht der Bürgermeister. Und auch nicht der Kandidat für den Senatorenposten.«
Nancy warf ihm ein kurzes Lächeln zu, das ihn an die glückliche junge Frau erinnerte, die er vor zehn Jahren geheiratet hatte. Er wünschte sich, er könnte sie häufiger so zum Lächeln bringen. In letzter Zeit sah sie oft müde und erschöpft aus.
Er hasste es, dafür verantwortlich zu sein.
Aber verdammt, ihm stand das Wasser bis zum Hals.
Sie steuerten gerade das Spielfeld an, als ein silberner Mercedes SL500 mit offenem Dach auf den Parkplatz bog. Der Fahrer hupte, dann streckte er den Arm heraus, um zu winken.
»Onkel Connor!« Brians Gesicht leuchtete auf, und er winkte stürmisch zurück. Aufgeregt hüpfte er von einem Fuß auf den anderen, während er zusah, wie sein Onkel einparkte. Dann rannte er los, um den großen, dunkelhaarigen Mann zu begrüßen, der aus dem Wagen gestiegen war und auf sie zukam.
»Ich wusste gar nicht, dass du kommst«, rief Brian, gab ihm fünf und grinste von einem Ohr zum anderen, während sie gemeinsam zu Stephen und Nancy gingen.
»Hast du etwa gedacht, ich würde dein erstes Spiel versäumen?« Connor Stratford lächelte eines seiner seltenen Lächeln, die er für seinen Neffen reserviert hatte. »Cooler Handschuh«, meinte er mit einem Blick auf den Fanghandschuh, den Brian zu Weihnachten bekommen hatte. »Aber dein Trikot sieht ein bisschen eng aus. Ich glaube, du bist seit dem letztem Monat tüchtig gewachsen.«
»Bin ich auch. Vor allem meine Muskeln. Mir ist vorhin ein Knopf vom Hemd gesprungen. Mom musste ihn im Auto festnähen.«
Connor beugte sich vor, um seine Schwägerin auf die Wange zu küssen. »Das war sicher ein besonderes Vergnügen. Mit so einem Instrument zu hantieren, während dieser Wirbelwind neben dir sitzt und mein Bruder mit hundert Sachen rast, um pünktlich hier zu sein. Ich beneide dich nicht.«
»Achtzig«, korrigierte Stephen und schüttelte Connor die Hand. »Ausgerechnet du musst das sagen. Wie viele rote Ampeln hast du denn zwischen Manhattan und hier überfahren? Und wie viele Autos hast du in einer Staubwolke weit hinter dir gelassen?«
»Nicht viele.« Connor legte den Arm um Brians Schulter und ging mit ihm in Richtung Spielfeld. »Samstagsmorgens ist es auf dem West Side Highway ziemlich ruhig. Ich glaube nicht, dass ich allzu viel Schaden angerichtet habe.«
Stephen nahm Nancys Hand und folgte seinem Bruder. Dabei schaute er sich automatisch nach Leuten von der Presse um. Sie waren da, natürlich, mit Kameraausrüstung und allem. Die gute Nachricht war, dass sie ihn noch nicht entdeckt hatten. Vielleicht konnte er ja ein paar Innings in Ruhe genießen, ehe sie sich auf ihn stürzten. Besser noch, vielleicht konnte Connor sich ja etwas ausdenken, um sie abzuschütteln. Niemand war kreativer als sein jüngerer Bruder, wenn es darum ging, gute Strategien zu entwickeln. Es lag ihm im Blut, ebenso wie es ihrem Vater im Blut lag. Es hatte aus Harrison Stratford den Multimillionär und Geschäftsmogul gemacht, der er heute war. Und es hatte aus Connor den außergewöhnlich erfolgreichen Risikokapitalisten gemacht, der er heute war.
Ein Risikokapitalist, der wahnsinnig viel zu tun hatte. Zu viel, um einen großen Teil des Samstags zusammen mit seiner Familie zu verbringen.
Unter normalen Umständen hätten da alle Alarmglocken bei Stephen schrillen müssen. Wenn Connor unerwartet in Leaf Brook auftauchte, dann kam er normalerweise, um seinem Bruder auf die Finger zu schauen. Heute jedoch nicht. Heute war er wegen Brian hier. Und wenn es um Brian ging, waren Connors Gefühle aufrichtig. Die beiden waren ganz vernarrt ineinander.
Also schrillten die Alarmglocken nicht. Und es gab keine besonderen Spannungen zwischen den Brüdern.
»Schön, dass du hier bist«, murmelte Stephen Connor zu. »Ich dachte, du hättest so viel Arbeit.«
»Die Arbeit kann warten. Mein Pitcher-Ass nicht.« Connor zupfte am Rand der Baseballkappe, die das Pitcher-Ass gerade hastig aufgesetzt hatte.
»Mein Arm ist in Superform«, verkündete Brian. »Das hat der Trainer gesagt. Und Miss Talbot auch. Wusstest du eigentlich, dass sie als Kind den schnellsten Effetball in der ganzen Nachbarschaft werfen konnte? Ihr Dad hat es ihr beigebracht. Er war früher auch Pitcher in der Juniorliga, aber das ist Trillionen von Jahren her. Hast du das gewusst?«
»Ich schätze, das hast du mir ungefähr dreißig oder vierzig Mal erzählt«, antwortete Connor trocken.
»Egal. Auf jeden Fall versteht Miss Talbot eine Menge von Effetbällen. Und sie hat gesagt, meiner wäre dieses Jahr noch besser als letztes Jahr.«
»Das bezweifle ich nicht.« Connor blinzelte gegen die Sonne. Sie hatten die Tribünen inzwischen erreicht, und er schaute sich um, weil er wissen wollte, wo sich die Presse positioniert hatte.
Ganz plötzlich streckte Brian den Zeigefinger aus und schrie aufgeregt. »Da ist ja Miss Talbot! Da vorne. In der ersten Reihe. Lass uns zu ihr gehen und Hallo sagen.«
Leider war Miss Talbot nicht die Einzige in der ersten Reihe, wie Connor sofort feststellte. Drei Reporter und zwei Fotografen standen unmittelbar neben ihr – eine ziemliche Medienpräsenz für ein kleines Juniorligaspiel. Offenbar waren sie gekommen, um mit dem Bürgermeister zu sprechen oder besser gesagt mit dem Senatorenanwärter. Sie hatten die Stratfords nur noch nicht gesichtet, aber das würde sich gleich schlagartig ändern. Normalerweise war das kein Problem. Stephen wuchs über sich hinaus, wenn er vor einer Kamera stand. Mit seiner natürlichen Ausstrahlung konnte er jedes Publikum leicht für sich einnehmen. Mühelos wickelte er Journalisten, Fotografen und sein Wählerpublikum gleichermaßen um den Finger, machte ihre Träume zu seinen Träumen und ihre Hoffnungen zu seinen Absichten. Ohne viel dafür zu tun, stand Stephen immer im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Heute würde das nicht so sein. Heute war Brians Tag, heute stand Brian im Mittelpunkt. Sein Vater würde es so haben wollen.
Wie zur Bestätigung spannte Stephen sich und hielt den Blick starr auf die lauernden Reporter gerichtet. Seine Körpersprache unterstrich Connors Einschätzung: Er wollte in Ruhe gelassen werden, bis das Spiel vorüber war. Dann würde er sich um die Presseleute kümmern.
»Brian, dein Trainer macht dir gerade ein Zeichen«, meinte Connor. »Die Mannschaft wartet. Wink Miss Talbot vom Spielfeld aus zu. Sie wird das verstehen. Wir können ja später noch Hallo sagen. Jetzt wärmst du dich besser ein bisschen auf, und wir anderen suchen uns einen Platz, sonst verpassen wir noch den Anfang. Wir setzen uns dort drüben hin.« Er zeigte auf eine Sitzreihe direkt hinter dem Schlagrand. »Von da aus haben wir den besten Blick auf die Abwurfstelle.«
»Tja dann ...« Brian sah unentschlossen aus. Offenbar war er hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, Miss Talbot zu begrüßen, und dem Unwillen, sich seinem Onkel zu widersetzen.
Die Waagschale bewegte sich schließlich zu Connors Gunsten, als Brians Mannschaftskameraden ihm zuwinkten.
»Also gut«, willigte er ein. Er verabschiedete sich von seinen Eltern, streckte siegesgewiss den Daumen in die Höhe und lief davon. Auf halbem Weg zum Spielfeld drehte er sich um und winkte Miss Talbot strahlend zu. Sie setzte sich aufrecht hin, lächelte ihm zu und winkte zurück.
»Danke«, murmelte Stephen in Connors Richtung, während sie sich alle in der zweiten Tribünenreihe einrichteten, die er ausgesucht hatte – und die zufällig weit von der Presse entfernt war. »Wenn ich oder Nancy das gesagt hätten, hätte er nie gehört.«
»Ihr seid seine Eltern. Ich bin sein Onkel. Ihr macht die Arbeit, ich bin für das Vergnügen zuständig. Deshalb gewinne ich jeden Beliebtheitswettbewerb.« Connor beobachtete die kurze Szene zwischen Brian und seiner Lehrerin. »Wo wir gerade von Beliebtheitswettbewerb sprechen, euer Sohn ist anscheinend immer noch ganz verrückt nach Miss Talbot, oder?«
»Und ob.« Stephen nickte. »Er spricht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang von ihr. Aber ich verstehe ihn gut. Sie ist eine tolle Lehrerin, die sich unglaublich gut darauf versteht, die Kinder zu motivieren.«
»Dann kann sie also noch mehr als nur Effetbälle werfen«, kommentierte Connor trocken.
»Keine Frage«, mischte Nancy sich ein, die aus ihrer Bewunderung für Brians Lehrerin keinen Hehl machte. »Obwohl ihr sportliches Talent nicht schadet. Ebenso wenig wie die ganze Zeit, die sie zusätzlich aufbringt, um mit den Kindern zu trainieren. Aber Stephen hat Recht. Sie ist eine ziemlich gute Pädagogin. Sie ist klug und begeisterungsfähig. Und sie ist in der Lage, die Welt durch die Augen der Kinder zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Welt, in der du arbeitest, nicht weiter von Bedeutung ist, aber es ist eine bemerkenswerte Fähigkeit, die viel Einsicht und Sensibilität erfordert. Und mit diesen ganzen Eigenschaften verfügt Miss Talbot über eine sehr seltene Kombination.«
»Selten? Ich würde eher sagen ausgestorben.« Connor warf einen kurzen Blick in Julias Richtung. Es war beileibe nicht der erste Blick, der ihr gegolten hatte. Julia Talbot zu übersehen war äußerst schwierig, selbst aus der Ferne. Und aus der Nähe war sie eine absolute Sensation. Er wusste das aus erster Hand, schließlich war er ihr dank Brian schon fünf oder sechs Mal begegnet.
Sie hatten nie mehr als ein paar Worte gewechselt. Das war keine Überraschung. Nach Nancys Beschreibung waren ihre und seine Welt ja auch Lichtjahre voneinander entfernt. Sie lebte in einer idealistischen, behüteten Umgebung, die von Kinderlachen beherrscht war. Er lebte in einer kalten Wirklichkeit, wo Geld und Macht alles bedeuteten, eine Welt, die ihm schon vor langer Zeit die rosarote Brille von der Nase gerissen hätte – wenn er je eine gehabt hätte. Aber als Stratford hatte er von Anfang an gelernt, dass das Leben eine einzige große Herausforderung war, die man entweder annahm oder von der man überrollt wurde.
Lichtjahre voneinander entfernt war noch milde ausgedrückt. Er konnte gar nicht glauben, dass jemand so Naives wie Julia Talbot überhaupt existierte. Und nach der Mauer zu urteilen, die sie jedes Mal um sich herum errichtete, wenn sie miteinander sprachen, war sie von ihm ebenso wenig angetan wie er von ihr.
Das hielt ihn jedoch nicht vom Hinschauen ab.
Sie war sehr hübsch, auf eine viel natürlichere und wahrhaftigere Weise als die Frauen, in deren Kreisen er sich sonst bewegte. Ihre Züge waren weich und makellos, und sie war so gut wie ungeschminkt. Auf ihrer Stupsnase trug sie eine modische Sonnenbrille. Das seidige kastanienbraune Haar hatte sie zu einem französischen Zopf geflochten, aber ein paar Strähnen hatten sich gelöst und fielen ihr ins Gesicht. Sie trug eine leichte Jacke und Jeans, die ihre schlanke Figur leider nur erahnen ließen. Aber Connor hatte sie auf Brians Sommersportfest gesehen, im Juli oder August, als sie nur ein T-Shirt und knappe Shorts angehabt hatte. Julia Talbot hatte einen Körper, der Männern den Schlaf raubte.
Im Augenblick drehte sie ihm den Rücken zu, ihre gesamte Konzentration galt Brian. Sie jubelte und schrie, als er und seine Mannschaft aufs Feld liefen.
»Sie ist mit Greg Matthews zusammen.«
»Hm?« Connor warf seinem Bruder einen verständnislose Blick zu. »Wer?«
»Julia Talbot. Greg hat es mir diese Woche nach der Stadtratssitzung erzählt. Er scheint die Sache ziemlich ernst zu nehmen.«
»Du machst Witze. Sie passen doch überhaupt nicht zusammen. Er ist ein aalglatter Geschäftsmann mit genug politischen Ambitionen, um selbst für ein Amt zu kandidieren. Und sie ...« Connor schüttelte den Kopf. »Es wäre wie ein Lamm in der Höhle des Löwen.«
»Ja, das habe ich auch gedacht.«
»Wie lange geht das zwischen ihnen schon?«
»Ungefähr einen Monat. Sie haben sich bei einem Empfang für die Direktorin ihrer Schule kennen gelernt.«
Connor antwortete mit einem Achselzucken. »Es ist manchmal rätselhaft, warum sich Menschen voneinander angezogen fühlen. Aber ich bin ja kein Experte. Meine Erfolge bei Frauen halten sich schließlich auch in Grenzen.«
»Das liegt nur daran, dass du mit deiner Arbeit verheiratet bist, genau wie die Frauen, mit denen du dich einlässt. Das ist natürlich keine gute Ausgangsposition für ein ›Bis dass der Tod euch scheidet‹.«
Connor entging nicht, dass eine Spur Verbitterung in Stephens Stimme mitschwang. Er hätte seinen Bruder sofort darauf angesprochen, wenn Brian nicht gerade begonnen hätte, sich aufzuwärmen, um seinen ersten Wurf zu versuchen.
Fragen würden warten müssen.
Aber das unbehagliche Gefühl, das seit dem letzten Besuch in Leaf Brook an Connor nagte, wurde noch stärker.
Im fünften Inning, als Brians Team 3:1 führte, begann Stephen unruhig zu werden. Connor runzelte die Stirn, als er die Anzeichen bemerkte, und hoffte, dass er sie falsch interpretierte.
Doch das, was Stephen als Nächstes tat, zeigte ihm, dass es nicht so war.
Stephen erhob sich und drängte sich an Nancy vorbei, die den Platz am Mittelgang hatte. Gleichzeitig griff er in seine Tasche und zog sein Handy heraus. »Ich muss kurz telefonieren«, meinte er nur. »In einer Minute bin ich zurück.«
»Jetzt?«, fragte Connor. »Brians Team führt gerade.«
Stephens kalter Blick gab Connor unmissverständlich zu verstehen, dass er sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern sollte. »Es sind noch fünf Batter an der Reihe, ehe Brian wieder wirft. Ich werde bestimmt nichts verpassen.«
Er verließ die Bank und entfernte sich.
Connor sah, dass Nancy die Lippen fest aufeinander presste und schluckte, so als müsste sie mit den Tränen kämpfen. Aber sie nahm den Blick keine Sekunde vom Spielfeld.
Wieder ein Warnzeichen.
»Nancy?« Connor senkte die Stimme. »Was ist los?«
Er wusste genau, dass sie ihn gehört hatte. Aber sie gab keine Antwort.
»Nancy.« Connor würde so schnell nicht aufgeben. »Steckt mein Bruder in Schwierigkeiten?«
Sie drehte den Kopf nur ganz leicht in Connors Richtung. Aber er konnte den Schmerz in ihrem Gesicht sehen. »Lass ihn, Connor. Es ist nur der Stress wegen der bevorstehenden Wahl. Es belastet ihn. Es ist schon okay.«
Wie häufig hatte Connor diese Worte schon gehört? »Verflucht«, zischte er.
»Es ist schon okay«, wiederholte Nancy. »Wirklich. Es ist nichts, womit ich nicht zurechtkäme. Und was das Politische angeht, hat Cliff alles unter Kontrolle. Er kümmert sich um den Wahlkampf, sorgt dafür, dass alles glatt geht. So hat Stephen nicht so viel um die Ohren. Sobald die Vorab-Umfragen die Zahlen bringen, auf die wir hoffen, wird sich alles wieder beruhigen.«
Alles. Was sie eigentlich meinte, war Stephen.
Connor schaute sich rasch um, sah niemanden, der ihnen zuhörte, nur applaudierende Eltern und mitgerissene Zuschauer. Dennoch zwang er sich, die Sache nicht allzu weit nach vorn zu drängen. Er war ein Stratford, seit frühester Kindheit darauf trainiert, seine Familie unter allen Umständen zu schützen. Und dazu gehörte auch, in der Öffentlichkeit keine schmutzige Wäsche zu waschen. Alle Einzelheiten würden bis später warten müssen – und dann würde er sehen, was er herausbekam. Weder sein Bruder noch seine Schwägerin waren sehr auskunftsfreudig. Nancy war immer bemüht, Stephen zu schützen, und Stephen war stets bemüht, sich selbst zu schützen. Beide waren sehr verschlossen.
Die einzig gute Nachricht war, dass Cliff Henderson für die Wahlkampagne verantwortlich war. Es würde die Belastungen für Stephen erheblich reduzieren, und das wiederum würde auch seine Probleme einigermaßen in Schach halten.
Diese Aussicht beruhigte Connor ein wenig. Cliff war Stephens ältester und engster Freund. Er war zugleich sein Anwalt und nun auch noch zuständig für seinen Wahlkampf. Ihre Freundschaft ging weit zurück. Sie waren zusammen in Yale auf dem College gewesen und hatten anschließend auf die juristische Fakultät gewechselt. Dort hatten sie auch Nancy kennen gelernt. Sie stand kurz vor ihrem Collegeabschluss, als die beiden Männer im vierten Semester Jura waren. Eigentlich war Cliff ihr als Erster begegnet und ein paar Mal mit ihr ausgegangen, aber die Beziehung war nicht richtig in Schwung gekommen. Als sie und Stephen sich dann kennen gelernt hatten, war es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Sie hatten geheiratet, nachdem Nancy mit dem College fertig gewesen war und Stephen die Zulassung als Barrister für die Gerichte in den Bundesstaaten Connecticut und New York bekommen hatte. Zunächst hatten sie sich in Connecticut niedergelassen und Harrison Stratfords Beziehungen genutzt, um Stephens Karriere voranzutreiben. Als Harrison schließlich der Ansicht war, es sei Zeit für die politische Laufbahn seines Sohnes, waren sie nach Leaf Brook gezogen, eine aufstrebende Stadt, die Harrison für Stephens politische Ambitionen für geeignet hielt.
Im Laufe dieser ganzen Zeit war Cliff Stephen immer ein treuer Freund geblieben. Er war schließlich nach Westchester gezogen, in die Nähe der Kanzlei, die er inzwischen gegründet hatte und die nur eine halbe Stunde Autofahrt von Stephen und seiner Familie entfernt war.
Connor mochte Cliff. Er war ein anständiger Kerl, intelligent und schnell, wenn es darum ging, Zusammenhänge klar zu erkennen. Cliff glaubte an Stephen und dessen Zukunft, und als für Stephen der Zeitpunkt gekommen war, der Forderung seines Vaters nachzukommen und sich um ein politisches Amt zu bewerben, war Cliff sofort zur Stelle gewesen, um ihn in seinem Wahlkampf nach Kräften zu unterstützen.
Cliff war klug. Zu klug, um nach zwanzig gemeinsamen Jahren nichts von Stephens Problemen zu wissen – oder zumindest zu vermuten. Aber was immer er über die Leiche in Stephens Keller wusste oder zu wissen glaubte, er behielt es für sich. Stattdessen bot er sich immer wieder an, tauchte dort auf, wo er gebraucht wurde, und tat, was getan werden musste.
Tat, was getan werden musste. Nun, hier lag der Haken.
Connor presste frustriert die Handflächen zusammen. Das Schlimme war, dass Stephens Problem einfach nicht verschwand. Es ging auf und ab, je nachdem wie hoch die Belastungen in seinem Leben waren. Und die Menschen, die ihm nah waren, mussten dieses Auf und Ab mit ihm vollziehen, mussten ihm eine Stütze sein, ihm beim Überleben helfen und das Hässliche zugleich vor dem öffentlichen Auge verborgen halten – und vor Harrison Stratford.
Das wurde zunehmend schwieriger.
»Alles geregelt«, verkündete Stephen und ließ sich wieder auf seinen Platz fallen. »Ich habe doch nichts verpasst, oder?«
»Offenbar nicht«, murmelte Connor.
Stephen warf seinem Bruder einen Seitenblick zu. »Es war ein geschäftliches Gespräch.«
»Tatsächlich?« In Connors Stimme lagen deutliche Zweifel.
»Ja, tatsächlich.« Stephen richtete seine ganze Aufmerksamkeit wieder aufs Spielfeld. »Also lass mich in Ruhe.«
Erneut verdrängte Connor seine Bedenken – vorerst. Aber diese Angelegenheit war noch nicht beendet. Er hatte eigentlich vorgehabt, nach Brians Spiel und einer gemeinsamen Siegesfeier wieder in die Stadt zurückzufahren. Aber das Verhalten seines Bruders ließ ihn seine Pläne ändern. Er würde nun mit zu Stephen nach Hause fahren, den Nachmittag dort verbringen und bei passender Gelegenheit ein Vier-Augen-Gespräch mit seinem Bruder führen – ganz gleich, ob Stephen in der Stimmung dazu war, sein Herz auszuschütten.
Das Endergebnis lautete 7:2, Brians Team – und seine Effetbälle – gingen als Sieger aus dem Spiel hervor.
Julia applaudierte und pfiff, als Brian von seinen Mannschaftskameraden gefeiert wurde. Er hatte es verdient, denn er hatte fantastisch geworfen. Sie war sehr stolz, als er sich schließlich von seinen feiernden Mannschaftskameraden löste und sie hinüberführte, um sich mit der geschlagenen Mannschaft in einer Geste von Fairness die Hände zu schütteln. Selbst in seinem zarten Alter vergaß Brian nie, sich um die Gefühle anderer Menschen zu kümmern. Dies war ein Charakterzug, der ihm auch dann noch anhaften würde, wenn sein beneidenswerter Wurf-Arm längst eine schöne Erinnerung sein würde.
Sie sah zu, wie sein Team auseinander ging, und ihr Herz wurde ganz warm, als er sofort auf seine Familie zustürmte, die von der Tribüne geklettert war, um ihn zu empfangen. Seine Mom, eine elegante, schlanke Frau mit glatten blonden Haaren und einem strahlenden Lächeln, umarmte ihn fest und beugte sich vor, um ihm etwas zu sagen, was sein Gesicht aufleuchten ließ. Und sein Dad, Bürgermeister Stratford, stand direkt hinter ihr und betrachtete ihn mit einem stolzen Lächeln.
Er wollte gerade etwas zu Brian sagen, als die Presse auf ihn losging.
»Herr Bürgermeister, was ist es für ein Gefühl, einen so großartigen Pitcher in der Familie zu haben?«, hörte Julia eine Reporterin fragen. Sie tat das auf eine Art und Weise, die ganz deutlich machte, dass dies nur ihre einleitende Frage war, auf die die Fragen folgen würden, die sie eigentlich stellen wollte.
Stephen Stratford lächelte sein charmantes Lächeln, mit dem er Eisberge zum Schmelzen bringen konnte. Er war ein erstaunlich attraktiver Mann – groß, breitschultrig, mit tiefschwarzem Haar und saphirblauen Augen, die Wärme und Freundlichkeit sowie Intelligenz und Klugheit ausstrahlten. Allein mit seinem unglaublich guten Aussehen, seinem natürlichen Charisma und seinen beeindruckenden Familienbeziehungen würde er vermutlich mühelos in den Senat gewählt werden. Aber er hatte noch mehr zu bieten: eine erfolgreiche fünfjährige Amtszeit als Bürgermeister. Im Laufe dieser Zeit hatte er sich als eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit erwiesen, als jemand, der die Wirtschaft von Leaf Brook entscheidend nach vorn gebracht hatte und der sich engagiert hatte für die Schulen und Grünanlagen der Stadt. In Julias Augen war er ein aussichtsreicher Kandidat für einen Platz im Senat. Und er würde dort nicht Halt machen. Julia war sich sicher, dass Stephen Stratford noch im nächsten Jahrzehnt aus Albany in den US-Senat nach Washington einziehen würde.
»Hallo, Cheryl.« Er begrüßte die aufdringliche Journalistin und ließ sich trotz ihrer nervenden Art die gute Laune nicht verderben. »Wenn Sie mir bitte kurz gestatten würden, meinem Sohn zu gratulieren, werde ich Ihre Fragen anschließend gern beantworten.« Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich um und umarmte Brian stürmisch. »Tolles Spiel, du Superstar«, hörte Julia ihn sagen. »Und großartige Effetbälle.«
»Danke.« Brian grinste von einem Ohr bis zum anderen. Interessant, dass er die Presse kaum wahrzunehmen schien. Julia vermutete, dass er daran gewöhnt war, sie um sich herum zu haben. Mit einem übermächtigen Großvater und Vater und einer Familie, die ständig in den Nachrichten war und im Interesse der Öffentlichkeit stand, waren Journalisten wahrscheinlich etwas Alltägliches, auch für einen Siebenjährigen. Dennoch konnte Julia sich nicht vorstellen, selbst derartig im Mittelpunkt zu stehen.
Dafür konnte sie sich umso besser in seinen gegenwärtigen Zustand versetzen. Der Sieg hatte ihn beflügelt. Er strahlte, hüpfte herum, unfähig auch nur eine Sekunde still zu stehen, war voller Energie und Aufregung. Er löste sich von seinen Eltern und lief zu dem anderen großen Mann hinüber, der in ihrer Begleitung war und der ihn ebenfalls stolz umarmte.
Connor Stratford.
Julias Lächeln schwand, als sie sich seiner Anwesenheit bewusst wurde und die Nervosität spürte, in die sie sein Anblick jedes Mal stürzte und gegen die sie machtlos zu sein schien.
Das war es, wovon ihre Mutter am Vorabend gesprochen hatte und was für sie ein Hinderungsgrund für eine ernste Beziehung mit Greg war. Chemie hatte sie es genannt. Nun, wenn sie meinte. Julia würde es eher als unverständliche Faszination bezeichnen, die abgesehen von der körperlichen Anziehungskraft jeder Grundlage entbehrte und ihr ziemlich lästig war.
Ja, Connor Stratford war attraktiv – sehr attraktiv –, aber auf eine unangenehme und arrogante Art. Passend zu seiner Persönlichkeit. Und sie hasste Arroganz. So sehr, dass sie sich sofort von jedem abwandte, der über diesen Charakterzug zu verfügen schien, ganz gleich, wie gut er aussah. So war es zumindest bisher immer gewesen. Aber in diesem Fall schien alles irgendwie anders zu sein. Wieso, wusste sie nicht. Sie wusste bloß, dass sie Connor Stratford erst wenige Male getroffen hatte und dass es ihm jedes Mal gelungen war, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Sie senkte den Blick und versuchte ihre unbeabsichtigten Reaktionen auf einen Mann zu verstehen, den sie nicht einmal mochte.
Kaum zu glauben, dass er und Stephen Stratford Brüder waren. Okay, äußerlich war es offensichtlich. Sie sahen sich sehr ähnlich. Das gleiche dunkle Haar, die gleiche Größe und Statur, die gleichen blauen Augen. Nein, eigentlich verschiedene blaue Augen. Die des Bürgermeisters waren strahlend, funkelnd, warm und offen. Die Augen seines Bruders waren eher graublau, kühl und distanziert. Sie passten zu seiner Persönlichkeit – arrogant und beherrscht, cool und geheimnisvoll, mit einer abschätzenden Art, die ihm alle Menschen auf Distanz zu halten schien.
Und als ob das alles nicht schon ausreichte, war er auch noch Risikokapitalist – ein komischer Name für jemanden, der Geld anlegte, um noch mehr Geld daraus zu machen. Ebenso wie der seines Vaters tauchte auch sein Name regelmäßig in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen auf, in Artikeln, die die Glücksgriffe rühmten, die er getan hatte, und deren Details Julia nicht einmal entziffern, geschweige denn verstehen konnte. Alles, was sie wusste, war, dass er im Alter von fünfunddreißig bereits Millionen gemacht hatte, die er in immer größere und lukrativere Spekulationsobjekte investierte.
Was für eine Verschwendung! Zumindest hatte Bürgermeister Stratford sich dazu entschlossen, die Vorteile, die ihm das Leben bot, zu nutzen, um etwas zu bewegen, etwas zurückzugeben und die Welt zu verbessern. Er beschäftigte sich mit Menschen. Sein Bruder beschäftigte sich mit Geld. Diese Vorstellung ließ Julia kalt. Connor Stratford ließ sie kalt.
Die meiste Zeit jedenfalls.
Doch dann sah sie ihn zusammen mit Brian, und sie erlebte einen völlig anderen Menschen, einen, der sie auf unerklärliche Weise faszinierte. Seine Reserviertheit war wie weggeblasen, seine Arroganz verschwunden, und er erstrahlte plötzlich wie ein Weihnachtsbaum, warm und lebendig. Es war ganz offensichtlich, dass er verrückt war nach seinem Neffen, und Brians Zuneigung zu seinem Onkel grenzte fast an Heldenverehrung.
Jetzt erlebte sie gerade wieder ein typisches Beispiel.
»War das nicht ein Superspiel, Onkel Connor?«, fragte Brian.
»Mehr als super«, antwortete sein Onkel und lächelte jenes seltene Lächeln, das sein ganzes Gesicht völlig veränderte. »Du bist nur noch einen kleinen Schritt von den Profis entfernt. Warte noch ein Jahr, höchstens zwei, dann bist du ganz oben.« Er zwinkerte ihm zu. »Andererseits ist es vielleicht besser, wenn du in der Schule bleibst. Damit dein Verstand genauso stark wird wie dein Arm.«
Das Wort Schule schien Brian an etwas zu erinnern. Und Julia hatte das ungute Gefühl, zu wissen, was, oder besser gesagt, wer das war.
Und tatsächlich – Brian wirbelte herum, sein Blick suchte die Tribüne ab, wo sie immer noch stand. Er fand sie, seine Augen leuchteten. »Miss Talbot!«, schrie er und winkte heftig. »Miss Talbot! Ich bin hier drüben!«
Julia spürte, wie auch Connors Blick in ihre Richtung wanderte. Sie schluckte und wünschte sich, verschwinden zu können. Mechanisch winkte sie zurück und zermarterte sich das Hirn nach einer Möglichkeit, von hier entkommen zu können. Es gab keine.
Doch. Die Presse. Sie umschwirrte den Bürgermeister wie ein Schwarm Bienen. Und da wollte sie nicht stören.
Nancy Stratford verschloss ihr auch diesen Fluchtweg.
»Miss Talbot, Sie müssen unbedingt zu uns kommen«, rief sie ihr zu. »Es kann keine Siegesfeier ohne Sie geben.«
Mit weichen Knien ging Julia zu ihnen.
»Herr Bürgermeister.« Ein forscher Reporter sprach ihn gerade an. »Ich weiß, dass Sie sich dafür einsetzen, dass Kindern nach der Schule mehr Freizeitmöglichkeiten geboten werden. Werden Sie dieses Engagement auch auf bundesstaatlicher Ebene fortsetzen?«
»Selbstverständlich«, antwortete Stephen mit ruhiger, fester Stimme, die signalisierte, dass er genau wusste, wovon er sprach. »Nicht jede Familie verfügt über genügend finanzielle Mittel, um ihren Kinder diese Möglichkeiten zu bieten, ganz gleich, ob es sich um Sport, Kunst, Fortbildung, Naturwissenschaft oder was auch immer handelt. Der Staat muss dafür sorgen, sie allen Familien verfügbar zu machen.« Er lächelte in Julias Richtung. »Danke für das Extra-Training. Es hat sich wirklich gelohnt.«
»Gern geschehen.« Sie lächelte zurück und bückte sich, um Brian zu umarmen. »Du warst sensationell.«
»Danke. Sagen Sie Onkel Connor Hallo.«
Warum hatten Kinder bloß einen so sicheren Instinkt für das, was man gerade im Moment am allerwenigsten wollte?
Resigniert erhob sich Julia und ging auf Connor zu, der sie kühl musterte. »Ich freue mich, Sie zu sehen.«
»Gleichfalls.« Er nickte knapp. »Ich habe gehört, Sie haben Brian ein tolles Last-Minute-Training geboten?«
»Das war nicht nötig. Das Einzige, was Brian brauchte, war noch eine starke Lunge, die ihn lauthals anfeuerte. Dafür habe ich gesorgt.«
Es waren wieder dieselben steifen Sätze und anstrengenden Bemerkungen, die all ihre Begegnungen prägten.
Julia wollte nichts wie weg von hier.
Aber Brian hatte andere Pläne. »Sobald Dad fertig geredet hat, gehen wir ein Eis essen«, verkündete er. »Ach und auch mittagessen. Können Sie mitkommen?«
Julia schüttelte bedauernd den Kopf. »Es tut mir Leid, aber das geht nicht. Ich muss eine Menge Diktate korrigieren, außerdem bin ich noch verabredet.«
Die letzte Bemerkung war ein Fehler gewesen, das wusste Julia in der Sekunde, als Brians Augen interessiert aufleuchteten.
»Verabredet?«, fragte er. »Mit Miss Haley?«
»Nein, Süßer, nicht mit Miss Haley«, antwortete Julia. Sie wusste nicht, ob sie amüsiert sein sollte oder verzweifelt. Sie hätte es sich denken können. Robin Haley war die Computerlehrerin in ihrer Grundschule, und sie waren Freundinnen. Klar, dass ein Zweitklässler, der sich nicht vorstellen konnte, dass eine Lehrerin auch ein Leben außerhalb der Schule hatte, glauben musste, dass mögliche Freunde nur von dort stammen konnten. Völlig logisch also, dass sie mit Robin verabredet sein sollte.
Brian irrte sich. Aber Julia hatte nicht die Absicht, ihn zu berichtigen und ihm zu sagen, dass sie sich mit einem Mann traf – und schon gar nicht mit welchem. Greg arbeitete für den Bürgermeister. Sie unterrichtete den Sohn des Bürgermeisters. Es war ein blöder Zufall – und einer, den sie nicht unbedingt überall publik machen wollte.
»Nicht mit Miss Haley?« Brian ließ keine Ruhe. »Mit wem denn?«
»Brian, ich glaube, du hast Miss Talbot jetzt genügend Fragen gestellt.« Connor rettete sie, aber er klang ziemlich süffisant, und Julia hatte das unangenehme Gefühl, dass er genoss, wie sie sich wand. Er beugte sich vor und raunte seinem Neffen ins Ohr: »Du hörst dich ja schon fast an wie einer von denen da.« Ganz leicht zeigte er mit dem Kopf in Richtung Pressemeute.
Brian verdrehte die Augen und grinste seinen Onkel an. »Ja, du hast Recht. Tut mir Leid, Miss Talbot.«
Julia wollte gerade den Mund aufmachen, um etwas zu antworten, als sich die Reporterin namens Cheryl zu ihnen herumdrehte. »Mr. Stratford«, sagte sie zu Connor. »Mein Name ist Cheryl Lager, ich arbeite für die Leaf Brook News. Es ist kein Geheimnis, dass Ihr Vater und Sie die Stratford-Millionäre sind. Sagen Sie, werden Sie sich am Wahlkampf für Ihren Bruder beteiligen? Oder kommt der Hauptteil der finanziellen Unterstützung von Ihrem Vater?«
Den Bruchteil einer Sekunde herrschte atemlose Stille, und Julia konnte geradezu fühlen, welche Spannung sich über die Gruppe legte. Sie schaute zu Stephen Stratford und bemerkte ein kurzes irritiertes Aufflackern in seinen Augen, das aber sofort wieder verschwand. Seine Frau wirkte überrascht, näherte sich reflexartig ihrem Mann, als wollte sie ihn schützen. Die übrigen Presseleute beugten sich interessiert vor, froh, dass sie selber die Frage nicht gestellt hatten, und zugleich zufrieden, dass jemand anders es getan hatte.
Connors Gesichtsausdruck veränderte sich nicht eine Sekunde, allerdings stand Julia nahe genug, um zu erkennen, dass er die Lippen leicht zusammenpresste.
»Ms. Lager, ich bin mir sicher, dass mein Bruder ein außergewöhnlicher Senator wäre«, antwortete er. »Daher besitzt er in jeder Hinsicht meine volle Unterstützung, auch finanziell, falls das erforderlich werden sollte. Mein Vater teilt diese Überzeugung, was er Ihnen sicher jederzeit bestätigen wird.« Er zog die dunklen Augenbrauen hoch. »Stellen Sie sich vor, eine Familie finanziert gemeinsam einen Wahlkampf. Eine erfrischende Idee, finden Sie nicht auch? Und sicher wesentlich unverfänglicher als eine Finanzierung durch irgendwelche Interessengruppen.«
Gelächter erklang, und Julia glaubte für einen Moment, die Spannung würde sich legen.
Aber Cheryl Lager war noch nicht bereit, das Handtuch zu werfen. »In der Theorie klingt das sicher vorbildlich. Aber bei Ihren weit verzweigten Geschäftsinteressen stellt sich mir natürlich schon die Frage, ob Sie nicht doch gewisse Vorstellungen haben, wie öffentliche Gelder zukünftig investiert werden könnten.«
Dieses Mal erhielt sie eine wesentlich heftigere Reaktion. Connors Gesicht wurde starr, und der Blick, den er ihr zuwarf, war absolut tödlich. »Meine Vorstellungen – und mein Ethos – sind absolut privater Natur und gehören nicht in diesen Wahlkampf. Außerdem sind sie nicht verkäuflich und stehen nicht zur Diskussion. Beantwortet das Ihre Frage, Ms. Lager?«
»Allerdings.« Sie zog sich zurück, als ihr klar wurde, dass sie ihre Grenzen überschritten hatte.
»Onkel Connor.« Brian zupfte an seinem Arm. »Warum schaust du so böse? Ich dachte, wir feiern jetzt.«
Irgendetwas machte klick bei Julia. Vielleicht war es die hässliche, penetrante Art der Fragestellung, vielleicht war es auch die Tatsache, dass Brians Baseballerfolg durch eine unverschämte, sensationsgierige Journalistin plötzlich zweitrangig geworden war. »Das tun wir«, hörte sie sich selber sagen. Sie legte eine Hand auf Brians Schulter und fügte hinzu: »Weißt du, wenn ich es mir recht überlege, habe ich doch noch Zeit für ein schnelles Eis. Außerdem wollte ich deinen Dad um einen Gefallen bitten.« Sie drehte den Kopf fragend in Bürgermeister Stratfords Richtung. »Ich hatte mir nämlich vorgestellt, er könnte uns einmal im Unterricht besuchen und unserer Klasse ein wenig darüber erzählen, wie man für ein Amt kandidiert. Wir haben ja bald Klassensprecherwahl und könnten da jede Menge Hilfe gebrauchen.«
»Kein Problem.« Das Lächeln kehrte in Stephen Stratfords Gesicht zurück, aber es blieb seltsam gezwungen. Er schien äußerst ungehalten zu sein, ebenso wie seine Frau. Und Connor Stratford war so nervös, dass Julia es beinahe fühlen konnte.
»Großartig. Danke«, antwortete Julia. »Dann können wir vielleicht gleich einen Termin vereinbaren, während Brian sich die Eissorte aussucht.«
»Gute Idee.« Das kam von Connor, der sich nun einmischte, als hätte er genug von allem. »Keine weiteren Fragen mehr heute Morgen«, sagte er an die Journalisten gerichtet. »Wir haben Familientag. Wenn Sie uns also bitte entschuldigen würden ...«
Sein Ton duldete keinen Widerspruch. Die Presseleute begriffen, suchten ihre Ausrüstung zusammen und verzogen sich.
»Danke«, sagte Stephen leise zu seinem Bruder. Auf seiner Stirn standen Schweißperlen.
»Gern.« Connor schaute Cheryl Lager mit zorniger Miene nach. »Sie ist widerlich. Das versteht man wohl unter Pressefreiheit.« Er drehte sich um und warf seinem Bruder einen düsteren Blick zu. »Aber da wird wohl noch einiges auf uns zukommen, was?« Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich um. Seine Miene hellte sich auf, als er an Brians Baseballmütze zupfte. »Komm, Champion. Wir haben heute noch eine Menge zu feiern.«
»Miss Talbot auch«, erinnerte Brian ihn.
Die kühlen blauen Augen musterten Julia kurz. »Ja, Miss Talbot auch. Aber nur auf ein schnelles Eis. Sie muss noch Diktate korrigieren, und du und ich haben viel zu besprechen.«
»Okay.« Brian nickte eifrig. Die Vorstellung, mit seinem Onkel zusammen zu sein, schien ihn über die Enttäuschung, dass Julia nur kurz mitkam, hinwegzutrösten. »Wir gehen zu ›Big Scoop‹«, verkündete er. »Dort gibt es mein Lieblingseis.«
»Meins auch«, antwortete Julia.
»Ich verhungere fast.« Brian warf einen erwartungsvollen Blick in Richtung seiner Eltern. »Können wir jetzt endlich gehen?«
Stephen Stratford schaute nachdenklich vor sich hin.
»Stephen?« Seine Frau berührte ihn am Arm.
Er blinzelte und war sofort wieder da. »Klar können wir jetzt gehen. Sind alle bereit? Dann los.« Er sah die Gruppe auffordernd an, legte einen Arm um die Schulter seiner Frau und setzte sich in Bewegung.
Connor blieb noch einen Moment stehen. »Sind Sie mit dem Auto hier?«, fragte er knapp.
Da Julia die einzige Erwachsene war, die noch übrig war, konnte er nur sie meinen. »Ja.«
»Gut. Dann sind Sie ja völlig unabhängig und können jederzeit nach Hause fahren.«
Er legte die Hand auf Brians Schulter und steuerte mit ihm den Parkplatz an.
Julia sah ihm nach. Connor Stratford hatte nicht einmal versucht, vor ihr zu verbergen, dass er sie so schnell wie möglich loswerden wollte. Aber dieses Mal hatte das nichts mit den irritierenden Spannungen zwischen ihnen zu tun. Dieses Mal hatte es etwas mit seiner Familie, mit seinem Bruder zu tun.
Dieses Mal stimmte etwas nicht.
4
2. April
Stephen saß mit aufgestützten Ellbogen an seinem Schreibtisch, massierte seine Schläfen und starrte auf das Telefon. Wenn es doch nur endlich klingeln würde. Wenn sich sein Instinkt doch endlich einmal auszahlen würde. Er brauchte diesen Gewinn. Er brauchte eine gute Nachricht nach dem lausigen Wochenende, das er hinter sich hatte. Erst diese nervtötende Zeitungstante am Samstag, anschließend das Verhör mit Connor. Dann am Sonntag die Nachricht, dass er in einer Umfrage völlig durchgefallen war. Und zu allem Überfluss auch noch dieser grässliche Streit gestern Abend mit Nancy.
Sie sorgte sich um ihn. Connor sorgte sich um ihn. Die ganze verdammte Welt sorgte sich um ihn.
Wenn sie ihn doch alle in Ruhe lassen würden, das wäre das Beste. Er wusste, was er tat. Er hatte alles unter Kontrolle. Schließlich war er ein Stratford, oder nicht?
Ungehalten schob er seinen Stuhl vom Schreibtisch zurück, drehte ihn, sodass er aus dem Fenster schauen konnte. Fünf Stockwerke tiefer pulsierte die Innenstadt von Leaf Brook. Um das Rathaus herum ging es um diese Zeit am Morgen immer sehr geschäftig zu. Menschen eilten zu ihrem Arbeitsplatz, Eltern fuhren ihre Kinder zur Schule oder in den Kindergarten, Einkäufer transportierten ihre Tüten von den Supermärkten nach Hause.
Es sah alles so einfach aus.
Vielleicht war es das für manche Leute.
Sein Handy klingelte. Stephen riss es ans Ohr. »Ja?«
»Hat leider nicht geklappt. Das Team hat den Vertrag nicht bekommen.«
Stephens Finger schlossen sich fester um das Telefon. »Was soll das heißen, das Team hat den Vertrag nicht bekommen? Sie standen doch kurz vor der Unterzeichnung.«
»Nun, sie haben aber nicht unterzeichnet. Er hat seinen Vertrag noch einmal überdacht. Er bleibt.«
»Scheiße.« Stephen schlug auf die Taste, um das Gespräch zu beenden, und steckte das Handy in seine Jackentasche. Zehntausend Dollar den Bach herunter. Wie viel schlimmer konnte es noch werden?
Es klopfte an der Tür.
Er schluckte, stützte die Hände auf den Schreibtisch und atmete tief durch. Ruhe. Er durfte jetzt nicht die Ruhe verlieren.
»Mr. Stratford?« Celeste, seine Sekretärin, steckte den Kopf durch die Tür. »Es tut mir Leid, dass ich Sie stören muss, Sir, aber Ihr Neun-Uhr-dreißig-Termin ist hier. Und Mr. Henderson. Soll ich ihn zuerst reinschicken?«
Stephens Blick fiel automatisch auf seinen Terminkalender. Neun Uhr dreißig. Philip Walker, einer der mächtigsten Immobilieninvestoren von Leaf Brook. Er hatte zwei Drittel aller Gebäude in der Einkaufszeile der Stadt gebaut, einige Bürokomplexe, das Sport- und Schwimmstadion und zwei Kinos. Außerdem hatte er mächtig in die neue Super-Mall im Zentrum investiert, das Einkaufszentrum, das gerade fertig gestellt worden war und in knapp zwei Wochen eröffnet werden sollte. Greg hatte erwähnt, dass Walker mit ihnen über eine weitere Geschäftsidee sprechen wollte, die das Image der Stadt immens verbessern würde.
»Mr. Stratford?« Celeste sah ihn fragend an.
Stephen hob den Kopf und schenkte seiner Sekretärin einen wohlwollenden Blick. »Ja, schicken Sie Cliff zuerst rein. Und informieren Sie Greg. Sagen Sie ihm, Mr. Walker sei hier. Er möchte bei dem Gespräch dabei sein.«
»In Ordnung, Sir.«
»Ach, und Celeste? Bitten Sie Mr. Walker, sich noch fünf Minuten zu gedulden. Bieten Sie ihm so lange einen Kaffee an.«
»Natürlich.«
»Vielen Dank.« Stephen lächelte dankbar. »Sie sind eine echte Perle.«
Sie lächelte zurück. »Ich gebe mir alle Mühe.«