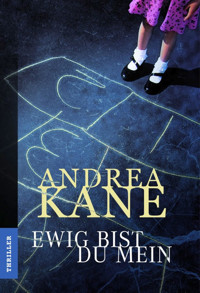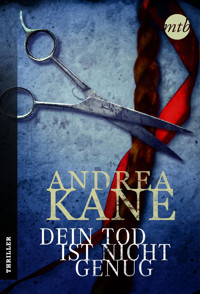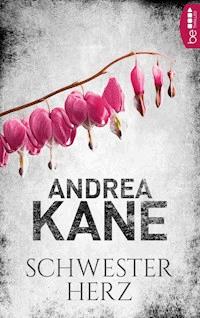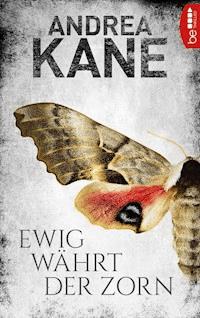4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Romantic Suspense der Bestseller-Autorin Andrea Kane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau gerät in einen Strudel aus Ehrgeiz, Verlangen und gefährlichen Geheimnissen ...
Der Parfümmagnat Carson Brooks wird von einem Unbekannten angeschossen. Die Verletzung ist tödlich - nur ein Blutsverwandter kann ihn mit einer Organspende noch retten. Da Carson in jungen Jahren eine anonyme Samenspende vorgenommen hat, macht sich sein Anwalt Dylan Newport auf die Suche nach dem vermeintlichen Kind, der einzig infrage kommenden Person. Er trifft schließlich auf die aufstrebende Management-Beraterin Sabrina Radcliffe - und es knistert gewaltig zwischen ihnen. Doch schon bald geraten beide in Gefahr. Denn es gibt jemanden, der mit allen Mitteln versucht, die Rettung des Parfümmagnaten zu verhindern ...
Eine explosive Mischung aus packender Spannung und prickelnder Romantik. Weitere Titel von Andrea Kane bei beTHRILLED: Schwesterherz. Dunkelziffer. Hetzjagd. Angsttage. Ewig währt der Zorn. Das Böse liegt so nah.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmung1234567891011121314151617181920212223242526272829303132EPILOGDANKSAGUNGENÜber dieses Buch
Eine junge Frau gerät in einen Strudel aus Ehrgeiz, Verlangen und gefährlichen Geheimnissen …
Der Parfümmagnat Carson Brooks wird von einem Unbekannten angeschossen. Die Verletzung ist tödlich – nur ein Blutsverwandter kann ihn mit einer Organspende noch retten. Da Carson in jungen Jahren eine anonyme Samenspende vorgenommen hat, macht sich sein Anwalt Dylan Newport auf die Suche nach dem vermeintlichen Kind, der einzig infrage kommenden Person. Er trifft schließlich auf die aufstrebende Management-Beraterin Sabrina Radcliffe – und es knistert gewaltig zwischen ihnen. Doch schon bald geraten beide in Gefahr. Denn es gibt jemanden, der mit allen Mitteln versucht, die Rettung des Parfümmagnaten zu verhindern …
Über die Autorin
Andrea Kane ist eine erfolgreiche US-Autorin, die u. a. psychologische Thriller schreibt. Ihre Bücher wurden bereits in über 20 Sprachen übersetzt. Sie lebt mit ihrer Familie und einem Zwergspitz in New Jersey. Im Internet ist sie unter www.andreakane.com zu finden.
Andrea Kane
GEFAHRENZONE
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Barbara Först
beTHRILLED
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Digitale Neuausgabe
Titel der Originalausgabe: SCENT OF DANGER
© 2003 by Rainbow Connection Enterprises, Inc.
Copyright © 2006/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Published by Arrangement with Rainbow Connection Enterprises Inc.
on behalf of Jane Rotrosen Agency, LLC
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Lektorat: Wolfgang Neuhaus/Jan Wielpütz
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © shutterstock: pupsy | Krasovski Dmitri | Scisetti Alfio
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5137-8
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Diesen Roman widme ich Organspendern in aller Welt,deren Edelmut ihren Mitmenschen eine Zukunft ermöglicht,sowie den Ärzten,deren Kunst diese Zukunft Wirklichkeit werden lässt.
1
Montag, 5. September, Labor Day17.45 Uhr, New York City
Man hatte auf ihn geschossen.
Er hatte den Schützen nicht gesehen, nicht einmal gehört. Als der Schuss fiel, spürte er auch schon den brennenden Schmerz im Rücken. Er wurde gegen das Panoramafenster geschleudert, durch das er hinausgeschaut hatte, streckte eine Hand aus und stützte sich an der Scheibe ab. Er schaffte es, sich halb umzudrehen und zur Tür seines Büros zu schauen.
Doch wer immer geschossen hatte, war verschwunden.
Schmerz durchfuhr ihn wie eine Messerklinge; dann überkam ihn Schwäche, und seine Beine gaben nach. Er versuchte noch, sich am Schreibtisch festzuhalten, griff aber ins Leere und stürzte auf den Teppich. Seine Hände konnten den Aufprall kaum bremsen. Instinktiv drehte er den Kopf zur Seite, um sein Gesicht zu schützen. Er bekam nicht mehr richtig Luft. Als er dann doch einen Atemzug nahm, stieg ihm zugleich ein süßlicher, Übelkeit erregender Geruch in die Nase.
Er veränderte seine Lage ein wenig und versuchte, durch den Mund zu atmen. Erst jetzt fiel ihm auf, dass der Teppich feucht war und immer feuchter wurde, da irgendetwas Klebriges ihn durchtränkte. Mein Blut, dachte er verwirrt und spürte die nahende Ohnmacht, konnte sich aber nicht bewegen, nicht zur Tür kriechen. Die Schnur des Telefonhörers hing vom Schreibtisch, aber er kam nicht heran. Er versuchte zu rufen, brachte aber keinen Laut hervor. Außerdem – was sollte das nutzen? Heute war Labor Day, ein Feiertag. In der Firma war keine Menschenseele, außer ihm selbst und Dylan Newport. Und Dylans Büro lag auf der anderen Seite des Gebäudes. Es brachte nichts, Lärm zu machen. Carson konnte nur hoffen, dass Dylan erschien, bevor es zu spät war.
Er hörte Schritte näher kommen.
»Okay, Carson, ich hab die Akten, die du wolltest. Wir können sie später durchgehen. Jetzt sollten wir erst mal über diese persönliche Sache sprechen, die ich … mein Gott!« Dylan warf die Papiere hin und war wie der Blitz neben Carson Brooks. »Kannst du mich hören?«, rief er und fühlte den Puls.
»Ja …« Carsons Stimme klang rau und schwach. »Angeschossen«, brachte er hervor und leckte sich die trockenen Lippen.
Dylan sprang auf. »Nicht sprechen! Ich rufe einen Rettungswagen.« Er schnappte sich das Telefon, wählte den Notruf. »Hier Dylan Newport«, sprudelte er hervor. »Ich rufe von Ruisseau an, 57. Straße West. Ein Mann wurde angeschossen.« Pause. »Keine Namen, keine Presse. Schicken Sie nur einen Rettungswagen, und zwar schnell. Ja, er ist noch bei Bewusstsein, aber sehr schwach. Er hat viel Blut verloren. Sieht aus, als hätte es ihn im Rücken erwischt.« Wieder eine kurze Pause. »Ja. Gut. Schicken Sie den Rettungswagen. Jetzt. Elfter Stock, südöstliche Ecke des Gebäudes.«
Er knallte den Hörer auf die Gabel und kniete sich wieder neben den Verletzten. »Lieg still. Beweg dich nicht. Der Rettungswagen ist unterwegs.«
»Unverschämter Kerl …«, spottete Carson mit schwacher Stimme. »Ich bin noch nicht mal tot, und er gibt schon Befehle …«
Dylan erwiderte etwas, doch Carson konnte es nicht verstehen. Er hatte das Gefühl, außerhalb seines Körpers zu schweben. Fühlte sich so das Sterben an? Dann war es gar nicht so schlimm. Ärgerlich war nur, dass er so viele Dinge noch nicht erledigt hatte. Vor allem blieb die eine große, ungelöste Frage, die er nun als Geheimnis mit ins Grab nehmen würde.
Achtundzwanzig Jahre. Schon seltsam, dass es erst vor kurzem so wichtig geworden war. Und jetzt, als er endlich etwas unternehmen wollte, wurde ihm die Möglichkeit dazu genommen.
»Verdammt, Carson, bleib wach!«
Er hätte Dylan gern geantwortet, doch seine Gedanken schweiften in eine andere Zeit, eine Zeit vor achtundzwanzig Jahren, in ein anderes Leben. Zu dem zentralen Ereignis, das über sein Schicksal entschieden hatte. Damals war das Samenkorn gepflanzt worden, aus dem ein Imperium gewachsen war.
Ein Samenkorn. Was für eine ironische Metapher.
Ein Same … zwanzigtausend Dollar. Kein Risiko, keine Verpflichtungen, nichts zu verlieren. Was für ein Handel.
Stan hatte Recht gehabt. Es war ein Handel gewesen – ein Handel, der sein Leben verändert hatte.
Und vielleicht ein anderes Leben hatte entstehen lassen.
Carson, du hast es. Die Intelligenz. Das Aussehen. Die Jugend. Den Charme. Setz es ein. Wenn sie anbeißt, kannst du ’ne hübsche Stange Geld verdienen.
Sie hatte angebissen. Und er hatte kassiert.
Von diesem Tag an hatte er das Feld beackert. Hatte nie zurückgeschaut. Nicht bis vor wenigen Wochen. Schon seltsam, wie der fünfzigste Geburtstag einen Mann dazu bringen konnte, Bilanz zu ziehen …
»Wo ist er?«
Stimmen. Rasche Schritte. Der Geruch nach Desinfektionsmitteln und Krankenhaus.
Sanitäter.
»Hier.« Dylans drängende Stimme, als er die Männer hereinführte. »Es ist Carson Brooks.«
Seine Lider flatterten. Durch einen Nebel nahm er zwei Beinpaare in Rettungsuniformen wahr.
Die Sanitäter knieten neben ihm nieder und machten sich an die Arbeit.
»Puls hundertfünfzig.«
»Blutdruck hundert zu sechzig.«
»Das ist für Carson sehr niedrig.« Dylans Anwaltsstimme. Schneidend. Respekt einflößend. Eine Stimme, die selbst seine gefährlichsten Gegner beeindruckte. »Normalerweise hat er hundertfünfzig zu hundert. Er leidet an Bluthochdruck und nimmt Dyaxide.«
»Wissen Sie, ob er sonst regelmäßig Medikamente einnimmt?«
»Nein.«
»Okay.« Carson spürte einen Druck im Rücken. Seine Lider wurden gehoben, seine Augen von einem nadelstichartigen Licht geblendet. »Die Pupillen sind geweitet. Können Sie mich hören, Mr Brooks?«
»Ja …«
»Gut. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir versuchen, die Blutung zu stoppen.«
»Atmung flach.«
»Sauerstoff. Er muss auf die Trage. Los!«
»Sofort.« Zwei weitere Sanitäter waren ins Zimmer gekommen und machten sich an ihren Geräten zu schaffen.
Träge schweifte Carsons Blick zu dem komplizierten Muster des Orientteppichs. Die Blumen wiesen mehr Rot auf als vorher. Und das Rot breitete sich immer weiter aus.
Eine Sauerstoffmaske wurde ihm über Nase und Mund geschoben und mit einem Elastikband befestigt. »Atmen Sie ganz normal, Mr Brooks. Das wird Ihnen gut tun.«
Das stimmte nur bedingt. Rasselnd sog er den Sauerstoff ein. Der penetrante Geruch nach Lufterfrischer verflog.
»Sein Puls wird schwächer. Das Herz schlägt schneller. Wir müssen ihn wegbringen.« Wieder ein Wirbel an Aktivität um ihn herum: Eine Krankentrage wurde neben ihn gestellt. »Auf Drei. Eins, zwei … drei.«
Carson hörte sich stöhnen, als sie ihn auf die Trage hoben und festschnallten. Das Stöhnen erinnerte ihn daran, dass er noch lebte. Er musste am Leben bleiben. Er musste herausfinden, wer ihn hatte erschießen wollen. Er musste sein Vermächtnis schützen.
Und er musste herausfinden, ob die Ruisseau Corporation sein einziges Vermächtnis war oder ob es noch ein anderes gab: einen Menschen.
Doch seine Entschlossenheit wurde von dem Nebel, der sein Bewusstsein einhüllte, nahezu erstickt.
»Bleiben Sie wach, Mr Brooks!« Die Stimmen der Sanitäter. Sie hatten ihn auf die Bahre gelegt und waren bereits auf dem Weg durch die Eingangshalle. Seltsam. Er konnte sich nicht entsinnen, mit dem Fahrstuhl hinuntergefahren zu sein.
»Ist er noch bei Bewusstsein?«, wollte Dylan von den Sanitätern wissen.
»Nur sehr schwach.« Die Glastür flog auf. Um ihn herum die stickige Luft des Sommers von Manhattan. Ein Hauch davon drang ihm durch die Sauerstoffmaske in die Nase. Blaulichter zuckten. Neben der Ambulanz hielten mehrere Streifenwagen. Ein Cop lief auf die Sanitäter zu. Andere verschwanden im Gebäude.
Man trug ihn zum Rettungswagen. »Mount Sinai Hospital?«, fragte Dylan den Sanitäter, der sich neben ihn gesetzt hatte.
»Yep. Wir fahren rüber zur Madison und dann geradeaus nach Uptown. Mit Sirene schaffen wir’s in drei Minuten.«
»Ich fahre mit«, sagte Dylan und schickte sich an, in den Wagen zu klettern.
»Äh, Mr Newport …« Der Fahrer drehte sich um und räusperte sich verlegen. »Die Polizei möchte mit Ihnen über den …«
»Ach ja?«, schnitt Dylan ihm das Wort ab. »Dann sollen sie zum Mount Sinai kommen. Ich fahre mit, keine Diskussion. Und wie ich schon sagte – Sie nennen keine Namen und verständigen auch nicht die Presse. Los jetzt!«
Niemand wagte zu widersprechen. Die Türen wurden zugeschlagen. Die Sirene heulte auf, und der Rettungswagen jagte davon.
»Herzschlag hundertsiebzig. Blutdruck fünfzig zu neunzig.« Der Sanitäter beugte sich über ihn. »Mr Brooks, können Sie mir sagen, wie alt Sie sind?«
»Fünfzig …«
Seine Stimme verschmolz mit dem Heulen der Sirene. Der Verkehr auf der Madison Avenue schien sich zu teilen wie die Wasser des Roten Meeres.
»Carson«, hörte er Dylans Stimme undeutlich, aber nahe an seinem Ohr.
»Immer noch … am Leben«, brachte er mühsam heraus.
»Hab ich auch nicht bezweifelt. Du bist unverwüstlich.«
»Jaaa … sag das dem … der das getan hat.«
»Ich könnte mir was Besseres vorstellen, als es diesem Scheißkerl nur zu sagen.« Er überlegte kurz. »Hast du ihn sehen können?«
»Nichts gesehen … war zu schnell … und von hinten.« Carson holte langsam und rasselnd Luft. »Dylan …«
»Wir kriegen ihn, Carson. Mach dir keine Sorgen.«
»Darum geht es nicht.« Schwach schüttelte er den Kopf. Allmählich verlor er das Bewusstsein. War es nur vorübergehend? Oder bedeutete es das Ende? »Diese Sache, die mir so zu schaffen gemacht hat … diese vertrauliche Sache …«
»Ja, ich weiß.«
Er schluckte, kämpfte gegen die Wogen der Dunkelheit. »Falls ich ein Kind habe … will ich es wissen. Du musst es rausfinden …«
2
Dienstag, 6. September, 10.30 Uhr,Institut für kreatives unternehmerisches Denken (cctl), Auburn, New Hampshire
Guten Morgen. Willkommen bei cctl.«
Sabrina betrat den Konferenzraum und nahm ihren Platz am Kopfende des eleganten Teakholztisches ein. Gleichzeitig musterte sie das neue Managementteam von Office Perks, einer in Boston ansässigen Firma für Büroartikel.
Die Gruppe hatte den üblichen Zuschnitt. Acht leitende Angestellte – fünf Männer, drei Frauen. Die meisten Mitte dreißig, wenige zwischen Anfang und Mitte vierzig. Allen voran der 44-jährige Robert Stowbe, der nach der Aufsehen erregenden Fusion zum neuen Direktor des Unternehmens ernannt worden war. Seine Abteilungsleiter hatte er sorgfältig ausgewählt und dabei Sabrinas Recherchen zufolge einen hervorragenden Job geleistet. Edward Roward, der Chef der Finanzabteilung, hatte in seiner vorherigen Stellung eine satte Erhöhung der Gewinne zu Stande gebracht; Harold Case, der Vertriebsleiter, war ein smarter Typ, der seine Klientel gut kannte; Lauren Hollis, die IT-Expertin, war ein Arbeitstier; Paul Jacobs von der Strategischen Planung besaß Initiative und kreative Energie; Lois Ames vom Marketing hatte gute Verbindungen und sprühte vor neuen Ideen; Jerry Baines von der Abteilung Forschung und Entwicklung konnte hervorragende Referenzen vorweisen, neigte aber ein wenig zu Selbstherrlichkeit; und schließlich war da Meg Lakes, eine viel versprechende junge Frau für die Führung der Personalabteilung.
Doch nun begann der schwierige Teil. Wie brachte man eine Gruppe ebenso talentierter wie ehrgeiziger Individuen dazu, sich zu einem funktionierenden Managementteam zusammenzufinden?
Das war Sabrinas Aufgabe.
Ob sie Erfolg hatte oder nicht, würde sich erst mit der Zeit zeigen.
Nachdem sie vier Jahre in der Managementberatung gearbeitet hatte – drei bei den Topadressen der Branche und ein Jahr hier bei cctl –, wusste Sabrina, dass kein Team mit dem anderen zu vergleichen war. Es gab kaum Veränderungen, die ohne Widerstand durchgesetzt werden konnten, und man durfte nichts für gegeben hinnehmen.
Und doch hatte Sabrina eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Deshalb nahmen viele Firmen, die expandieren wollten oder eine Verjüngungsspritze brauchten, gern ihre Hilfe in Anspruch.
»Ich bin Sabrina Radcliffe«, begann sie und blieb absichtlich stehen, obwohl alle anderen saßen – ein Routineschachzug, um die Kontrolle über das Meeting zu behalten. »Wie Sie wissen, bin ich die Geschäftsführerin von cctl. Ich will Sie nicht mit einer Aufzählung meiner Laufbahn und meiner Zeugnisse langweilen, denn sicherlich haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht und wissen, wie es um meinen Ruf und den von cctl bestellt ist. Ich möchte Sie für den Anfang nur einladen, Gebrauch von unserer Einrichtung zu machen – sowohl für Ihre Erholung, geistig wie physisch, als auch für Ihre berufliche Weiterbildung.
Richten Sie sich für die nächsten vier Tage auf eine intensive Arbeitsphase ein. Wir werden regelmäßig Meetings abhalten. Die Zeiten Ihrer Workshops sind auf den Stundenplänen vermerkt, die Sie bei der Anmeldung erhalten haben. Sie werden feststellen, dass wir zwischen den einzelnen Blöcken Zeit zu Ihrer freien Verfügung gelassen haben. Diese sollten Sie zur Entspannung nutzen. Wir wollen damit beide Enden der Skala bedienen: sich ausruhen und wieder anspannen. Unser Personal bietet Stressmanagement- und Yogakurse an. Überdies haben wir ein Fitnesscenter mit den neuesten Geräten, die Sie benutzen können, wann immer Sie Lust dazu haben. Und schließlich haben wir den Lake Massabesic direkt vor der Tür. Sie können segeln, Kanu fahren oder wandern. Tun Sie, was Ihnen Spaß macht.«
Sabrina schätzte die Aufmerksamkeitsspanne ihrer Zuhörer ab. Es wurde Zeit, über das Essen zu reden.
»Nun zu den Mahlzeiten.«
Alle setzten sich auf. Kein Wunder. So war es immer, wenn das Essen zur Sprache kam.
»Unsere Köche sind hervorragend«, fuhr sie fort. »Wir haben sie aus den besten Restaurants der ganzen Welt abgeworben. Erwarten Sie also keinesfalls, dass Sie abnehmen. Das werden Sie nicht schaffen, es sei denn, es wäre Ihr Ziel. Wenn Sie also besondere Wünsche haben oder Diätvorschriften befolgen müssen, sagen Sie es bitte dem Küchenpersonal. Sie werden alles tun, Ihren Wünschen entgegenzukommen.«
Sabrina strich mit den Fingerspitzen leicht über ihren dunkelroten Seidenblazer und ihre Slacks. »Zu den Team Meetings kommen Sie bitte nicht overdressed. Das Letzte, was wir gebrauchen können, sind enge Krawatten und Hosenbünde. Meiner Überzeugung nach behindert alles, was die Atmung einengt, auch die Kreativität.«
Ein paar Zuhörer lächelten.
Nun musste sie ihnen Zeit geben, die Informationen zu verdauen.
»Die Einzelheiten unserer Meetings teile ich Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt mit. Leben Sie sich erst mal ein. Unser Personal ist erstklassig. Geben Sie sich ruhig in unsere Hände, und vertrauen Sie sich unserer Führung an. Dann werden Sie das Gefühl haben, die Welt erobern zu können, wenn wir Sie nach Hause schicken.«
11.15 UhrMt. Sinai Hospital
Dylan stürzte den letzten Schluck Kaffee hinunter, zerknüllte den Styroporbecher und warf ihn in den Abfalleimer.
Die vergangenen sechzehn Stunden waren ein unwirklicher verwaschener Fleck.
Die Notaufnahme. Dann der OP. Stunden hatte Carson dort zugebracht und ausgedehnte Eingriffe über sich ergehen lassen müssen, damit Organe gerettet und Blutgefäße genäht werden konnten. Jetzt lag er auf der Intensivstation an Schläuchen und Tropf, war an eine Unzahl Monitore angeschlossen und zeigte keine Anzeichen von Besserung.
Was für ein Albtraum! Dylan kniff die Augen zusammen und rieb die pochenden Höhlen, um einen Kopfschmerz zu lindern, der sich nicht lindern ließ. Nicht, bevor er endlich etwas aß, ein wenig Schlaf bekam und beruhigende Nachrichten von den Ärzten hörte. Er hatte die notwendigen Anrufe getätigt und in Bewegung gesetzt, was er konnte. Aber er hatte so viele lose Enden zu verbinden …
»Ich halte diese Unsicherheit nicht mehr aus. Wenn man nichts hört, nichts weiß … ich verliere noch den Verstand.« Susan Lane sprang vom Stuhl im Wartezimmer auf, ihr ganzer Körper vor Sorge verspannt. Sie fuhr mit den Fingern durch ihr glattes, blond gesträhntes Haar und zerzauste es noch mehr. Dylan fiel auf, dass er Susan noch nie so ungepflegt gesehen hatte. Mit ihren vierzig Jahren sah Carsons Freundin wie eine Dreißigjährige aus, stets perfekt geschminkt und elegant gekleidet. Nicht aber heute Morgen. Nach der ruhelosen Nacht sah sie fürchterlich aus. Aber Dylan selbst nicht minder.
»Warum sagen die uns nichts?«, wollte Susan wissen.
»Vielleicht, weil es nichts Neues zu sagen gibt«, erwiderte Dylan. »Carson hat die OP überstanden. Er ist ein Kämpfer. Er wird es schon schaffen.«
»Er muss es schaffen.« Es klang, als wollte Susan eher sich selber überzeugen als Dylan. Wieder nahm sie ihre ruhelose Wanderung auf, sprach mit erstickter Stimme. »Ich hatte schon so eine Ahnung, dass irgendwas passiert war. Selbst für seine Verhältnisse war das eine arge Verspätung. Schließlich war es nicht irgendeine langweilige Dinnerparty, sondern die US Open. Ich hätte auf meine innere Stimme hören sollen. Ich hätte anrufen sollen.«
»Das hätte auch nichts geändert. Das Spiel fing erst nach sieben an, Carson wurde aber schon vor sechs angeschossen.«
»Stimmt. Und du hast mich erst gegen zehn angerufen«, warf Susan ihm mit anklagender Stimme vor. »Als ich längst in unserer Loge auf dem Platz saß und mein Handy ausgeschaltet hatte.«
»Ich habe dich angerufen, als ich wieder klar denken konnte.« Dylan hatte das Gefühl, als spräche er über etwas, das sich vor einem Jahr und nicht letzte Nacht ereignet hatte. »Tut mir Leid, dass du es über die Mailbox erfahren musstest. Ich weiß, dass meine Nachricht dir einen Schock versetzt haben muss.« Mit einem Seufzer stieß er den angehaltenen Atem aus. »Ehrlich gesagt weiß ich von den ersten Stunden nicht mehr allzu viel.«
»Ist mir schon klar, dass du völlig fertig warst«, gab Susan zu, und ihre Miene wurde weicher. »Ich wollte dich auch nicht so überfallen. Ich muss nur ständig daran denken … wenn ich früher hingekommen wäre, wäre alles anders gelaufen. Hätte er meine Stimme gehört oder gewusst, dass ich da war …« Sie schluckte schwer. »Aber was geschehen ist, ist geschehen. Jetzt geht es nur darum, dass Carson durchkommt.«
Sie ging zum Eingang der Intensivstation und versuchte hineinzuspähen. Doch sämtliche Vorhänge waren zugezogen, seit Carsons behandelnder Chirurg auf der Station verschwunden war. »Dr. Radison ist schon sehr lange drin.«
Dylan folgte ihr und stellte sich neben sie. »Radison ist tüchtig. Du weißt doch, welchen Ruf er hat – er ist der Beste. Und er weiß genau, dass wir hier draußen warten. Er wird uns informieren, sobald er etwas weiß.«
»Mr Newport?«
Die Stimme kam aus dem Korridor hinter ihnen. Dylan drehte sich um. Er war kaum überrascht, die Detectives Barton und Whitman wieder zu sehen. Sie hatten ihn schon gestern Nacht vor Susans Eintreffen befragt: über seine Beziehung zu Carson, über Carsons Lebensstil, seine Freunde und Feinde – die üblichen Routinefragen zu Beginn einer Ermittlung. Dylan hatte geantwortet wie ein Automat und bezweifelte, dass seine Angaben besonders stimmig gewesen waren. Aber das war im Grunde egal. Was er auch sagte – er war einer der Hauptverdächtigen. Als die Schüsse gefallen waren, war niemand außer Carson und ihm in der Firma gewesen. Seine Vertrauensstellung bei Carson und sein Einfluss im Unternehmen waren kein Geheimnis. Und bestimmt hatten die Ermittler in der Zwischenzeit ihre Hausaufgaben gemacht. Sie wussten von seiner Herkunft, und sie wussten, was er zu gewinnen hatte, falls Carson nicht überlebte. Folglich wollten sie noch ein wenig tiefer bohren. Oder sie hatten tatsächlich etwas herausgefunden …
»Ja, bitte?« Dylan schob die Hände in die Hosentaschen und versuchte, in den Mienen der beiden etwas zu lesen. Sie machten keineswegs den Eindruck zweier zufriedener Gesetzeshüter, die soeben eine Verhaftung vorgenommen haben. »Können Sie uns etwas Neues sagen?«
»Nichts, das Sie nicht schon wüssten.« Frank Bartons Tonfall schien irgendetwas anzudeuten. »Wir haben mit den beiden Nachtwächtern von letzter Nacht gesprochen – dem am Haupteingang und dem Zuständigen für die Videoüberwachung. Die haben nichts und niemanden gesehen, außer Ihnen und Mr Brooks. Wir haben uns die Bänder angeschaut und konnten es nur bestätigen. Falls also noch jemand das Gebäude betreten hat, muss er den Lieferanteneingang genommen haben.« Barton schaute nicht Dylan an, sondern warf einen fragenden Blick auf Susan.
»Das ist Susan Lane«, stellte Dylan sie vor. »Ihr Name steht auf der Liste von Carsons Freunden, die ich Ihnen gegeben habe. – Susan, das sind die Detectives Barton und Whitman.«
»Miss Lane«, sagte Eugenia Whitman. »Gut, dass wir Sie antreffen. Wir wollten uns heute ohnehin bei Ihnen melden und ein paar Fragen stellen. Können wir das gleich erledigen?«
Susan nickte. »Natürlich. Was immer ich für Sie tun kann …«
»Schön. Im Übrigen kann ich Ihnen versichern, dass wir rund um die Uhr vor Mr Brooks’ Krankenzimmer eine Wache aufstellen lassen, nur für den Fall, dass der Täter es noch einmal versucht. Officer Laupen müsste jeden Augenblick hier eintreffen. Er übernimmt die erste Schicht.« Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Dylan zu. »Es scheint Ihnen besser zu gehen als gestern Nacht. Heißt das, dass es auch Mr Brooks besser geht?«
Als ob ihr nicht längst im Krankenhaus angerufen und das überprüft hättet, dachte Dylan.
»Gestern Nacht ging es mir so schlecht, weil ich unter Schock stand«, sagte er. »Der Schock lässt allmählich nach, deshalb wirke ich jetzt ein wenig gefasster. Carson geht es den Umständen entsprechend. Er hat einen Lungendurchschuss, innere Verletzungen und eine zerfetzte Arterie. Außerdem hat er eine Menge Blut verloren. Eine Prognose lässt sich daher noch nicht stellen. Im Augenblick steht er unter Medikamenten und liegt auf der Intensivstation. Sein Arzt ist gerade bei ihm. Wenn Sie noch ein wenig bleiben, werden Sie sicherlich die neuesten Informationen hören.«
»Das hatten wir vor«, erklärte Barton. »Dem Bericht des Chirurgen habe ich entnommen, dass die Kugel nicht entfernt wurde.«
»Das stimmt. Die Kugel steckt in Carsons Brust, in der Nähe der Lunge. Sie zu entfernen wäre gefährlicher, als sie an Ort und Stelle zu belassen.«
Barton verschränkte die Arme vor dem Bauch. »Wir haben also weder Kugel noch Waffe – und ein Opfer, das keine Aussage machen kann.«
Dylan fiel auf, dass er weder Motiv noch Verdächtige erwähnte.
»Es würde auch nichts nützen, mit Carson zu reden. Er hat den Angreifer nicht gesehen.« Dylan fand, es habe keinen Sinn, die Detectives zu verärgern, daher wiederholte er seine Aussage der vergangenen Nacht. »Er wurde von hinten niedergeschossen. Er sagte, das Ganze sei so schnell gegangen, dass er gar keine Zeit hatte, sich umzudrehen.«
»Ihrer Aussage zufolge hat er das im Krankenwagen gesagt. Leider hat es außer Ihnen niemand gehört.« Detective Whitman wickelte sich die Enden ihrer kurzen platinblonden Locken um die Finger – eine täuschend lässige Geste, denn gleichzeitig musterte sie Dylan argwöhnisch.
»Die Sanitäter hatten ja auch alle Hände voll zu tun, Detective.« Allmählich wurde Dylan sauer. »Sie hatten alle Mühe, Carsons Leben zu retten. Er hat nur ein paar Worte sagen können. Und er hat nur mit mir gesprochen.« Er hielt Whitmans kühlem Blick stand. Mit ihren einsdreiundachtzig war sie fast so groß wie er – blass, zaundürr und mit einer Frisur wie eine Wattekugel.
»Ja.« Sie überflog ihre Notizen. »Das haben Sie uns bereits gesagt.«
»Genau so ist es auch passiert. Hören Sie, mit dieser Debatte verlieren wir nur Zeit. Sie können sich die Bestätigung von Carson holen, sobald der Arzt sein Einverständnis gibt.«
»Deshalb sind wir hier, Mr Newport. Um zu hören, ob die Aussage des Opfers mit der Ihren übereinstimmt.«
Nun reichte es Dylan.
»Hören Sie, Detective«, sagte er eisig. »Ihre Nachricht ist angekommen, laut und deutlich. Aber Sie bellen den falschen Baum an. Allerdings müssen Sie das selber herausfinden. Verschwenden Sie keine Zeit. Ich will, dass Sie den Schuldigen finden, und wenn Sie noch so sehr graben müssen. Der Anschlag auf Carson war geplant.«
»In diesem Punkt stimmen wir überein. Es lag eine Absicht vor. Aber ein Raubüberfall war es nicht. Als Mr Brooks hier eingeliefert wurde, hatte er fünfhundert Dollar in der Jackentasche, an einem schweren goldenen Clip. Und da der Täter ja angeblich spurlos verschwunden war, als Sie in Carsons Büro kamen, hätte er mehr als genug Zeit gehabt, Geld und Wertgegenstände an sich zu nehmen.«
»Raub? Ist mir nie in den Sinn gekommen. Es stimmt schon, Carson ist reich und berühmt. Aber wenn man ihn überfallen wollte, hätte man das doch an einer Straßenecke tun können. Wozu elf Stockwerke rauffahren, um ihn in seinem Büro niederzuschießen?«
»Da ist was dran.« Nachdenklich schaute Barton Dylan an. »Sagen Sie mal, Mr Newport, fällt Ihnen vielleicht ein Motiv ein?«
Mein Motiv, meint ihr wohl, überlegte Dylan. Laut sagte er: »Mehrere. Zum Beispiel Rache. Oder Gier. Ein abgeschlagener Konkurrent. Wie ich Ihnen gestern Abend schon sagte, ist Carson nicht der typische Topmanager, nicht mal ein typischer Selfmademan. Er ist auf der Straße aufgewachsen. Er hat mit nichts angefangen und sich den Arsch aufgerissen, um sein Vermögen zu machen. Dabei hat er sich bloß auf seinen Kopf und seinen Instinkt verlassen. Er ist ein brillanter Chemiker, ein brillanter Geschäftsmann – ein wahres Genie, wenn Sie mich fragen. Solche Menschen bringen bei ihren Feinden meist das Schlechteste zum Vorschein.«
»Und warum sollte es diesen Feinden einfallen, ausgerechnet jetzt zuzuschlagen?«, bohrte Whitman.
»C’est Moi.« Susan hatte begriffen, worauf Dylan hinauswollte. »Es ist im Juni auf den Markt gekommen. Der Anschlag auf Carson muss damit zusammenhängen.« Sie warf Whitman einen fragenden Blick zu. »Haben Sie schon davon gehört?«
»Von dem Parfüm, das die gesamte Nation auf den Kopf gestellt hat?« Whitmans Stimme triefte vor Ironie. »Da hätte man schon tot sein müssen, um nicht davon zu hören. Die Sensationsmache der Werbekampagne hat ja in jedem Parfümgeschäft im Land zu Aufständen geführt.«
»Es lag nicht an der Kampagne«, sagte Dylan steif. »Sondern am Produkt. Die Werbung hat lediglich die Aufmerksamkeit aller Welt erregt. Aber es geht um den Duft – der hat die Branche in Aufruhr versetzt.«
»Weil dieses Parfüm jede Frau in eine Göttin verwandelt«, bemerkte Whitman.
»Es ist ein Parfüm, Detective, kein Liebestrank. Es kann nicht Attraktivität aus dem Nichts heraus schaffen, sondern verstärkt nur, was bereits vorhanden ist. Eigentlich das, was man von jedem Parfüm erwarten sollte. Da können Sie fragen, wen Sie wollen. Oder besser noch, probieren Sie es selber aus.«
»Das werde ich. Sobald wir den Fall gelöst haben.« Whitman ließ sich nicht von ihrer Fährte abbringen. »Sagen wir also, dieses Parfüm hält, was es verspricht. Wie kann sein Erfolg dann etwas mit dem Anschlag auf Brooks zu tun haben? Das Produkt ist doch längst auf dem Markt. Wie sollte Brooks’ Tod etwas daran ändern? Ruisseau ist ein solides Unternehmen. Ich glaube nicht, dass es ohne seinen Direktor Konkurs macht.«
»Das nicht. Aber im Fall von C’est Moi gibt es eine Achillesferse«, erklärte Dylan. »Die Formel für das Parfüm ist einzigartig. Die Entwicklung hat fast zwei Jahre gedauert und lief unter absoluter Geheimhaltung.«
»In Brooks’ Forschungsabteilung?«
»Nein. Er selbst hat die Formel entwickelt.«
Argwöhnisch hob Whitman die Brauen. »Brooks selbst?«
»Ja. Und er ist der Einzige, der die genaue Zusammenstellung kennt.«
Zum ersten Mal wirkte die Kriminalbeamtin perplex. »Der Einzige? Niemand sonst ist eingeweiht?«
»Keine Menschenseele. Ich übrigens auch nicht. Aber eine Menge Leute wären es gern. Dieses Parfüm fährt Millionengewinne ein.«
»Also glauben Sie, dass jemand Brooks töten wollte, um an die Formel zu kommen?«
»Oder um die Produktion abrupt zu stoppen. C’est Moi hat in wenigen Monaten Millionen gebracht und sämtliche anderen Parfümhersteller wirtschaftlich hart getroffen. Deren Lager quellen über. Ein Umstand, der Carson bei der Konkurrenz nicht gerade beliebt macht.«
»Das alles haben Sie vorher nicht erwähnt.«
»Weil ich dachte, Sie hätten Ihre Hausaufgaben gemacht. Oder waren Sie zu sehr damit beschäftigt, mich zu durchleuchten?«
Bevor Whitman darauf antworten konnte, schwang die Tür zur Intensivstation auf und der Oberarzt, der Carson operiert hatte, kam heraus, wobei er mit gerunzelter Stirn ein Krankenblatt betrachtete.
»Dr. Radison.« Dylan eilte zu dem Chirurgen und vertrat ihm den Weg. »Wie geht es ihm?«
Der Arzt blieb stehen und blickte vom Klemmbrett auf. Seine Miene war verhalten. »Er hält sich tapfer.«
»Ist er bei Bewusstsein?«, wollte Barton wissen.
Dr. Radison warf den Detectives einen abschätzenden Blick zu. »Er wird immer wieder kurz wach und schläft dann wieder ein. Das liegt zum großen Teil an den Schmerzmitteln.«
»War er eben noch wach?«, drängte Whitman.
»Ja.« Der Chirurg hielt eine Hand hoch und erstickte damit alle weiteren Fragen im Keim. »Wir haben einen Endotrachealtubus gelegt und Mr Brooks an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Er kann Fragen schriftlich beantworten, aber nicht sprechen. Außerdem ist er für eine lange Vernehmung noch zu schwach. Sie können ihm ein paar Fragen stellen, mehr aber nicht.« Sein Blick wanderte zu Dylan. »Er hat geschrieben, dass ich Sie nach Hause schicken soll. Sie sollten ausgeruht sein, weil Sie rund um die Uhr arbeiten müssen, bis er wieder auf dem Posten ist.«
Dylan spürte, wie seine Mundwinkel zuckten. »Das klingt ganz nach Carson.«
»Weiß er, dass ich da bin?«, schaltete Susan sich ein.
Dr. Radison nickte. »Ich habe es ihm gesagt. Es hat ihn gefreut, bis er hörte, dass Sie die ganze Nacht hier verbracht haben. Er sagte, dass auch Sie nach Hause gehen und sich ausruhen sollen.«
»Sollten wir noch etwas über Mr Brooks’ Zustand wissen, bevor wir zu ihm hineingehen?« Whitman war schon auf dem Weg zum Zimmer.
»Allerdings.« Dr. Radisons Tonfall ließ sie innehalten. »Es gibt eine Komplikation. Wie ich Ihnen bereits sagte, hat die Kugel Mr Brooks’ Bauchschlagader verletzt.«
»Sie haben aber auch gesagt, dass Sie die Ader genäht haben«, entgegnete Dylan.
»Das haben wir, ja.«
»Und?«
Dr. Radison rieb sich das Kinn. »So einfach ist das nicht, Mr Newport. Diese Aorta ist die Hauptarterie des Körpers. Sie versorgt die Organe mit Blut. Bei Mr Brooks wurde die Bauchschlagader an einer Stelle verletzt, von der die Nieren betroffen sind. Deren Blutversorgung ist nicht mehr ausreichend. Nimmt man den Blutverlust und den septischen Schock der Infektion hinzu, die durch die inneren Verletzungen entstanden ist, liegt Grund zur Besorgnis vor. Ich habe soeben ein CT machen lassen, und das Ergebnis gefällt mir nicht. Die Nierenfunktion ist um achtzig Prozent herabgesetzt. Sofern sie sich nicht bessert, werde ich mit der Dialyse beginnen.«
»Dialyse«, wiederholte Dylan langsam. »Wollen Sie damit sagen, Sie befürchten ein Nierenversagen?«
»Das wäre der schlimmste Fall. Möglicherweise brauchen die Nieren nur ein wenig Unterstützung, bis sie wieder von selbst zu arbeiten beginnen.«
»Also ist es vorübergehend.«
Kurzes Zögern. »Das hoffe ich.«
Dylan fuhr auf. »Aber es könnte auch irreparabel sein.«
»Möglicherweise, ja. Und da Mr Brooks ein aktiver Mann ist, der eine Abneigung gegen Einschränkungen jeglicher Art hegt, möchte ich vorbereitet sein.«
»O Gott.« Susan presste die Hände gegen die Wangen. »Sie reden von einer Transplantation.«
»Ich rede nur darüber, dass eine Grundlage geschaffen werden muss«, stellte Dr. Radison klar. »Nur für alle Fälle.« Er vertiefte sich wieder in die Krankenakte und runzelte die Stirn. »Unglücklicherweise hat Mr Brooks keine Familie. Außerdem hat er Blutgruppe Null positiv, wodurch der Kreis möglicher Spender stark eingeschränkt wird. Wir sollten schon mal anfangen, sämtliche Menschen anzusprechen, die ihm nahe stehen und bereit wären, sich auf Gewebeverträglichkeit untersuchen zu lassen – wie gesagt, nur für alle Fälle.« Er neigte den Kopf. »Ich nehme an, wir können mit Ihnen beiden anfangen?«
»Aber natürlich«, lautete Susans prompte Antwort.
»Hm?« Dylans Gedanken rasten. Zum Glück hatte er die notwendigen Anrufe bereits gemacht. Er hatte die Dinge in Bewegung gesetzt, sich aber nicht träumen lassen, welche Bedeutung sie in so kurzer Zeit erlangen würden. Es war schon seltsam, dass Carson ausgerechnet jetzt auf die Idee gekommen war, nach seinem Kind zu suchen. Was zuvor sentimentale Neugier war, wurde nun zu einer Lebensnotwendigkeit.
»Mr Newport?«, sagte Radison. »Ich habe gefragt, ob Sie Ihre Blutgruppe kennen.«
»Sorry. Ich musste das alles erst einmal verdauen. Ich habe Null positiv.«
»Also die gleiche Blutgruppe wie Mr Brooks. Gut. Miss Lane sagte mir gerade, dass sie A negativ hat. Das würde nicht klappen.«
»Heißt das, ich käme als Spender infrage?«, wollte Dylan wissen.
»Ich fürchte, so einfach ist das nicht. Es ist nur der erste Schritt. Wir müssen Ihnen Blut abnehmen für die Gewebetypisierung, und außerdem …«
»Ich gehe gleich runter zum Labor und lass es machen.« Dylan spürte, wie die Detectives ihn beobachteten und seine Reaktion abschätzten. Er konnte nicht fragen, ob er mit Dr. Radison allein sprechen könne, ohne ihren Verdacht zu verstärken. Außerdem war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um dem Chirurgen anzuvertrauen, dass Carson ein leibliches Kind hatte. Nicht, bevor Dylan sich überzeugt hatte, dass dieses Kind tatsächlich existierte.
»Stimmt was nicht, Mr Newport?«, erkundigte sich Whitman.
»Ich mache nur gerade eine Kehrtwendung im Geiste – von Carsons Feinden zu Carsons Freunden.« Dylan riss sich zusammen, damit sie nicht merkten, wie aufgeregt er war. »Ich rufe jeden an, der mir einfällt. Je mehr Personen sich untersuchen lassen, desto größer die Chance, dass wir einen Spender finden.« Entschlossen schaute er sie an. »Ich nehme an, wir können unsere Unterhaltung vertagen, bis ich diese Anrufe erledigt habe und mir Blut abgenommen wurde?«
»Ich kümmere mich schon um die Anrufe, Dylan«, erbot sich Susan mit zitternder Stimme. »Dann komme ich mir wenigstens nützlich vor. Du kannst immerhin dein Blut spenden. Ich kann ihm nicht einmal das geben.« Sie schluckte schwer. »Wenn ich jemanden vergesse … Geschäftsfreunde, Freundinnen, wer immer ihm helfen könnte … kannst du den Betreffenden dann anrufen?«
Dylan nickte. »Sind Sie einverstanden?«, wandte er sich an die Detectives.
»Natürlich«, versicherte Whitman, die wieder ihr Pokerface aufgesetzt hatte. »Wir wollen jetzt sowieso mit Mr Brooks sprechen – und mit Dr. Radison, wenn er eine Minute erübrigen kann. Danach unterhalten wir uns mit Miss Lane. Wir gehen nirgendwohin. Sie auch nicht, nehme ich an. Also treffen wir uns später wieder hier. Es sei denn, Sie wollen nach Hause und sich ausruhen, wie Mr Brooks vorgeschlagen hat?«
»Nein. Ausruhen kommt jetzt nicht infrage.« Dylans Entschlossenheit wuchs. »Ich bleibe hier im Krankenhaus – es sei denn, ich sitze in einem Taxi oder stehe zu Hause unter der Dusche oder ziehe mich um. Auf jeden Fall bin ich erreichbar.«
»Schön.« Barton wandte sich an Susan. »Sie warten hier?«
»Natürlich. Ich stelle mich vors Krankenhaus und rufe vom Handy aus die Leute an. Holen Sie mich, wenn Sie mich brauchen.« Ihre Augen schimmerten vor ungeweinten Tränen. »Ich will, dass der Täter gefasst und bestraft wird.«
»Wir auch«, versicherte Barton. »Und machen Sie sich keine Sorgen. Wir kriegen ihn. Bald.«
Mit einem letzten prüfenden Blick auf Dylan folgte er seiner Kollegin auf die Intensivstation.
3
2.30 Uhr76. Straße West, Nr. 341
Das Telefon klingelte. Dylan stieg tropfnass aus der Dusche, wickelte sich leise fluchend ein Handtuch um die Hüften und eilte ins Schlafzimmer.
Wahrscheinlich war es einer dieser nervigen Detectives, der ihn schon wieder ausquetschen wollte, und darauf hatte er absolut keine Lust. In den letzten drei Stunden hatte er keine ruhige Minute gehabt.
Zuerst hatte er sich Blut abnehmen lassen. Dann hatte er noch einmal bei Carson vorbeigeschaut, der nach einer offenbar kurzen Unterredung mit den beiden Beamten wieder eingeschlafen war. Anschließend waren Whitman und Barton mit Susan beschäftigt gewesen; Dylan hatte sie kurz aus der Befragung herausgeholt, um zu erfahren, welche Leute sie bereits erreicht hatte.
Susan war eben dabei, den Detectives zu schildern, wie sie Carson durch ihr gemeinsames Engagement für die Wohltätigkeitsorganisation »YouthOp«, der Susan vorstand, kennen gelernt hatte. Carson war einer der Mäzene. Dylan hatte den Rest der Geschichte nicht abgewartet. Zweifellos würden die Cops Susan noch einige Fragen über ihn stellen, aber da würden sie in einer Sackgasse enden. Mit Susan verstand er sich prächtig. Sie hingegen wusste von Dylan nur, dass er eine enge Verbindung zu Carson hatte. Und da Carson ein sehr verschwiegener Mann war, der seine geschäftlichen oder persönlichen Dinge nicht einmal mit Susan besprach und niemals Informationen über Ruisseau preisgab, konnte Susan den Detectives auch keinen Zündstoff liefern.
Als Dylan nach Hause gekommen war, hatte er eine geschlagene Stunde am Telefon gehangen und schließlich vier oder fünf Leute zu einem Bluttest überredet. Es fiel ihm nicht ein, den Neinsagern ihre Haltung anzukreiden. Respekt oder sogar Zuneigung zu einem Menschen zu empfinden, war eine Sache; etwas ganz anderes war es, diesem Menschen einen Teil seines Körpers zu geben.
Blutsverwandte waren dafür am besten geeignet.
Und mit ein wenig Glück würde er es ermöglichen können.
Zu Hause war er sofort unter die Dusche gegangen und hatte das heiße Wasser aufgedreht in der Hoffnung, es würde seine Anspannung mildern. Keine Chance. Er war so verspannt, dass er zitterte. Und jetzt noch das verdammte Telefon!
Dylan nahm den Hörer kurz vor Einschalten des Anrufbeantworters ab. »Hallo?«
»Dylan?«, fragte eine Stimme am anderen Ende. »Ich hätte beinahe schon aufgelegt und es übers Handy versucht.«
»Stan!« Sofort stellte sich Erleichterung, aber auch Angst ein. Dylan ließ sich in einen Sessel sinken. »Sag mir, dass du was für mich hast.«
»Hab ich. Hat eine Weile gedauert, weil der Arzt in den Ruhestand gegangen ist. Mein Strohmann musste rauskriegen, wo die Akten abgeblieben waren. Und dann gab’s noch die Schwierigkeit, sie in die Finger zu bekommen. Aber er hat’s geschafft.«
»Bist du sicher, dass sie rechtskräftig sind?«
»Aber ja. Ich hab doch da gearbeitet und kenne den Arzt. Ich weiß, wo er jetzt wohnt. Ich kenne auch seine Unterschrift und seinen Briefkopf. Und das Fax, das ich erhalten habe, ist authentisch. Darauf steht der Name der Frau, ihre persönlichen Daten und alles andere. Von da an war es einfach. Unser Privatschnüffler hat die Spur der Frau und die ihrer Familie verfolgt. Gloria Radcliffe. Modeschöpferin, lebt in Rockport, Massachusetts. Stammt aus ’ner superreichen Familie aus Beacon Hill in Boston. Hab alles hier. Und da du jetzt zu Hause bist, faxe ich’s dir zu.«
»Sofort.«
»Ja, klar.« Stan schwieg betroffen. »Wie geht es Carson?«, fragte er dann.
»Seine Nieren arbeiten nicht richtig. Möglicherweise braucht er eine Transplantation.«
Stan fluchte unterdrückt. »Ist er schon an die Dialyse angeschlossen?«
»Als ich ging, noch nicht. Aber jetzt könnte es so weit sein. Kommen wir zur Sache: Hat Carson ein leibliches Kind oder nicht?«
»Ja, hat er. Eine Tochter. Sie heißt Sabrina. Wurde am dritten Juni 1975 im Newton Wellesley Hospital geboren – fast genau zehn Monate nach dem Tag, als Carson seine Samenspende abgab. Dem Hebammenbericht zufolge war Sabrina ein kerngesundes Kind.«
»Hast du die Unterlagen?«
»Liegen vor mir auf dem Tisch. Ich lese gerade daraus vor.«
»Kannst du mir auch ihre Blutgruppe sagen?«
»Äh …« Eine Pause entstand, während Stan blätterte. »Null, Rhesus positiv.«
Dylan stieß die angehaltene Luft aus – es war die pure Erleichterung. »Ich nehme an, du hast auch neue Informationen über diese Sabrina. Wo steckt sie jetzt?«
»Sie leitet so ein Manager-Trainingszentrum in der Nähe von Manchester, New Hampshire. Ist gleichzeitig Schulungszentrum und Erholungsstätte. Sie wohnt auch da.«
Dylan fasste einen Entschluss.
»In einer Stunde kann ich die Maschine nach Manchester nehmen. Erst mal spreche ich mit Carsons Arzt. Dann fahre ich zum Flughafen. Du hältst Carsons Namen aus der Presse raus, wie besprochen. Löse ein paar Gefallen ein und tue, was nötig ist. Du musst es nur einen Tag lang geheim halten, bis ich bei Sabrina Radcliffe gewesen bin. Und Stan – danke. Das könnte Carsons größte Chance sein, vielleicht die einzige.«
»Einen Augenblick, Dylan«, sagte Stan, bevor er auflegen konnte. »Du kannst doch nicht einfach in diesem Trainingszentrum aufkreuzen, ohne vorher angerufen oder dich angemeldet zu haben, und dem Mädchen so zusetzen.«
»Doch, kann ich. Darauf kannst du Gift nehmen.«
»Aber …«
»Hör mal, Stan, hier geht es nicht um eine sentimentale Erinnerung, sondern um Carsons Leben. Du weißt doch, was für ein Mensch er ist. Er kann es nicht leiden, von anderen abhängig zu sein. Lebenslang Dialyse? Abhängig von Krankenhäusern, Schläuchen und Maschinen? Das würde ihn umbringen.«
»Ich will mich nicht mit dir streiten. Aber irgendjemand muss die Dinge von der vernünftigen Seite betrachten. Was du vorhast, wird Sabrina Radcliffes Leben völlig umkrempeln. Zunächst mal weißt du ja gar nicht, ob sie als Spenderin überhaupt infrage kommt. Und wichtiger noch, ob sie überhaupt einwilligen würde. Sicher, Carson ist ihr biologischer Vater. Aber sie hat ihn nie kennen gelernt. Wahrscheinlich weiß sie nicht mal, dass er existiert. Woher willst du wissen, was ihre Mutter ihr erzählt hat? Deren Verhalten war selbst für die Siebziger radikal. Ich glaube kaum, dass sie ihre Tochter in eine solche Sache eingeweiht hat.«
»Diese Tochter ist jetzt siebenundzwanzig Jahre alt. Sie wird es schon verkraften.«
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Du kannst nicht voraussehen, wie sie reagiert, und schon gar nicht, ob sie mitmacht.«
»Diese Brücke werde ich überschreiten, wenn es so weit ist.«
»Sie könnte dich achtkantig rauswerfen lassen.«
»Und ihre Mutter könnte mich verklagen«, setzte Dylan trocken hinzu. »Und sie würde gewinnen. Sie hat genug in der Hand, um mir meine Zulassung zu nehmen und einige meiner Kollegen hinter Gitter zu bringen. Vertrauliche Krankenhausdokumente an sich zu bringen und deren Inhalt ohne Erlaubnis preiszugeben ist kriminell und obendrein unmoralisch. Es verstößt gegen das Berufsethos. Aber das Risiko muss ich eingehen.«
»Dylan …«
»Mach dir keine Sorgen. Dein Name wird nicht mal erwähnt. Ich nehme alles auf meine Kappe. Aber was auch geschieht, ich fliege nach Manchester. Es muss sein.«
»Ja, ich weiß.« Während Stan sprach, begann Dylans Fax zu piepen. »Da hast du alles, was du brauchst. Sieben kostbare Seiten. Viel Glück.«
3.15 UhrMt. Sinai Hospital
Dylan rauschte in die Wartezone der Intensivstation und steuerte direkt auf den Empfang zu. »Ich muss Dr. Radison sprechen«, sagte er zur Schwester. »Es ist dringend.«
Die Frau sah von einem Krankenblatt auf. »Mr Brooks geht es den Umständen entsprechend gut, Sir. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen.«
»Ich mache mir keine Sorgen. Ich habe bloß keine Zeit. Ich muss mit Dr. Radison sprechen, und zwar sofort.« Dylan warf einen Blick über die Schulter und sah den Cop, der vor Carsons Zimmertür Wache hielt. »Das ist ein Dialysegerät, an dem Carson da hängt, stimmt’s?«
»Ja. Dr. Radison hat vor einer Stunde mit der Behandlung begonnen. Aber es hat keine Komplikationen gegeben. Mr Brooks spricht gut auf die Behandlung an. Sein Blutdruck ist stabil, und er zeigt keine gravierenden Nebenwirkungen oder Beeinträchtigungen.«
»Das liegt daran, dass er zu betäubt ist, um zu merken, was diese Maschine für sein Leben bedeutet.« Dylan beugte sich über die Theke. Er würde sich nicht besänftigen oder abwimmeln lassen. »Ist Dr. Radison im OP?«
»Nein, aber …«
»Dann piepsen Sie ihn an.«
Die Krankenschwester beäugte ihn misstrauisch. Dann gelangte sie anscheinend zu der Überzeugung, dass er es ernst meinte, nahm den Hörer ab und kam seiner Bitte nach.
Auf der anderen Seite der Wartezone rutschte Detective Barton ungeduldig auf seinem Stuhl nach vorn und wollte aufstehen.
»Warte.« Seine Partnerin legte die Tüte Kartoffelchips beiseite und hielt ihn am Ärmel zurück.
»Warum? Newport ist völlig durch den Wind. Jetzt passt er nicht mehr so gut auf. Es wird Zeit, ihm die Daumenschrauben anzulegen.«
»Da hast du Recht. Aber wir müssen erst das Gesamtbild haben und herausfinden, warum Dylan Newport so durcheinander ist. Muss ganz schön ernst sein, wenn er darauf besteht, mit dem Chirurgen zu sprechen. Lass ihn nur machen. Später greifen wir ein.«
Dylan spürte die forschenden Blicke der beiden Ermittler. Es war ihm egal. Wenn Radison seinem Plan zustimmte, musste er den Cops ohnehin alles erzählen.
»Mr Newport?« Mit gerunzelten Brauen kam Radison über den Flur auf ihn zu. »Sie wollten mich sprechen? Die Schwester sagte, es sei dringend.«
Dylan nickte. »Gibt es einen Raum, in dem wir uns ungestört unterhalten können?«
»Natürlich.« Der Chirurg führte ihn über den Flur in ein leeres Zimmer. »Worum geht’s?«, fragte er, während er die Tür schloss.
»Carson hängt an der Dialyse. Heißt das, dass seine Nierenfunktion sich verschlechtert hat?«
»Es bedeutet, dass die Nieren in ihrer Arbeit unterstützt werden müssen, ja. Ob sie sich wieder erholen und ohne Hilfe arbeiten, kann man noch nicht sagen.« Der Arzt runzelte die Stirn. »Die Krise kam nicht unerwartet. Wir hatten doch schon darüber gesprochen, dass wir möglicherweise die Dialyse einsetzen müssen.«
»Ja. Aber da wusste ich noch nicht … Es geht um eine Sache, die ich eben erst herausgefunden habe. Es könnte eine ungeahnte Hilfe sein, falls Carsons Nieren sich nicht so erholen, wie wir hoffen.« Dylan blickte Radison fest in die Augen. »Carson hat ein leibliches Kind, von dem er nichts weiß. Eine Tochter. Sie ist siebenundzwanzig und lebt in Neuengland. Ich weiß nicht, wie ihr Gesundheitszustand ist, aber ich kenne ihre Blutgruppe: Null, Rhesus positiv.«
Radison starrte ihn an. »Wie sind Sie an diese Information gekommen?«
»Das ist unwichtig. Wichtig ist, dass sie stimmt. Nun aber muss ich von Ihnen ein paar Dinge wissen. Zunächst … wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Carsons Tochter eine passende Spenderin ist?«
Eine Pause entstand, während der Arzt über die Antwort nachdachte. »Garantien gibt es nicht. Aber außer einem Zwilling oder einem Geschwisterkind sind die leiblichen Eltern oder Kinder die bestmöglichen Spender. Sie haben bereits die erste Hürde übersprungen, indem Sie mir mitteilten, dass Vater und Tochter die gleiche Blutgruppe haben. Das ist der erste Schritt. Natürlich müssen wir eine Gewebetypisierung machen, um auf gemeinsames Genmaterial zu testen, und zudem eine Kreuzprobe durchführen. Bevor diese beiden Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, kann ich Ihnen keinen Erfolg versprechen. Danach müsste die Frau noch zu einem Nephrologen, der einen Gesamttest macht, einschließlich einer ganzen Reihe von Laboruntersuchungen. Zum Schluss muss sie sich einem Nierenangiogramm unterziehen. Positiv zu bewerten wäre bei einer Kompatibilität von Mr Brooks und seiner Tochter, dass ihre gemeinsamen Gene das Risiko einer Organabstoßung vermindern. Und die Übertragung verspricht größeren Erfolg, wenn der Spender jung ist, wie im vorliegenden Fall. Wenn Sie also wissen wollen, ob dies eine ermutigende Entdeckung ist, kann ich Ihnen sagen: Ja.«
»Das wollte ich hören«, sagte Dylan und warf einen raschen Blick auf seine Uhr. »Wie schnell soll ich sie herbringen?«
Wieder runzelte der Arzt die Stirn. »Sie wollen einen Zeitplan entwerfen? Nun, ehrlich gesagt, bevor ich das Thema überhaupt anschneide, muss ich Sie wohl daran erinnern, dass Mr Brooks der Vater dieser jungen Frau ist. Er wurde angeschossen, und sein Zustand ist kritisch. Allein schon deshalb sollte sie benachrichtigt werden. Sie hat jedes Recht und allen Grund, ihren Vater zu sehen.«
»Da haben Sie natürlich Recht.« Dylan wollte Antworten, keine Belehrungen. »Aber was die medizinische Dringlichkeit betrifft …«
»Sie stehen nicht unter Zeitdruck. Selbst wenn Mr Brooks’ Nieren völlig versagen und sich nicht wieder erholen, würden wir erst dann eine Transplantation vornehmen, wenn seine Wunden abgeheilt sind und wenn er sechs bis acht Wochen infektionsfrei ist. Andererseits ist dieser Zeitrahmen natürlich irreführend, denn man braucht ebenso sechs bis acht Wochen, um einen Spender auf Tauglichkeit zu untersuchen. Was ich damit sagen will … falls Carson Brooks’ Tochter einverstanden ist, könnten die Untersuchungen sofort beginnen.« Er sah Dylan fragend an. »Soll ich den Anruf machen?«
»Nein.« Dylan schüttelte den Kopf. »Ich bin in einer heiklen Lage. Sehr wenige Menschen wissen die Wahrheit, und die junge Dame vermutlich auch nicht. Wenn sie von ihrem Vater erfährt, könnte sie einen Schock davontragen. Deshalb wollte ich wissen, ob wir unter Zeitdruck stehen. Ich wollte Zeit haben, um sie persönlich aufzusuchen. Und diese Zeit haben Sie mir ja gegeben. Ich fliege heute Abend zu ihr und bringe ihr die Neuigkeit so schonend wie möglich bei. Ich hoffe, ich kann sie überzeugen, dass sie mitkommt.« Dylan presste die Lippen zusammen. »Doch zuerst einmal muss ich das den beiden Detectives sagen, die da draußen auf der Lauer liegen.«
»Da ist unser Mann.« Whitman zerknüllte die leere Chipstüte und warf sie in den Abfalleimer, als sie Dylan auf sich zukommen sah.
»Ja«, bemerkte Barton trocken. »Wir müssen ihn gar nicht suchen. Er kommt zu uns. Und gestresst sieht er aus!«
»Wir werden den Grund dafür schon rauskriegen.«
Dylan baute sich vor den beiden auf. »Haben Sie noch Fragen an mich? Dann stellen Sie sie jetzt. In zehn Minuten muss ich zum Flughafen, dann geht meine Maschine.«
»Ach?« Detective Whitman sah ihn neugierig an. »Und wohin wollen Sie?«
»Nach Manchester, New Hampshire. Mein Flug geht um zehn nach sechs von LaGuardia. Ich reise nach Auburn, das liegt elf Meilen vom Flughafen Manchester entfernt. Ich sage Ihnen noch Adresse und Telefonnummer. Auf diese Weise können Sie mich im Auge behalten und aufpassen, dass ich nicht das Land verlasse.«
»Kommt ein bisschen plötzlich, diese Reiselust, oder?« Barton ging auf Dylans Ironie nicht ein. »Gar nicht davon zu reden, dass diese Reise ganz schön wichtig sein muss. Immerhin lassen Sie Mr Brooks in seinem Zustand allein.«
»Ich fliege seinetwillen.«
Whitman deutete mit dem Kinn auf die leere Lounge auf der anderen Seite des Flures. »Lassen Sie uns dort reden.«
Mit einem kurzen Nicken bekundete Dylan sein Einverständnis, und die drei begaben sich in den Raum.
»Was gibt es denn so Wichtiges in Auburn?«, fragte Whitman, sobald die Tür hinter ihnen zugefallen war.
»Nicht was, sondern wen«, berichtigte Dylan. »Und die Antwort lautet: Carsons leibliche Tochter.«
Whitmans bleistiftdünne Augenbrauen schnellten in die Höhe. »Ich dachte, er hätte keine lebenden Verwandten.«
»Das haben wir alle geglaubt. Aber es war ein Irrtum. Ich habe eben erst von der Existenz dieser Frau erfahren und es Dr. Radison gesagt. Er möchte, dass sie unverzüglich untersucht wird.«
»Gut. Dann rufen Sie sie an. Am Telefon geht das doch viel schneller.«
Verärgert rieb Dylan sich den Nacken. »Ich habe Ihnen schon viel mehr gesagt, als ich sollte, denn nichts davon darf an die Öffentlichkeit dringen«, fügte er mit Betonung hinzu. »Ich habe es Ihnen nur mitgeteilt, weil Sie nach einem glaubwürdigen Grund für meine Reise gefragt haben … und damit Sie verstehen, warum die Presse nichts davon erfahren darf, zumindest bis morgen. Denn es ist eine persönliche Angelegenheit, nicht Sache der Polizei. Ich kann keine weiteren Einzelheiten preisgeben, ohne Carsons Vertrauen zu hintergehen.«
»Wir haben kein Interesse daran, einen Skandal heraufzubeschwören«, sagte Barton steif. »Wir wollen nur ein Verbrechen aufklären. Wir haben versprochen, die Presse rauszuhalten, und daran werden wir uns halten. Aber Sie müssen schon uns überlassen, was wir im Sinne der Ermittlungen für wichtig halten. Geben Sie uns noch ein wenig mehr an Informationen. Warum diese Reise?«
»Ich will es mal so ausdrücken: Es könnte sein, dass meine Nachricht Carsons Tochter kalt erwischt.«
»Die Nachricht, dass er angeschossen wurde?«
»Die Nachricht, dass er ihr Vater ist.«
»Ach so.« Whitman schürzte die Lippen. »Sie weiß es noch gar nicht. Und Sie sind derjenige, der es ihr beibringen muss.«
»Ich bin der Einzige, dem Carson es anvertraut hat, damit ich sie finde. Es liegt in meiner Verantwortung.«
»Anvertraut?« Whitman stürzte sich darauf wie der Jäger auf seine Beute. »Carson Brooks wusste, dass er ein leibliches Kind hat? Aber Sie sagten doch eben …«
»Er vermutet es. Er ist nicht sicher«, fiel Dylan ihr ins Wort. »Lassen wir doch das Katz-und-Maus-Spiel. Später können Sie ja Carson dazu befragen. In den nächsten sieben Minuten können Sie mich noch zu allem ausquetschen, was Ihnen einfällt. Dann muss ich los. Falls Sie nicht ohnehin vorhaben, mich festzuhalten.«
»Warum sollten wir das tun?«
»Weil Sie glauben, dass ich Carson angeschossen habe.«
»Haben Sie?«
Dylan schaute Whitman so lange an, bis sie den Blick senkte. »Nein.«
Barton riss ein Päckchen Kaugummi auf und schob sich einen Streifen in den Mund. »Besitzen Sie eine Waffe, Mr Newport?«
»Ah, endlich kommen Sie zur Sache. Ich bin sicher, Sie wissen längst, dass ich keine Waffe habe. Ich habe auch keine geliehen oder gestohlen. Außerdem, wenn ich der Schütze wäre, was hätte ich dann mit der Waffe getan? Sie aus dem Fenster geworfen oder in den Aufzugschacht?«
»Das ist eine der offenen Fragen. Keine Waffe. Keine Kugel.«
»Aber Motiv und Gelegenheit«, schaltete Whitman sich ein. »Zum Zeitpunkt des Anschlags waren Sie die einzige andere Person in den Büroräumen.«
»Die einzige andere Person, von der Sie wissen«, korrigierte Dylan.
»Stimmt. Sie hatten die nötige Zeit, und Sie hatten Zugang zum Opfer. Und was das Motiv angeht … wenn man bedenkt, was Sie nach Carson Brooks’ Tod an Geld, Firmenanteilen und Macht erhalten würden.«
Dylans Augen blitzten. »Stimmt. Ich kriege eine Menge. Aber ich würde den Mann verlieren, der mir wie ein Vater ist. Ein mieses Geschäft.«
»Sie kennen Mr Brooks seit neunzehn Jahren.« Whitman blätterte in einem Bericht, den sie offensichtlich von der Jugendfürsorge erhalten hatte. »Als Sie zu ihm kamen, hatten Sie bereits eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Fünf Pflegefamilien …« Sie legte eine beredte Pause ein. »Drei Verhaftungen wegen Jugendkriminalität.«
»Ich habe mit den Fäusten gekämpft, nicht mit Schusswaffen.«
»Ja, sehr oft. Straßenschlägereien, Aufsässigkeit in der Schule …«
»Stimmt. Ich hatte eine Scheißkindheit.« Dylan biss die Zähne zusammen. »Dann blättern Sie mal ein bisschen weiter. Lesen Sie den Teil, nachdem ich Carson Brooks kennen gelernt hatte. Nur noch Bestnoten, Praktikum in seiner Firma, Juraexamen mit Auszeichnung an der Columbia University. Ist das bei Ihnen angekommen? Wenn ja, müssten Sie begreifen, was Carson mir bedeutet.«
»Er ist zweifellos ein Wohltäter. Haben Sie eine Ahnung, warum er Ihnen so viel Gutes getan hat?«
Dylan spürte, wie ein Muskel an seiner Wange zuckte. »Auch diese Frage müssen Sie Carson selber stellen. Lassen Sie mich jetzt nach Auburn fliegen, ja?«
Whitman sah ihn längere Zeit nachdenklich an. Dann nickte sie und riss einen Zettel von ihrem Notizblock. »Schreiben Sie Namen und Adresse von Mr Brooks’ Tochter auf«, sagte sie. »Und lassen Sie Ihr Handy eingeschaltet. Wenn wir Sie brauchen, möchten wir Sie auch erreichen können.«
4
20.15 UhrInstitut für kreatives unternehmerisches Denken
Sabrina beendete soeben den abendlichen Workshop, als ihre Assistentin Melissa Andrews den Kopf durch die Tür steckte.
»Verzeihung, Sabrina«, murmelte sie mit unbehaglicher Miene und ungewöhnlich zögernd – eine Seltenheit für dieses fünfunddreißigjährige Energiebündel, das mit nahezu allem fertig wurde. »Kann ich dich einen Moment sprechen?«
»Sicher.« Sabrina fing den Wink auf, sammelte ihre Unterlagen ein und bedeutete der Gruppe, dass die Sitzung beendet war. »Wir wollten ohnehin Schluss machen. Die Leute brauchen ein wenig Erholung.« Sie lächelte höflich in die Runde. »Den Abend haben Sie frei. Machen Sie das Beste daraus.«
Sie ging auf den Korridor und zwängte sich in eine ruhige Nische, wo Melissa bereits auf sie wartete, um in Ruhe mit ihr zu reden. »Worum geht’s?«
»Vorne ist ein Mann, der dich sprechen will«, berichtete Melissa, verschränkte die Arme vor der Brust und tippte nervös mit einem gepflegten Fingernagel auf den Ärmel. »Sein Name ist Dylan Newport. Offenbar der Firmenanwalt von Ruisseau.«
»Die Ruisseau Corporation?« Sabrina zog interessiert eine Augenbraue hoch und blickte Melissa an. »Der Firmenanwalt? Das ist aber seltsam.«
»Vor allem, dass er abends um acht am Empfang auftaucht und darauf besteht, unverzüglich mit dir zu sprechen, und nur mit dir. Er hat mich praktisch gezwungen, in deinen Workshop reinzuplatzen. Ich wette, der Kerl hätte dir die Tür eingerannt, wenn ich ihn gebeten hätte zu warten.«
»Seltsam«, sagte Sabrina. »Mit Ruisseau haben wir nie zu tun gehabt. Um eine Klage kann es sich also nicht handeln.«
»Darum geht es auch nicht. Ich habe ihn ausdrücklich gefragt, ob er etwas Schriftliches dabeihätte. Ich habe ihn richtig in die Mangel genommen. Schließlich hat er zugegeben, dass es nicht um etwas Juristisches geht. Mehr konnte ich nicht aus ihm rauskriegen. Er hat nur noch einmal betont, dass er dich sprechen will. Heute Abend noch.« Melissa warf ihrer Chefin einen fragenden Blick zu. »Du hast doch nichts mit ihm?«
»Na, hör mal«, gab Sabrina zurück, während sie sich das Hirn auf der Suche nach einer Erklärung zermarterte. »Ich habe doch kaum Zeit zum Schlafen, wie sollte ich da eine Affäre unterbringen?«
»Habe ich auch nicht geglaubt. Obwohl … schade eigentlich. Ist ’n heißer Typ. Wirklich heiß. Aber ist nicht deine Kragenweite. Viel zu rau und kantig.«
»Danke für die Einschätzung.« Melissas Unverblümtheit störte Sabrina nicht. Die Assistentin nahm weder bei der Beurteilung von Beziehungen noch bei der Arbeit ein Blatt vor den Mund. »Aber was immer dieser Dylan Newport von mir will, mit Sex hat es bestimmt nichts zu tun.«
»Schade eigentlich. Auf jeden Fall ist er ein Mann mit einer Mission. Ein Nein kann er nicht akzeptieren. Und statt ihn zu reizen, habe ich lieber in Kauf genommen, dich beim Workshop zu stören.«
»Eine kluge Entscheidung. Wo ist er jetzt?«
»Im Zimmer hinter dem Empfang. Hab ihn dort reingelotst, um kein Aufsehen zu erregen. Jetzt wartet er dort auf dich und rennt herum wie ein Tiger im Käfig.«
»Dann wollen wir keine Zeit mehr verlieren, weder seine noch unsere. Finden wir raus, was er will.«
»Viel Spaß!« Melissa klopfte Sabrina auf die Schulter. »Ich bin an meinem Platz. Wenn du mich brauchst, drück auf die Sprechanlage und schrei um Hilfe.«
»Ich werde schon allein damit fertig.« Sabrina war bereits unterwegs, doch ihre Gedanken waren noch schneller als ihre Füße. Warum kam der Anwalt von Ruisseau her und bestand darauf, mit ihr zu sprechen?
Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden.
Sabrina durchquerte den Eingangsbereich aus Marmor und Glas und begab sich zum Büroraum dahinter.
Als sie eintrat, wäre sie fast mit einem großen dunkelhaarigen Mann zusammengestoßen, der unruhig im Zimmer auf und ab ging.
»Mr Newport?«
Als der Mann sich zu ihr umdrehte, erkannte Sabrina sofort, warum Melissa ihn als »heißen Typen« bezeichnet hatte. Er war ein dunkler, hart aussehender Bursche, der nicht den üblichen Klischees eines gut aussehenden Mannes entsprach. Sein Blick war stechend, und die leicht gekrümmte Nase war mindestens einmal gebrochen gewesen. Haltung und Körperbau zeigten, dass er hart im Nehmen war. Sabrina konnte ihn sich besser in Jeans und schwarzem T-Shirt vorstellen als in dem Fischgrätjackett und der konservativen Anzughose aus Wollstoff.
»Ich bin Sabrina Radcliffe«, sagte sie und streckte ihm die Hand hin. »Sie wollen mich sprechen?«
Der Mann schüttelte ihr die Hand. In seinen Augen lag ein Ausdruck, als würde er sie wiedererkennen und wäre erschrocken darüber. Er trat einen Schritt zurück und musterte Sabrina mit beunruhigender Entschlossenheit von Kopf bis Fuß – nicht auf die übliche, anzügliche Art, die sie nur zu gut kannte, sondern eher klinisch nüchtern wie ein Wissenschaftler, der eine Probe unter dem Mikroskop untersucht.
»Krieg ich den Job?«, fragte sie spitz.
Der Mann verstand, brach die Musterung ab und blickte ihr in die Augen. Er sah ein bisschen verstört aus, wofür Sabrina kein Grund einfallen wollte. »Ja, Sie kriegen den Job. Ich hoffe, Sie wollen ihn auch.«
Okay, er war also tatsächlich gekommen, um sich ihrer Dienste zu versichern. Aber warum um diese Zeit? Und warum schickte Ruisseau den Firmenanwalt?
Die Sache wurde von Minute zu Minute spannender.
»Sie machen mich neugierig.« Sabrina schob sich eine Haarsträhne hinters Ohr. »Ruisseau hat im letzten Vierteljahr einen Riesenerfolg gehabt. Ihr Unternehmen ist auf der Überholspur. Was wollen Sie dann hier, bei cctl? Verstehen Sie mich nicht falsch – wir finden immer Möglichkeiten, die Effektivität eines Unternehmens noch zu steigern. Aber den Firmenchef möchte ich sehen, der bei einem solchen Aufschwung einen Gedanken an Managementtraining verschwendet. Und der mir dann den Firmenanwalt schickt und nicht den Chef der Personalabteilung. Also, wo ist der Haken?«
Zu ihrer Überraschung brach Dylan Newport in heiseres Lachen aus. Ungläubig schüttelte er den Kopf und rieb sich den Nacken, als müsse er eine überraschende Erkenntnis verdauen.
»Würde es Ihnen etwas ausmachen, mich in den Witz einzuweihen?«
»Sorry. Es war ein ziemlich harter Tag. Und ein Witz ist es nicht. Nur eine unerwartete Erkenntnis.«
»Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.«
Die Belustigung Newports verflog. Er beugte sich vor, um die Tür zu schließen. Dann wies er auf einen Stuhl. »Setzen Sie sich, Miss Radcliffe. Unser Gespräch wird nicht einfach.«
Normalerweise wäre Sabrina stehen geblieben. Doch irgendetwas in seiner Stimme ließ sie gehorchen.
Newport zog einen anderen Stuhl heran, sodass er ihr gegenübersaß. »Ich bin nicht gekommen, um Sie anzuheuern.«