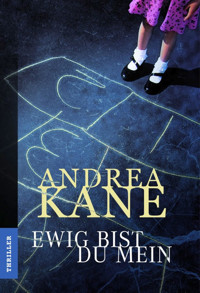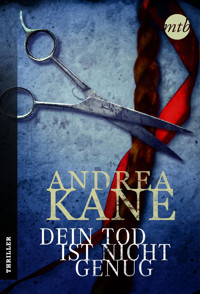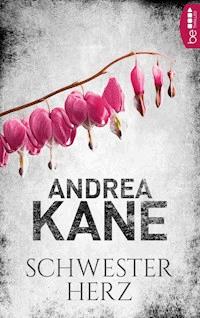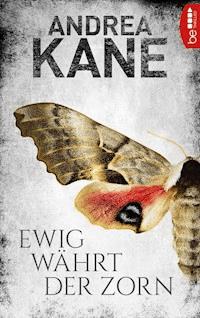4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Romantic Suspense der Bestseller-Autorin Andrea Kane
- Sprache: Deutsch
"Du kannst dich nicht vor mir verstecken ..."
Mit dieser mysteriösen E-Mail kehrt für Taylor Halstead ein Albtraum zurück. Vor vielen Jahren wurde sie brutal misshandelt und beinahe vergewaltigt. Angeblich starb ihr Peiniger kurz darauf bei einem Bootsunglück. Nun jedoch packt Taylor die Angst - lebt der Täter vielleicht doch noch und hat es wieder auf sie abgesehen? Taylor will wissen, wer hinter der Drohung steckt, und wird unterstützt vom charismatischen Anwalt Reed. Und immer wieder taucht auch der Zwillingsbruder des Totgeglaubten auf. Aber kann sie ihm trauen?
Ein packender Psychothriller von Andrea Kane. Weitere Titel der Bestseller-Autorin bei beTHRILLED:
Gefahrenzone.
Schwesterherz.
Dunkelziffer.
Das Böse liegt so nah.
Angsttage.
Ewig währt der Zorn.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Einführung
Widmung
Danksagungen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
Epilog
Über das Buch
»Du kannst dich nicht vor mir verstecken …«
Mit dieser mysteriösen E-Mail kehrt für Taylor Halstead ein Albtraum zurück. Vor vielen Jahren wurde sie brutal vergewaltigt. Angeblich starb ihr Peiniger kurz darauf bei einem Bootsunglück. Nun jedoch packt Taylor die Angst – lebt der Täter vielleicht doch noch und hat es wieder auf sie abgesehen? Taylor will wissen, wer hinter der Drohung steckt, und erhält dabei unerwartet Hilfe vom Bruder des Totgeglaubten. Aber kann sie ihm trauen?
Über die Autorin
Andrea Kane ist eine erfolgreiche US-Autorin, die u. a. psychologische Thriller schreibt. Ihre Bücher wurden bereits in über 20 Sprachen übersetzt. Sie lebt mit ihrer Familie und einem Zwergspitz in New Jersey. Im Internet ist sie unter www.andreakane.com zu finden.
Andrea Kane
HETZJAGD
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch vonKarin Meddekis
beTHRILLED
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Titel der Originalausgabe: I’ll Be Watching You
© 2005 by Rainbow Connection Enterprises, Inc.Published by Arrangement with Rainbow Connection Enterprises Inc.Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC.vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH,30827 Garbsen.
Für diese Ausgabe:Copyright © 2007/2017 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Wolfgang Neuhaus/Jan Wielpütz
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © shutterstock: pupsy | Krasovski Dmitri | Manfred Ruckszio
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN: 978-3-7325-5135-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Dies ist ein Roman. Alle Personen, Ereignisse und Dialogesind allein der Fantasie der Autorin entsprungen.Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen und lebenden oder
Für Brad,der jedes »erste Mal« zu einer Möglichkeit,
Danksagungen
Jeder Roman, den ich schreibe, stellt für mich in dem Bestreben, alle Nuancen und Details so authentisch wie möglich zu zeichnen, eine neue Herausforderung dar. Der vorliegende Roman Hetzjagd bildet da keine Ausnahme.
Die folgenden Personen standen mir dabei hilfreich zur Seite. Ihre Geduld und ihre Hilfsbereitschaft wurden nur durch ihre erstaunlichen Kenntnisse zu allen angeschnittenen Themenbereichen übertroffen. Ich danke jedem Einzelnen von ihnen für seine wertvolle Mithilfe.
Wie immer trage ich für alle Abweichungen von der Wirklichkeit die Verantwortung allein – eine schriftstellerische Freiheit, derer ich mich nur bediene, wenn es unbedingt sein muss.
Detective Mike Oliver, der das Police Department von New York für mich lebendig werden ließ; der ruhig und ohne zu zögern meine Anrufe beantwortete, die mit den Worten begannen: »Mike, angenommen, jemand wird auf diese Weise umgebracht …«; der mich innerhalb kürzester Zeit zurückrief und der auf all meine endlosen Fragen Antworten wusste. Mike, Sie waren mein Retter in der Not. Hadman, der Detective, ist eine verdiente Hommage an Sie.
An WOR 710 AM, eine erstaunliche und engagierte Radiofamilie, der ich ganz besonders danken möchte:
Eloise Maroney, der Leiterin des Senders, die so freundlich war, mir die Tür und die Welt des Rundfunks zu öffnen, mir unzählige Fragen zu beantworten und mir immer die richtige Richtung zu weisen.
Tom R. Ray III., dem technischen Leiter des Rundfunksenders, der die Geheimnisse der komplexen Welt der Rundfunktechnik für mich entschlüsselt hat, sodass sogar ein Laie wie ich sie verstehen konnte.
Maurice Tunick, dem stellvertretenden Programmchef, der es mir ermöglichte, einen Tag im Leben eines Programm-Managers zu erleben. Diese Erfahrung flößte mir großen Respekt vor den talentierten Leuten in diesem Job ein. Ich werde seine Worte niemals vergessen: »Radio ist das Theater des Geistes.«
Und mein Dank gilt ganz besonders dem erstaunlichen Team, dem der Erfolg der Dr. Joy Browne Show zu verdanken ist:
Bob Iorio, dem erfahrenen Tontechniker, der mir einen Blick aus der Vogelperspektive auf sein Schaltpult ermöglichte und der mir alle wichtigen und routinemäßigen Tätigkeiten gezeigt hat, die in seine Verantwortung fallen und die er täglich ausführt.
Scott Lakefield, dem Chefredakteur, einem Genie, der mit seinem Können, seiner Reife und seinen vielseitigen Fähigkeiten durchaus jemandem das Wasser reichen könnte, der doppelt so alt ist wie er und über doppelt so viel Erfahrung verfügt. Er führt die Regie über eine ganze Rundfunksendung und schafft es mühelos, alle Klippen auf seinem Weg zu umschiffen, ohne jemals den Kopf zu verlieren. Immer wieder hat er tausende von Fragen der übereifrigen Autorin beantwortet, die ihm über die Schulter schaute.
Und Dr. Joy selbst, die so freundlich war, mir Einlass in ihr Heiligtum zu gewähren und in ihrer Rundfunksendung zu sitzen, sie bei der Arbeit zu beobachten und zuzuhören, während sie sich mit einem breiten Spektrum an psychologischen Themen und menschlichen Krisen auseinander setzte. Ich verließ ihr Studio mit einem Gefühl des Staunens und der Bewunderung für ihre besorgte, natürliche und professionelle Art, mit der sie ihren Anrufern hilft. Es ist kein Wunder, dass sie sich an sie wenden und ihr vertrauen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir geholfen haben, Taylor mit einigen dieser Qualitäten auszustatten.
Außerdem möchte ich danken:
Robert Dekoff, der freundlicherweise sein Wissen über die Hamptons mit mir geteilt und mir alles von den Orten bis hin zu den Jachthäfen erklärt hat. Außerdem haben mir seine Erfahrungen als Pilot geholfen, mich mit Flugzeugen sowie mit Start- und Landeplätzen vertraut zu machen.
Bill und Michael Stock, die mir einen Crashkurs in Sachen Jachten, Schiffstechnik und Zodiacs gegeben und mir auch beigebracht haben, wie man durch die Gewässer rund um Eastern Long Island schippert. Dank ihrer präzisen Erklärungen und ihrer Geduld konnte ich die Szenen in Hetzjagd, die sich auf dem Wasser abspielen, spannend und authentisch schildern.
Dr. Hillel Ben-Asher, dessen breites Wissen im medizinischen Bereich für mich bei der realistischen Schilderung Furcht einflößender Szenen von unschätzbarem Wert war.
Andrea Cirillo, für ihre unerschütterliche Unterstützung, ihre Anregungen und ihre Fähigkeit, für mich zum richtigen Zeitpunkt Kontakte mit den richtigen Leuten herzustellen. Ich kann kaum in Worte fassen, wie wertvoll Ihre Hilfe für mich gewesen ist, Andrea.
Und mein größter Segen: meine einzigartige Familie – Brad, Wendi und Mom und Dad, die mir während der gesamten Arbeit mit ihren kreativen Anregungen und ihrer begeisterten Unterstützung geholfen haben und mir einen Grund geben zu glauben. Ich betrachte das ungeheure Glück, euch an meiner Seite zu haben, niemals als selbstverständlich.
1. Kapitel
Samstag, 14. September, 14.35 UhrWest Seventy-Second Street, New York City
Es war ein entsetzlicher Tag gewesen.
Vier Stunden im Sitzungszimmer der Dellinger Academy. Zwei kurze Pausen, die gerade ausreichten, um schnell die Toilette aufzusuchen. Drei Elternpaare, die ihr feindselig gegenübersaßen und sich total verweigerten. Und wieder einer von Taylors geliebten Samstagen durch die Verwaltung einer Eliteprivatschule vergeudet, die unnötiges Aufsehen vermeiden wollte.
Da alle beteiligten Parteien so sehr von ihren eigenen Vorstellungen überzeugt waren, schienen sie zu vergessen, dass im Mittelpunkt dieses Dramas drei siebzehnjährige Jugendliche standen, die von ihren Problemen fast erdrückt wurden.
Taylor hatte als psychologische Beraterin der Schule verzweifelt versucht, für die Jugendlichen zu sprechen. Sie kannte ihre Ängste: die Angst, zu versagen; die Angst, Schwächen zu zeigen; die Angst, ihre Eltern zu enttäuschen.
Die Angst, erwachsen zu werden.
Erinnerte sich denn hier niemand mehr daran, was für eine traumatische Lebensphase Jugendliche in diesem Alter durchlebten?
Offenbar nicht. Denn das, was sich hier heute abgespielt hatte, war Taylor bestens vertraut. Es war immer das Gleiche und schier zum Verrücktwerden.
Nachdem Taylor einen halben Tag lang ihren taktvollen, psychologischen Tanz aufgeführt hatte, ohne etwas erreicht zu haben, verließ sie nach der Besprechung frustriert, besorgt und mit fürchterlichen Kopfschmerzen das Sitzungszimmer.
Als sie zu Hause ankam und durch die Eingangshalle ihres Wohnhauses lief, freute sie sich, dass ihre Mitbewohnerin, ihre Cousine Stephanie, unterwegs zu den Hamptons war. Taylor hatte die Wohnung für sich allein und wünschte sich nichts sehnlicher als ein heißes Bad, zwei starke Kopfschmerztabletten und einen ausgedehnten Mittagsschlaf.
Sie hatte nicht im Entferntesten damit gerechnet, Gordon Mallory in ihrem Wohnzimmer vorzufinden, der es sich so gemütlich gemacht hatte, als wäre es seine eigene Wohnung. Das hatte ihr gerade noch gefehlt.
Als Taylor ihn sah, blieb sie wie angewurzelt stehen und wünschte sich, sie hätte nicht bereits den halben Weg zu ihrem Zimmer zurückgelegt, sodass sie in Gordons Blickfeld getreten war. Wenn sie rechtzeitig erkannt hätte, dass er und Steph sich noch in der Wohnung aufhielten, wäre sie auf der Stelle umgekehrt. Sie hätte gewartet, bis die beiden verschwanden, und wäre zurückgekehrt, wenn sie hier Frieden und Einsamkeit gefunden hätte.
Doch es war zu spät. Sie stand genau gegenüber vom Wohnzimmer und vis-à-vis von Gordon. Steph war nirgends zu sehen, aber wie Taylor ihre Cousine kannte, war sie sicher in ihrem Zimmer und packte noch ein paar nette Kleinigkeiten für ihre nächtliche Party auf Gordons Jacht zusammen – eine Party, die sie mit zwanzig anderen Partygästen feiern würde. Es kam nicht jeden Tag vor, dass einer Bande glücklicher, junger, türkischer Investoren das unverhoffte Glück einer Investmentgesellschaft widerfuhr wie die, die Gordon gegründet hatte – verbunden mit der Hoffnung, das schnelle Geld zu machen.
»Taylor.« Gordon wandte seinen schmalen Kopf mit dem dunklen Haar in ihre Richtung und nickte zur Begrüßung. Er war vom Sideboard zur Couch geschlendert und nippte an seinem Scotch, während er Ordnung in Stephs Reisetasche brachte. Ein durch und durch selbstsicherer Mann, der hier daheim zu sein schien.
Zugegeben, Steph hatte dafür gesorgt, dass Gordon sich bei ihr vom ersten Tag an wie zu Hause gefühlt hatte. Gordon entsprach genau den Maßstäben, die Steph bei der Bewertung eines Freundes anlegte: reich und erfolgreich, gut aussehend, großspurig und schlagfertig. Ein aalglatter Typ. Er kannte genau die richtigen Leute und verkehrte in den richtigen Clubs. Zudem war er älter als Steph, sexy, erfahren, ehrgeizig und immer auf der Überholspur unterwegs. Genau der Typ, auf den Steph stand.
Nur dass dieser Typ einen gefährlichen Charakterzug aufwies, der Taylor in Angst und Schrecken versetzte. Man sah es in seinen kalten braunen Augen: eine Art losgelöste Skrupellosigkeit. Taylor traute dem Burschen nicht.
Steph hingegen vertraute ihm leider.
»Hallo, Gordon.« Taylor klang freundlich, aber reserviert.
Gordon war lässig gekleidet – Khakihose, Golfhemd, Docksiders –, doch sein Verhalten war alles andere als lässig. Auch seine Gesichtszüge waren nicht entspannt, als er Taylor beäugte. Mit abschätzendem Blick musterte er sie von Kopf bis Fuß, als würde er ein prächtiges Kunstwerk begutachten.
»Was für eine schöne Überraschung«, sagte er. »Ich hab dich gar nicht reinkommen hören.«
»Das habe ich mir schon gedacht.« Taylor kannte seine »Ich will dich«-Signale nur zu gut. Sie gehörten zu seiner Vorgehensweise, doch heute war er unglaublich aufdringlich. Taylor spürte es intuitiv. Und die Scotchflasche stand geöffnet auf dem Sideboard, sodass er sich sofort nachschenken konnte. Wie viele Drinks hatte er schon intus?
Taylor legte ihre Handtasche ab, verschränkte die Arme vor der Brust und starrte auf sein Glas. »Wie viele Gläser hast du getrunken?«
»Zwei.« Er stellte das Glas ab. »Keine Sorge. Ich relaxe nur. Ich bin vollkommen nüchtern.«
Klar, dachte sie. Relaxen. Du bringst dich wohl eher auf Touren. »Ist auch besser so. Ihr habt doch große Pläne an diesem Wochenende, du und Steph. Betrink dich auf der Party und nicht vorher.«
»Ein weiser Rat. Ich werde ihn mir zu Herzen nehmen.«
Taylors Kopfschmerzen wurden immer schlimmer. Sie hatte keine Lust, mit Gordon zu streiten. Sie wollte, dass er ging. »Ich wusste nicht, dass ihr noch hier seid«, sagte sie ungehalten. »Es ist fast drei Uhr. Startet dein Charterflug nicht bald nach Montauk? Du solltest ihn nicht verpassen.«
Gordon verzog das Gesicht. »Es ist ein privater Charterflug. Der Hubschrauber wartet auf uns. Und was deinen eleganten Rausschmiss angeht … Warum die Eile? Erwartest du jemanden?«
»Ich will nur meine Ruhe. Hör zu, ich will nicht unhöflich sein, aber ich hatte einen harten Tag. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen und hatte auf ein bisschen Entspannung gehofft. Ein heißes Bad und einen langen Mittagsschlaf.«
»Du Arme.« Gordon wurde eine Spur freundlicher. Er ging auf Taylor zu, legte seine Hände auf ihre Schultern und massierte sie sanft. »Die Anspannung hat kein Recht, einen so schönen Körper zu ruinieren. Was hältst du von einer Rückenmassage, um den Stress zu vertreiben?«
Gordons Worte jagten Taylor einen kalten Schauder über den Rücken. Seine Berührung war nicht freundschaftlich. Sie war intim. Und das war seine Nähe auch. Zudem hatte er sich wie eine Straßensperre vor ihr aufgebaut.
Taylors Instinkte erwachten. Sie trat einen großen Schritt zurück, sodass er sie nicht mehr berühren konnte. »Nein danke.« Ihr Blick glitt zum Zimmer ihrer Cousine, und sie fragte sich, wann Steph endlich auftauchte. In diesem Augenblick fiel ihr auf, dass es ungewöhnlich still in der Wohnung war. Keine klappernden Schranktüren, keine Schubladen, die zugeworfen wurden, kein fröhliches Geschnatter – aus Stephs Reich drang nicht das geringste Geräusch. Das war seltsam. Steph war sehr temperamentvoll. Es war nicht zu überhören, wenn sie in der Nähe war.
Jetzt wurde Taylor allmählich mulmig. Sie bekam eine Gänsehaut.
»Ist Steph in ihrem Zimmer?«, fragte sie. »Ich helfe ihr beim Packen.«
»Sie ist nicht da.«
»Wie meinst du das, sie ist nicht da? Wo ist sie denn?«
Taylors Magen verkrampfte sich. »Sie ist noch beim Vorsprechen.« Gordon schaute auf die Uhr. »Sie ist spät dran. Ich vermute, sie kommt direkt zum Hubschrauber.«
»Und wie bist du hier hereingekommen?«
Ein hartes Lächeln verzerrte Gordons Lippen, als er einen Schlüsselbund durch die Luft schwenkte. »Hiermit. Steph hat mich gebeten, hier vorbeizufahren und noch ein paar Sachen zu holen. Hat Harry dir das nicht gesagt?«
Harry. Der Portier. Jetzt erinnerte Taylor sich, dass er gar nicht in der Eingangshalle gesessen hatte, als sie das Haus betrat. »Ich habe ihn nicht gesehen.«
»Ah, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Er macht gerade Pause.«
»Ach ja?« Taylors Herz begann zu klopfen. Sie trat noch einen Schritt zurück und fragte sich, ob sie die Tür erreichen könnte, wenn sie in einem großen Bogen um Gordon herumlief. »Komisch. Mitten am Nachmittag macht er normalerweise nie eine Pause.«
»Es ist heiß. Er hatte Durst. Ich habe ihm ein paar Dollar geschenkt, damit er drüben im Starbucks einen Eiskaffee trinken kann.«
»Wann war das?«
»Vor zehn Minuten. Als ich einen Blick aus dem Fenster geworfen habe und dich die Straße hinaufkommen sah.« Gordon näherte sich ihr und schnitt ihr nun definitiv den Fluchtweg ab. »Ich wollte, dass wir bei meinem kleinen Besuch unter uns sind.« Er streckte den Arm aus und rollte eine Strähne ihres dunkelroten Haars zwischen den Fingern. »Dieser Stress, über den du dich beklagt hast …«
Jetzt reichte es. Taylor wusste nicht, ob Gordon betrunken war oder sich irgendwelchen Wahnvorstellungen hingab. Und sie hatte nicht vor zu warten, bis sie es herausgefunden hatte. Sie musste hier raus.
Sie rannte zur Tür.
Blitzschnell streckte Gordon seine Arme nach ihr aus und ergriff sie. Einen Arm schlang er fest um ihre Taille und umklammerte mit der Hand ihr Handgelenk. »Nicht doch«, flüsterte er ihr ins Ohr. Taylor roch seine Scotchfahne. »Pass auf, sonst werden deine Kopfschmerzen noch schlimmer.« Er hob sie ein Stück in die Luft und trug sie in ihr Zimmer. »Ich weiß, wie wir die Kopfschmerzen vertreiben können.«
»Lass mich los!« Taylor strampelte verzweifelt mit den Beinen, schlug mit den Armen und stemmte sich mit aller Kraft gegen ihn, um sich zu befreien.
Es nützte nichts. Sie waren bereits in ihrem Zimmer.
»Hör auf, dich zu wehren!«, befahl er. »Du willst es doch genauso wie ich.«
»Nein. Will ich nicht. Es wird nicht passieren. Nicht jetzt und auch in Zukunft nicht. Niemals.« Taylor hakte ihre Füße an beiden Seiten des Türrahmens fest, um Gordon aufzuhalten. Sie hob den Kopf, starrte ihn an und versuchte, ihn zur Vernunft zu bringen. Offenbar hatte er vollkommen den Verstand verloren. »Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass ich das will. Es muss ein Missverständnis sein. Lass mich los; hau ab, und wir vergessen diesen ganzen hässlichen Vorfall.«
Gordon schaute sie amüsiert an und trat gegen ihre Füße, sodass er sie durch die Tür und die restlichen Meter bis zum Bett tragen konnte. »Du hast in jeder Beziehung unrecht. Es wird passieren. Es wird nicht hässlich sein. Und du wirst garantiert niemals vergessen wollen, dass es passiert ist.«
Blanke Panik ergriff sie.
»Nein! Nein!« Mit all ihrer Kraft wehrte Taylor sich wie ein gefangenes Tier. Doch der Mann hatte ungeheuere Kräfte. Und er schien tatsächlich überzeugt zu sein, dass sie es beide wollten. »Lass mich los!«
Gordon presste sie aufs Bett und wich ihren Faustschlägen und ihren spitzen Knien aus, als sie versuchte, sie ihm in die Leiste zu rammen. Er setzte sich auf ihre Oberschenkel, sodass sie die Beine nicht mehr bewegen konnte, und presste ihre Arme mit einer Hand über ihrem Kopf aufs Bett. Mit der anderen Hand massierte er ihren Nacken, als wolle er sie beschwichtigen, und strich ihr mit den Fingern durchs Haar. Dann drückte er seine Lippen auf ihren Mund, um ihre Schreie zu ersticken. »Schschsch«, flüsterte er. »Du hast ja keine Ahnung, wie schön es sein wird.«
Taylor spürte Übelkeit in sich aufsteigen.
»Ich weiß genau, was du brauchst. Ich werde es dir geben – alles und noch mehr.«
»Aber … ich … will … dich … nicht«, zischte Taylor in dem verzweifelten Versuch, ihn zu erreichen und alle Fantasien, denen er sich in Bezug auf sie beide hingab, zu zerstören.
»Doch, du willst es. Ich werde es dir beweisen. In ein paar Minuten wirst du mich anflehen. Das verspreche ich dir.« Gordon knöpfte ihr die Bluse auf und streichelte sie währenddessen – ihre Schultern, ihre Arme, ihr Dekolleté. Als Taylor versuchte, seinen Berührungen auszuweichen, umklammerte er ihre Handgelenke noch fester. »Keine Spiele mehr, Taylor. Keine Kämpfe mehr. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Es ist Zeit.«
»Nein, ist es nicht!« Hilflos biss Taylor ihm in die Lippe. Gordon zuckte zusammen und wich zurück. Diesen Moment der Schwäche nutzte sie, um ihre Arme loszureißen und ihm mit den Fäusten kräftig auf die Brust zu schlagen. »Lass mich los, du irrer Scheißkerl! Nimm deine dreckigen Pfoten weg!«
Dieser Wutausbruch würde sie teuer zu stehen kommen. Das erkannte Taylor, als sie sah, wie Gordon reagierte.
Er kochte innerlich vor Wut. Einen kurzen Moment verharrte er reglos; dann hob er den Kopf und blickte auf sie hinab. Seine kalten Augen, die jetzt fast schwarz waren, funkelten gefährlich. Keine Sekunde später umklammerte er mit einer Hand ihre Kehle und drückte auf ihre Luftröhre. »Sprich nie mehr in diesem Ton mit mir. Hast du verstanden? Das lasse ich mir von niemandem bieten.«
Die Angst durchdrang Taylor wie ein spitzes Messer. Sie röchelte und krächzte: »Ich … Ich habe verstanden.«
»Hast du?«
»Ja … Es … tut mir leid …«
Der böse Schimmer in Gordons Augen verblasste. »Ist auch besser so.«
»Du … Du … tust mir weh.«
»Ach ja? Das hatte ich nicht vor.« Der Druck auf ihre Kehle ließ nach. Er beugte sich hinunter, rieb mit der Nase sanft über ihr Dekolleté und zeichnete mit der Zunge die Furche zwischen ihren Brüsten nach.
Taylor erstarrte. Sie musste nachdenken. »Steph …«, stammelte sie. »Sie wird furchtbar enttäuscht sein. Das können wir ihr nicht antun.«
»Sie wird es niemals erfahren.«
»Gordon, sie liebt dich.«
Er lachte. Sein heißer Atem strich über Taylors Haut. »Das ist keine Liebe, sondern Leidenschaft.« Er massierte ihre Taille und versuchte, den Knopf ihrer Hose zu öffnen. »Steph ist heiß«, murmelte er. »Aufreizend. Kaum zu bändigen. Unersättlich.« Er zog den Reißverschluss ihrer Hose herunter. »Du bist wie eine Wolke. Schwer zu fassen. Kaum zu erobern.« Mit der Handfläche strich er ihr über den Bauch, wobei seine Finger mit dem Bändchen ihres Stringtangas spielten. »Du machst mich wahnsinnig. Aber das weißt du ja. Du hast es darauf angelegt, mich verrückt zu machen.«
»Nein.« Taylor atmete tief ein und wich ein Stück zurück. »Das ist nicht wahr.«
»Doch, das ist es.« Gordon erstickte ihren Protest mit einem weiteren Kuss. »Ich deute Signale nicht falsch. Sie waren eindeutig. Wir mussten nur auf den richtigen Augenblick warten, und der ist jetzt gekommen. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um es endlich zu tun. Ich will, dass dich das, was ich dir geben kann, um den Verstand bringt. Und das wird es. Bald.« Seine Finger glitten unter ihren Slip und zwischen ihre Beine. »Schluss mit dem Gerede. Genieße es einfach.«
Wie eine Ertrinkende wehrte Taylor sich erneut mit Händen und Füßen und bäumte sich mit all ihrer Kraft auf.
Plötzlich hörte sie die Gegensprechanlage in der Diele.
»Gordon?« Stephs leise Stimme drang aus der Eingangshalle an ihre Ohren. »Ich bin zurück. Harry hat gesagt, dass du noch oben bist. Komm runter. Ich kann es kaum erwarten, deine Jacht zu sehen.«
Erstarrt blickte Taylor in Gordons Gesicht und fragte sich, ob er jetzt aufhören würde, oder ob er Stephs Stimme in seiner Lüsternheit überhaupt gehört hatte.
»Meine Cousine …«, flüsterte sie. Das Risiko, ihn erneut in Wut zu versetzten, war zu groß. »Sie wartet auf dich.«
Gordons Gesichtsmuskeln zuckten. »Sieht so aus.«
»Dann ist jetzt doch nicht der richtige Zeitpunkt für uns.«
»Vielleicht nicht.«
Taylor schöpfte ein wenig Hoffnung. »Du solltest hinuntergehen.«
Ihre Hoffnung erstarb, als er grimmig die Lippen zusammenpresste und seine Hand auf ihre Kehle drückte. »Ich hoffe, das ist kein Befehl.«
»Kein Befehl … ein Vorschlag … eine Bitte.«
»Gut.« Gordon ließ sie nicht los. Während eine Hand ihre Kehle umspannte, wühlte er mit der anderen in seiner Tasche. Taylor sah, dass er einen Gegenstand aus der Tasche zog, den er durch die Luft schwenkte und der in der Spätnachmittagssonne silbern glitzerte. Dann verstärkte er den Druck auf ihre Luftröhre und würgte sie. »Wir werden das hier zu Ende bringen, Taylor«, versprach er ihr. »Darauf gebe ich dir mein Wort. Ich komme wieder. Beim nächsten Mal werden wir die Zeit haben, die wir brauchen. Sei geduldig. Sei brav. Sei vernünftig.«
Er drückte noch stärker zu, bis Taylors Blick sich trübte und schwarze Punkte vor ihren Augen tanzten.
Gordon beugte sich hinunter und hauchte einen Kuss auf ihre Lippen. »Bis dahin«, flüsterte er, ehe sie die Besinnung verlor. »Ich werde dich beobachten.«
2. Kapitel
Als Taylor wieder zu sich kam, begann sie zu husten und hechelte nach Luft:
Es war kein Albtraum gewesen. Es war wirklich geschehen. Ihre zerzauste Kleidung erinnerte sie ebenso deutlich daran wie der Schmerz in ihrer Kehle.
Ihr Blick glitt durch den Raum. Sie war allein. Gordon war verschwunden.
Die Pendelwanduhr aus Buchenholz zeigte drei Uhr fünfundzwanzig an. Gordon musste Steph unten getroffen haben. Sie waren auf dem Weg zum Hubschrauberlandeplatz.
Taylor schnellte hoch und wurde sofort wieder nach unten gezogen, als ein stechender Schmerz durch ihr Handgelenk schoss. Sie drehte sich zur Seite, um zu sehen, was der Grund dafür war.
Sie war mit Handschellen ans Kopfteil ihres Messingbettes gefesselt. Und das Telefon auf dem Nachtschrank war verschwunden. Vermutlich hatte Gordon es weggenommen, damit sie Steph oder die Cops nicht über den Vorfall informieren konnte. Er wollte Zeit gewinnen, und das war ihm gelungen. Sogar ihr verdammtes Handy war außer Reichweite. Es steckte in ihrer Handtasche, und die lag im Wohnzimmer.
Eine ziemlich verzwickte Lage.
Taylor hatte jedoch nicht die Absicht, sich damit abzufinden.
Sie versuchte zu schreien, doch nur ein krächzender Laut drang über ihre Lippen.
Panisch zog sie an den Handschellen. Wie erwartet, waren sie verschlossen. Okay, dann musste sie eben einen anderen Weg finden, um sich zu befreien. Sie riss am Kopfteil des Bettes und versuchte, es zu lockern, wobei sie ihre freie Hand zur Hilfe nahm. Das Kopfteil bestand aus röhrenförmigen Messingstangen und stellte den instabilsten Teil des Bettes dar. Wahrscheinlich würde es ewig dauern, bis sie die Stange, an die sie gefesselt war, zerbrochen hätte, aber es war nicht unmöglich. Sie würde das verdammte Ding herausreißen, und wenn die ganze Nacht dabei draufging.
Taylor riss fast zwei Stunden lang ruckartig an der Messingstange, bis sie sich schließlich lockerte. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis es ihr endlich unter Aufbietung all ihrer Kraft gelang, die Stange in der Mitte durchzubrechen. Sie schob die Handschelle über die zerbrochene Stange und kroch aus dem Bett.
Als sie sich hinstellte, gaben ihre Beine beinahe nach. Taylor war körperlich und emotional vollkommen am Ende und stand kurz vor einem Zusammenbruch. Nicht nur der pochende Schmerz in ihren Handgelenken machte ihr zu schaffen, sondern auch ihre wahnsinnigen Kopfschmerzen. Es dauerte einen Moment, bis sie sich wieder ein wenig gefasst hatte. Ihr Blick fiel auf die Uhr: Viertel nach fünf. Inzwischen war Gordon gewiss schon mit ihrer Cousine auf hoher See.
Vielleicht.
Taylor lief in die Küche, ergriff den Hörer und wählte Stephs Handynummer. Mailbox. Verdammt. Das bedeutete, dass sie unterwegs war und nicht gestört werden wollte.
Toll. Steph und Gordon feierten auf der Jacht eine Party mit zwanzig anderen Gästen. In der Menge waren sie gut aufgehoben. Gordon würde Steph auf gar keinen Fall etwas von dem Vorfall erzählen, egal, wie betrunken er war. Daher konnte er sich zunächst in Sicherheit wiegen. Wenn Gordon allerdings glaubte, dass er ungeschoren davonkäme, würde sie ihn rasch eines Besseren belehren. Selbst wenn er die ganze Nacht auf seiner Jacht ein Fest feierte, würde Taylor dafür sorgen, dass ihn bei der Rückkehr ein Begrüßungskomitee erwartete.
Sie wählte den Notruf.
»Notrufzentrale. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich möchte eine versuchte Vergewaltigung anzeigen.« Taylors Stimme krächzte, und ihre Kehle und ihr Nacken schmerzten fürchterlich. »123 West Seventy-second Street, Wohnung 5F.«
»Sind Sie das Opfer?«
»Ja.«
»Und der Täter? Ist er noch im Haus?«
»Nein. Er ist gegangen.« Das Kratzen in Taylors Kehle wurde schlimmer, und sie bekam einen Hustenanfall.
»Ma’am, ist alles in Ordnung?«, erkundigte die Polizistin sich sofort. »Sind Sie verletzt?«
»Ich bin okay«, versicherte Taylor ihr. »Aber mir sitzt noch der Schreck in den Gliedern.« Sie lieferte die notwendigen Informationen, erklärte, sie sei nicht vergewaltigt worden und ihre Verletzungen erforderten keinen Krankenwagen. Dankbar nahm sie zur Kenntnis, dass zwei Polizeibeamten bereits unterwegs seien.
Kurz nach dem Telefonat trafen die Polizeibeamten Slatter und Hillman vom zwanzigsten Revier bei ihr ein. Sie saßen im Wohnzimmer auf der Couch und nahmen ihre Aussage auf, nachdem sie die Handschellen, die noch immer an ihrem Handgelenk baumelten, aufgeschlossen hatten.
»Der Mann ist in Ihre Wohnung eingebrochen?«, begann Slatter, nachdem Taylor ihren Bericht beendet hatte.
»Nein.« Taylor lehnte sich in ihrem gepolsterten Ohrensessel zurück und zuckte unwillkürlich zusammen, als sie ihren Arm massierte und die Durchblutung angeregt wurde. »Er hatte einen Schlüssel. Meine Cousine, mit der ich diese Wohnung teile, hat ihm den Schlüssel gegeben.«
»Dann ist er kein Fremder.«
»Sein Name ist Gordon Mallory. Er ist …«, es folgte eine unangenehme Pause, »… ein Freund meiner Cousine.«
»Ein Freund.« Skeptisch wiederholte Slatter ihre Worte. »Sind Sie auch mit ihm befreundet?«
»Auf gar keinen Fall.«
»Okay, dann halten wir fest, dass es sich um keinen Einbruch gehandelt hat. Was ist mit einer Waffe? Hatte er eine?«
»Wenn Sie ein Messer oder eine Pistole meinen, nein. Er bediente sich nur seiner Körperkraft.«
»Sie sagten, Ihre Verletzungen hätten Sie nicht außer Gefecht gesetzt«, hob Hillman hervor. »Warum hat es dann zwei Stunden gedauert, bis Sie das Verbrechen gemeldet haben?«
»Darum.« Taylor zeigte auf die Handschellen, die Slatter an sich genommen hatte. »Gordon hat mich gewürgt, bis ich bewusstlos wurde, und mich dann mit Handschellen ans Bett gefesselt. Er hat das Telefon vom Nachtschrank genommen, damit ich keine Hilfe rufen konnte. Es dauerte eine ganze Weile, bis es mir gelungen ist, mich zu befreien und den Notruf zu verständigen.«
»Die Handschellen hingen an Ihrem rechten Handgelenk. Das erklärt die Schürfwunden dort. Sie haben aber auch an Ihrem linken Handgelenk beträchtliche blaue Flecke.«
»Er hat mich aufs Bett gepresst.«
»Richtig.« Hillman wechselte einen schnellen Blick mit seinem Partner. »Das würde es erklären.«
»Ja, würde es«, erwiderte Taylor ungehalten. »Und das Würgen erklärt meine heisere Stimme und die Druckstellen an meiner Kehle.«
»Sicher«, stimmte ihr Hillman in einem Ton zu, der Taylor veranlasste, mit den Zähnen zu knirschen. Hillmans unterschwellige Anspielungen waren nicht zu überhören.
»Sie sagten, er habe getrunken«, fuhr Hillman fort.
»Scotch. Nach seinen eigenen Worten hatte er erst zwei Drinks intus.«
»War er betrunken, als er über Sie hergefallen ist?«
»Eigentlich nicht. Er erlag der Illusion, ich wollte es auch.«
»Er erlag der Illusion … Dann haben Sie also falsche Signale ausgesendet.«
»Ich habe gar keine Signale ausgesendet.«
»Dann ist der Bursche ein Egozentriker. Sie sagten, es sei eine versuchte Vergewaltigung gewesen, aber er hat Sie letztendlich nicht vergewaltigt.«
»Das war reines Glück. Meine Cousine klingelte und meldete sich aus der Eingangshalle über die Sprechanlage. Darum änderte Gordon seine Pläne und ließ von mir ab.«
»Er hat Sie gewürgt, aber nur bis Sie das Bewusstsein verloren haben.«
»Genau darauf hatte er es angelegt. Töten wollte er mich nicht. Er hat vor, es zu Ende zu bringen. Das hat er gesagt.«
»Er hat Sie bedroht? Was genau hat er gesagt?«
»Dass er wiederkommen und wir dann all die Zeit haben würden, die wir brauchten. Und dass er mich beobachten wird.« Taylor war körperlich und psychisch vollkommen am Ende. Sie beugte sich vor, um dieser unangenehmen Befragung ein Ende zu setzen. »Hören Sie, Officer Hillman. Wir sollten dieses unerquickliche Gespräch nun beenden. Das war keine wilde Bettgeschichte, die aus dem Ruder gelaufen ist. Es war eine versuchte Vergewaltigung. Gordon Mallory ist über mich hergefallen. Punkt. Verhaften Sie ihn jetzt oder nicht?«
Hillman ließ seinen Notizblock sinken und hob den Blick. »Wir nehmen Ihre Anzeige auf, Ms Halstead. Ein Detective wird sich noch einmal mit Ihnen unterhalten und mit Mr Mallory ebenfalls. Wir werden ihn verhören und überprüfen, ob er vorbestraft ist. Ob er nun verhaftet wird oder nicht, das hängt ganz davon ab, was wir finden.«
Taylor bekam erneut einen Hustenanfall und spürte starke Schmerzen in der Kehle. »Ich bezweifle, dass er vorbestraft ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, steht sein Wort jetzt gegen meines, korrekt?«
»Darauf kann ich Ihnen erst eine Antwort geben, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind.« Als Hillman aufstand, erhob Slatter sich ebenfalls. »Wenn Sie um Ihre Sicherheit fürchten, sollten Sie die nächsten Nächte bei Verwandten oder Freunden verbringen. Sie können auch Personenschutz anfordern, wenn Sie sich dann sicherer fühlen. Laut Ihren eigenen Worten stellt der Bursche im Augenblick keine unmittelbare Gefahr für Sie dar, weil er auf seiner Jacht über den Atlantik schippert. Ich an Ihrer Stelle würde die Schürfwunden und Quetschungen behandeln lassen, mir einen starken Drink genehmigen und mich ins Bett legen. Einer der Kollegen vom Revier wird Sie morgen entweder über Ihren Festanschluss oder übers Handy anrufen.«
»Schön.« Taylors Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Sie hatte Schmerzen am ganzen Körper und rasende Kopfschmerzen. Officer Hillman hatte Recht. Heute Abend konnten die Beamten nichts mehr für sie tun. Und sie brauchte dringend Schlaf. »Vielen Dank, meine Herren.« Sie stand auf und klammerte sich sofort an der Rückenlehne des Sessels fest, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. »Es war sehr nett von Ihnen, dass Sie so schnell gekommen sind. Ich begleite Sie zur Tür.«
Nachdem Taylor eine Tasse Tee getrunken, zwei Schmerztabletten geschluckt und geduscht hatte, streifte sie eine halbe Stunde später ihr Nachthemd über, überprüfte zweimal die Sicherheitskette und den Riegel an der Wohnungstür und kroch ins Bett.
Als ihr Kopf das Kissen berührte, schlief sie ein.
Das Klingeln des Telefons weckte sie. Es war schrill. Aufdringlich. Weit weg.
Taylor beugte sich herüber und tastete über den Nachtschrank aus Kirschbaumholz. Das Stechen in ihrem Handgelenk und die schmerzenden Muskeln weckten die lebhafte Erinnerung an die Geschehnisse des Nachmittags. Sie erinnerte sich auch daran, dass sie das Telefon im Schlafzimmer noch nicht wieder angeschlossen hatte.
Fluchend stapfte sie in die Küche und stolperte über einen Hocker, als sie nach dem Lichtschalter suchte. Es war dunkel in der Wohnung. Vermutlich war es mitten in der Nacht. Als Taylor das Licht schließlich eingeschaltet hatte, schaute sie auf die Küchenuhr: zehn nach vier. Wer zum Teufel rief sie um diese Zeit an?
Gordon.
Ihr Magen verkrampfte sich, und das Adrenalin strömte durch ihre Adern. Taylor war augenblicklich hellwach.
Sie starrte auf das Telefon und überprüfte die Nummer des Anrufers. Auf dem Display stand »Privat«. Das sagte ihr nichts. Ob es Gordon war? Selbst wenn er sich lange genug von den anderen Partygästen entfernen konnte, um ungestört telefonieren zu können, stellte sich die Frage, warum er es tun sollte.
Taylors Hand zitterte, als sie nach dem Hörer griff. »Hallo?«
»Ms Halstead?«, fragte eine förmliche Stimme.
»Ja?«
»Hier ist Detective Hadman vom neunzehnten Revier. Entschuldigen Sie die Störung um diese Zeit; aber es hat einen Unfall gegeben.«
»Einen Unfall?« Damit hatte Taylor nun wirklich nicht gerechnet. Dennoch begann sie zu frösteln und verstärkte ihren Griff um den Hörer. »Was für einen Unfall?«
»Eine Schiffsexplosion. Sie ereignete sich in der Nähe von Long Island auf einer Jacht, die Gordon Mallory gehört. Die Jacht lag zwanzig Meilen südlich von Montauk vor Anker. Das Police Department von Suffolk County informierte das neunzehnte und zwanzigste Revier, weil die meisten Passagiere in Upper East oder West Side gewohnt haben.« Nach einer bedeutungsschwangeren Pause fuhr er fort. »Einer der Passagiere war Ihre Cousine Stephanie Halstead.«
»Ja … das stimmt.« Taylor sank zu Boden, zog die Knie an und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand. »Wurde Steph … wurde jemand … verletzt?«
»Es tut mir sehr leid. Alle Passagiere sind ums Leben gekommen.«
Mein Gott, nein. Das konnte nicht sein. Nicht Steph.
»Sind Sie sicher?«, murmelte Taylor. »Ist es nicht möglich, dass einige der Passagiere durch die Explosion von Bord geschleudert wurden und …«
»Wir sind ganz sicher. Der Unfall ereignete sich im Morgengrauen. Seitdem sucht die Küstenwache nach Überlebenden. Sie haben … Leichenteile und persönliche Gegenstände geborgen. Glauben Sie mir. Es hat niemand überlebt.«
Taylor schnürte es die Kehle zu, als sie schwimmende Leichenteile vor ihrem geistigen Auge sah. Nicht ihre hübsche, temperamentvolle Cousine, die voller Leben steckte und keine Anstrengungen gescheut hatte, um als Broadwaystar die Karriere zu machen, von der sie immer geträumt hatte. Voller Hoffnungen und Träume. In deren Leben es so viele Dinge gab, für die es sich zu leben lohnte … Sie konnte unmöglich tot sein.
»Ms Halstead?«, fragte der Detective. »Ist alles in Ordnung?«
»Hat die Küstenwache etwas gefunden, was Steph gehört?«, fragte Taylor. Sie klammerte sich an einen Strohhalm, und sie wusste es. »Vielleicht war sie gar nicht an Bord. Vielleicht hat sie in letzter Minute beschlossen, nicht an Bord zu gehen. Vielleicht …«
»Sie war an Bord«, erklärte Detective Hadman. »Zeugen haben sie an Deck gesehen, als die Jacht abgelegt hat. Sie haben sie beschrieben: groß, schlank, mit rotem schulterlangem Haar. Sie trug ein türkisfarbenes seidenes Cocktailkleid.«
Taylor kniff die Augen zusammen. Dieses Kleid hatte sie Steph zum Geburtstag geschenkt. Steph hatte es für eine besondere Gelegenheit aufgehoben.
»Ihre Tante und Ihr Onkel wurden bereits informiert. Sie sind jetzt am Unfallort. Ich habe beschlossen, Sie anzurufen, da die Eltern nicht in der Lage sind, Fragen zu beantworten. Es tut mir furchtbar leid«, fügte er hinzu.
»Danke«, erwiderte Taylor tonlos. Ihre Wahrnehmung war gestört. Sie verstand nichts mehr. Sie fühlte nichts mehr. Sie war wie erstarrt.
»Ich würde gern im Laufe des Vormittags vorbeikommen und mit Ihnen sprechen, wenn Sie sich dem gewachsen fühlen.«
»Was?« Taylor verstand nicht, was Detective Hadman von ihr wollte. Sie war so benommen, dass sie kaum einen klaren Gedanken fassen konnte. Sie musste ihre Eltern anrufen, sich mit ihrer Tante und ihrem Onkel in Verbindung setzen, um die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. Niemand stand Steph näher als sie. Sie musste sich um alles kümmern.
»Ich habe ein paar Fragen an Sie.«
»Fragen?« Es kostete Taylor ungeheure Mühe, sich zu konzentrieren. »Was denn für Fragen?«
»Sie betreffen den Besitzer der Jacht«, sagte der Detective. »Gordon Mallory. Er gehört zu den Opfern. Ich habe ihn überprüft und festgestellt, dass Sie gestern Abend Anzeige gegen ihn erstattet haben.«
»Was hat das jetzt noch für eine Bedeutung? Er ist tot.«
»Ich mache nur meinen Job, Ms Halstead. Sie haben eine versuchte Vergewaltigung zur Anzeige gebracht. Die Officer Hillman und Slatter aus dem zwanzigsten Revier haben Ihre Anzeige zu Protokoll genommen. Ich unterstütze sie und führe Ermittlungen durch, damit der Fall abgeschlossen werden kann. Es wird nicht lange dauern.«
»Schön.« Taylor stand kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Sie verspürte das dringende Bedürfnis, wieder ins Bett zu kriechen und allein zu sein. »Kommen Sie möglichst früh, so gegen acht. Anschließend muss ich mich um alles kümmern. Für Steph. Sie verlässt sich auf mich.«
Das entsprach der Wahrheit. Steph hatte sich immer auf sie verlassen.
Aber diesmal hatte Taylor ihre Cousine im Stich gelassen.
3. Kapitel
Donnerstag, 19. Dezember, 16.55 Uhr746 Park Avenue, New York City
Taylor Halstead. In einer Therapie.
Selbst nach zwei Monaten intensiver wöchentlicher Sitzungen bei Dr. Phillips erschien ihr die Vorstellung noch immer absurd. Da sie selbst Psychotherapeutin war, wusste sie besser als jeder andere, wie wichtig diese Besuche waren und wie dringend sie die Gespräche brauchte.
Die Feiertage nahten. Seit Stephs Tod waren drei Monate vergangen, und noch immer konnte Taylor die Albträume und die Schuldgefühle nicht abschütteln. Es wurde beides höchstens noch viel schlimmer. Als Therapeutin kannte sie die Anzeichen. Sie brauchte Hilfe.
Es war schon eine komische Situation, denn zum ersten Mal in ihrem Leben war Taylor auf fremde Hilfe angewiesen, anstatt wie sonst diejenige zu sein, auf die sich andere verließen. Sie war immer die Starke gewesen, die Ausgeglichene, diejenige, an der sich andere orientierten. Diejenige, die ihre Probleme und sogar die anderer bisher immer allein gelöst und die schon in ihrer Kindheit gelernt hatte, ihre Verletzbarkeit nicht nach außen zu tragen.
Und das aus gutem Grund. Zeit ihres Lebens war Taylor in allen wichtigen Dingen auf sich selbst gestellt gewesen.
In materieller Hinsicht hatte es ihr als Kind an nichts gefehlt. Taylor war in einem Penthouse am Central Park West aufgewachsen und von zahlreichen Kindermädchen betreut worden. Sie war ein Einzelkind, und während Geld in Hülle und Fülle vorhanden gewesen war, waren ihre Eltern nie für sie da gewesen. Ihre Mutter hatte wie eine Besessene gearbeitet, und ihr Vater war ebenfalls ein Workaholic gewesen, was beiden recht gut gefallen hatte. Sie hatten sich scheiden lassen, als Taylor elf Jahre alt war. Anschließend war sie in ein Internat gesteckt worden und hatte ihre Sommerferien in Ferienlagern verbracht.
Das Ende der Kindheit. Es begann die Jugend und die enge Freundschaft zwischen ihr und Steph.
Das Leben ihrer Cousine war fast ebenso verlaufen wie ihres. Kein Wunder, da die Brüder, Anderson und Frederick Halstead, sich in charakterlicher Hinsicht stark ähnelten. Sie waren beide ehrgeizig und egozentrisch. Steph war in einem palastartigen Herrenhaus in Bronxville, New York, aufgewachsen, wo ihre Eltern noch immer lebten, wenn sie sich nicht gerade im Ausland aufhielten. Wahrscheinlich hatte die Ehe nur deshalb gehalten, weil keiner von beiden Lust gehabt hatte, sich dem finanziellen Ärger auszusetzen, den das Teilen ihrer Vermögenswerte mit sich gebracht hätte.
Die beiden Familien waren nicht oft zusammengekommen, als Taylor und Steph Kinder waren, obwohl beide Einzelkinder und gleichaltrig waren und die Fahrt von Bronxville nach Manhattan keine Stunde dauerte. Dennoch hatten die beiden Mädchen sich während dieser sporadischen Familientreffen angefreundet. Sie zogen sich gegenseitig damit auf, eine Stadtmaus beziehungsweise Landmaus zu sein, und dabei kehrten beide nicht gern nach Hause zurück.
Ihre Freundschaft war wirklich das Beste, was ihre Kindheit ihnen bescherte. Als ihre Eltern beschlossen, sie ins selbe Internat zu stecken, sahen sie es als Chance, ihre Freundschaft zu festigen und vielleicht sogar jetzt die Schwester zu bekommen, die sie nie gehabt hatten. Es war einfach so, dass sie beide etwas Verlässliches in ihrem Leben brauchten.
Und in Stephs Fall war auch eine gewisse Stabilität vonnöten.
Steph, die in emotionaler Hinsicht sehr labil war, hungerte stets nach Aufmerksamkeit. Immer auf der Suche nach irgendetwas, das die Leere füllte, war sie impulsiv und wild, und ihr Leben wurde von zahlreichen Höhen und Tiefen erschüttert – Charakterzüge, die sich im Laufe der Jahre noch zu verstärken schienen. Taylor hatte oft Mühe, mit den Gefühlsschwankungen ihrer Cousine Schritt zu halten. Stephs umwerfende Schönheit half ihr nicht, sondern sorgte lediglich dafür, dass sie sich ständig mit den falschen Leuten einließ und in Schwierigkeiten geriet. Und Taylor war immer da, um ihr aus der Patsche zu helfen. Seltsamerweise hatte sie mitunter das Gefühl, Steph wäre ein Papierdrache und sie würde die Leinen festhalten und ihre Cousine immer wieder in sichere Gefilde ziehen.
Stephs einziges heilsames Ventil war die Schauspielerei.
Sie hatte Schauspielerin werden wollen, seit sie im vierten Schuljahr Pippi Langstrumpf gespielt hatte. »Es ist nicht nur, weil ich rote Haare habe«, vertraute sie Taylor damals an. »Sondern weil ich gut bin. Ehrlich, Taylor, es ist, als würde ich mich in Pippi verwandeln. Es ist schwer zu erklären, aber wenn ich oben auf der Bühne stehe, tritt alles andere in den Hintergrund.«
Taylor verstand das besser, als Steph glaubte. Das Bedürfnis zu fliehen war ebenso charakteristisch für sie wie ihr rotes Haar.
Stephs starke Motivation war die eine Sache, doch sie hatte tatsächlich Talent. Taylor hatte im Internat miterlebt, wie ihre Cousine in jedem Stück die Hauptrolle ergattert und sich in jede Figur verwandelt hatte, die sie spielte. Nach dem Abitur hatte sie an der New Yorker Universität, Tisch School of the Arts, studiert. Sie war besessen davon, Broadwaystar zu werden, und sie hätte es bestimmt geschafft, wenn ihr Leben nicht so abrupt beendet worden wäre.
Seufzend sank Taylor tiefer in den Sessel, während sie auf Dr. Phillips wartete. Sie schaute aus dem Fenster des geschmackvoll ausgestatteten Büros auf die Schneeflocken, die durch die Luft tänzelten – winzige weiße Flecke vor dem dunklen Abendhimmel – und auf die Pendler, die zum Grand Central eilten, als die Rushhour ihren Höhepunkt erreichte. Sie fühlte Wehmut in sich aufsteigen. In der Vergangenheit hatte auch sie diese Energie besessen. Im Augenblick brachte sie jedoch höchstens Energie für ihre Schüler und die Hörer ihrer Radiosendung auf. Wenn es um ihr eigenes Leben ging, trat sie auf der Stelle.
»Hallo, Taylor. Tut mir leid, dass Sie warten mussten.« Dr. Eve Phillips schlenderte in einem eleganten beigefarbenen Kostüm herein. Sie lächelte Taylor freundlich an, als sie zu ihrem Schreibtisch ging und Taylors Akte aufschlug. Die erstklassige Therapeutin konnte eine lange, beeindruckende Patientenliste vorweisen. Das war keine Überraschung, denn Taylors Vater hatte sie ausgewählt, und Anderson Halstead wählte immer nur die Besten aus.
Taylor hatte nicht vorgehabt, gemeinsam mit ihrem Vater einen Therapeuten auszusuchen oder ihm überhaupt zu sagen, dass sie eine Therapie machen wollte. Aber wie es der Zufall wollte, war er vorbeigekommen, um mit ihr über Stephs Nachlass zu sprechen, und hatte Taylor in einem schwachen Augenblick erwischt. Ihre Stimme hatte gebebt, und sie war so unkonzentriert gewesen, dass sie dem Gespräch kaum hatte folgen können. Selbstverständlich hatte sie versucht, sich zusammenzureißen. Es war undenkbar, vor ihrem Vater zusammenzubrechen, aber er hatte ein feines Gespür. Er bedrängte sie, bis sie zugab, dass sie ihr seelisches Gleichgewicht noch immer nicht wiedergefunden hatte.
Ihr Vater war schier außer sich geraten und hatte darauf bestanden, den besten Psychiater in ganz New York für sie zu suchen und die Sitzungen zu bezahlen. Taylor hatte nicht die Kraft gehabt, mit ihrem Vater zu streiten.
Und jetzt saß sie hier.
»Kein Problem«, beteuerte sie. »Ich war zu früh hier und war froh, dass ich noch fünf Minuten für mich hatte.«
Dr. Phillips setzte sich auf die Schreibtischkante und nickte. »Sie sehen müde aus. Hatten Sie eine schlimme Nacht?«
»Das ist untertrieben.« Taylor stand auf, massierte sich den Nacken und ging zu dem cremefarbenen Sofa, auf dem sie während der Sitzungen gerne saß. »Ich fühle mich, als hätte ich ein Zugunglück überlebt.«
»Immer noch Albträume?«
Taylor nickte.
»Hat sich irgendetwas verändert?« Dr. Phillips sprach ganz offen mit Taylor. Sie wusste, dass ihre Patientin staatlich geprüfte Familientherapeutin war. Es war zwecklos, die üblichen Techniken anzuwenden, da ihre Patientin diese sofort durchschaut hätte.
»Nein, es hat sich nichts geändert, nur dass die Albträume noch schlimmer geworden sind.« Taylor schlug seufzend die Beine übereinander. »Ich höre Steph noch immer schreien. Ich versuche, sie zu retten, aber etwas drückt mich herunter und hindert mich daran.«
»Etwas oder jemand?«
»Es war auf jeden Fall Gordon, entweder symbolisch oder in persona. Er ist Schuld daran, dass ich Steph nicht rechtzeitig erreichen konnte.« Taylor wandte der Therapeutin das Gesicht zu. »Es gibt einen Grund, warum der Albtraum in der letzten Nacht so scheußlich war. Ich habe nämlich eine Kopie des Unfallabschlussberichtes erhalten. Detective Hadman hat ihn mir gefaxt.«
»Ach ja?« Eve Phillips stützte ihr Kinn auf die Hand. »Und was steht in dem Bericht?«
»Genau das, was die Küstenwache vermutete: Bei ihren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um keinen Terroranschlag handelte, sondern um einen Defekt der Ventilatoren im Kielraum. Gordons neue Jacht war ebenso protzig und außergewöhnlich wie er selbst – eine siebzig Fuß lange Hatteras, die mit Benzin betrieben wurde. Benzin ist schnell entflammbar, viel schneller als Diesel. Durch den Defekt sammelten sich Benzingase, und als der Motor gestartet wurde, explodierte die Jacht.« Taylors Stimme bebte, doch sie wandte ihren Blick nicht von der Therapeutin ab. »Jetzt werden Sie mich sicher fragen, ob dieser Bericht mir geholfen habe, eine Art Schlussstrich zu ziehen. Das muss ich leider verneinen. Mir ging es nie um die Frage, wie es passiert ist, sondern warum.«
Dr. Phillips runzelte die Stirn. »Ehrlich gesagt hatte ich auch nie angenommen, dass Ihnen ein Stück Papier mit technischen Details helfen würde, einen Schlussstrich zu ziehen. Ihre Cousine ist tot, und Sie fühlen sich dafür verantwortlich. Zudem haben Sie Angst und verspüren Ohnmacht und Wut. All diese Gefühle sind auf ein und dieselbe Person gerichtet: Gordon Mallory. Unglücklicherweise ist er nicht greifbar, sodass Sie Ihre Wut nicht an ihm auslassen könnten.«
»Warum habe ich dann das Gefühl, er wäre irgendwo in meiner Nähe?«, fragte Taylor hilflos.
»Aus demselben Grund, der Sie daran hindert, Stephanies Tod zu überwinden: Weil es keine Leichen gibt. Wenn es sie gäbe, wären Sie gezwungen, die Tatsachen zu akzeptieren, und in der Lage, den Schock zu verarbeiten. Und in Gordons Fall würden Sie vermutlich auch Erleichterung verspüren. Er hat versucht, Sie zu vergewaltigen, Taylor. Obwohl er Sie letztendlich nicht vergewaltigt hat, hat er Ihnen Gewalt angetan. Ja, er war indirekt für den Tod Ihrer Cousine verantwortlich. Aber es geht nicht nur um Ihre Cousine. Es geht um Sie. Gordon Mallory hat versucht, Sie zu vergewaltigen. Sie haben das Recht, wütend zu sein, weil er Ihnen das angetan hat, und nicht nur, weil Stephanie der Schiffsexplosion zum Opfer gefallen ist.«
»Ich weiß«, erwiderte Taylor leise. »Und das bin ich auch. Ich durchlebe immer wieder die Geschehnisse, die sich an jenem Tag in meinem Schlafzimmer zugetragen haben. Er war nicht lange da, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Es war ein entsetzliches Gefühl, ihm hilflos ausgeliefert zu sein. Ich konnte nichts tun, um ihm Einhalt zu gebieten. Wenn Steph nicht aufgetaucht wäre, hätte er mich vergewaltigt.« Es folgte eine schmerzliche Pause. »Wäre er andererseits geblieben und hätte sein Ziel erreicht, hätte er vielleicht die Jacht verpasst und Steph würde noch leben.« Taylor verstummte.
»Wahrscheinlicher ist wohl, dass er Sie als körperliches und psychisches Wrack zurückgelassen und die Jacht dann eine Stunde später bestiegen hätte«, erwiderte Dr. Phillips ruhig. »Dann wären Sie in einer noch schlimmeren Verfassung als jetzt, und Steph wäre dennoch ums Leben gekommen.«
Taylor kniff die Augen zusammen. Sie wusste, dass Dr. Phillips Recht hatte. »Ich habe das Gefühl, als wäre er ein Geist, der mich unaufhörlich quält«, flüsterte sie. »Darum habe ich Erkundigungen eingezogen. Ich wollte irgendetwas über ihn in der Hand haben, aber ich habe nichts gefunden, was mir geholfen hätte.«
Nur eine für den National Enquirer erstellte Kurzbiografie.
Gordon Mallory war in einem herrschaftlichen Anwesen in East Hampton, Long Island, aufgewachsen, einem Anwesen, das einem millionenschweren Investmentbanker namens Douglas Berkley gehörte. Seine Mutter, die mittlerweile verstorbene Belinda Mallory, war Hausangestellte bei den Berkleys gewesen, und sein Zwillingsbruder, Jonathan, war ein erstklassiger Wirtschaftsberater – kein Wunder, denn Douglas Berkley hatte alle Unkosten für die Ausbildung der Zwillingsbrüder übernommen, obwohl er nicht ihr Vater war. Gordon hatte an der Harvard University Betriebswirtschaft und an der Princeton University Naturwissenschaften studiert. Jonathan hatte an der London School of Economics promoviert. Schließlich wurde Gordon Investmentbanker und Jonathan Wirtschaftsberater.
Eine Biografie, die zwangsläufig zu Gerede hatte führen müssen. Doch Taylor ging es nicht um das Gerede der Leute oder um Gerüchte. Sie suchte nach … Im Grunde wusste sie es gar nicht genau. Frühere Anzeigen gegen ihn. Beweise, dass er in der Vergangenheit gewalttätig geworden war oder bereits andere Frauen sexuell belästigt hatte. Nichts.
Sie hatte nichts dergleichen gefunden.
Das hätte ihr vielleicht Erleichterung verschafft.
Taylor hatte bei ihrer Recherche nur Fakten aufgedeckt. Eine Biografie drang nicht in die Psyche eines Menschen ein und erforschte nicht die Auswirkungen von Ereignissen, die sich in der Kindheit zugetragen hatten. Das wusste niemand besser als Taylor. Die Kinder, die sie täglich in ihrem Büro zu sehen bekam, waren der lebende Beweis dafür. Biografien berührten keine Gefühle. Sie beschrieben nicht die mentale Verfassung eines Menschen – oder falls doch, dann erst, wenn sein Geisteszustand ihn dazu trieb, kriminelle Handlungen zu begehen, die zudem dokumentiert sein mussten.
Taylor hatte das Bedürfnis, sich ein umfassendes und objektives Bild von Gordon Mallory machen zu können. Vielleicht würde sie dieses Kapitel dann abschließen können.
Gespräche mit Gordons Kollegen hatten sie ebenfalls nicht weitergebracht. Er war ehrgeizig gewesen und hatte sich seinen Weg an die Spitze mit Überschallgeschwindigkeit gebahnt. Er hatte gut aussehende Frauen und schnelle Autos gemocht und war gerne Risiken eingegangen. Enge Freunde? Negativ. Geschäftsfreunde? Offenbar keine. Nur eine Horde Bekannter, die von Monat zu Monat wechselten.
Als Taylor sich keinen anderen Rat mehr wusste, war sie nach East Hampton gefahren und hatte versucht, mit Douglas Berkley und seiner Frau Adrienne zu sprechen, nachdem sie von der Totenfeier im privaten Kreis gelesen hatte, die die Berkleys für Gordon abgehalten hatten. Sie hatte dem Butler ihren Namen genannt und erklärt, dass ihre Cousine Stephanie zu den Opfern der Schiffsexplosion gehört habe, und gebeten, ein paar Minuten mit Berkley sprechen zu dürfen. Doch der Butler hatte nur den Kopf geschüttelt und ihr mitgeteilt, dass die Berkleys niemanden in dieser Angelegenheit empfangen würden. Dann hatte er ihr sein Mitleid ausgesprochen und ihr einen guten Tag gewünscht.
Wieder eine Sackgasse.
Taylor spielte schon mit dem Gedanken, ihre Recherchen auf Jonathan Mallory auszudehnen und zu versuchen, im Internet etwas über ihn und seine in Manhattan ansässige Wirtschaftsberatung herauszufinden, als sie auf einen archivierten Zeitungsartikel stieß, in dem stand, dass Gordon und Jonathan eineiige Zwillinge waren. Allein der Gedanke, einem Spiegelbild von Gordon zu begegnen, war mehr, als sie ertragen konnte. Zudem hatten die Brüder sich ihrer Kenntnis nach in vollkommen anderen Kreisen bewegt, sodass sie nicht einmal sicher sein konnte, ob sie miteinander in Kontakt gestanden hatten. Und selbst wenn dies der Fall gewesen wäre und sie die Kraft aufgebracht hätte, Jonathan Mallory zu treffen, was hätte sie ihn dann fragen sollen? Verzeihung, aber war Ihr Bruder jemals aggressiv oder labil? Das wäre sicherlich nicht besonders gut angekommen. Jonathan hätte sie sofort aus seinem todschicken Büro im Chrysler Building geworfen.
Aber was konnte sie sonst noch tun?
Der Drang, mehr über Gordon zu erfahren, wurde allmählich zum Zwang. Das war nicht gut für ihre Psyche, und das wusste sie genau. Taylor hatte es bei anderen gesehen.
Aber wie konnte sie Dr. Phillips oder überhaupt jemandem erklären, welch einen starken Eindruck Gordons letzte Worte bei ihr hinterlassen hatten? Es war schon schlimm genug, dass sie ihn noch immer vor sich sah, noch immer seine Scotchfahne roch und seine Hände auf ihrem Körper spürte. Aber diese Worte, die Art, wie er sie ausgesprochen hatte, der bedrohliche Ausdruck in seinen dunklen Augen, als er gesagt hatte, dass er sie beobachten würde, diese Worte verfolgten sie von früh bis spät und selbst, wenn sie schlief. Manchmal ertappte sie sich sogar dabei, einen Blick über die Schulter zu werfen, als könne er dort irgendwo sein und sie beobachten, so wie er ihr gedroht hatte.
Natürlich war das unmöglich.
»Taylor.« Dr. Phillips’ Stimme holte sie in die Gegenwart zurück. Sie musterte Taylor mit einem wissenden Blick. »Nächste Woche ist Weihnachten. Was haben Sie für Pläne?«
Weihnachten? Ein seltsamer Gedanke. »Nichts Besonderes.«
Die Therapeutin seufzte. »Hören Sie, ich weiß, mit welchem Engagement Sie Ihre beiden Jobs ausüben. Aber wie alle Schulen wird auch Ihre bis Mitte Januar schließen. Darum werden Sie keine Schüler beraten müssen. Und was Ihre Radiosendung betrifft, so bin ich sicher, dass der Sender ein paar Tage ohne Sie auskommen wird. Warum verbringen Sie nicht ein paar Tage mit Ihrer Familie?«
Ihre Familie. Bei diesem Wort verspürte Taylor das übliche Zwicken in der Magengegend. Ihre Mutter »beging« Weihnachten nicht. Sie verbrachte die Feiertage auf der Canyon Ranch in Massachusetts, um sich zu regenerieren. Ihr Vater war wie immer auf Geschäftsreise – diesmal in London. Ihr Onkel hielt sich irgendwo in Japan auf, um eine große Firmenfusion zum Abschluss zu bringen; und ihre Tante, die ein Reisebüro betrieb, das höchsten Ansprüchen genügte und das sich hauptsächlich an die Anwohner der Park Avenue wandte, war in Acapulco, um dort ein neues Urlaubsdomizil zu besichtigen und zu testen – natürlich für ihre Kunden.
Nein. Weihnachten im Kreise der Familie stand nicht zur Debatte, selbst unter anderen Umständen nicht. Und in diesem Jahr war es das Letzte, was Taylor sich wünschte.
»Eine gute Idee, Dr. Phillips«, sagte sie. »Aber ich brauche Zeit für mich. Und das nicht nur, um nachzudenken und um mich zu entspannen. Es ist anstrengend, von einem Job zum anderen zu hetzen. Ich freue mich darauf, ausschlafen zu können, ein bisschen zu lesen, wozu ich sonst nicht komme, und vor und nach meiner Sendung etwas Zeit mit meinen Kollegen vom Radiosender zu verbringen. Außerdem werden die Hörer in dieser Woche zuhauf anrufen. Sie wissen besser als jeder andere, dass viele Menschen gerade an den Feiertagen an schweren Depressionen leiden.«
»Das weiß ich in der Tat.« Dr. Phillips nickte betrübt. »Ich werde auch fast die ganze Woche Sitzungen abhalten. Ich nehme mir nur den Vierundzwanzigsten und den Fünfundzwanzigsten frei.« Sie schaute Taylor fragend an. »Dann können wir unseren üblichen Donnerstagtermin wahrnehmen, wenn Sie möchten.« Nachdem Taylor zustimmend genickt hatte, fügte die Therapeutin hinzu: »Ich werde Ihnen ein Stück von meinem berühmten Bananen-Walnuss-Brot mitbringen. Ach was, ich werde Ihnen ein ganzes Brot mitbringen; das können Sie dann mit zum Sender nehmen. Ich backe einmal im Jahr, und zwar in der Weihnachtszeit. Das Problem ist, dass ich dann zu maßlosen Übertreibungen neige. Meine Familie beklagt sich immer, sie könne sich bis Mitte Januar kaum bewegen. Sie würden meiner Familie also einen großen Gefallen erweisen, wenn Sie das Brot annehmen.«
Taylor lächelte verhalten. »Sie brauchen mich nicht zu überreden. Ich nehme es gerne an. Meine WVNY-Kollegen essen wie die Scheunendrescher. Sie schlingen alles in sich hinein, was sich nicht bewegt. Sie werden begeistert sein.«
»Es ist eine kleine Truppe, die fest zusammenhält, nicht wahr? Sind Sie mit Ihren Kollegen auch befreundet?«
Man konnte in der Tat behaupten, dass die Truppe bei WVNY fest zusammenhielt. In den letzten Monaten waren die Kollegen Taylors Lebensretter gewesen. Nein, sie hatten sich nicht wie alle anderen, die sie kannte, aufgedrängt und sie nicht mit Beileidsbekundungen überhäuft. Sie hatten ihr keine Blumen geschickt, ihr keine Geschenke gemacht, keine Kuchen gebacken. Sie hatten ihr nur über den Arm gestrichen oder leise ihr Beileid bekundet oder angeboten, für sie einzuspringen, oder ihr ein Sandwich oder eine Tasse Kaffee gebracht – alles kleine Aufmerksamkeiten, die aber von Herzen kamen.
Die Kollegen waren alle vollkommen unterschiedliche Menschen. Sie hatten alle einen anderen Werdegang hinter sich und andere Charaktere. Natürlich moderierten sie auch andere Sendungen – von Bills Sports Talk, der auf ein männliches Publikum ausgerichtet war, bis hin zu Taylors eigenem Teen Talk, einer Beratungssendung für die ganze Familie, in der es vorwiegend um Probleme Jugendlicher ging, die ebenso wie ihre Eltern während der Sendung anrufen konnten, und die werktags von zwanzig bis zweiundzwanzig Uhr ausgestrahlt wurde. Egal, welche Jobs die Kollegen auch machten, es kümmerte sich einer um den anderen.
»Ja, die Truppe hält zusammen«, gab Taylor zu. »Wir sind eine kleine Radiofamilie.«
»Schön. Dann treffen Sie sich doch mit einigen Kollegen außerhalb der Arbeit«, schlug Dr. Phillips vor. »Vielleicht sogar Weihnachten. Es ist schön, wenn man Zeit allein verbringt. Zu viel Zeit allein ist aber auch nicht gut.«
»Schon verstanden. Das war klar und deutlich.«
Das war es in der Tat.
Taylor hatte zwar Freunde, aber keine engen Freunde. Mit Ausnahme von Steph lebte sie ihre Beziehungen mit einer gewissen Distanz. Das war sicherer. Dr. Phillips teilte diese Ansicht nicht. Sie hatte Taylor ermutigt, ihre Freundschaften zu vertiefen – auch Liebesbeziehungen zu Männern. Schön. Vielleicht eines Tages, falls sie den Richtigen traf. Aber bisher war der Richtige noch nicht aufgetaucht. Daher verließ sie sich am liebsten auf eine Person: auf sich selbst.
»Taylor.« Dr. Phillips riss sie aus ihren Gedanken.
»Okay, okay. Während der Feiertage werde ich so kontaktfreudig sein wie nie zuvor.« Taylor bemühte sich um einen lockeren Ton. Sie wusste jedoch, dass sie Dr. Phillips’ Ratschlag, den Weihnachtstag mit anderen zu verbringen, nicht aufgreifen würde, und sie wusste auch, dass die Therapeutin es ebenfalls wusste. Sie würde den Tag ruhig verbringen. Sie würde ihn allein verleben und versuchen, Ordnung in ihr Gefühlschaos und in ihr Leben zu bringen. Außerdem wollte sie einen Stapel Wohnungsangebote unter die Lupe nehmen. Das wäre der erste Schritt. Es wurde Zeit, dass sie sich eine kleinere Wohnung suchte und endlich aufhörte, sich permanent im Kreis zu drehen. Zeit, endlich etwas zu tun, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.
Weihnachten. Tage des Friedens. Vielleicht bescherten die Feiertage auch ihr ein wenig Seelenfrieden.
Das taten sie jedoch nicht.
Am Weihnachtsmorgen wachte Taylor auf, schaltete den Computer ein, um die neuesten Wohnungsangebote zu überprüfen, und stellte fest, dass sie eine elektronische Grußkarte erhalten hatte. Es war eine Weihnachtskarte mit rieselndem Schnee, einem Schornstein aus Ziegelsteinen und einem im Schatten stehenden Weihnachtsmann, der sich anschickte, durch den Schornstein ins Haus zu klettern.
Gleichzeitig ertönten aus den Lautsprechern die fröhlichen Klänge des Liedes: »Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt«. Während die Melodie erklang, wurden die ersten vier Zeilen des Liedtextes nacheinander auf dem Bildschirm sichtbar:
Er sieht dich, wenn du schläfst,Er weiß, wann du erwachst,Er weiß, ob du artig oder böse warst,Und darum musst du immer artig sein.
Darunter stand eine persönliche Mitteilung:
Wie der Weihnachtsmann, so werde auch ich dich beobachten.
Keine Unterschrift.
4. Kapitel
Taylor erstarrte.
Als Erstes kontaktierte sie den Anbieter dieser elektronischen Grußkarte. Auf jeden Fall versuchte sie es. Es meldete sich jedoch nur eine aufgezeichnete Ansage, die ihr fröhliche Weihnachten wünschte und sie bat, morgen noch einmal anzurufen.
Das tat sie, auch wenn es sie letztendlich nicht weiterbrachte.
Die Mitarbeiterin der Kundenbetreuung erklärte ihr, dass sie grundsätzlich nur die Angaben hätten, die die Absender ihnen angeben würden – Namen und E-Mail-Adresse für gewöhlich –, und in diesem Fall hatte derjenige, der Taylor die elektronische Karte geschickt hatte, als Absender und Adresse Taylors E-Mail-Adresse angegeben. Mehr konnte ihr die Kundenbetreuerin nicht sagen.
Kurzum – die Karte war nicht zurückzuverfolgen. Es gab also keine Möglichkeit, sie mit Gordon in Verbindung zu bringen.
Das spielte jedoch keine Rolle. Taylor fühlte, dass er die Karte geschickt hatte, und der bloße Gedanke daran rief Übelkeit in ihr hervor. Denn das bedeutete, dass seine Wollust an jenem Nachmittag, als er sie überwältigt hatte, nicht aus einer Laune des Augenblicks entstanden war. Das bedeutete, er hatte es geplant und dafür gesorgt, dass diese Visitenkarte von ihm folgte. Er hatte dieser nur in seiner Phantasie bestehenden Beziehung viel mehr Platz eingeräumt, als Taylor geahnt hatte.