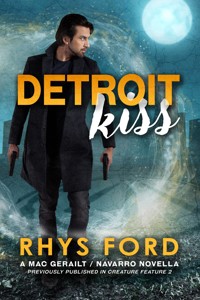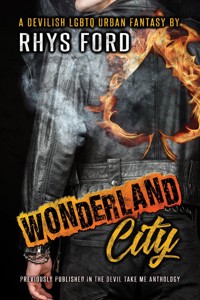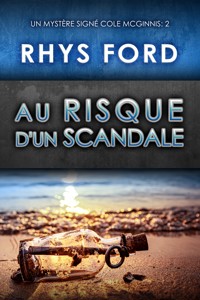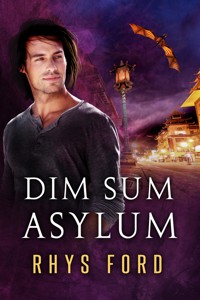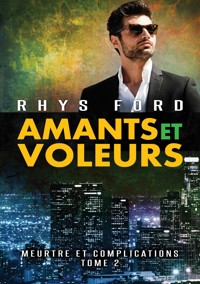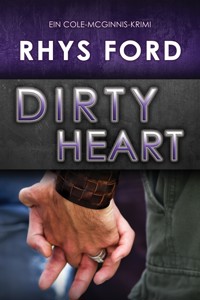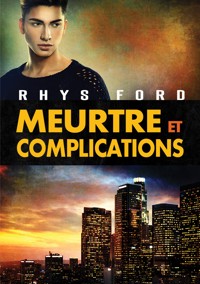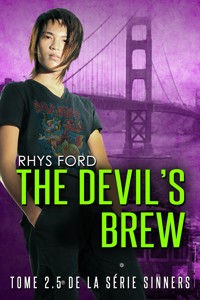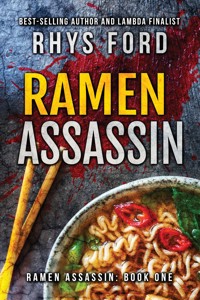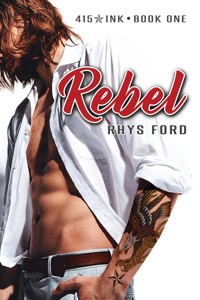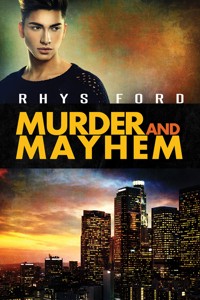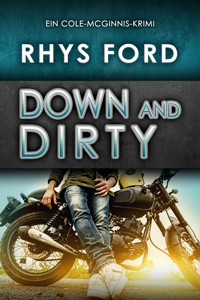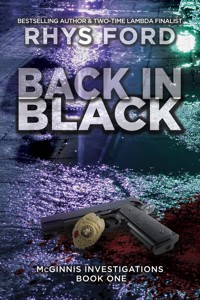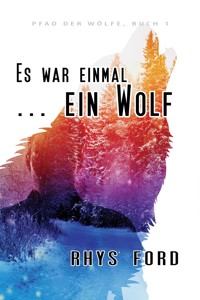Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: DSP Publications
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Buch 1 in der Serie - Ink and Shadows Kismet Andreas lebt in Angst vor den Schatten. Für den jungen Tattookünstler bedeuten sie mehr als nur Dunkelheit. Er hält sich für verrückt, weil er darin Kreaturen und kriechende Dinge sieht – Monster, die die Schwachen jagen, um ihren Verstand und ihre Seelen zu fressen, und nichts als leere Hüllen der Verzweiflung zurücklassen. Kismet fürchtet nichts mehr, als ebenfalls auf diese Weise in den Wahnsinn getrieben zu werden. Die schattenhafte Welt der Grenze ist Colms Zuhause. Als Pestilenz ist er der jüngste und unerfahrenste der apokalyptischen Reiter – wiederauferstandene Menschen, die nun als Unsterbliche der Menschheit dienen und sie zugleich eindämmen. Nur sichtbar für die Toten oder Wahnsinnigen existieren sie zwischen der Welt der Sterblichen und der Grenzwelt, an ihr nahezu ewiges Schicksal gebunden. Da selbst andere Unsterbliche sie fürchten, leben die vier Reiter größtenteils isoliert. Doch Colm möchte mehr kennenlernen als Tod, Krieg und Hunger. Colm möchte … menschlicher sein und nicht nur mit Wahnsinnigen und Toten zu tun haben. Als Kismet Colm vor einem Angriff aus den Schatten rettet, findet Pestilenz sich plötzlich in einer heftigen Auseinandersetzung wieder, bei der die Menschheit auf dem Spiel steht. Kismet allein hat Vertrauen zu ihm, obwohl die anderen Reiter den Tod des Menschen voraussehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Zusammenfassung
Widmung
Danksagung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mehr Bücher von Rhys Ford
Biographie
Von Rhys Ford
Besuchen Sie Dreamspinner Press
Copyright
Dunkle Schatten
Von Rhys Ford
Buch 1 in der Serie – Ink and Shadows
Kismet Andreas lebt in Angst vor den Schatten.
Für den jungen Tattookünstler bedeuten sie mehr als nur Dunkelheit. Er hält sich für verrückt, weil er darin Kreaturen und kriechende Dinge sieht – Monster, die die Schwachen jagen, um ihren Verstand und ihre Seelen zu fressen, und nichts als leere Hüllen der Verzweiflung zurücklassen.
Kismet fürchtet nichts mehr, als ebenfalls auf diese Weise in den Wahnsinn getrieben zu werden.
Die schattenhafte Welt der Grenze ist Colms Zuhause. Als Pestilenz ist er der jüngste und unerfahrenste der apokalyptischen Reiter – wiederauferstandene Menschen, die nun als Unsterbliche der Menschheit dienen und sie zugleich eindämmen. Nur sichtbar für die Toten oder Wahnsinnigen existieren sie zwischen der Welt der Sterblichen und der Grenzwelt, an ihr nahezu ewiges Schicksal gebunden. Da selbst andere Unsterbliche sie fürchten, leben die vier Reiter größtenteils isoliert. Doch Colm möchte mehr kennenlernen als Tod, Krieg und Hunger.
Colm möchte … menschlicher sein und nicht nur mit Wahnsinnigen und Toten zu tun haben.
Als Kismet Colm vor einem Angriff aus den Schatten rettet, findet Pestilenz sich plötzlich in einer heftigen Auseinandersetzung wieder, bei der die Menschheit auf dem Spiel steht. Kismet allein hat Vertrauen zu ihm, obwohl die anderen Reiter den Tod des Menschen voraussehen.
Ich widme die vier … den fünfen, Z.A. Maxfield und LE Franks.
Den fünfen, weil sie die Grundlage für jedes meiner Werke sind.
ZAM, die von ihrer Liebe zu mir überzeugt ist.
Und LE, weil sie offenbar an den Pixeln geleckt und die Geschichte für sich beansprucht hat.
Danksagung
FÜR DIE fünf, die alles sind – von Drache bis Ratte: Penn, Lea, Tamm und Jenn. Und für meine Hanai-Schwestern: Ren, Ree und Lisa.
Ich kann mich niemals genug bei Elizabeth North und dem Rest der Dreamspinner Press bedanken. Alles Gute ist mir nur ihretwegen widerfahren. Grace und ihrem Team bin ich unendlich dankbar, dass sie eine mitgenommene einäugige Katze wie mich auf den rechten Weg gelenkt haben.
Mein Dank gilt außerdem meinen Test-Lesern und den Dirty Ford Guinea Pigs, die sich SOOOOO viel Unsinn und Gejammer und „verdammt, lest das doch nicht, ich habe eine andere Idee“ von mir anhören mussten. Geduld ohne Ende.
Und zu guter Letzt wären da noch sämtliche Künstler in meiner Musiksammlung. Gott, danke für die Gesellschaft.
1
WÄHREND ER sich eine reife Orange aus der Obstschale nahm, schob Tod sich weiter auf die Arbeitsplatte, deren kalten Marmor er selbst durch den dicken Stoff der tief sitzenden Baumwollhose spürte, in die er nach seinem Training geschlüpft war.
Die Stille ihres Penthouse war von jaulender, hämmernder Musik durchbrochen worden, was Tod allerdings nicht störte. Es war gut, Colm bei ihnen zu haben, weshalb Tod ihrem Jüngsten bereitwillig einiges nachsah. Neu in der Rolle der Pestilenz, brachte er eine Jugendlichkeit in das Quartett, die seit langem gefehlt hatte – auch wenn die anderen zwei es nicht ganz so positiv sahen wie Tod. Zumindest hatten diesmal nicht die Fenster gebebt. Vor kurzem hatten sie sogar einen Spiegel ersetzen müssen, der Colms Musik zum Opfer gefallen war.
Als sich der älteste apokalyptische Reiter vorbeugte, verdeckte sein tintenschwarzes Haar sein kantiges Kinn und fiel beinahe bis über seine hohen Wangenknochen. Hinter ihm leuchtete San Diego in der untergehenden Sonne, kämpfte gegen die Nacht an, die bereits am Horizont herankroch.
Mit dem Fingernagel ritzte Tod die mit winzigen Dellen übersäte Orangenschale an und atmete den stechenden Geruch des Zitrusöls ein, bevor er den Nagel vorsichtig etwas tiefer schob, um die Schale zu durchbrechen. Die Frucht lag noch unbeschädigt unter ihrer leuchtenden Hülle, scheinbar immun gegen die Finger des Unsterblichen. Links vom Küchenbereich öffnete sich eine Tür, durch die gleich darauf Ari frisch geduscht in den gemeinsamen Wohnraum trat.
An einer Stelle seines Brustkorbs war eine Erhebung zu sehen – eine auf gebräunter Haut erblühende Narbe, die wie eine strahlende Sonne unter dem Handtuch hervorbrach und Tod von seiner Orange und seinem neuen Problem ablenkte. Kriegs Narbe war ihm so vertraut wie seine eigene, jedoch wesentlich faszinierender. Mit ihren sich vom Zentrum ausbreitenden feinen Linien regte sie noch immer seine Fantasie an. Seiner eigenen Narbe – ein schmaler Streifen unterhalb seines linken Auges, der sich bis über seinen Nasenrücken zog – schenkte er weit weniger Beachtung.
Tod fragte sich, ob die Narben mit ihrem Ableben zu tun hatten. Er gestattete sich nur selten, über die genaue Herkunft der vier Reiter nachzudenken, und fand auch diesmal keine Antwort. Pestilenz, ihr neuestes Mitglied, besaß keine Narben. Dass ironischerweise gerade Pestilenz an einer Krankheit gestorben zu sein schien, war ein amüsanter Gedanke. Mins flachen Bauch zierte ein heller Halbmond zwischen ihren Hüftknochen, beinahe ein Fingerbreit vernarbter Haut.
„Oh, wir sind allein. Na gut, vielleicht nicht ganz allein, aber solange Bazille in seinem Zimmer bleibt, sind wir allein genug. Sollen wir rummachen, ein bisschen Spaß haben?“ Aris Zähne näherten sich dem Ohr des dunkelhaarigen Mannes, um daran zu knabbern, hatten allerdings kaum das weiche Ohrläppchen berührt, als dieser sich ihm mit einem nur allzu vertrauten missbilligenden Blick entzog. Die schrägstehenden Augen warfen Ari angesichts seiner Aufdringlichkeit eine finstere Warnung zu.
„Hör auf.“ Er hatte den Blick gesenkt und seine Stimme war ein leises Flüstern, als er aus Gewohnheit den halbherzigen Protest vorbrachte. Mit einem Blick auf die widerspenstige Frucht widmete sich Tod erneut der Schale, zerdrückte dabei jedoch das Fruchtfleisch. „Ich denke nach.“
„Damit übertreibst du manchmal. Und gib die her. Ich schäl sie dir“, unterbrach er mit seiner rauen Stimme Tods Bemühungen. Mit einem abfälligen Blick auf die mitgenommene Orange streckte er die Hand nach ihr aus und zog daran, bis Tod sie losließ und seine langen Finger widerstrebend unter Aris schwieliger Hand öffnete.
Ari starrte unbeirrt in die nachdenklichen dunklen Augen, ohne sich von Tods Sturheit beeindrucken zu lassen. Tod senkte den Blick und betrachtete stattdessen das um Aris Hüften geschlungene Handtuch.
Aris flacher Bauch war nackt bis auf einen Streifen blonder Härchen, an einigen Stellen vom Wasser verdunkelt, der sich von seinem Nabel nach unten zog und unter dem Handtuch verschwand. Während er sich energisch der Orangenschale widmete, näherte sich der blonde Mann, bis seine muskulösen Oberschenkel Tods Knie einrahmten.
So standen sie in der Küche, berührten sich wie zufällig. Dennoch war Tod vorsichtig – er wusste, dass Ari sich auf das kleinste Anzeichen von Intimität stürzen und sich davon fortreißen lassen würde. Es wäre nicht Aris erster Annäherungsversuch gewesen, auch wenn er sich nach jedem Misserfolg zurückzog, seine Wunden leckte und schwor, es nie wieder zu tun, nur um dann leise fluchend einen neuen Anlauf zu wagen. Zurzeit herrschte ein seltener Waffenstillstand – Ari wartete auf eine gute Gelegenheit, während Tod es nicht zu bemerken schien.
Die Luft zwischen ihnen knisterte mit der Spannung unzähliger Auseinandersetzungen, angereichert mit der Leidenschaft des blonden Mannes, der häufig zu energisch vorging. Tod war in Aris Spielen der Gegner und gab nur weit genug nach, um Aris Appetit anzuregen.
Die Schale der Frucht löste sich unter Aris Fingern. Saft spritzte heraus.
Ari leckte das an seinem Daumen zurückgebliebene Stück weißer Haut ab und reichte Tod die Orange. Als dieser mit gerümpfter Nase die tropfende Frucht betrachtete, musste Ari grinsen.
„Du hast sie umgebracht.“ Tod zerteilte die saftige Kugel mit einem gespielt vorwurfsvollen Blick auf die durch Aris aggressive Vorgehensweise zerdrückten Zellen.
„Du gehst mit allem zu sanft um.“ Ari zog schniefend das Handtuch hoch, das von seiner Hüfte zu rutschen drohte. Der größte Teil seines Körpers war noch feucht und sein langes dunkelblondes Haar begann gerade erst an den Spitzen zu trocknen. Ari stützte sich mit den Händen auf die Marmorplatte, sodass seine Fingerspitzen Tods Knie berührten, und zog eine Augenbraue hoch. „Manchmal muss man Dinge zerreißen. Bei dir sah es aus, als würdest du niemals fertig werden.“
„Manchmal muss man es behutsam angehen“, antwortete Tod, während er ein Stück aus der Orange löste.
„Ich habe es versucht. Aber Zerreißen funktioniert besser.“
Ari drehte sich um und schaute auf die Stadt hinunter. Die Fensterfront auf der Westseite war der Innenstadt und dem Hafen zugewandt. „Die Stadt sieht heute schön aus. Es könnte sein, dass bald Nebel aufzieht.“
„Möglich“, nickte Tod.
Plötzlich flatterte ein wabernder Wraith ins Blickfeld der überraschten Reiter und warf sich gegen die Glasscheibe.
Die Augen des Geisterwesens schienen an seinem länglichen, reptilienartigen Gesicht herabzurinnen, das sich zu einer Grimasse verzog, als es ihnen lautlos zuheulte. Die fahlweiße Erscheinung presste sich dicht an das Fenster, wie um die Aufmerksamkeit der so knapp außerhalb ihrer Reichweite lebenden Männer auf sich zu ziehen. Mit einem bläulichen Schimmer verdichtete sich die Grenzwelt und der Wraith prallte zurück. Kurz wurde er in die Schatten gesogen, wo andere Kreaturen lauerten, bevor er wieder auftauchte und sich wie ein blassgrauer Nebelfetzen vor dem Himmel abzeichnete.
„Was soll das denn?“ Ari richtete sich auf und schlang einen Arm um Tods Taille, bereit, ihn von der Marmorplatte zu ziehen und in Sicherheit zu bringen. „Was zum Teufel macht das hier oben?“
„Es macht sich seit einer halben Stunde an den Fenstern zu schaffen“, antwortete Tod mit einem Schulterzucken. „Ich mache mir keine Sorgen, solange es nicht die Scheibe zerbricht.“
Das Wesen bewegte sich weiter um das Gebäude herum und schwebte auf den Teil mit Colms Fenstern zu.
Ari, durch die plötzliche Erscheinung gefährlich aufgeregt, grinste, als er den überraschten Schrei des Jüngsten hörte. Er lachte gegen Tods Schulter und warf ihm einen schelmischen Blick zu. „Bazille scheint sich erschreckt zu haben.“
In seinem Zimmer bemühte sich Colm darum, die Musik leiser zu stellen, ohne versehentlich den Bass zu verstärken und das Glas seiner Bücherregale zu beschädigen. Das flackernde Grün auf dem Display der Fernbedienung half ihm, trotz seiner verschwommenen Sicht, die richtigen Knöpfe zu finden. Als er sich die Knie am Couchtisch aufschürfte, schrie er auf und biss sich auf die Zunge. Mit den Fingern suchte er die Tischplatte nach seiner Brille ab, bis er klappernd gegen einen der Bügel stieß. Als er sie aufsetzte, konnte er endlich deutlich sehen: Ein unordentliches Zimmer voll von aufgeschlagenen Büchern und leeren Gläsern. Colm strich sich sein helles Haar aus dem Gesicht, auch wenn ihm einige Strähnen gleich wieder in die Augen fielen.
„Habt ihr das gesehen?“ Colm streckte den Kopf aus seiner Zimmertür und gestikulierte wild in Richtung seines Fensters, bis ihm klar wurde, dass die Männer nicht durch die Wand schauen konnten. „Ein Wraith. Hier oben!“
„Eins muss man dem Jungen lassen, manchmal ist er nicht ganz strohdumm.“ Ari lehnte sich mit der Hüfte gegen die Arbeitsplatte. „Aber so mutig sind sie normalerweise nicht. Das Ding sollte eigentlich nicht in der Lage sein, uns so nahe zu kommen.“
„Ja, ziemlich frech“, stimmte Tod zu, während er ein weiteres Stück von seiner Orange löste. „Vielleicht fühlt es sich hinter der Scheibe sicher? Aber warum sollte es dann versuchen, hereinzukommen?“ Tod war beunruhigt, seit er die Nachricht erhalten hatte, dass sie vier für eine Aufgabe gebraucht würden. „Ich glaube, in unserer Nähe schwächt irgendetwas die Grenze. Und ich habe Gerüchte über Vorfälle gehört …“
„Schwächt? Wie sehr?“, fragte Ari finster.
„Offenbar ist einiges durchgekommen.“ Tod sah zu, wie Colm voller Energie in den Raum kam und dem Wraith auf seinem Weg um das Penthouse folgte. „Du kannst in meine Zimmer gehen, falls er in die Richtung fliegt. Aber wenn es aussieht, als käme er durch, sag uns Bescheid. Wir kümmern uns darum.“
„Danke.“ Colm ging an Ari vorbei, ignorierte den anderen Reiter. „Ich dachte erst, er hätte mein Fenster zerbrochen, aber es hat gehalten.“
„Mach bloß kein Fenster auf!“, rief Ari dem jungen Mann hinterher, als er dem Wesen in Tods Teil des Penthouse folgte. „Ansonsten frisst ihn das Ding dann vielleicht und wir können uns eine neue Pestilenz besorgen. Zum Beispiel eine, die mit einem Schwert umgehen kann, oder so.“
„Sei nicht so gemein, Ari“, antwortete Tod. „Außerdem haben wir andere Sorgen als einen Wraith vor unseren Fenstern. Ich habe mich ein bisschen umgehört, aber nichts Konkretes herausgefunden. Nur Gerede.“
„Verrückte führen eben gern Selbstgespräche.“ Ari streckte eine Hand nach der zerdrückten Orange in Tods Hand aus. Seine Gedanken waren so verworren wie Tods die Frucht umklammernde Finger. „Jetzt bringst du sie um.“
„Ich bin der Tod. Was hast du anderes erwartet?“ Tod warf Ari einen gekränkten Blick zu, der den Blonden zum Lachen brachte, dröhnend und warm.
„Dass du sie isst. Du isst nämlich zu wenig.“
Ein Kribbeln regte sich in Aris Bauch, als er Tod ein Stück Orange hinhielt und dieser sich vorbeugte, um hineinzubeißen, wobei seine Zähne Aris Fingerspitzen streiften. Während der andere Mann das Obststück aß, leckte Ari seine Finger sauber und hoffte, daran einen Hauch von Tods Geschmack zu finden. Einen Moment lang stand die Welt für Ari still.
Nachdem er geschluckt hatte und sein Mund nicht mehr zu trocken zum Reden war, fragte Ari: „Was hast du denn genau gehört? Ist es nur das übliche Oh mein Gott, Außerirdische untersuchen die Kühe? Und von wem hast du die Informationen, von den Idioten auf der anderen Seite?“
„Diese Idioten, wie du sie nennst, sind hilfreich. Ich habe gestern Nachmittag eine Nachricht erhalten und musste erst mal darüber nachdenken.“ Die Anweisungen, die der Anführer der Reiter entgegennahm, waren ein Grund, aus dem Ari mit dieser Rolle nichts zu tun haben wollte. „Wir sollen etwas für sie herausfinden.“
„Immer wenn du so eine Nachricht kriegst, bin ich froh, dass du dich um so etwas kümmerst.“ Ari spuckte einen Orangenkern aus. „Ich hasse sie. Sie sind furchtbar kryptisch und erinnern mich daran, dass wir nur Marionetten sind. Schon beim Gedanken daran bekomme ich Gänsehaut.“
Tod zuckte mit den Schultern und zupfte einige weiße Fäden von der Frucht. „Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Und es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Dass meine Dieffenbachie Feuer fängt und in fremden Zungen redet, ist mir lieber, als wenn mein Pferd plötzlich Runen in den Boden kratzt. Das war irgendwie wesentlich verstörender.“
„Geht’s deiner Pflanze gut?“
„Ja, prima. Diesmal haben sie den Fernseher benutzt.“ Tod grinste Ari zu.
„Und was wollte das elende Ding?“
„Wie gesagt, irgendetwas hat die Grenze aus dem Gleichgewicht gebracht und einiges hat sie durchdrungen. Von unserer Seite.“ Tod lehnte sich nach hinten und stützte sich auf seine Hände, an denen noch Orangensaft klebte. „Viele Informationen konnten sie mir nicht geben. Du weißt, wie schwer ihnen der Blick in die Welt der Sterblichen fällt.“
„Allmächtig aber blind. Interessante Kombination. Schon lustig, wie sie sich immer mit ‚die Welt der Sterblichen ist uns verborgen‘ rausreden, wenn sie uns nicht genug sagen.“ Ari behielt seine Meinung über die unsichtbaren Drahtzieher selten für sich. „Wonach genau suchen wir?“
„Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Grenze ernsthaft geschwächt wurde. Möglicherweise ist etwas Großes entwischt. Vielleicht weil jemand mit Dingen herumgespielt hat, von denen er keine Ahnung hatte.“
„Ein Seher oder Magus? Die sind immer so nervig.“ Ari grübelte über die Möglichkeit der Rückkehr zu einer Zeit nach, zu der Menschen die Grenzgänger unter ihnen als selbstverständlich hingenommen hatten. „Es wäre zum Kotzen, wenn wir wieder unsere ganze Zeit damit verbringen müssten, Schatten zu jagen.“
„Mit denen würden wir fertigwerden. Mir wurde gesagt, dass Dinge aus der Grenze hervorkriechen und Menschen sie sehen und berühren können.“ Tod biss von einer weiteren Orangenspalte ab und verzog das Gesicht. „In San Diego scheint es am schlimmsten zu sein.“
„Dann sieht es so aus, als wäre hier die Quelle.“ Ari stibitzte ebenfalls ein Stück Orange und saugte das Fruchtfleisch heraus.
„Vielleicht“, antwortete Tod. „Was hier auch vor sich geht, es macht sogar die Elfen nervös. Sie wollen auf keinen Fall in der Welt der Sterblichen landen. Sie haben sich schon lange nicht mehr den Menschen gezeigt und hätten damit vermutlich Probleme. Heutzutage würden sie nicht verehrt, sondern verfolgt werden.“
„Glaubst du, irgendetwas ist ins Wasser geraten?“, fragte Ari, während er nachdenklich an seinem Handtuch zupfte. „In Montana ist doch mal die Sache mit diesem Getreidepilz passiert, der dafür gesorgt hatte, dass eine ganze Stadt unheimliche Dinge gesehen hat. Es hat Tage gedauert, bis Pestilenz … Batu … es entdeckt hat.“
„Ich weiß es nicht. Ich wünschte, wir hätten mehr Unterstützung, aber die anderen sind nicht willens, uns zu helfen. Ich habe sie gefragt.“ Tod kam Aris Gejammer über die anderen Unsterblichen mit einem Kopfschütteln zuvor und fuhr fort: „Der Fernseher hat sich heute Morgen noch einmal gemeldet, aber die Nachricht war nicht viel deutlicher.“
„Auch wenn es nichts Ernstes sein sollte, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, mal wieder rauszukommen und etwas zu erleben.“ Ari streckte sich, bis seine Wirbelsäule knackte. „Jetzt ist die passende Zeit für eine Jagd: Die Nächte sind kühl und der Mond ist nur eine schmale Sichel. Genau richtig, um Beine zu brechen und das Mark aus Knochen zu saugen.“
„Ich wollte Näheres herausfinden, aber der Erfolg hielt sich in Grenzen“, antwortete Tod, der es endlich aufgegeben hatte, an den Resten der Orange herumzuzupfen. „Die Menschen, die uns sehen können, meiden mich meistens.“
„Sterbliche.“ Ari beugte sich vor, als er diese alte Wunde in Tods Bewusstsein berührte. „Nimm dir nicht so zu Herzen, dass du nicht gern mit ihnen redest und sie nicht mit dir. Aus einem für den Festtagsbraten bestimmten Schwein macht man kein geliebtes Haustier. Außerdem ist es besser, wenn du mysteriös und unnahbar bleibst.“
Tod schnaubte. „Wir sind, was wir sind.“
„Stimmt, aber du schleichst herum, gespenstisch und schattenhaft – das beeindruckt die Leute. Ich dagegen stampfe, fluche und hure mich durch die Welt. Nicht besonders geheimnisvoll.“ Ari schenkte seinem ältesten Freund ein breites Grinsen. „Aber Stampfen und Fluchen gefällt mir.“
„Und das Huren auch“, fügte Tod hinzu.
„Stimmt, das macht ziemlich viel Spaß“, gab Ari zu. „Aber ich ziehe mich jetzt lieber an, damit wir ein paar Häschen jagen können.“
„Das geht nicht.“
Der Schmerz in Tods Blick ließ Ari innehalten. Hinter den zimtfarbenen Augen schien ein Feuer zu brennen.
„Ich werde in Asien gebraucht.“
„Du musst dich um Seelen kümmern?“ Ari neigte den Kopf und näherte sich wieder. Er wusste, was Tod dabei erwartete, dachte allerdings nur ungern darüber nach. Zu viele widersprüchliche Gefühle waren damit verbunden. „Kein guter Zeitpunkt, wenn wir mit dieser anderen Sache fertigwerden müssen.“
Ari sehnte sich danach, Tods Gesicht zu berühren, die kräftigen Knochen mit seiner Handfläche zu umschließen. Während Ari seine Rolle bei den Reitern liebte, graute es Tod davor, Seelen ins Jenseits zu locken. Die meisten gingen unaufgefordert, und zwar an einen Ort, den niemand kannte. Selbst die, die hinter der Grenze lebten, in den Schatten jenseits der Welt der Sterblichen, wussten nicht mehr darüber. Auch wohin ein Unsterblicher ging, nachdem er seine Dienste geleistet hatte, konnte niemand sagen. Nicht einmal Tod.
„Musst du wirklich gehen? Sofort?“ Ari wusste es bereits, bevor er die Frage ganz über die Lippen gebracht hatte, und Tod hielt es nicht für nötig, die Antwort auszusprechen.
Natürlich würde Tod gehen. Was wäre sonst aus der Welt geworden? Aus ihren Körpern gerissene Seelen – meist durch Tragödien oder Gewalt – spukten herum und bedrohten das Vermögen der Grenze, Gefährlicheres von der Welt der Sterblichen fernzuhalten. Einzelne Geister stellten kein großes Problem dar, doch größere Ansammlungen führten häufig zu Schwierigkeiten. Wenn die Seelen nicht davon überzeugt wurden, ihre Verbindung zur Welt der Sterblichen aufzugeben, brachten sie manchmal andere dazu, ebenfalls zu bleiben, oder versuchten Kontakt zu Menschen aufzunehmen, da sie nicht verstanden, dass sie ihren Körper verlassen hatten.
Ari atmete geräuschvoll aus. „Wann?“
„Bald.“ Tod machte sich an einem Stück Orangenschale auf der Arbeitsplatte zu schaffen, zerquetschte es zwischen den Fingerspitzen. „Ein Feuer in den Slums von Hongkong. Ich weiß noch nicht, wie viele, aber ich sollte dort sein.“
„Du musst nicht von Anfang an dabei sein. Es dauert Stunden, bis sie hier festsitzen.“ Ari biss die Zähne zusammen. Diese Diskussion hatten sie schon so oft geführt. „Geh später. Erspar dir den Schmerz.“
„Jemand muss bei ihnen sein, wenn sie sterben. Niemand sollte diese Welt unbeachtet und unberührt verlassen“, antwortete Tod. Oft reagierte Ari unbedacht und ließ seiner Wut freien Lauf, doch jetzt schien er sie energisch zu unterdrücken. Tod wusste es zu schätzen. „Wenn ich es nicht tue, wer dann? Es ist meine Aufgabe. Damit sie nicht einsam und vergessen umherziehen.“
Ari presste seine Hände rechts und links von Tod auf die kalte Marmorplatte. „Ja, wir sind die Reiter der Apokalypse. Die vier. Aber hier ist niemand, der dir vorschreibt, dass du das dir servierte Getränk jedes Mal kochend heiß herunterstürzen musst. Lass es doch erst abkühlen.“
„Darüber haben wir doch gesprochen, Ari.“ Tods Stimme war ein Flüstern, heiser durch Aris Nähe. „Ich kann nicht anders. So bin ich, so ist meine Rolle. Also musst du dich heute Nacht für mich umsehen. Mein Gefühl sagt mir, dass es nicht warten kann.“
„Na gut, du bist schließlich der Kopf der ganzen Sache und ich steuere nur meine Muskeln bei“, sagte Ari, während er sich von der Arbeitsplatte abstieß und das Handtuch wieder fester um seine Hüften schlang. Trotzdem ließ er nur ungern zu, dass Tod zu den Slums aufbrach, wo er stundenlang umherwandern und jeder Seele seine Unterstützung beim Verlassen dieser Welt anbieten würde. „Aber ich bin eindeutig heißer.“
„Nimm Colm mit.“ Tod hob eine Hand, um Aris Protesten zuvorzukommen. „Er ist einer von uns und muss endlich lernen, was unsere Aufgaben sind. Und zwar nicht nur durch Geschichten beim Mittagessen.“
„Das ist doch nicht dein Ernst“, zischte Ari frustriert. „Sieh ihn dir doch an: Er jagt gerade einem Wraith nach wie ein Goldfisch seinen Futterflocken.“
„Er soll das Gefühl haben, zu uns zu gehören.“ Tods Blick schien in weite Ferne zu schauen, als dächte er an etwas anderes. „Im Augenblick ist das noch nicht der Fall. Ich weiß, wie schlimm Batus Verlust für dich war. Er war für uns alle schlimm. Er war ein guter Freund.“
„Ein verdammt guter Freund“, brummte Ari und verschränkte die Arme vor seiner nackten Brust. „Und eine verdammt gute Pestilenz. Colm ist … Tod, neben Batu ist er unbrauchbar.“
Colm erstarrte vor der Tür zum Wohnbereich. Er hörte die anderen manchmal über Batu flüstern, wenn sie sich seiner Anwesenheit nicht bewusst waren. Aris Worte lösten einen heftigen Schmerz in seiner Brust aus und der junge Reiter biss die Zähne zusammen, um eine wütende Reaktion zu unterdrücken.
„Das ist nicht Colms Schuld. Die Neuen fühlen sich immer erst fremd“, widersprach Tod. „Und so kann das nicht bleiben.“
„Aber er fühlt sich wie ein Außenseiter an. Bei Min war das ganz anders. Es gab keine Probleme. Sie ist ein guter Hunger. Ein dünnes, kleines Gör, aber gehässig. Das passt zu Hunger“, gab Ari zurück, obwohl er Tods vorwurfsvollen Blick auf sich spürte. „Er ist anders als wir. Zu anders.“
„Aber genau das brauchten wir.“ Tod beugte sich vor, wandte den Blick nicht von Aris gebräuntem Gesicht ab. „Also haben sie uns Colm geschickt. Du und ich, wir sind schon ewig hier. Aber bei den anderen ist manchmal eine Veränderung nötig. Das weißt du doch. Selbst wenn wir uns nicht von ihnen trennen wollen, müssen sie von uns gehen. Colm ist hier, weil wir ihn brauchen. Und vielleicht braucht er uns auch. Das wird sich noch zeigen.“
„Batu hat einfach seine Arbeit gemacht. Ohne Theater. Man musste ihn nicht wie einen kleinen Jungen trösten oder auf sein Ego Rücksicht nehmen. Er kam einfach und hat getan, was von Pestilenz erwartet wird.“ Ari verzog das Gesicht, als er daran dachte, Stunden mit dem jungen Reiter verbringen zu müssen. „Colm ist wie eine Scheide, die zu eng für ihr Schwert ist.“
Ihre neue Pestilenz schien ständig im Weg zu sein und die vielen Fragen gingen Ari auf die Nerven. Auch wenn Ari nicht abstreiten konnte, dass es vor allem damit zusammenhing, wie sehr er ihre alte Pestilenz vermisste.
Es hatte sich um einen schlanken schwarzen Mann mit langen Dreads gehandelt, der immer für einen Scherz oder ein entspanntes Gespräch bei einem Bier zu haben gewesen war. Als er beschlossen hatte, die Reiter zu verlassen, war Ari in tagelange Trauer verfallen und hatte versucht, sie in Whisky und Wodka zu ertränken. Nachdem sie ihm einen Tag lang dabei Gesellschaft geleistet hatte, war Min wieder ihrer Arbeit nachgegangen, doch ihr Blick ruhte häufig auf den von Batu geschnitzten Ebenholzfiguren, die dieser zurückgelassen hatte. Tod hatte sich darauf vorbereitet, dass bald eine neue Pestilenz auftauchen würde – nackt, verwirrt und mit dem Kopf voller Wissen, wie man die Menschheit am besten quälte.
Batu war ersetzt worden, wie er die Pestilenz vor ihm ersetzt hatte. Bereits nach zwei Stunden war ein neuer Unschuldiger eingetroffen, ein kurzsichtiger blonder Mann. Mit seiner Metallbrille und seinem zerzausten flachsfarbenen Haar wirkte er lernbegierig, und seine Neugier und sein Interesse für moderne Erfindungen und Technologie schienen tatsächlich keine Grenzen zu kennen.
„Redest du schon wieder über mich?“ Barfuß näherte sich Colm beinahe lautlos über den glatten Holzboden, wobei er eine Tasse mit einem Rest kalten Kaffees in der Hand trug. „Hast du keine bessere Beschäftigung? Versuch’s doch mal mit Malbüchern.“
„Tod möchte, dass wir uns nach etwas umsehen. Und irgendwie muss ich ihn so sehr verärgert haben, dass er mich zwingt, dich mitzunehmen.“ Dass sein Freund einen abgelenkten Blick auf Pestilenz warf, nutzte Ari aus, um seine Lippen sanft an Tods Kiefer entlanggleiten zu lassen. „Überzeug den Jungen doch bitte davon, zur Abwechslung mal auf mich zu hören. Und vielleicht auch, sich Schuhe anzuziehen.“
„Er hört besser auf dich als du auf mich“, brummte Tod, als Ari das Zimmer verließ.
Colm sah Ari wütend an, hielt sich jedoch mit weiteren Bemerkungen zurück, als er Tods Blick auf sich spürte. Er wandte sich dem Älteren zu, kräuselte die Lippen und murmelte: „Ich kann ihm nie widersprechen, ohne wie ein weinerliches Kind zu klingen.“
„Er ist eben besser im Streiten als du“, antwortete Tod. „Das liegt in seiner Natur.“
„Er hasst mich.“ In Anbetracht seiner eigenen Worte verzog Colm das Gesicht. „Ich klinge immer noch wie ein weinerliches Kind.“
„Ari ist im Grunde ziemlich einfach gestrickt.“ Tod dachte kurz darüber nach. Ari trug viele heftige Gefühle in sich, die manchmal hervorbrachen wie ein Wirbelsturm. „Wenn er etwas oder jemanden nicht versteht, knurrt er. Dich versteht er nicht. Ist der Wraith verschwunden?“
„Ein geschickter Themenwechsel“, sagte Colm grinsend. „Aber ja, er ist nicht lange geblieben.“
„Ich übe ja auch seit Jahrtausenden“, antwortete Tod. Die schmale Narbe unter seinem Auge war kaum zu sehen, als er Colms Lächeln erwiderte. „Lass Ari nicht zu lange warten, sonst wird seine Laune noch schlechter.“
Colm kaute unsicher auf seiner Unterlippe. Beim letzten Mal hatte er ein absolutes Chaos angerichtet. Die Welt hatte sich noch nicht davon erholt, wie er sich vor den älteren Reitern aufgespielt hatte. Er wusste nicht, ob er für die nächste Aufgabe bereit war, nachdem seine erste Katastrophe ganze Gebiete ausgelöscht und so viele unschuldige Menschen das Leben gekostet hatte.
„Soll ich wirklich mitgehen?“ Colm hob den Blick. „Was ist mit dir?“
„In ein paar Stunden wartet Arbeit auf mich.“ Tod betrachtete die im Licht glänzenden Brillengläser, während er die Schalenstücke von der Arbeitsplatte in seine Hand fegte. „Vielleicht musst du in ein paar Tagen mit Min nachkommen. Mal sehen, wie es sich entwickelt.“
Tods Gesicht war zu einer starren, gelassenen, aber nichtssagenden Maske geworden, die sicher mehr Geheimnisse verbarg, als Colm sich je vorstellen konnte. Er wusste, warum Tod nicht mit ihnen kam und warum Ari so verärgert verschwunden war.
Nur eine einzige Sache konnte bei Ari diese verbitterte Wut hervorbringen. In der Nacht würde etwas Großes, Schreckliches passieren und Tod würde sie zwischen sterbenden Menschen verbringen müssen, um diese ins Jenseits zu leiten.
Colm hatte bereits Grauenvolles erlebt, allerdings bei weitem nicht im selben Umfang wie Tod.
Als seine erste Seuche ihren Lauf genommen hatte, war er überglücklich gewesen. Zwar waren Tausende gestorben, doch er hatte gewusst, dass ihr Tod notwendig war und die Gemeinschaft der Menschen nur stärker machen würde. Er hatte darauf gewartet, dass sie sich zusammentaten, um das Virus zu besiegen.
Nur waren stattdessen mehr und mehr Menschen gestorben und Verzweiflung hatte sich ausgebreitet. Anführer hatten sich erhoben und verkündet, die Opfer hätten den Tod verdient. So verwandelte sich Krankheit in Hass und Colm wurde klar, was er angerichtet hatte. Doch da es seine Schuld war, konnte er nicht wegsehen. Er beobachtete genau, welche Folgen sein Handeln hatte.
Und weinte bitterlich.
Tod war für ihn da. Als sich sein großartiger Plan, die Menschheit in eine mitfühlendere, hilfsbereitere Gemeinschaft zu verwandeln, in Luft auflöste, war Tod für diese arrogante, gedankenlose Pestilenz da. Tod tröstete ihn mit Worten und warmem, dampfendem Tee, während er ihn daran erinnerte, dass sie sich jetzt außerhalb der menschlichen Welt befanden und vieles einfach geschehen lassen mussten. Die Reiter konnten nur wenig Einfluss nehmen – am Ende wurden die Menschen durch ihren eigenen Willen gelenkt.
„Und trotzdem darfst du nicht vergessen, dass du … das wir, trotz unserer Unsterblichkeit, auch jetzt noch Menschen sind. Wir haben menschliche Schwächen und menschliche Stärken. Wir wurden aus der Welt der Sterblichen für diese Rollen ausgewählt“, sagte Tod damals. „Niemand von uns ist perfekt. Die Reiter existieren, um der Menschheit einen Weg zur Hoffnung aufzuzeigen. Wir tun abscheuliche Dinge und versuchen, darauf zu vertrauen, dass die Menschheit an unseren Herausforderungen wächst. Das ist unsere Bestimmung, Pestilenz.“
„Tut mir leid“, stotterte Colm jetzt, als er daran zurückdachte. „Es war gedankenlos, so etwas zu sagen. Ich werde schon zurechtkommen, selbst mit Ari.“
„Es wird Zeit, dass du deinen Beitrag leistest“, stimmte Ari zu, der sich mit mittlerweile trockenem Haar zu ihnen gesellte, während er in eine vom jahrelangen Tragen weiche Lederjacke schlüpfte. Dann warf er ein Schlüsselbund in die Luft und fing es auf. „Manchmal müssen wir eben die Drecksarbeit erledigen, für die niemand anders Zeit hat.“
„Das weiß er, Ari“, antwortete Tod leise. Er rutschte von der Arbeitsplatte und ließ Colms Schulter los. „Menschen, die uns sehen können, fürchten sich vor mir. Aus gutem Grund.“
„Nur weil sie dich nicht kennen“, verteidigte ihn Colm.
„Wenn sie mich kennen, sind sie normalerweise schon lange tot und suchen jemanden, mit dem sie sich unterhalten können. Und Tote sind selten geistreich.“ Tod grinste. „Keine Sorge, Colm. Ich bin daran gewöhnt, dass Menschen vor mir davonlaufen. Es ist eine ganz natürliche Reaktion. Geh mit Ari und lass dich nicht zu viel von ihm ärgern. Und auch nicht von anderen.“
„Lass uns gehen, Pest.“ Ari stieß seine Schulter gegen Colms, was den Jüngeren beinahe aus dem Gleichgewicht brachte.
„Ich hasse es, wenn du mich so nennst.“ Colm hielt sich an der Arbeitsplatte fest und warf Krieg einen bösen Blick zu, bevor er drüben bei den Sofas ein Paar Sneaker entdeckte, die er wohl dort vergessen hatte. Während er sich Socken und Schuhe anzog, hörte er mit halbem Ohr den anderen beiden in der Küche zu.
„Deswegen mache ich es ja“, sagte Ari nicht allzu leise. Er näherte sich Tod, bis ihre Nasen sich beinahe berührten, ihr Atem sich miteinander vermischte. „Glaubst du, du bist schon hier, wenn wir zurückkommen?“
„Unwahrscheinlich.“ Tod schüttelte den Kopf. „Ich rechne mit einigen Stunden. Das Gebiet hat viele Bewohner und die Regierung betrachtet sie als entbehrlich. Ich bezweifle, dass es zu gut organisierten Rettungseinsätzen kommt.“
„Also wird es schlimm.“ Ari hakte seine Daumen in die Gürtelschlaufen seiner Jeans. Im Augenblick fasste er Tod besser nicht an. Wut brodelte in seinem Bauch, als er sich vorstellte, wie der Reiter stundenlang zwischen sterbenden Menschen umherlaufen musste, um die zu finden, die für den Weg ins Jenseits seine Hilfe benötigten. Mit einem stummen Gebet zu einem, wie er leider vermutete, tauben Gott bat Ari um starken Regen, der die Ausbreitung des Feuers verlangsamen und den Menschen eine Gelegenheit zur Flucht verschaffen würde. „Soll ich hinkommen, falls wir vor dir zurück sind?“
„Was hätte das für einen Sinn?“ Tod neigte den Kopf, ein Kunstwerk aus Schatten und Licht. „Bei einer so angespannten, emotionalen Atmosphäre führt deine Anwesenheit am Ende noch zu Krawallen.“
„Für dich bringe ich doch gern ein paar Krawalle in Gang …“, sagte Ari mit einem anzüglichen Grinsen. „Aber das hat Zeit. Erstmal schauen der Junge und ich, in wie große Schwierigkeiten wir geraten können.“
„Lasst euch bitte nicht verhaften.“ Tod zog sich widerstrebend von Aris warmem Körper zurück und ging den Flur entlang auf seine Zimmer zu. „Dann müsst ihr nämlich warten, bis ich zurück bin und die Kaution bezahle. Min stellt gerade etwas Schreckliches in Afrika an und ist wahrscheinlich noch bis morgen unterwegs.“
„Pass nur gut auf dich auf, Shi“, murmelte Ari, während er Tod nachsah. Dann wandte er sich mit einem Seufzer Colm zu. Er hatte absolut keine Lust, den jungen Mann mitzunehmen. „Jetzt muss ich mich wohl erst mal mit dir abfinden.“
„Ich könnte dir ja von Tod ausrichten, dass du dich benehmen sollst, aber dann wirst du nur wieder sauer.“ Colm bemühte sich auf dem Weg ins Foyer, mit Ari Schritt zu halten, was ihm selbst mit seinen langen Beinen nicht leichtfiel.
„Dann wüsste ich, dass du lügst.“ Ari drückte energisch den Knopf für den Aufzug. „Tod hat es schon vor Ewigkeiten aufgegeben, mir das zu sagen. Jetzt warnt er nur noch alle anderen davor, dass ich ein Arschloch bin und sie damit leben müssen.“
2
SCHMETTERLINGE.
Einfache Geschöpfe. Ungefährlich. Sie verbrachten den Tag damit, hübsch auszusehen und Zucker zu trinken. Ein leichtes Leben.
Lieblich und harmlos.
Sie krochen nie unter der Haut hervor, nachdem man sie gestochen hatte. Nein, dachte Kismet, als er einem Flügel etwas rote Tinte hinzufügte. Schmetterlinge blieben immer dort, wo man sie platzierte. Sie befanden sich unter der Haut und entrollten niemals ihre Rüssel, um das Blut aufzusaugen, das um die Nadel herum aufwallte.
Kismet hasste Schmetterlinge. Hasste es, sie zu stechen. Hasste es, sie zu sehen.
Weil sich in ihnen kein Leben befand, beschloss Kismet, während er den Kopf neigte, um den Schwarm bunter Insekten zu betrachten, mit dem er die Hüfte einer Blondine verziert hatte. Schwache Kreaturen, kaum in der Lage, einen heftigen Windstoß zu überstehen. Eigentlich war es unlogisch, dass Menschen beim Anblick eines Schmetterlings dahinschmolzen. Kakerlaken waren wesentlich bewundernswerter. Sie überlebten Hass und stampfende Füße. Das Leben der Schmetterlinge war kurz und leicht. Vermutlich planten die Kakerlaken bereits ihren Untergang, die Vernichtung ihrer hübscheren Geschwister.
Oder sie dachten über Wege nach, selbst hübscher zu werden. Schönheit schützte oft gegen Hass.
Andererseits zog sie manchmal Brutalität an.
Oh, er wusste nur zu gut, wie gern grausame Menschen Schönes beschmutzten. Kismet schnaubte leise und konzentrierte sich wieder auf das Farbenspiel, das er auf seine unbarmherzige Leinwand auftrug. Noch ein bisschen Blau und dann einen etwas dunkleren Farbton, um den Flügel aus seiner Starre zu ziehen und ihm Tiefe einzuhauchen.
Seine Kundin murmelte etwas, gefolgt von einem leisen, erregt klingenden Stöhnen. Ihre Finger wanderten zu seinem Nacken, um lange braune Haarsträhnen zu streicheln. Die Berührung ließ ihn aufschrecken, Schmetterlinge und Kakerlaken vergessen. Ein Lächeln lag auf ihrem Gesicht und sie schaute unter schweren Lidern hervor. Kismet kannte diesen Blick. Kannte ihn nur allzu gut.
„Ich bin fast fertig.“ Mit geschürzten Lippen wandte er sich seinen Pappbechern mit Tinte zu und reinigte die Maschine, bevor er die Nadeln in ein lebendiges Gelb tauchte. Das von seiner Kundin mitgebrachte Schmetterlingsbuch gab ihm eine Vorstellung davon, wie es mit den vielen anderen Farben harmonieren würde – die Natur war beim Einkleiden der Nektartrinker großzügig gewesen.
„Gut, es tut nämlich ziemlich weh.“ Wie sie ihr Haar über eine Schulter nach hinten warf, sollte wohl einladend wirken, genau wie die Finger, die über seine Lippen wanderten. Er spürte die Wärme über ihrem Bauch, roch ihren süßen Duft. „Hast du heute Abend Zeit? Wir veranstalten eine Party. Ich könnte dich allen vorstellen, wenn ich ihnen mein neues Tattoo zeige.“
„Ähm, ich weiß nicht. Eigentlich bin ich heute Abend beschäftigt.“ Kismet schüttelte den Kopf und senkte den Blick.
Das war ein Fehler: Unter der Arbeitsfläche hockte sein Bruder – mit angezogenen Knien, damit sie den Pferden, die er mit seinen Fingern formte, als Berge dienen konnten. Riesige Augen schauten unter Chase’ wildem Haarschopf hervor und strahlten eine jungenhafte Unschuld aus, die Kismet bereits vor langer Zeit verloren hatte.
Er wusste noch genau, wann. An dem Morgen, als er aufgewacht war und den kalten, leblosen Körper seines Bruders neben sich vorgefunden hatte. Jede Spur von Unschuld hatte sich im Licht des Morgens in Luft aufgelöst. Seine Kindheit wurde hinfortgespült, als er unter der Dusche stand und zusah, wie die getrockneten Reste von seinem und Chase’ Blut die Fliesen rot färbten.
Die Unschuld in den Augen des Geistes war geblieben. Das Einzige, wofür Kismet wirklich dankbar war.
Die Erscheinung spielte weiter mit ihren Fantasietieren, ließ sie über Berg und Tal galoppieren. Als Kismet Chase’ Beine durchquerte, erzitterte die Ansammlung von Schatten und zersprang in Splitter aus Dunkelheit, bevor sie sich wieder zusammensetzte und der blasse Junge so menschlich wirkte, wie ein Geist es eben konnte.
„Du bist übrigens süß.“ Auch diesmal schwang in ihrer Stimme eine Einladung mit. Dieses Spiel kannte Kismet ebenfalls. „Wie einer meiner Schmetterlinge.“
„Ich wäre lieber eine Kakerlake“, murmelte er leise, während er den Blick seiner dunkelbraunen Augen weiterhin gesenkt hielt. Nachdem er die Stelle gefunden hatte, der er das Sonnengelb hinzufügen wollte, zog er die helle Haut glatt, neben der seine dunklen Latexhandschuhe wie Blutergüsse wirkten. „Halten Sie kurz still. Ich bin fast fertig.“
Normalerweise vermied er es, bei der Arbeit zu reden – zu Nicks Leidwesen. Der Ladenbesitzer nervte ihn ständig mit der Aufforderung, sich um Small Talk mit seinen Kunden zu bemühen, was Kismet allerdings einfach zu sehr ablenkte. Es war schon schwer genug, mit Nadeln zu malen, und Leute bewegten sich häufig, wenn sie redeten. Beim Tätowieren konnte er einen Fehler nicht so einfach übermalen. Acrylfarben verziehen einem wesentlich mehr, doch Bilder brachten weniger Geld ein.
Hätte er jemals einen Weg gefunden, Geister zu tätowieren, wäre sein Lebensunterhalt gesichert gewesen.
„Ich mache es für meine Mutter“, sagte die Blondine plötzlich. „Sie hat Schmetterlinge geliebt. Sie ist gestorben, als ich noch ein Kind war.“
„Scheiße. Verdammter Nick.“ Kismet ließ beinahe die Maschine fallen und zog sie hastig zurück, bevor er Schaden anrichtete. „Er hätte es mir sagen sollen. Mit Porträts und Erinnerungen will ich nichts zu tun haben.“
„Ja, deswegen wollte er, dass ich es verschweige. Aber das möchte ich nicht.“ Sie blinzelte mit feuchten Augen. „Jetzt weißt du also, wie viel es mir bedeutet. Macht es das nicht sogar besser? Du hörst doch nicht etwa auf?“
Am liebsten wäre Kismet aufgesprungen und davongestürmt. Seine Finger verkrampften sich um die Maschine. Er schloss die Augen, um einige Male tief durchzuatmen und sich um Gelassenheit zu bemühen. Außer Chase hast du hier heute nichts gesehen, ermahnte er sich. Keine anderen Schatten. Keine anderen in der Dunkelheit lauernden Gesichter. Ihre Mutter ist wahrscheinlich schon lange fort, an einem anderen Ort.
Nicht jeder trägt sein Grauen mit sich herum, flüsterte Kismets Verstand. Nur die Schuldigen wurden ihre Geister nicht los.
„Nein, schon gut.“ Er schüttelte das kalte Prickeln unter seiner Haut ab. „Ich weiß, wie es ist, seine Familie zu vermissen.“
Er öffnete die Augen und sah sich um, entdeckte jedoch nichts als Staubteilchen, die durch die Nachmittagssonne schwebten. Im Studio herrschte Stille, abgesehen vom leisen Klicken der Maschinen und gelegentlichen Gelächter der anderen Mitarbeiter, die sich mit ihren Kunden unterhielten. Er hörte Nick vorn im Laden telefonieren, konnte ihn jedoch wegen des bemalten Plastikvorhangs, der den Eingangs- und Wartebereich abtrennte, nicht sehen.
Kismet wollte auf keinen Fall den Geist einer Person in ihrer Haut verewigen. Menschen sagten oft nicht die Wahrheit darüber, wie sehr sie jemanden liebten. Genauso wenig darüber, wie der geliebte Mensch gestorben war. Kismet hatte mehr Geschichten über tragische Unfälle gehört, als ihm lieb war. Und Kunden mit diesen Geschichten wurden normalerweise von den Überresten eines menschlichen Wesens verfolgt, das mit von wütenden Fäusten zerschmettertem oder von einer Kugel zerrissenem Gesicht in ihrem Schatten lauerte.
Porträts hatte er an dem Tag aufgegeben, als einer Frau ein blutüberströmtes Mädchen mit verweinten Augen ins Studio gefolgt war. Die traurige Geschichte einer ertrunkenen Tochter war danach nicht überzeugend gewesen. Genauso wenig wie Nicks Versprechen, ihn bei diesem Auftrag das gesamte Geld behalten zu lassen. Der Schmerz in den Augen des Mädchens war einfach zu viel gewesen. Er machte ihn dankbar für Chase’ Naivität.
Außerdem machte ihm der Vorfall klar, dass Menschen sich offenbar eine Art Trophäe für ihren Schmerz wünschten – aus Schuldgefühlen heraus oder weil es ihnen eine grausige Genugtuung verschaffte. Er wollte nicht daran beteiligt sein, die Toten auf diese Weise zu verewigen. Er hoffte immer noch, dass Chase eines Tages den Weg ins Jenseits finden würde.
Seit langer Zeit fragte er sich, ob er Chase’ Seele irgendwie dazu gebracht hatte, bei ihm zu bleiben, weil er zu jung gewesen war, um wirklich zu begreifen, dass sein Bruder tot war. Oder vielleicht hatte der Geist einfach niemand anderen – genau wie Kismet. Es war schwer, die einzige Person loszulassen, die man je geliebt hatte.
„He, alles in Ordnung?“ Die junge Frau berührte ihn erneut, doch ihre Fingerspitzen fühlten sich an seinen erhitzten Wangen eisig an.
Kismet zuckte mit zitternden Händen zurück und schluckte schwer, bevor er antwortete: „Ja, mir geht’s gut. Aber sagen Sie niemandem, dass ich das hier mache. Es ist eine Ausnahme. Nick nehme ich mir später vor.“
„Ich wollte ihn nicht in Schwierigkeiten bringen.“
„Wie viele Schwierigkeiten könnte ich ihm schon machen?“, lachte Kismet mit einem bitteren Unterton, während er seine langen Beine unter der Massageliege, die er für seine Kunden benutzte, in eine bessere Position brachte. „Nick gehört der Laden. Ich habe mich nur bei ihm breitgemacht.“
Der Rest ging schnell. Bald konnte er das Tattoo desinfizieren und die übliche Erklärung dazu abgeben, wie die Kundin in den nächsten Tagen damit umgehen sollte. Er warnte sie vor Krustenbildung und wies sie darauf hin, dass es einige Zeit so aussehen würde, als träte Tinte unter der Haut hervor. Sie war nicht begeistert. Noch weniger gefiel ihr sein Rat, es ein oder zwei Tage abgedeckt zu lassen, damit es verheilen konnte, ohne dass ihre Kleidung darunter litt.
„Die Leute wollen ihre Tattoos ansehen, Andreas.“ Einer der anderen Tätowierer kam an Kismets Arbeitsbereich vorbei und warf einen angewiderten Blick auf die sterilen Mullkompressen, die Kismet für neue Tattoos benutzte. „Frischhaltefolie ist viel besser.“
„Menschen sind keine Sandwiches, Mike. Man muss sie nicht frischhalten“, antwortete er, während er um Chase’ Füße herumging. Wenn es möglich war, wich er ihm aus. Meistens war es das nicht. „Ein frisches Tattoo unter Folie sieht schlimmer aus als ein verschimmelter Wackelpudding mit Obstsalat.“
„Ich sag’s ja nur, Prinzessin.“ Mike stützte sich auf die niedrige Trennwand. „Leute geben gerne damit an, dass sie gerade höllische Schmerzen durchgemacht haben. Das liegt in ihrer Natur.“
Kismet ignorierte ihn und legte seine Instrumente zur Sterilisation in einen Autoklav. In seiner Zeit als Mitarbeiter im Steel Sin hatte er schon schlimmere Beleidigungen gehört. Einigen stimmte er sogar zu. Nachdem er seinen Arbeitsplatz gereinigt hatte, knüllte er die Papierauflage der Liege, Pappbecher und Tücher zusammen, um sie im Sondermüll zu entsorgen.
„Na, Baby.“ Er spürte Nicks Hand an seinen Rippen. Die Finger des älteren Mannes glitten unter sein T-Shirt und wanderten über Kismets Rücken. „Das war gute Arbeit heute. Ich habe davon ein Foto für dein Buch gemacht. Und sogar den Mull wieder draufgeklebt.“
„Du hättest mir sagen sollen, dass es für ihre Mutter ist.“ Kismet machte einen Schritt zurück, um sich von Nick zu lösen. Er wusste, wie albern es war, Nick böse zu sein. Der Mann verstand die Gründe für seine Abneigung nicht. Er konnte von Nick nicht erwarten, dass er eine so unvernünftige Eigenheit einfach so akzeptierte.
Nur wie konnte man jemandem sagen, dass man fürchtete, versehentlich eine Seele unter der Haut eines anderen Menschen zu versiegeln?
Nick war viel zu realistisch, um solch eine Erklärung hinzunehmen. Da war es besser, es als ungewöhnliche Macke stehenzulassen. Kismet haftete ohnehin der Ruf an, etwas verrückt zu sein. Warum sollte er sich diesen also nicht zunutze machen?
„Dann hättest du abgelehnt. Und, Kleiner, du brauchst das Geld.“ Er nahm einen Stapel Geldscheine aus der Tasche. „Hier. Ich habe nichts für das Studio behalten. Du bekommst alles.“
„Die anderen werden sauer sein, falls sie es herausfinden.“ Kismet sah sich um, als könnten seine Mitarbeiter ihn beobachten. Doch Nick hatte hinter sich den Vorhang zugezogen, sodass sie vor Blicken geschützt waren. Trotz seines Widerspruchs schob Kismet das Geld in die Tasche. Sein Portemonnaie war zu leer, als dass er sich wegen der anderen Gedanken machen konnte.
„Der Laden gehört mir.“ Nick lehnte sich an die Arbeitsfläche, wobei er Chase’ Beine durchquerte. „Also können die mich mal.“
Die sinkende Nachmittagssonne fiel von hinten auf Nicks dunkles Haar und tauchte sein Gesicht in tiefe Schatten. Der Mann legte seine Finger um Kismets Handgelenk, um ihn an sich zu ziehen, sodass er zwischen seinen Beinen stand. Nicks Zähne leuchteten in seinem gebräunten, rauen Gesicht auf, als sich sein Mund zu einem Grinsen verzog, und neben seinem kräftigen Körper kam Kismet sich mit seiner schlanken Gestalt zerbrechlich vor.
„Danke“, sagte Kismet ehrlich. Er verdankte Nick wirklich eine Menge. Er wusste Kismet zu schätzen und ließ ihn bei sich arbeiten, wenn er Geld brauchte. „Ich schulde dir etwas.“
„Ich mag es, wenn du mir etwas schuldest.“ Nick zog Kismet noch dichter an sich und verschränkte die Finger hinter seinem Rücken. „Alles okay bei dir?“
Nicks aufrichtig scheinende Sorge um ihn überraschte Kismet nicht. Nick war immer auf der Suche nach Schwächen. Ihm eine solche einzugestehen wäre gewesen, als hätte ein Schwein einem Fleischer ein frisch geschärftes Messer gereicht. Beim Anblick von Kismets Stirnrunzeln verzogen sich Nicks schmale Lippen zu einem noch breiteren Grinsen. Doch Kismet nickte nur und unterdrückte ein Zittern, als Nicks Hände über seinen Körper wanderten und seine Finger sich in Kismets Hosenbund schoben. „Ja, mir geht’s gut. Nur, na ja, ich brauche bald wieder was.“
„Oh, da habe ich genau das Richtige.“ Der Mann beugte sich grinsend vor, um an Kismets Ohr zu knabbern. „Guck in meiner Tasche nach.“
Dieses Spiel spielten sie schon lange – seit Kismet elf Jahre alt gewesen war und Nick Kismets Mutter für ein bisschen Spaß besucht hatte. Damals hatten sich in seiner Tasche Süßigkeiten oder Kaugummi befunden. Jetzt fanden sich darin andere Genüsse. Kismet schob seine Finger unter den Jeansstoff und zog ein Plastikpäckchen heraus. Er wog das Heroin in seiner Hand und versuchte einzuschätzen, wie viel es ihn wohl kosten würde.
„Wie viel?“ Das war ein weiteres ihrer Spiele: zu sehen, wie viel von seinem Verdienst Nick gleich wieder zurückforderte. Auch wenn er zu schätzen wusste, was Nick für ihn tat, vergaß Kismet nie, dass seine Güte oft einen hohen Preis hatte. Manchmal war es nicht unbedingt Geld. Allerdings war Kismet heute gleichzeitig zu müde und zu nervös für diese Art von Bezahlung. Er wollte nur nach Hause, sein Verlangen stillen und dann etwas bemalen, das sich nicht bewegte.
„Bleib ein bisschen.“ Nicks Mund fühlte sich warm an, hinterließ einen glühenden, feuchten Pfad an Kismets Hals, den er am liebsten abgewischt hätte. „Wir finden sicher etwas, womit du mich entschädigen kannst.“
„Du verwechselst mich mit meiner Mutter.“ Kismet machte einen großen Schritt zurück, löste sich von Nick. „Ich bin keine Hure.“
„Hätte sie nicht rumgehurt, wärst du jetzt nicht hier. Du solltest ihr dafür dankbar sein. Wäre ich nicht scharf auf sie gewesen, hätte ich dich nie kennengelernt. Das wäre doch schade.“
„Aber ich bin trotzdem nicht sie. Vergiss das nicht. Ich bezahle meine Schulden. Ich treibe es nicht mit Leuten, damit ich etwas umsonst bekomme.“
„Aber du siehst ihr wirklich ähnlich. Lange Beine, samtige braune Augen … Nur bist du nicht blond. Aber ich mag deine Haarfarbe. Wie Kaffee.“ Der ältere Mann betrachtete den schlanken Künstler. „Jedenfalls bist du so hübsch wie sie es war. Und besser im Bett, als sie es je gewesen sein könnte – deine Mutter war eine prüde Ziege. So kühl du dich auch manchmal gibst, Kiz, das liegt dir mehr.“
„Nicht ablenken, Nicky: wie viel?“ Kismet hielt das Päckchen hoch. „Ich möchte dir nichts schulden.“
„Aber schuldest du mir nicht schon so viel, Kizzie?“ Die bissige Erinnerung daran, wie viel er ihm verdankte, brannte fast so sehr wie der Kuss, den Nick sich raubte. „Nimm es einfach. Ich will nichts dafür.“
„Sicher?“ Nicks Großzügigkeit machte ihn misstrauisch. Das Päckchen würde für mindestens fünf Schüsse reichen. Mehr als genug, um ihn durch eine Woche zu bringen – vielleicht sogar zwei, wenn er sparsam damit umging. „Wieso?“
„Außer dir mag das Zeug niemand. Alle anderen macht es verrückt. Du bist der Einzige, der davon nicht durchdreht.“ Nick zuckte mit den Schultern, während er Kismet unverwandt ansah. „Also habe ich dem Typ gesagt, dass ich es nicht mehr für ihn unter die Leute bringen will. Wie soll das auch gehen, wenn ich dafür nur einen Kunden habe? Baby, so heiß ich dich auch finde, kann ich nicht mit irgendeinem Scheiß handeln, den ich nicht loswerde.“
„Anscheinend hilft es, wenn man vorher schon verrückt ist.“ Er bemühte sich, seine Finger ruhig zu halten, doch es wurde zunehmend schwerer, das Zittern unter Kontrolle zu bringen. Seine Sucht machte sich immer heftiger bemerkbar, strömte durch seinen Körper. Wenn er ihr nicht bald nachgab, würden Schweißausbrüche und Bauchkrämpfe folgen.
„Bring dich nur nicht damit um, mehr verlange ich nicht.“ Nick stieß sich von der Arbeitsfläche ab, um Kismets Handgelenk mit seinen Fingern zu umschließen. Er packte fest zu, hinterließ beinahe einen Bluterguss. „Ich will dich nicht an dieses Zeug verlieren.“
„Dann hättest du mich vielleicht nicht darauf bringen sollen“, erwiderte er und fixierte den größeren Mann mit einem unnachgiebigen Blick.
Das erste Mal war in Nicks Bett gewesen. Er hatte auf dem schmutzigen Laken gelegen und sich gefragt, warum um ihn herum eine Party stattfand. Die Dunkelheit hatte sich ihm mit jedem Atemzug genähert, bis die Gespenster und Gesichter in den Schatten ihn beinahe ertränkten. Er war erstarrt vor Angst. Selbst Alkohol konnte die Ungeheuer offenbar nicht mehr von ihm fernhalten. Sein Körper brannte, wo Klauen rote Furchen in seine Haut kratzten. Sie verschwanden nach einigen Minuten, doch die Schmerzen blieben zurück, ein unsichtbares Leiden, das Kismet wahnsinnig machte.
Eine Metallnadel in seiner Vene heilte ihn davon. Im Nirwana zu schweben verschaffte ihm ein Gefühl des Friedens, an das er sich mit aller Kraft klammerte. Das in perlengleiche Tropfen verwandelte Pulver war seine Rettung, als die Welt immer dunkler wurde. Sein Verstand flehte um das Ende der Albträume, die ihn verfolgten – und bald verzehrte sich auch sein Körper nach der bitteren Erlösung.
Er verdankte es Nick, dass er noch nicht völlig verrückt geworden war. Verdammt, dachte Kismet, eigentlich sollte ich ihm dafür, dass er mir diese Nadel ins Fleisch geschoben hat, die Füße küssen. An manchen Tagen war die Droge das Einzige, was ihn am Leben erhielt.
Auch wenn er sich an diesen Tagen fragte, warum er das überhaupt versuchte.
KISMET SCHOB seine Hände tief in die Taschen seiner Jeans, um das Geld zu berühren, das er hineingestopft hatte. Sein Daumen streifte das Plastikpäckchen, dessen bröseliger Inhalt baldigen Frieden versprach. Im Augenblick wünschte er sich jedoch nichts als einen Atemzug süßen Rauchs und Schlaf. Sein Magen und seine Venen würden warten müssen, bis er sich ausgeschlafen hatte. Na ja, zumindest sein Magen. Ob er mit der Öffnung des Päckchens warten konnte, musste sich zeigen.
Die College Area hatte sich seit seiner Geburt kaum verändert: ein Sumpf, in dem die Verzweifelten und Ungewaschenen versanken, so lange er sich erinnern konnte. Den größten Teil seiner Kindheit hatte er im Umkreis von fünf Kilometern um seinen jetzigen Wohnort verbracht. Manchmal im Schutz von vier Wänden, manchmal bei dem Versuch, auf dem Vordersitz eines Autos zu schlafen, während seine Mutter auf der Rückbank halbherzig für den Mann stöhnte, der schwabbelig und feucht auf ihrem zierlichen Körper lag.
Kismet fühlte sich den Straßen so zugehörig wie die wechselnde Einwohnerschaft von Prostituierten und ihren Bewachern.
Er war zwischen ihnen aufgewachsen, sodass er jetzt, als Erwachsener, ganz zwanglos in weiten T-Shirts und farbbespritzten Jeans durch den vertrauten Schmutz die Straße entlanggehen konnte – ein blasser Geist, der an noch kaputteren Leben vorbeidriftete.
Ein finster dreinblickender Latino trat herausfordernd aus der Eingangsnische eines Hauses, wurde jedoch gleich von einem zweiten Mann am Arm festgehalten, der flüsternd auf Kismet deutete. Kismet war an das Geflüster gewöhnt und wusste, was über ihn gesagt wurde – oft so laut, dass er es hörte. Mittlerweile musste so ziemlich jeder gehört haben, dass er verrückt war. Allerdings war es unter Leuten, die ständig nach jemandem suchten, dem sie das Geld abnehmen konnten, nicht der schlechteste Ruf. Wahnsinn schien andere auf Abstand zu halten. Er war wie eine Rüstung.
„Kizzie.“
Kismet ging weiter, ließ den Laden an der Ecke nicht aus den Augen. Er maß die Entfernung mit seinen Schritten, zählte leise jeden Spalt im Gehweg. Kismet hatte aufgehört, sich nach dem flackernden Schatten am Rand seines Sichtfeldes umzusehen. Mittlerweile wusste er, wo Chase lauerte und ihm in jeder wachen Minute folgte. Als er den Laden betrat, signalisierte ein Läuten dem durch ein Metallgitter geschützten Verkäufer seine Ankunft.
Der dunkelhäutige Mann nickte ihm zu und holte eine Schachtel Nelkenzigaretten aus dem Regal. Kismet hielt zwei Finger hoch – er musste ausnutzen, dass er gerade so flüssig war. Als der Verkäufer die Schachteln auf die Theke legte, um zu kassieren, wurde er durch Kismets nachdenklichen Gesichtsausdruck gebremst.
„Sonst noch was?“ Der Mann warf einen Blick auf den abgeschlossenen Schrank mit den alkoholischen Getränken. „Ich habe noch was von dem Buckfast. Der bringt wieder Farbe in so ein blasses Gesicht.“
„Ja, warum nicht.“ Kismet räusperte sich. Der Verkäufer hörte weder das Tapsen der kleinen Füße auf dem Linoleumboden noch sah er Chase’ Haar wippen, als dieser sich mit seinen Gespensterhänden an die Theke klammerte, um davor auf und ab zu hüpfen.
„Was Süßes, was Süßes. Ich will was Süßes.“ Kismet schloss kurz die Augen und wartete dann, bis sich der Verkäufer von ihm abgewandt hatte, bevor er die Erscheinung neben sich ansah. Chase’ Augen waren so grau wie der Rest seines Körpers, durch den Tod zu aschfahlem Nichts verblichen. „Haben wir Geld dafür?“
Der Geist würde nicht verschwinden, bevor Kismet auf ihn einging – wie eine Marionette, die von den Fäden seines kranken Gehirns durch das Theater seiner Gedanken bewegt wurde. Das Gespenst flackerte und kämpfte gegen die Logik an, unter der Kismet diesen Wahnsinn zu begraben versuchte. Wenn er unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, rückten die Erscheinungen in den Hintergrund. Wenn er nüchtern war, wurden sie ganz deutlich, allen voran sein Bruder.
Also musste er bald etwas gegen seinen nüchternen Zustand unternehmen, ihn zumindest mit ein paar Schlucken abschwächen.
„Was willst du denn haben?“ Das Klicken des Schlüssels im Schrankschloss und die Schritte des Verkäufers kündigten seine Rückkehr an. Kismet sprach leise, damit der Mann ihn nicht hörte. Das Gesicht seines toten Bruders strahlte vor Freude, als Kismet sich den Süßigkeiten zuwandte. „Such dir schnell etwas aus, Chase. Bevor der Mann zurückkommt.“
„Was Großes mit Schokolade.“ Chase hüpfte wieder, was seine Umrisse zum Wabern brachte, als bestünde er aus Nebel.
Kismet entschied sich für einen in braunes Plastik gehüllten Schokoriegel und legte ihn zu seinen Zigaretten auf die Theke. Nachdem er bezahlt und vom Verkäufer die Tüte mit seinen Einkäufen entgegengenommen hatte, verließ er mit Tränen in den Augen den Laden.
Er überquerte den Parkplatz und bog in eine schmale Gasse ein, ständig begleitet von Chase’ fröhlichem Schokoladen-Singsang. Bald tauchte zwischen den anderen grauen Gebäuden das leuchtend blaue Dach seines Motels auf. Als er sich näherte, wurde Chase’ Stimme immer leiser, je heller es wurde, bis sie schließlich ganz verschwand.
An den Müllcontainern neben dem Motel kauerte eine schmale Gestalt, auch wenn das jägergrüne Metall wohl kaum Schutz vor den Elementen bot. Das tabakfarbene Haar der Frau umrahmte strähnig ihr verlebtes Gesicht, als sie mit trüben Augen von ihren Fingern aufblickte, deren Nagelhaut sie blutig geknibbelt hatte.
Aus ihrem Zahnfleisch ragten schwarze Stümpfe, da die Zähne bis auf die Wurzel verfault waren. Sie streckte eine knochige, wettergegerbte und vom Rauchen gelblich verfärbte Hand aus, senkte jedoch den Blick. Kismet näherte sich und ging neben ihr in die Knie, um ihr einen Fünfdollarschein in die Hand zu drücken.
„Hi, Lucy“, sagte er leise. Kismet atmete flach, um den Gestank nach getrocknetem Urin und altem Schweiß so gut es ging aus seiner Nase fernzuhalten. Sie war ein vertrauter Anblick. Ein schmerzhafter Anblick.
Die Frau hob den Kopf. Kismet konnte sehen, wie sich die Haut über den vorstehenden Knochen spannte. Von der lachenden Schönheit, die ihm manchmal einige Dollar für Süßigkeiten oder einen Burger zugesteckt hatte – die Freundinnen seiner Mutter hatten dem hübschen Jungen, der zwischen ihnen umhertobte, nur selten widerstehen können –, war nichts zurückgeblieben. Jetzt wirkte sie welk, als wäre ihr jegliches Leben entzogen worden.
„Kizzie!“, rief sie. Wegen der Drogen, die ihren Zahnschmelz zerfressen hatten, roch ihr Atem faulig. Sie klopfte mit der Hand auf den Boden neben sich – so unbekümmert in der schmutzigen Gasse wie andere Frauen in einem eleganten Salon. „Setz dich. Du solltest mir kein Geld geben. Du brauchst es dringender.“
„Ich habe heute genug mit einem Tattoo verdient“, murmelte er. Sie hatte ihn bei sich wohnen lassen, als er zum ersten Mal von einem der Männer seiner Mutter auf die Straße gesetzt worden war. Etwas Geld war das mindeste, was er ihr dafür geben konnte.
Als er ihr Gesicht aus der Nähe betrachtete, sah er die zuckenden schwarzen Kaulquappen, die sich in ihre Haut fraßen. So nüchtern konnte er deutlich erkennen, wie sie mit ihren messerscharfen Zähnen gnadenlos Stücke aus ihrem Fleisch rissen. Sie fraßen ihren Verstand. Da war Kismet sicher. Eine schob sich sogar in das weiche Gewebe ihres Auges. Kismet wühlte den mit Koffein versetzten Wein aus seiner Tüte hervor und nahm einen kräftigen Schluck, bevor er ihn Lucy anbot.
„Du nimmst deine Medikamente nicht, Luce“, sagte er, nachdem der brennende Wein seine Kehle passiert hatte. „Du weißt doch, dass du sie brauchst.“
„Sie … sie machen mich verrückt, Kizzie.“ Lucy nahm die Flasche in beide Hände, um sie zitternd hochzuheben. Dann öffnete sie den Mund und goss einen Schluck hinein, ohne die Flasche mit den Lippen zu berühren. „Ich kann nicht denken, wenn ich so ein Ding geschluckt habe.“
„Lucy, du musst sie nehmen, bis du dich daran gewöhnt hast. Du kannst nicht einfach aufhören, sobald es dir etwas besser geht.“ Kismet half ihr, die Flasche für einen weiteren Schluck zu neigen, bevor er sie ihr abnahm, um selbst von der betäubenden Flüssigkeit zu trinken. „Halt still, ich muss was gegen dieses Zeug machen.“
Als Kind hatte er zusehen müssen, wie die kleinen, augenlosen Schatten über die Brüste seiner Mutter hergefallen waren, sich unter ihre Haut gefressen hatten, bis nur noch Narben auf ihrem blassen Körper zurückgeblieben waren. Die Menschen, denen er begegnete, waren oft mit den schwarzen Klumpen übersät, die sich unbemerkt in Arme und Gesichter fraßen.
Wenn er nüchtern genug war, um sie zu sehen, überprüfte er regelmäßig seinen eigenen Körper, immer auf der Suche nach verräterischen Dellen zwischen seinen Beinen oder über seinem Herzen. Er hasste die Dinger. Noch viel mehr hasste er allerdings den Gestank, den sie absonderten, wenn er mit den Fingerspitzen die zuckenden, kreischenden Kreaturen von jemandem löste.
Nachdem er sich gewappnet hatte, entfernte er als Erstes die unter Lucys Auge und zerquetschte sie zwischen seinen Fingern, bis der schrille Schrei abbrach. Durch den Gestank würgend arbeitete er sich vorsichtig über Gesicht und Schultern der Frau vor und entfernte alles, was er finden konnte. Er musste gegen das Bedürfnis ankämpfen, sich zu übergeben, als er Lucys fettige, strähnige Haare zur Seite schob, um einen langen, schlangenartigen Schwanz hinter ihrem Ohr hervorzuziehen.