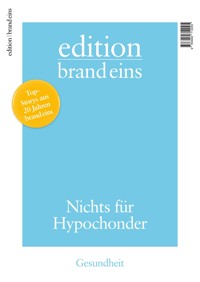
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: brand eins Medien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie besiegt man ein Virus? Was können Online-Praxen? Wer hilft Ärzten, wenn sie nicht weiter wissen? Kann Architektur heilen? Lassen sich Tierversuche durch Chips ersetzen? Wie sieht das Krankenhaus der Zukunft aus? Wozu brauchen wir Schulschwestern? Warum sind in den arabischen Ländern so viele Menschen depressiv? Und wie geht das überhaupt: ein gesundes Leben? Die besten Geschichten aus mehr als 20 Jahren brand eins zu den großen Fragen der Gesundheit, die alle beschäftigen – oder auf die man erstmal kommen muss. Mit ungewöhnlichen und inspirierenden Antworten von Praktikern und Visionären, aber ganz ohne Besserwisser. brand eins ist das moderne Medienhaus mit dem Schwerpunkt Wirtschaft. Seit 1999 berichtet es über Menschen und Ideen, die das Leben und die Arbeit, die Gesellschaft und den Planeten besser machen. Gründlich recherchiert und unterhaltsam aufgeschrieben, zeigt es in unterschiedlichen Magazinen und Kanälen jeden Monat, wie sich die Welt verändert und was alles möglich ist. Essentielle Informationsquellen für Macher und Veränderer, die Inspiration suchen und weiter denken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Editorial
Grund zur Hoffnung
Gesundheit
Die Ebola-Lektion
Wo das Dogma beginnt, ist das Leben am Ende
Schluckbeschwerden
Der Leitlinienwolf
Revolution in kleinen Schritten
Hilf dir selber
Wie am Fließband
„Das aktuelle System geht gar nicht mehr“
Rettung für die Übersehenen
Der Mensch auf einem Chip
Super-Viren
Die gläserne Klinik
Kann Architektur heilen?
Die Kümmerin
Das Haus der stillen Patienten
Der unsichtbare Feind
Arbeit kann helfen
Trauriges Arabien
(Man gewöhnt sich dran)
Weniger ist mehr
Fit wofür?
Impressum
Impressum
[nächster Abschnitt]
Editorial
Grund zur Hoffnung
Wer sich dieser Tage die Bilder von Demos anschaut, bei denen sich Maskenverweigerer, Verschwörungstheoretiker, Aluhütchenträger und Impfgegner bunt mischen, um ihre kruden Überzeugungen kundzutun, könnte meinen, es hätte die medizinische Aufklärungsarbeit der vergangenen Jahre nicht gegeben. Und es stimmt ja auch: Die Gruppe der Skeptiker hierzulande, die Impfseren für Teufelszeug halten und hinter den Empfehlungen der WHO nur Profitgier der Pharmaindustrie vermuten, hält sich beharrlich und ist durch die Corona-Pandemie noch gewachsen. Überall sonst in den Gesundheitssystemen der Welt kann von Rückschritt hingegen nicht die Rede sein. In Medizin und Versorgung passiert ungeheuer viel – und es geht überall voran.Weiterlesen
[nächster Artikel]
Grund zur Hoffnung
Von Susanne Risch, Chefredakteurin
Wer sich dieser Tage die Bilder von Demos anschaut, bei denen sich Maskenverweigerer, Verschwörungstheoretiker, Aluhütchenträger und Impfgegner bunt mischen, um ihre kruden Überzeugungen kundzutun, könnte meinen, es hätte die medizinische Aufklärungsarbeit der vergangenen Jahre nicht gegeben. Und es stimmt ja auch: Die Gruppe der Skeptiker hierzulande, die Impfseren für Teufelszeug halten und hinter den Empfehlungen der WHO nur Profitgier der Pharmaindustrie vermuten, hält sich beharrlich und ist durch die Corona-Pandemie noch gewachsen (Seite 134). Überall sonst in den Gesundheitssystemen der Welt kann von Rückschritt hingegen nicht die Rede sein. In Medizin und Versorgung passiert ungeheuer viel – und es geht überall voran.
Nehmen wir die Telemedizin. Es ist noch gar nicht lange her, da fanden wir die Vorstellung, online einen Arzt zu konsultieren, noch ziemlich exotisch. Inzwischen wächst die Zahl der Internet-Konsultationen kontinuierlich. Nach einem Report von Zava (ehemals DrEd) stieg die Zahl der Arztpraxen, die in Deutschland Videosprechstunden anbieten, allein von Februar bis April dieses Jahres von 1700 auf 25.000 (Seite 64). Für den Kinderarzt Thomas Finkbeiner ein Segen. Der Mediziner kämpft seit Jahren weltweit für den Ausbau der Telemedizin (Seite 74). Seine Patienten werden auch von „Child Growth“ profitieren, einem einfachen digitalen Werkzeug, das hilft, Unterernährung bei Kindern zu diagnostizieren. Nächstes Jahr soll die App in Indien auf den Markt gehen und danach schon bald Tausende von Menschenleben retten (Seite 80).
Auch anderswo verbessern Wissenschaft und Technik unser Leben. Ein Unternehmen in Wien hat eine Alternative zu Antibiotika entwickelt (Seite 96), in Berlin tüfteln Forscher an Organ-Chips (Seite 88), das Universitätsspital Basel will bis 2025 ein vernetztes Krankenhaus sein (Seite 102). Doch wir sollten bei allem technologischen Fortschritt den Menschen nicht vergessen: Angehörige, Regionalpolitiker, Verbandsvertreter, Ärzte und Schulkrankenschwestern, die sich tagein, tagaus für eine bessere Medizin, eine bessere Versorgung und das Wohl ihrer Patienten einsetzen (Seiten 124, 56, 46, 20, 146, 116).
Wir wissen nicht, wie weit wir im weltweiten Kampf gegen Covid-19 vorangekommen sind, wenn dieses Heft erscheint. Aber wir haben Grund zur Zuversicht: Im zweijährigen Kampf gegen die Ebola-Epidemie hat die Weltgemeinschaft schon einmal gezeigt, was sie kann – und dabei eine wichtige Lektion gelernt (Seite 8). --
[nächster Abschnitt]
[vorheriger Abschnitt]
Gesundheit
Die Ebola-Lektion
24 Monate zeigen, wozu die Weltgemeinschaft im Fall einer ungeahnten Virusepidemie in der Lage ist – und was besser werden muss.Weiterlesen
Wo das Dogma beginnt, ist das Leben am Ende
Autonom ist der Mensch, der fähig ist, Lust, Wohlbefinden, Zufriedenheit und Sicherheit zu erreichen, und zwar aus eigener Kraft. Das strengt an, macht aber gesund – behauptet der Mediziner und Philosoph Ronald Grossarth-Maticek. Seit gut 40 Jahren erforscht er, was seelische Autonomie, Gesundheit, Krankheit und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, miteinander zu tun haben. Und kommt dabei zu Ergebnissen, die nicht nur seine Kollegen irritieren.Weiterlesen
Schluckbeschwerden
Es gibt Leute, die finden Pillen doof. Ich nehm’ das jetzt mal persönlich.Weiterlesen
Der Leitlinienwolf
Günter Ollenschlägers Arbeit ist kaum bekannt, aber sehr nützlich. Er hilft Patienten zu verstehen, was mit ihnen geschieht. Und Ärzten, sich für die richtige Behandlung zu entscheiden. Ein Institutsbesuch.Weiterlesen
Revolution in kleinen Schritten
Wie viele chronisch Kranke verträgt unser Gesundheitssystem? Und wie können wir ihren medizinischen Bedarf finanzieren? Ein Gespräch mit dem BKK-Dachverband-Chef Franz Knieps.Weiterlesen
Hilf dir selber
Auf der Schwäbischen Alb entsteht ein Gesundheitszentrum, das Vorbild werden könnte – nicht nur für den ländlichen Raum.Weiterlesen
Wie am Fließband
DrEd behandelt Patienten in einer Internetsprechstunde. Das ist umstritten. Und beliebt.Weiterlesen
„Das aktuelle System geht gar nicht mehr“
Nach jahrelangen Debatten haben deutsche Ärzte beschlossen, Patienten nun auch online zu behandeln. Endlich, sagt der Kinderarzt Thomas Finkbeiner aus Tübingen, der Gesundheitsprogramme in verschiedenen Ländern betreut.Weiterlesen
Rettung für die Übersehenen
Kindern sieht man Unterernährung oft nicht an. Das ist fatal, denn sie kann ihr Gehirn schädigen. Die App Child Growth soll Abhilfe schaffen.Weiterlesen
Der Mensch auf einem Chip
Tierversuche sind unbeliebt. Umstritten. Und ihre Ergebnisse begrenzt. Doch bald könnte es eine Alternative geben: Medikamententests auf Organ-Chips.Weiterlesen
Super-Viren
Ein Wiener Unternehmen hat eine Alternative zu Antibiotika entwickelt.Weiterlesen
Die gläserne Klinik
Künstliche Intelligenz und Big Data verändern auch das Gesundheitswesen. Das Universitätsspital Basel will bis zum Jahr 2025 ein vernetztes Krankenhaus sein. So könnte es dann dort zugehen.Weiterlesen
Kann Architektur heilen?
Zumindest kann sie ihren Teil dazu beitragen. Einblicke in gesündere Kliniken.Weiterlesen
Die Kümmerin
Modellprojekte zeigen: Schulpflegekräfte helfen bei der Gesundheitserziehung. Im Ausland sind die „school nurses“ schon gang und gäbe.Weiterlesen
Das Haus der stillen Patienten
In der schwäbischen Kleinstadt Mössingen gibt es eine Wohngemeinschaft für Menschen im Wachkoma. Sie wurde gegründet von Angehörigen, die sich mit den Zuständen in Pflegeheimen nicht abfinden.Weiterlesen
Der unsichtbare Feind
Sicherheitshinweis: Ihr Gehirn macht erstaunliche Dinge. Zum Beispiel verwandelt es die Angst vor Krankheiten in die Angst, sich gegen Krankheiten impfen zu lassen. Lesen Sie den folgenden Text deshalb gründlich, und konsultieren Sie bei Unsicherheiten Ihren Arzt oder Apotheker.Weiterlesen
Arbeit kann helfen
Früher hatte man Tinitus, heute hat man Burnout. Tatsächlich steht hinter beidem oft eine Volkskrankheit: Depression. Der Umgang damit ist schwierig. Aber man kann ihn lernen.Weiterlesen
Trauriges Arabien
In kaum einer Weltgegend gibt es so viel seelisches Leid wie im Nahen Osten. Lange war es ein Tabuthema – doch das ändert sich nun.Weiterlesen
(Man gewöhnt sich dran)
Dies ist eine Geschichte über ganz normale Menschen. Die nichts sehen können. Blinde. Aber das ändert nichts. Außer, dass alles etwas klarer ist.Weiterlesen
Weniger ist mehr
Was tun gegen die Leiden des Alltags? Sechs Beispiele für Rückschritt als Fortschritt.Weiterlesen
Fit wofür?
Fünf Grundregeln zur nachhaltigen Selbstoptimierung.Weiterlesen
[nächster Artikel]
[vorheriger Artikel]
Alle gegen ein Virus
Wir wissen natürlich nicht, wie es um die Corona-Pandemie stehen wird, wenn dieses Heft erscheint – aber wir sind zuversichtlich. Ein Grund ist die folgende Geschichte: Sie erzählt von einer Ebola-Epidemie, die anfangs zögerlich und unter schlechten Bedingungen bekämpft wurde. Nach nur zwei Jahren war sie beendet. Heute sind wir auf allen Ebenen weiter. Covid-19 werden wir auch erledigen.
Die Ebola-Lektion
24 Monate zeigen, wozu die Weltgemeinschaft im Fall einer ungeahnten Virusepidemie in der Lage ist – und was besser werden muss.
Protokoll und Interview: Mischa Täubner Foto: Michael Hudler, Anne Morgenstern, Kathrin Spirk Aus brand eins Heft 10, Oktober 2016
Foto: Marcus Dipaola/Nurphoto/Shutterstock
Eine der gefährlichsten Aufgaben im Kampf gegen die Seuche: Ein Team vom Roten Kreuz in Liberia birgt im Oktober 2014 in der Hauptstadt Monrovia die hochinfektiösen Leichen der Opfer. Ebola ist eine Viruserkrankung. Typische Anzeichen sind Schwäche, Fieber, Kopf-, Hals- und Muskelschmerzen. Später kann es zu Erbrechen, Durchfall und Hautausschlag kommen, auch Nieren und Leberfunktionen können beeinträchtigt sein. In manchen Fällen leiden Betroffene unter inneren und äußeren Blutungen – darum werden Ebola und ähnliche Viruserkrankungen unter dem Namen „hämorrhagisches Fieber“ zusammengefasst. Der Erreger wird über Körperflüssigkeiten wie Blut, Sperma, Speichel, Urin und Tränenflüssigkeit übertragen. Je nach Ebola-Typ sterben 25 bis 90 Prozent der Infizierten.
Im Winter 2013 sprangen in Westafrika Ebola-Viren von einem Tier auf einen Menschen über und lösten eine Epidemie aus, die mehr als 11.000 Menschen töten sollte. Das erste Opfer war der zweijährige Emile Quamouno. Zumindest kamen spätere Recherchen zu dem Ergebnis, das Kleinkind aus dem Dorf Meliandou in der Präfektur Guéckédou im Süden von Guinea sei „patient zero“.
Am 26. Dezember bekam er Fieber, sein Magen verweigerte jede Nahrung, sein Stuhl war schwarz, er erbrach sich und war zwei Tage später tot. Kurz darauf starben seine Mutter, seine Schwester, die Großmutter, die Krankenschwester und die Hebamme des Dorfes. Dass Ebola die Ursache war, ahnte damals niemand.
Als dessen natürliche Wirtstiere gelten in Afrika verbreitete Flughund- und Fledermaus-Arten. Der kleine Emile war wohl mit einem dieser Tiere in Berührung gekommen. In der Nähe seines Elternhauses steht ein hohler Baum, an dem er häufig spielte. In Bodenproben fanden Wissenschaftler die Erbsubstanz einer Fledermaus-Art, die als möglicher Ebola-Wirt bekannt ist.
Mehr als 20-mal ist das Virus seit seiner Entdeckung im Jahr 1976 auf den Menschen übergesprungen. In jüngster Zeit häuften sich die Ausbrüche vor allem im Kongo, in Uganda und im Sudan. Meistens gab es rund 20 Tote, dreimal waren es mehr als 200. Immer blieben die Ausbrüche dank schneller Isolierung der Infizierten auf wenige Dörfer beschränkt.
In Westafrika war es anders. Ebola entwickelte sich dort zu einer Katastrophe, die die Welt zwei Jahre in Atem hielt. Ist der Sieg über sie als Erfolg zu werten? Oder war sie vermeidbar?
Man kann die Geschichte aus etlichen Perspektiven erzählen, es gibt viele Tausend Haupt- und Nebenfiguren. Eine davon ist der Amerikaner Armand Sprecher, 49, von Médecins Sans Frontières (MSF/Ärzte ohne Grenzen). Mitglieder des internationalen Netzes sind bei solchen Katastrophen meist als Erste vor Ort. Als erfahrener Mann, der schon im Jahr 2000 bei der Ebola-Bekämpfung in Uganda dabei war, hatte Sprecher die Aufgabe, von seinem Büro in Brüssel aus die Kollegen in Westafrika zu instruieren.
Eine zweite ist Stephan Becker, 56. Der Virologe von der Universität Marburg erforscht das Ebola-Virus seit Jahrzehnten. Während der Epidemie machte er sich Vorwürfe, weil kein Impfstoff zur Verfügung stand. Das versuchte er nachzuholen. Er hat dabei eng mit Marylyn Addo, 46, zusammengearbeitet. Die Leiterin der Sektion Tropenmedizin am Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf gehörte zu den Ersten, die einen Ebola-Impfstoff am Menschen testete.
Und dann ist da noch Christopher Dye, 60. Der britische Star-Epidemiologe und Chefstratege der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde auf dem Höhepunkt des Ausbruchs mit dessen Bekämpfung betraut. Seine wichtigste Waffe sind Daten, mit deren Hilfe er die Verbreitung des Virus untersucht.
Keiner von ihnen hat im Dezember 2013 etwas vom Tod des kleinen Emile mitgekriegt. Die Geschichte des größten Ebola-Ausbruchs aller Zeiten beginnt für sie erst Monate später.
14. März 2014:
In den Genfer Zentralen von MSF und WHO geht per E-Mail ein Bericht des Gesundheitsministeriums in Guinea ein. Von „einer mysteriösen Krankheit“ ist die Rede, die in den Präfekturen Guéckédou und Macenta ganze Familien, deren Ärzte sowie Krankenpfleger umgebracht habe. Die Autoren vermuten Lassafieber, mit den Symptomen Fieber, Durchfall, Erbrechen und Schluckauf. „Das ist kein Lassafieber“, denkt Armand Sprecher, als er den Bericht liest. Der Schluckauf, die Ballung der Fälle, die hohe Todesrate – alles deutet auf Ebola hin. Aber so einen Ausbruch in Westafrika? Das gab es doch noch nie.
15. März 2014:
Gut 30 Mitglieder der Ärzte ohne Grenzen brechen ins Krisengebiet auf.
18. März 2014:
Das erste MSF-Team erreicht Guéckédou, übernimmt im Krankenhaus die Versorgung der Kranken. Von 20 werden Blutproben in einer Kühlbox nach Paris geflogen. Von dort werden sie zur Untersuchung ins Institut Pasteur in Lyon und ins Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin nach Hamburg gebracht.
19. März 2014:
Im Auftrag des Gesundheitsministeriums in Guinea und des örtlichen WHO-Büros erkunden sechs Wissenschaftler die Lage im Krisengebiet. Sie erfahren von einer Frau, die am 3. März starb. Nun leide auch die Tochter unter den merkwürdigen Symptomen.
Beide Frauen, notieren die Forscher in ihrem Bericht, stammen aus einem Dorf jenseits der Grenze, in Sierra Leone. Diese Information erreicht weder die Zentrale der WHO noch die Regierung in Sierra Leone – das Virus breitet sich unbehelligt aus.
21. März 2014:
Um 19.06 Uhr erhält die WHO eine E-Mail aus dem Institut Pasteur: „Die Ergebnisse bestätigen die Präsenz des Ebola-Virus.“
22. März 2014:
Das Gesundheitsministerium von Guinea erklärt offiziell den Ausbruch von Ebola. Es gebe 49 Fälle und 29 Tote.
23. März 2014:
MSF-Mitarbeiter hören von Verdachtsfällen in der Hauptstadt Conakry. „Verdammt“, entfährt es Armand Sprecher. Dass das Virus schon 650 Kilometer zurückgelegt haben soll, beunruhigt ihn. Die WHO beruhigt die Öffentlichkeit: „Ein Ebola-Ausbruch war noch nie größer als einige Hundert Fälle.“
28. März 2014:
Die Regierung von Guinea bestätigt vier Ebola-Fälle in Conakry. Laut WHO gibt es nun insgesamt 103 Verdachtsfälle und 66 Tote. Sprecher telefoniert mit Kollegen vor Ort, es braucht in der Hauptstadt ein Zeltdorf mit einer Hochsicherheitszone, in der die Kranken behandelt und die Toten aufbewahrt werden.
30. März 2014:
Die Regierung von Liberia bestätigt die ersten beiden Fälle. MSF zieht Leute aus Guinea ab, um in der liberianischen Hauptstadt Monrovia und in Foya Isolierstationen aufzubauen.
Das Personal wird knapp, obwohl die Organisation inzwischen 60 Leute entsandt hat und von der WHO 38 Logistiker, Anthropologen, Labortechniker und Epidemiologen eingetroffen sind. Eine große Hilfe ist das mobile Labor, ein europäisches Projekt, vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut koordiniert. In 15 Kisten à 30 Kilogramm verpackt, wurde das Labor nach Guinea geflogen. Darin werden Blutproben binnen vier Stunden auf Ebola getestet.
31. März 2014:
Armand Sprecher gibt ein Interview nach dem anderen und betont, wie außergewöhnlich dieser Ebola-Ausbruch ist. „Wir haben es mit einer Epidemie zu tun, wie wir sie in Bezug auf die Verteilung der Fälle noch nie zuvor gesehen haben“, heißt es in einer Presseerklärung. Die WHO hält bei Twitter sofort dagegen. „Keine Notwendigkeit, etwas aufzubauschen, was schon schlimm genug ist.“ Die Antwort von MSF: „Es tötet neun von zehn Patienten.“
Impfstoffstudie in Guinea: Ein Freiwilliger erklärt sein Einverständnis. Foto: Marcus Dipaola/Nurphoto/Shutterstock
4. April 2014:
Obwohl sich die Helfer um die Aufklärung der Bevölkerung bemühen, greifen Jugendliche die Isolierstation in Macenta an, werfen Steine. Ihr Vorwurf: Die Ausländer hätten die Krankheit eingeschleppt, um daran zu verdienen. Die Station wird geschlossen.
5. April 2014:
Zwei Mitarbeiter von WHO und MSF sind losgezogen, um in Conakry nach der Ehefrau eines Verstorbenen zu fahnden. Sie finden sie zusammengekauert auf einer Matte, zu schwach, um sich zu bewegen. Die Helfer wollen sie mitnehmen, werden aber von Verwandten daran gehindert. Es ist nicht das erste Mal, dass das „Contact Tracing“ Probleme bereitet. Gesucht werden 623 Menschen, die Kontakt mit einem Kranken oder Toten hatten, um sie zu untersuchen und zu beobachten.
30. April 2014:
Trotz der Schwierigkeiten scheinen die Maßnahmen Wirkung zu zeigen, die Zahl der Patienten sinkt deutlich. Es ist 21 Tage her, dass in Liberia der letzte von zwölf Infizierten isoliert wurde.
22. Mai 2014:
Seit 42 Tagen kein neuer Fall, Ebola gilt in Liberia offiziell als besiegt. Die MSF-Leute ziehen ab, zurück nach Guinea. Auch dort scheint das Virus nicht mehr aktiv zu sein. Die Stimmung ist euphorisch. Was die Helfer nicht wissen: Vor zwei Tagen ist eine Frau dem Virus zum Opfer gefallen, die als Heilerin in der ganzen Region bekannt war. Sie lebte in einem Dorf im Distrikt Kailahun in Sierra Leone, nur durch den Fluss Mano von Guinea getrennt. Zur Trauerfeier kamen Hunderte Menschen, die die Leiche dem Brauch entsprechend noch einmal berührten. Viele steckten sich an und kehrten ahnungslos in ihre Dörfer in Sierra Leone, Guinea und Liberia zurück.
26. Mai 2014:
In Sierra Leone bestätigt das Gesundheitsministerium fünf Ebola-Opfer. MSF baut eine Isolierstation in Kailahun auf.
23. Juni 2014:
Das Virus scheint plötzlich überall zu sein. MSF zählt 60 Orte in Guinea, Liberia und Sierra Leone, in denen es kursiert, und erklärt öffentlich: „Die Epidemie ist außer Kontrolle.“
8. August 2014:
Jetzt schlägt auch die WHO Alarm und ruft eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ aus. Liberia und Sierra Leone rufen den Notstand aus.
10. August 2014:
Stephan Becker bricht seinen Sommerurlaub in Frankreich ab. Mit Urlaub hatte die vergangene Woche eh nichts zu tun: Jeden Tag gab er mehrere Interviews. Er gilt als einer der renommiertesten Ebola-Forscher.
11. August 2014:
Zurück in Marburg beschließt er, sich um einen Impfstoff zu kümmern. Es gibt zwar zwei vielversprechende Kandidaten, aber keiner wurde je an Menschen getestet. Die Stoffe müssen noch drei klinische Studien durchlaufen, eine zur Verträglichkeit (Phase I) und zwei zur Wirksamkeit – erst mit einigen Hundert Probanden (Phase II), dann mit mehreren Tausend (Phase III). Das dauert normalerweise Jahre. Egal, denkt Becker, er will etwas tun.
12. August 2014:
Becker startet einen Rundruf, um Kollegen zu mobilisieren. Eine Impfung mit dem Stoff rVSV-ZEBOV, weiß man von Tierversuchen, schützt auch, wenn sie kurz nach einer Infektion erfolgt. Beckers ehemaliger Marburger Kollege Heinz Feldmann hatte das Vakzin in Kanada entwickelt, doch kein Pharmaunternehmen interessierte sich dafür. Ebola, das war zu exotisch, zu weit weg. Nach den Terroranschlägen vom 11. September wuchs in den USA die Angst vor Bioterror-Attacken, was dort die Herstellung eines Ebola-Impfstoffs beschleunigte. Feldmanns Stoff wurde in größeren Mengen produziert und 2005 an Affen getestet – mit sehr guten Ergebnissen. Doch dabei blieb es. Klinische Tests fanden nicht statt. Die will Becker nun angehen. Sein Rundruf ist erfolgreich, alle sagen ihre Unterstützung zu.
Waren auf verschiedene Weise am Kampf gegen Ebola beteiligt: Marylyn Addo und ...
18. August 2014:
In den vergangenen 14 Tagen sind fast 500 neue Fälle dazugekommen. Das Virus breitet sich vor allem in Liberias Hauptstadt Monrovia aus. MSF errichtet dort das Behandlungszentrum Elwa III mit 250 Betten. Die Ärzte ohne Grenzen sind mit ihren Kräften am Ende. Contact Tracing ist kaum möglich, wer sich wann bei wem angesteckt hat, bleibt unübersichtlich. In Brüssel bereitet MSF mehr als 1000 Leute, auch von anderen Organisationen wie dem Roten Kreuz, auf einen Einsatz vor. Armand Sprecher trifft in Monrovia ein, um die Hilfe dort zu koordinieren. Vor dem Tor von Elwa III werden unentwegt Infizierte abgeliefert. Nicht für jeden gibt es ein freies Bett. Manche sterben im Straßengraben. Sprecher ahnt, dass es in der Stadt und im Dreiländereck vielleicht schon Tausende Infizierter gibt.
20. August 2014:
Becker telefoniert und telefoniert. Er muss den Impfstoff und Geld auftreiben. Der Stoff lagert bei der Gesundheitsbehörde in Kanada, die Patentrechte besitzt die kanadische Regierung, die bereits angekündigt hat, die vorhandenen 800 Dosen der WHO zu spenden. Eine gute Nachricht, wäre da nicht das Problem, dass der Stoff inzwischen an eine kleine amerikanische Firma namens Newlink Genetics lizenziert worden war. Die muss also beteiligt werden, genauso wie das US-Verteidigungsministerium und die US-Gesundheitsbehörde. Außerdem kostet die klinische Phase-I-Studie rund eine Million Euro. Becker fragt zwecks Finanzierung beim Bundesgesundheitsministerium an, doch da ist man zögerlich.
27. August 2014:
Für Marylyn Addo vom Universitätsklinikum Eppendorf ist der Ausbruch in Westafrika plötzlich ganz nahe. Ein senegalesischer Arzt der WHO, der sich in Sierra Leone infiziert hat, wird eingeliefert. Jahrelang haben sie und ihre Kollegen für den Ernstfall trainiert. Jetzt ist er da. Der Patient kommt in eine Sonderisolierstation, er hat Durchfall und erbricht, verliert dadurch täglich zehn Liter Flüssigkeit.
18. September 2014:
In Genf leitet der Chefstratege Christopher Dye seit vier Wochen das 80-köpfige Ebola-Notfall-Team in der WHO-Zentrale. Wo müssen Behandlungszentren und Labore aufgebaut werden? Wie viele Contact Tracer werden benötigt? Wie viele Leute, die sich um sichere Bestattungen der Leichen kümmern? Um solche Fragen zu beantworten, sammelt Dye Daten zu allen Infizierten und ihren Kontakten, erstellt Karten, errechnet den Verlauf der Epidemie. Alle paar Tage veröffentlicht er einen Lagebericht. Es sieht nicht gut aus, das Virus breitet sich immer rasanter aus. 5335 Menschen sind erkrankt, 2622 gestorben. Die Todesrate bei den Krankenhauspatienten liegt bei 70 Prozent.
19. September 2014:
Die UN erklärt Ebola als eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit und beginnt erstmals in ihrer Geschichte eine Mission aus Anlass einer Krankheit. Das Ziel: innerhalb von 90 Tagen alle Erkrankten zu isolieren und zu versorgen.
23. September 2014:
Die US-Seuchenkontrollbehörde CDC befürchtet, bis Januar könnten sich 1,4 Millionen Menschen infizieren.
25. September 2014:
Impfstoff-Gipfel bei der WHO in Genf: Forscher, Pharmafirmen und Behörden beschließen, die klinischen Studien im Schnellverfahren durchzuführen – und zwar für zwei Impfstoffkandidaten. Für Stephan Becker bringt der Tag ein Wechselbad der Gefühle. Er ist froh, dass die Sache vorankommt. Doch plötzlich wollen viele Länder die Studien durchführen, sodass es zwischendurch so aussieht, als kämen die Forscher in Deutschland nicht zum Zuge. Am Ende wird beschlossen, dass die Phase-I-Studien von rVSV-ZEBOV in Genf, Kenia, Gabun und Hamburg stattfinden.
... Christopher Dye
30. September 2014:
Der Kampf gegen die Seuche nimmt neue Dimensionen an. Tausende Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und US-Streitkräfte bauen in Liberia und Sierra Leone Behandlungszentren auf und schulen das medizinische Personal.





























